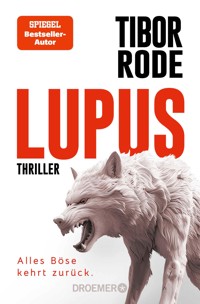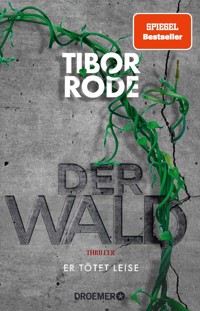12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Animal. Sprich oder stirb« von Bestseller-Autor Tibor Rode ist ein brandaktueller, top recherchierter True-Science-Thriller über die Entschlüsselung der Sprache der Tiere und die Frage, ob wir bereit sind, ihnen zuzuhören. Endlich darf der aufstrebende Anwalt Ben Lorenz für eine renommierte Hamburger Großkanzlei seinen ersten Fall vor Gericht verhandeln. Der Mandant: ein großer Agrarkonzern. Die Klage: auf Freilassung Die Klägerin: Rosa – ein deutsches Edel-Schwein! Spätestens jetzt ist Ben klar, warum man ihm als Frischling den Fall übertragen hat. Da Tiere nach dem Gesetz wie Sachen behandelt werden und keine Rechtsfähigkeit besitzen, ist die Klage rein symbolischer Natur – sein Mandant, der Agrarkonzern, kann den Fall gar nicht verlieren. Was Ben nicht weiß: Auf der Gegenseite arbeitet bereits ein internationales Forscherteam unter Hochdruck daran, mithilfe künstlicher Intelligenz die Kommunikation mit Tieren zu entschlüsseln – ein Durchbruch, der alles verändern könnte. Der Anwaltsveteran Rabenstein und seine Assistentin Enna, eine engagierte Tierschutzaktivistin, sind überzeugt: Wenn es gelingt, Rosas Stimme hörbar zu machen, besteht eine reale Chance, den Prozess zu gewinnen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt – während mächtige Gegner alles daransetzen, genau das zu verhindern. Denn eine Welt, in der Tiere sprechen können, bedroht mehr als nur ein Geschäftsmodell. Und Ben begreift, dass er auf der falschen Seite steht … Filmreifer Techno- und True-Science-Thriller mit Tiefgang und gedanklicher Sprengkraft Was lange nach Fiktion klang, wird durch KI und moderne Forschung zur realen Möglichkeit. Ein Durchbruch steht bevor, der unser Verhältnis zur Natur grundlegend verändern könnte. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit treten wir in einen echten Dialog mit der Tierwelt – und beginnen zu begreifen, wie wenig wir bislang verstanden haben. Tibor Rode hat auch für seinen Thriller »Animal« wieder akribisch recherchiert und liefert einen wissenschaftlich fundierten Pageturner im Spannungsfeld zwischen Mensch, Technik und Natur. Wer Thriller von Frank Schätzing, Marc Elsberg oder Preston & Child liebt, wird hier bestens unterhalten. Entdecken Sie auch die Thriller-Bestseller »Der Wald« und »Lupus« von Tibor Rode.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 632
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tibor Rode
Animal
Sprich oder stirbThriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Und was würden wir tun, wenn Tiere sprechen könnten? Wenn wir ihre Gefühle, Gedanken und Schmerzen verstehen würden? Dr. Maxwell Archer vom mexikanischen Institut für Meeresforschung macht das Unmögliche möglich: Mit künstlicher Intelligenz entschlüsselt er die Sprache der Tiere und verleiht ihnen eine Stimme, die niemand mehr ignorieren kann.
Mittendrin: Ben, ein erfolgreicher Anwalt, der zwischen Karriere und Gewissen hin- und hergerissen ist. Enna – eine mutige Tierschützerin. Und Rosa – ein Schwein, das zum Symbol für die Rechte aller gequälten Kreaturen wird. Gemeinsam wagen sie das Unglaubliche: eine Klage vor Gericht, die das Rechtssystem und unsere Wahrnehmung von Tieren für immer verändern wird.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Anmerkung
Motto
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
94. Kapitel
95. Kapitel
96. Kapitel
97. Kapitel
98. Kapitel
Epilog
Nachwort
Sämtliche handelnden Personen, Namen, Orte und Vereinigungen in diesem Buch entspringen allein der Fantasie des Autors. Alles in diesem Buch ist Fiktion.
»Seitdem ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere.«
Arthur Schopenhauer
Prolog
Sie wusste nicht, wie lange sie hier bereits eingesperrt war. Es gab kein Tageslicht, an dem sie sich orientieren konnte. Stundenweise leuchteten helle Strahler von der Decke, tauchten den schmutzigen Boden in fahles Licht, dann war es plötzlich wieder stockdunkel. Die Gitter des Metallkäfigs waren so eng gebaut, dass sie sich darin kaum umdrehen konnte. Das Liegen auf dem harten, kalten Untergrund war das Schlimmste: Der raue Beton hatte an vielen Stellen ihres Körpers ihre nackte Haut aufgerissen. Und so vermied sie es, sich hinzulegen, hockte meist auf allen vieren, wodurch, auch wegen der mangelnden Bewegung, ihre Gelenke geschwollen und entzündet waren. In den ersten Tagen hatte sie noch auf ein rasches Ende des Martyriums gehofft, doch jetzt war ihr jedes Zeitgefühl verloren gegangen. Nach ihrer Ankunft, sie musste damals vor Erschöpfung eingenickt sein, weckten sie eiskalte Hände. Starr vor Angst hatte sie versucht, sich umzudrehen, aber man musste sie im Schlaf so am Gitter fixiert haben, dass sie sich überhaupt nicht mehr bewegen konnte. Daraufhin hatte sie tief im Inneren ihres Körpers einen Schmerz verspürt wie noch niemals zuvor.
Seitdem war nichts mehr geschehen. Rein gar nichts. Meist döste sie vor sich hin und versuchte, nicht an ihren schmerzenden Leib zu denken, was besser funktionierte, wenn es hell war. Dann betrachtete sie die Dreckspritzer auf dem Boden, bis diese vor ihren Augen verschwammen. Sie bekam gerade so viel zu essen, dass sie nicht verhungerte, was das brennende Reißen im Magen nicht verhinderte. Am schlimmsten aber war der Gestank ihrer Exkremente in den Bodenspalten unter ihr.
Sie wusste, dass sie nicht die Einzige war, die hier eingesperrt war. Aber dies war kein Trost. Im Gegenteil: Die verzweifelten Schreie der anderen lösten regelmäßig Panik in ihr aus, ließen sie mit dem Kopf gegen die Gitter schlagen, bis sie Blut schmeckte. Die Rufe der Mitgefangenen wurden weniger, wenn das Licht ausging. Dann war es finster – und bitterkalt. In diesen Momenten hätte sie sich am liebsten eingegraben, zugedeckt, aber der steinharte Untergrund war unerbittlich. So lag sie meist frierend in tiefschwarzer Umgebung, die steifen Glieder krampfhaft angewinkelt, und starrte ins schwarze Nichts, darauf wartend, dass das helle Licht wieder anging.
Doch heute war es anders. Zunächst war es nur ein leises Scharren, das sie aufhorchen ließ. Sie glaubte schon, sich geirrt zu haben, als auf ein Klappern ein lautes Krachen folgte. Sie versuchte, auf die Beine zu gelangen, die vor Anstrengung zitterten, um in die Richtung zu schauen, aus der die ungewohnten Geräusche kamen. Um besser zu hören, hielt sie den Atem an, was ihr in der stickigen Luft schwerfiel. Ein leises Flüstern, gefolgt von einem Zischen, drang zu ihr durch die Dunkelheit. In einiger Entfernung sah sie einen Lichtkegel über den Boden huschen, hörte unterdrückte Stimmen und Schritte, die rasch näher kamen. Angst erfasste sie, und sie drängte rückwärts. Plötzlich flammten direkt vor ihr grelle Lichtblitze auf, blendeten sie. Erschrocken bäumte sie sich auf, grunzte laut vor Schmerz, als sie mit den offenen Wunden auf ihrem Rücken gegen den kalten Stahl des Käfigs prallte. Jemand berührte ihren Kopf, strich ihr ungewohnt sanft über die Stirn und sprach mit ruhiger Stimme auf sie ein. Die Stimme war heller und mitfühlender als diejenigen, die sie sonst hörte. Und gerade als in ihr Hoffnung aufkeimte, dass man vielleicht gekommen war, um sie hier herauszuholen, sie aus ihrer ausweglosen Situation zu befreien, wandten die Eindringlinge sich urplötzlich ab und liefen mit hektischen Rufen in die Richtung, aus der sie gekommen waren.
Eine ihrer Mitgefangenen, irgendwo weit entfernt, klagte aus tiefster Seele, dann hörte sie erneut ein Klappern, und schließlich senkte sich die alles betäubende Stille über sie.
Einen Moment noch lauschte sie ihrem raschen Atem, dann sank sie zurück in tiefe Dunkelheit und ergab sich zum tausendsten Mal ihrem Schicksal.
1
Der Kater verabschiedete sich mit einem zufriedenen Maunzen und verschwand wie jeden Morgen im Garten. Ben schloss ab und wollte die verwitterte Steintreppe hinabsteigen, als er zusammenzuckte. Auf der mit Unkraut zugewachsenen Auffahrt, keine sechs Meter entfernt, stand ein Mann. Die Haustür war gerade hinter seinem Rücken ins Schloss gefallen, der Fluchtweg zurück ins Haus damit versperrt. Er schaute auf das schief in den Angeln hängende Gartentor, durch das der Kater gerade verschwunden war. Doch der Kerl, der noch einen Kopf größer war als er selbst, hatte ihn bereits entdeckt. So umklammerte er den Griff seiner Aktentasche und ging mit festem Schritt auf den Fremden in seinem Vorgarten zu. Jetzt erst bemerkte er das schwere Motorrad, das auf der Straße direkt vor der Einfahrt parkte und dessen verchromte Verzierungen in der schönen Morgensonne blitzten. Wenigstens schien der Typ allein zu sein. Er würde ihn einfach vom Grundstück verweisen und mit der Polizei drohen.
»Benjamin Lorenz?«, kam der Mann ihm zuvor. Er trug eine lederne Bikerweste über einem schwarzen Hemd. Die hochgekrempelten Ärmel gaben den Blick auf muskulöse Unterarme frei, die ebenso tätowiert waren wie das Gesicht und sein kahler Schädel. Auf der Schläfe sprang ihm der grünstichige Schriftzug »Follow me into hell« ins Auge. Vielleicht sollte er doch lieber vorsichtig sein. Dieser Kerl konnte mehr Probleme bereiten als die anderen, die man bislang geschickt hatte.
»Sorry?«, fragte Ben, um Zeit zu gewinnen. Mittlerweile standen sie sich gegenüber, und trotz seiner eins dreiundachtzig Körperlänge hatte Ben sich selten so klein gefühlt.
»Wohnst du hier?«
Ben verzog die Mundwinkel, ohne zu antworten.
»Es gibt nämlich keinen Briefkasten!«, stellte sein Gegenüber fest und deutete in Richtung des Eingangs. Dort, wo unter der verrosteten Hausnummer 19 bis vor Kurzem noch der Briefkasten gehangen hatte, war nur noch ein verräterisches Quadrat dunkleren Mauerwerks zu erkennen. Zudem klafften zwei schwarze Löcher in den Ziegelsteinen. Ben selbst hatte ihn abmontiert.
»Sind Sie der neue Postbote?«, fragte er.
Nach einem kurzen Moment der Verblüffung begann der Mann zu lächeln. »Nein, ich habe nur nach einem Namensschild gesucht. Benjamin Lorenz? Richtig?«
»Bedauere, das bin ich nicht!« Ben bemühte sich, möglichst gelassen zu klingen.
Der Rockertyp hob überrascht die Augenbrauen und musterte ihn. Er tastete suchend an seiner Weste entlang und zog ein Foto aus der Brusttasche. Sein Blick wanderte zwischen Ben und dem Foto hin und her, dann breitete sich auf seinem Gesicht ein Grinsen aus. »Also, wenn du mich fragst, bist das hier sehr wohl du!« Er drehte das Bild zu ihm. Ben spürte, wie sein Puls in die Höhe schoss. Die Aufnahme musste zehn, zwölf Jahre alt sein und zeigte ihn und seinen Vater Arm in Arm, als wären sie beste Freunde. Er war damals gerade volljährig geworden, hatte noch strohblondes und längeres Haar als heute. Doch obwohl aus seinem sonnenverbrannten Gesicht noch die Unbekümmertheit der Jugend sprach, hatte er auch damals schon diesen oft als misstrauisch fehlinterpretierten Ausdruck in den Augen. Das war es aber nicht, was ihm einen Stich versetzte, sondern das gequälte Lächeln seines damaligen Ichs. Er kannte das Foto, erinnerte sich ganz genau daran, wo es aufgenommen worden war und wie er sich in dem Moment gefühlt hatte. Es war ein vergrößerter Ausschnitt des Originals, die rechte Hand seines Vaters war nicht zu sehen.
Aber woher hatten sie das Foto? Ihm fiel der Einbruch vor einigen Monaten ein. Damals hatten die Diebe alles im Haus durchwühlt, aber scheinbar nichts mitgenommen. Ein Gedanke schoss ihm durch den Kopf.
»Tut mir leid, das bin ich nicht«, sagte er.
Das war nicht die Antwort, die sein Gegenüber erwartet hatte. Der musterte erneut das Foto. Jetzt sah Ben, dass er auf den Fingerknöcheln seiner Hand das Wort »H a s s« tätowiert hatte.
»Sieht aber genauso aus wie du!« Seine Stimme wurde ungeduldiger. Nun klang er zum ersten Mal drohend.
Ben fuhr sich mit seiner freien Hand demonstrativ über sein Gesicht. Anders als der junge Mann auf dem Foto trug er heute einen akkurat getrimmten Dreitagebart.
»Das ist mein Bruder!«, sagte er.
Die volltätowierte Stirn seines Gegenübers warf erneut Falten. Aber nur kurz. »Benjamin Lorenz ist Einzelkind!«
»Gleicher Vater, andere Mutter. Benjamin ist mein Halbbruder.«
Der Rocker schaute unschlüssig. »Netter Versuch.« Er legte ihm seine riesige Hand auf die Schulter. »Lass uns mal ins Haus gehen!«
»Schauen Sie genau hin!«, sagte Ben und befreite sich mit einer geschickten Bewegung. »Mein Bruder hat ein Tattoo am linken Arm.« Tatsächlich war auf dem Foto am Unterarm des jungen Mannes, der ein T-Shirt trug, deutlich ein Tattoo zu erkennen.
Ben stellte die Tasche ab, zog das Anzugsakko aus und klemmte es zwischen die Beine, dann schlug er den linken Ärmel seines blauen Hemds bis zum Ellbogen hoch und präsentierte seinen nackten Unterarm. »Keine Tattoos«, sagte er.
Mit einer Geschwindigkeit, die er dem schweren Kerl gar nicht zugetraut hatte, schnellte dessen Hand nach vorn und legte sich um sein Handgelenk wie eine Schraubzwinge. Dann schob er den Ärmel nach oben und drehte Bens Arm unsanft hin und her. Ungläubig schaute er noch einmal auf das Foto.
»Kein Tattoo am linken Arm«, wiederholte Ben. »Und die verschwinden nicht so einfach, damit kennen Sie sich doch wohl aus.«
Der Mann ließ seinen Arm wieder los und starrte ihn nachdenklich mit düsterem Blick an, während er sich am Stiernacken kratzte. Ben schob den Ärmel zurück, knöpfte in aller Ruhe die Manschette zu und zog sein Anzugsakko wieder an.
»Und wie heißt du?«
»Mike.«
»Und du wohnst hier allein?«
Er nickte.
»Weißt du, wo dein Bruder Ben ist?«
Er kniff die Augen zusammen und schaute in die Sonne. »Ich habe ihn seit Jahren nicht mehr gesehen. Er ist untergetaucht. Er meinte, ein Haufen skrupelloser Arschlöcher suche nach ihm.« Die Miene des Rockers verfinsterte sich augenblicklich. »Seine Worte!«, schob Ben rasch hinterher.
»Dann sag deinem Bruder, wenn du ihn doch siehst, er soll sich bei Bojan melden. Er macht es nur noch schlimmer. Und wenn Bojan nicht bald seine Kohle bekommt, ergeht es ihm wie eurem Vater. Zuallererst aber schneiden wir ihm vielleicht einen kleinen Finger ab. Sag ihm das!«
Ben nickte. »Wie gesagt, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Und ich habe auch kein gutes Verhältnis zu ihm, glauben Sie mir das.«
Der Rockertyp verharrte kurz, dann wandte er sich um und ging zu seinem Motorrad. Er nahm einen Bikerhelm vom Lenker der Harley, stieg mühelos über den Sitz, ließ den Motor aufheulen und rollte dann langsam davon, nicht ohne zuvor noch einmal die Hand zu heben und den kleinen Finger abzuspreizen.
Ben wartete, bis er außer Sicht war, stützte die Hände auf die Knie und rang nach Luft. Er spürte das Pochen seines Herzens im Hals, konnte sich ein Lächeln aber nicht verkneifen. Das war knapp gewesen.
Er strich sich mit der Hand über den rechten Unterarm, wie er es so oft tat, wenn er Rat brauchte, und schaute auf seine Armbanduhr. Es war spät. Und er brauchte dringend einen Plan – oder aber hunderttausend Euro.
2
Enna parkte das Lastenfahrrad vor dem viel zu kleinen Fahrradständer und widmete sich der großen Transportbox. »Sei schön brav, Jewel«, sagte sie und strich dem größeren der beiden Hunde, die angeschnallt nebeneinander auf der Sitzbank saßen, sanft über den Kopf. »Und pass schön auf Blu auf!« Als die Kleine ihren Namen hörte, jaulte sie leise auf. »Na gut«, sagte sie und zog aus ihrer Bomberjacke einen schwarzen Beutel hervor, dem sie zwei Kaustangen entnahm. »Ihr wartet hier!« Sie sprang die drei Stufen hinab zum Eingang im Souterrain des weißen Hauses. Es war eine der typischen Reihenvillen aus der Gründerzeit, wie sie in den nobleren Hamburger Stadtvierteln rund um die Außenalster häufig zu finden waren. Auf der Schaufensterscheibe prangte in großen folierten Lettern der Name des Geschäfts: »Blütenrausch«.
Als sie die Glastür öffnete, ertönte eine laute Klingel, und schwülwarme Luft schlug ihr entgegen. Es roch nach feuchter Erde, schwerem, süßem Nektar – und Cannabis.
Sie war schon in vielen Blumenläden gewesen, aber keiner war wie dieser: Es war ein wahrer Dschungel aus Blüten, Blättern und Blumentöpfen. Sie standen überall, auf dem Boden, auf Bänken und Tischen und hingen in Schalen von der Decke. So war es auf den ersten Blick gar nicht so einfach, einen Weg durch das Pflanzenmeer zu finden. Enna reckte den Hals und schaute zum hölzernen Verkaufstresen am Ende des Raums.
»Hallo?«, rief sie und schlängelte sich an einer großen Vase mit Gladiolen vorbei. In diesem Augenblick schaute ein junger Mann aus einem Raum hinter dem Tresen hervor. In der Hand hielt er einen halb fertigen Strauß roter Tulpen.
»Hallo, ist er da?«, fragte Enna.
Der junge Mann verzog das Gesicht. »Ich habe ihn heute noch nicht gesehen, aber ich denke, ja. Du weißt ja, wo lang, oder?«
Sie nickte.
»Was ist mit der Zeichnung von Balu?«, rief er ihr hinterher.
»Bald fertig, wird großartig!«, entgegnete sie und bahnte sich weiter ihren Weg durch die Blütenwand, wobei sie die Luft anhielt. Wie die meisten Menschen mochte sie Blumen. Aber wie immer im Leben konnte auch alles Schöne im Überfluss zerstörerisch wirken. Man konnte an zu viel Liebe ersticken, von zu viel Süßem Diabetes bekommen und offenbar von zu viel Blütenduft Übelkeit. Sie atmete erst wieder ein, als sie durch einen runden Türbogen, in dem die Tür fehlte, in den hinteren Teil des Ladengeschäfts gelangte. Beinahe musste sie husten, als sie nun den Gestank von Cannabis in ihrer Nase spürte. Sie mochte den Geruch nicht, fand, es roch erdig und faulig, ein bisschen sogar nach Urin.
Hier war der Übergang vom Altbau zum Neubau, der sich, von der Straße nicht einsehbar, von hinten an die alte Villa schmiegte.
Sie blieb vor der Tür stehen, auf der ein Schild mit dem Schriftzug »Highmatverein Eimsbüttel« klebte. Nach dem zweiten Klopfen öffnete sie die Tür. Sie stand in einem gekachelten Raum, der an eine Küche erinnerte, allerdings fehlte jede Kochstelle. Ein junger Mann in einem weißen Laborkittel fuhr erschrocken herum. Er saß vor einem Mikroskop.
»Im Ernst?«, fragte Enna. »Du siehst aus wie ein Arzt!«
Er schaute an sich hinab. »Wir versuchen professionell zu sein! Das Zeug ist einhundert Prozent clean, und das soll auch so bleiben! Komm her!« Er winkte sie heran. »Schau, glasklare Trichome!« Unter dem Mikroskop lag eine reife Cannabisblüte, auf dem Monitor daneben war eine riesige Vergrößerung der Harzdrüsen zu sehen. »Die Cannabispflanze nimmt viele Substanzen aus dem Boden auf und speichert sie, was sie nützlich macht, um verunreinigte Böden zu säubern. Dabei ziehen ihre Wurzeln auch Schadstoffe wie Schwermetalle, Düngemittel und andere Verunreinigungen in das Pflanzengewebe. Besonders problematisch sind aber die radioaktiven Stoffe wie Phosphor: Wenn beim Anbau zu viel oder der falsche Phosphor verwendet wird, können die Blüten sogar leicht radioaktiv werden. Verunreinigte Blüten schmecken nicht, riechen unangenehm und brennen schlecht!«
»Radioaktiv?«, fragte sie. »Darum sind also so viele Kiffer verstrahlt! Ich weiß schon, warum ich die Finger davon lasse!« Sie zeigte auf eine Wendeltreppe an der rechten Seite des Raums. »Ist er wach?«
»Der Alte? Was meinst du, was hier so Loud ist!«
»Loud?«
»Ich meine den Dampf. Der Weed-Geruch. Er hat schon mehr als einen durchgezogen heute.«
Enna seufzte und ging zur Treppe.
»Wir machen mal zusammen eine Sesh!«
»Bestimmt nicht!«, flötete sie, während sie die Treppe hinaufstieg.
»Hast du denn gar kein Laster?«, rief er ihr hinterher.
Sie beugte sich über das Geländer zu ihm hinunter. »Zu viel Sex! Ich kann es einfach nicht lassen!«
Ein lautes Stöhnen war die Antwort.
Tatsächlich wurde der Cannabisgeruch intensiver, als sie oben angekommen war. Hier hinten, im ersten Stock des Anbaus, war das Büro von Henrik Rabenstein, in dem er auch wohnte. Oder umgekehrt.
»Henrik?«, rief sie und klopfte gegen die Tür am Ende des Aufgangs, auf der »Privat« stand. Sie holte ihren Zweitschlüssel und schloss auf. Der Anbau bestand aus dickem Beton. Bevor Henrik oben eingezogen war, hatte hier ein Musikproduzent gearbeitet, daher war alles weitestgehend schalldicht. Sie öffnete die Tür und rief erneut in die Wohnung dahinter. Als Antwort ertönte ein »Herein«, das klarer klang, als sie zu hoffen gewagt hatte. Durch eine Lücke zwischen den noch zugezogenen Vorhängen drang ein schmaler Sonnenstrahl und tauchte das Zimmer in fahles Zwielicht. Es war noch unaufgeräumter und chaotischer als beim letzten Mal. Berge aus orangefarbenen, abgewetzten Akten wechselten sich ab mit Stapeln aus Büchern und Zeitungen. Dazwischen lagen überall leere Flaschen, Pizzakartons und Kleidungsstücke. Über einem Teleskop, das auf eines der dicht belegten Bücherregale an der Wand zeigte, hing ein Bademantel. Es roch nach Schweiß, Gras und einem herben Männerparfüm. Sie machte zwei Schritte hinein und musste aufpassen, dass sie nicht stolperte. Hinter einem Raumteiler, der ebenfalls über und über mit Büchern vollgestopft war, stand das Bett. Es war ungemacht, aber leer. Eine feine Rauchfahne stieg aus einem Aschenbecher auf dem Nachttisch, in dem ein Joint lag, und zog in Richtung des Fensters. In diesem Augenblick öffnete sich die Tür des Badezimmers, und Rabenstein trat heraus – splitterfasernackt.
»Dein Ernst?«, schrie Enna kreischend auf und drehte sich zur Seite. Sie streckte sich nach dem Teleskop, nahm den Bademantel und warf ihn mit geschlossenen Augen in Richtung des Anwalts.
»Was platzt du hier auch bei mir rein mitten in der Nacht!«, polterte er, während Enna angestrengt ins Nichts starrte.
»Dann ruf nicht ›Herein‹, wenn du noch nicht so weit bist! Hast du jetzt endlich etwas an?«, fragte sie, während sie sich langsam wieder umdrehte.
Nun stand Rabenstein im Bademantel neben dem Bett und zog an der Haschischzigarette. »Was hast du mit deinen Haaren gemacht?«, fragte er und begann zu husten.
»Gefällt es dir nicht?«, erwiderte sie und strich sich durch die frisch gefärbten Haare.
»Tizianrot«, stellte Rabenstein fest. »Auf seinen Gemälden hatten beinahe alle Frauen rote Haare.«
»Ich denke, es ist eher rubinrot.«
»Dann taubenblutrot.«
»Taubenblut?« Sie verzog angeekelt das Gesicht.
»So bezeichnet man den Farbton der begehrtesten Rubine.« Rabenstein fasste sich in die nassen Haare. »Vielleicht sollte ich auch färben.« Enna schüttelte den Kopf. Sie verstand es hervorragend, Rabensteins oft bissige Kommentare einfach zu ignorieren.
»Meine beiden Süßen warten draußen«, sagte sie. »Hier!« Sie griff unter ihre Jacke und holte einen braunen Umschlag hervor, den sie auf das Bett zwischen ihnen warf.
»Wir haben dafür einiges riskiert. Es geht ihr wirklich schlecht. Also beeil dich!«
»Das hat meine Ex-Frau auch immer gesagt.« Erneut zog Rabenstein an der Zigarette, behielt den Rauch mit geschlossenen Augen in der Lunge und blies ihn dann langsam in ihre Richtung.
»Du solltest weniger konsumieren, damit du morgen klar im Kopf bist.«
»Ist medizinisch.«
Enna stockte. »Ich meine es wirklich ernst, Henrik. Bitte versaue es nicht!«
Rabenstein lächelte schwach. »Versauen ist gut. Ich werde es nicht versauen. Versprochen. Ich habe noch ein Ass im Ärmel.«
Zwei Minuten später war Enna zurück bei ihren Hunden. Jewel schaute ihr von der Sitzbank aus treuen Augen entgegen, es war der reumütige, schuldbewusste Blick, den er auflegte, wenn er etwas ausgefressen hatte. Sie blieb wie angewurzelt stehen und starrte in die Ladebox des Lastenfahrrads. Ihr kleiner Mischlingsterrier Blu war verschwunden.
3
Das Büro von Wolters & Hastings LLP befand sich in einem Geschäftshaus am Anfang der HafenCity. Nach dem Vorbild der Londoner Docklands war in den vergangenen Jahrzehnten auf den ehemaligen Freihafenflächen des Großen Grasbrooks und der Speicherstadt ein neuer Stadtteil entstanden. Ben arbeitete gern in der Speicherstadt, genoss den Blick über die Elbe und den Hamburger Hafen. Wohnen wollte er hier allerdings nicht. Nicht nur wegen der Horden von Touristen, sondern auch, weil die meisten bei all den schicken Gebäuden und hippen Gastronomien übersahen, dass der Hafen immer noch ein Industriegebiet war. Kaum sichtbar rieselte der aus den hohen Schloten der Handels-, Fähr- und Kreuzfahrtflotten emporsteigende Dieselruß über die Kaimauern und alles andere. Und auch die Fenster ihrer nach außen so glanzvoll wirkenden Anwaltskanzlei mussten regelmäßig vom Ruß des dreckigen Schweröls befreit werden, ohne dass die Mandanten es bemerkten. Daran dachte er, als er durch die bodentiefen Fenster hinüber zum neuen Hamburger Wahrzeichen, der Elbphilharmonie, starrte. Der Schreck vom Morgen saß ihm noch immer in den Gliedern.
»Das kann doch nicht sein. Mein Vater hat dieses Unternehmen gegründet. Man kann mich nicht rauswerfen«, wiederholte sein Gast, Graf Franz von Alvershusen, der hinter ihm am Konferenztisch saß oder besser lümmelte. Er hatte seine Füße auf dem Nachbarstuhl abgelegt. Seit über einer Stunde versuchte Ben, ihn zur Annahme des Vergleichsvorschlags zu bewegen. »Meiner Familie gehört dieses Unternehmen seit Jahrzehnten, verstehen Sie? Dieser kleine Schwanzlutscher hat von meinem Vater zehn Prozent der Anteile geschenkt bekommen, und nun kann er mich nach dessen Tod einfach so rausschmeißen und die Gesellschaft ganz allein übernehmen? Und das ohne Abfindung? Das kann nicht sein!«
Ben beendete seine kurze Gedankenpause und drehte sich wieder zu seinem Klienten. Auch Graf von Alvershusen selbst war am Ende eine Mogelpackung: Sein Titel und sein Aussehen waren aristokratisch. Schicker Wollanzug mit Weste und Krawatte, schlanke Figur und eine Drahtbrille, die einen gebildeten Menschen hinter den Gläsern vermuten ließ. Tatsächlich hatten Bens Recherchen ergeben, dass dieser in seinem Leben nur wenig auf die Reihe bekommen, das Studium abgebrochen und danach nie wirklich gearbeitet hatte. Es gab zudem eine Verurteilung wegen Kokainhandels und Körperverletzung. Die meiste Zeit hatte sein Mandant offenbar am Tropf des reichen Unternehmervaters gehangen. Und damit war nun Schluss: Keine zwei Monate war es her, dass der Vater verstorben war, und schon hatte dessen Geschäftspartner Gebrauch von der Klausel im Gesellschaftsvertrag gemacht und die Erben ohne Abfindung aus dem Familienunternehmen ausgeschlossen.
»Wie ich Ihnen bereits erklärt habe, ist das rechtlich leider so in Ordnung. Der Gesellschaftsvertrag war nun mal so gestrickt.«
»Mein Vater hat nie daran gedacht, dass er derjenige sein könnte, der zuerst stirbt! Dieser Bastard ist zwanzig Jahre älter als mein Vater, raucht wie ein Schlot und wiegt mehr als ein Wal. Wenn, dann sollten dessen Erben mit dieser Klausel ausgeschlossen werden, nicht wir!«
Ben setzte sich wieder auf einen der sündhaft teuren Ledersessel, die mehr kosteten, als eine Rechtsanwaltsfachangestellte im Monat verdiente.
»Es ist, wie ich es Ihnen erklärt habe«, setzte er erneut an, »wenn man eine Gesellschaft gründet, egal, ob eine GmbH oder KG oder was auch immer, dann schafft man damit eine eigene Rechtspersönlichkeit. Die Gesellschaft entwickelt quasi ihr Eigenleben. Wir nennen das eine ›juristische Person‹. Rechtlich behandeln wir eine Gesellschaft somit ganz ähnlich wie einen eigenständigen Menschen!« Das stimmte nicht so ganz, aber anders verstand sein Mandant es nicht.
»Was ist mit der Gesellschaft in Polen?«, unterbrach der Graf ihn. »Dr. Winterfeldt wollte einen Teil des Geschäfts nach Polen verlagern! Ein Briefkasten in Polen kann Gold wert sein, hat er gesagt. Mein Vater hat schon vor Jahren alles dafür unterschrieben und ich auch.«
Ben wusste nicht, wovon er sprach. »Es gibt kein Unternehmen in Polen«, sagte er. In der Akte hatte er davon nichts gesehen. »Zurück zu Ihrer Gesellschaft hier in Deutschland: Letztlich ist das mit einer Gesellschaft wie mit Mary Shelleys Frankenstein, der ein künstliches Monster erschaffen hat, das auf grausame Weise in sein Leben eingreift. Ihr Vater hat eine Gesellschaft gegründet, und diese lebt jetzt quasi wie ein Monster auch ohne ihn weiter, und aus dieser können Sie als Erbe als Gesellschafter ausgeschlossen werden.«
»Ich pfeife auf Frankenstein. Das einzige Monster ist dieser Loser, der uns das Unternehmen klauen will. Das Firmenvermögen gehört uns!«
»Nein, es gehört der Gesellschaft. Und wenn wir auf den Vergleichsvorschlag der Gegenseite nicht eingehen, müssen wir die Gesellschaft verklagen. Und wenn Sie die Dokumente zu Ihrem Ausscheiden nicht unterschreiben, verklagt die Gesellschaft Sie! Und ich fürchte, sie wird gewinnen!«
»Die Gesellschaft meines Vaters verklagt mich! Daddy würde sich im Grabe umdrehen! Ich bringe diesen Wichser um!« Der Mandant hatte vor Zorn hektische Flecken am Hals bekommen und schlug mit der Faust auf den massiven Konferenztisch.
Ben dachte an das Motto seiner Anwaltskanzlei, deren Wurzeln vor der Fusion mit den amerikanischen Kollegen bis ins neunzehnte Jahrhundert zurückreichten und auf deren Website die hanseatischen Tugenden wie Verantwortung, Innovation und Integrität gepriesen wurden.
»Das sollten Sie nicht tun, sonst enden Sie für immer im Gefängnis, und ich könnte Ihnen nicht helfen, denn wir machen kein Strafrecht. Immerhin ist es mir gelungen, die Wirksamkeit der Klausel anzuzweifeln. Ich denke nicht, dass wir damit vor Gericht wirklich durchkommen. Aber die Gegenseite möchte nun, dass Sie rasch ausscheiden, und hat auch keine Lust auf eine jahrelange Auseinandersetzung. Also nehmen Sie das Angebot an! Eine Million ist nicht wenig. Ansonsten bekommen Sie vermutlich gar nichts! Und dann müssen Sie vielleicht zum ersten Mal in Ihrem Leben richtig arbeiten!«
Er bereute seine Worte sofort. Er hatte, während er sprach, an den Tod seines Vaters gedacht und daran, wie anders es damals für ihn als Erben gelaufen war. Vielleicht war das der Grund für seinen Ausbruch gewesen.
Sein Mandant starrte ihn sprachlos aus geröteten Augen an. Dann sprang er plötzlich auf, und auch Ben erhob sich. Er hob die Hände zu einer beschwichtigenden Geste. »Hören Sie, ich meinte es …«
»Ich feuere Sie!«, schrie sein Mandant, nun puterrot angelaufen. »Sie sind genauso ein Versager wie dieser Penner, der versucht, uns auszunehmen.« Er schloss sein Sakko, stürmte zum Ausgang und verließ den Konferenzraum, nicht ohne die Glastür hinter sich zuzuschlagen.
Ben ließ sich in den Ledersessel sinken und lockerte seine Krawatte. Was für ein gebrauchter Tag. Eigentlich hatte er Winterfeldt nach dem, was am Morgen in seiner Auffahrt geschehen war, um eine Gehaltserhöhung bitten wollen. Dafür war es nun wohl ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Die Tür des Konferenzzimmers öffnete sich, und für einen Augenblick hatte er gehofft, dass der Mandant zurückgekommen war. Bis er in das ernste Gesicht Winterfeldts blickte.
4
Blu war nicht entlaufen, sondern gestohlen worden. Um das zu erkennen, bedurfte es keines besonderen detektivischen Spürsinns: Die Sicherheitsgurte, mit denen sie die Mischlingshündin im Lastenfahrrad angeschnallt hatte, waren sauber durchgeschnitten. Vor allem aber klebte auf der Sitzbank, wo ihr kleines Hündchen bis eben gesessen hatte, nun ein Zettel in der Größe einer Spielkarte. »Tauschen Hund gegen die Aufnahmen«, stand darauf in krakeliger Handschrift. Dahinter eine Handynummer. Panisch blickte sie sich um. Es konnte noch nicht lange her sein, sie war keine zehn Minuten fort gewesen. Um diese Zeit am Vormittag war nicht viel los auf den Straßen. Sie schaute in die eine Richtung: Eine ältere Dame ging mit ihrem Pudel Gassi, einige Meter entfernt trugen zwei Mitarbeiter einer Glaserei eine Glasscheibe in den Hauseingang eines Mehrfamilienhauses. Vor einem Eckcafé saß eine einzelne Frau und las Zeitung. Sie blickte in die andere Richtung, dorthin, wo die kleine Straße in die Hauptstraße mündete. Dort wartete eine Mutter mit ihrem Kind an einem Zebrastreifen, ein UPS-Wagen stand mit eingeschaltetem Warnblinker halb auf dem Bürgersteig, vom Fahrer war nichts zu sehen. Verzweiflung machte sich in Enna breit. Zwei Jahre war es her, dass sie Blu aus einer Tötungsstation in Târgu Jiu in Rumänien nach Deutschland geholt hatte. Sie war abgemagert und schreckhaft gewesen, bekam Panik bei dunklen Männerstimmen und suchte bei jedem Lärm sofort Schutz. Doch mit viel Geduld und Liebe war sie in den vergangenen Monaten zutraulich geworden, und zuletzt hatte sie sogar bei ihr im Bett geschlafen.
»Könnten Sie bitte kurz auf meinen Hund hier aufpassen? Man hat mir meinen anderen gestohlen!«, rief sie der Dame mit dem Pudel zu, die sich erstaunt zu ihr umdrehte. Sie zeigte auf Jewel. »Bitte!«
Die Frau schaute ihr ebenso irritiert entgegen wie Jewel, nickte dann aber. Der Pudel der Dame begann laut zu kläffen. Enna lief aus einem inneren Impuls heraus zur Hauptstraße. Wollte man schnell fliehen, schien ihr dies der beste Weg. Sie rannte, so schnell sie konnte, spürte ein Ziehen in den Rippen, die sie sich vor einigen Wochen bei einer ihrer geheimen Aktionen angebrochen hatte. Als sie die Straßenecke erreichte, raste ein Krankenwagen mit eingeschaltetem Martinshorn über die Hauptstraße und verschluckte ihre Rufe nach Blu. Abermals schaute sie nach links und rechts, und dann entdeckte sie ihn. Es war nur ein Rücken, eine blaue Jacke, ein gesenkter Kopf. Fünfzig, vielleicht sechzig Meter entfernt. Aber an der Art, wie er lief, leicht nach vorn gebeugt, als bücke er sich vor einem sich von hinten nähernden Unheil, dem etwas zu hektischen Schritt, erkannte sie, dass dies ihr Mann war. Er lief direkt auf die U-Bahn-Station zu. Dort unten würde sie ihn verlieren. Aus Panik wurde Wut und ließ sie noch einmal ihren Lauf beschleunigen. Beinahe rannte sie in einen Fahrradfahrer, der ihr verärgert hinterherschimpfte. Sie wich einem Schulkind mit pinkfarbenem Schulranzen aus, streifte einen älteren Herrn beim Überholen und griff nach seinem Arm und seiner Brust, um ihn vor dem Straucheln zu bewahren. Als der Mann nur noch wenige Meter vom Eingang zur U-Bahn entfernt war, drehte er sich plötzlich um, als habe er ihr Kommen gespürt. Er trug ein tief ins Gesicht gezogenes Cappy. Sie sah Blu, die er wie einen American Football unter dem Arm eingeklemmt vor der Brust trug.
»Blu!«, kreischte sie – und im nächsten Moment begann das schwarze Fellknäuel sich aus dem Arm des Mannes zu winden. Erneut rief sie ihren Namen und löste so in ihrem kleinen Liebling Herkuleskräfte aus: Sie sah, wie sie die Zähne fletschte, dann schrie der Mann auf, Blu hatte ihm in die Hand gebissen. Mit wutverzerrtem Gesicht packte der Unbekannte die Hündin mit der anderen Hand im Nacken und schüttelte sie derb. In dem Moment war Enna schon bei ihm, wollte ihn attackieren, aber er hielt Blu immer noch fest im Griff. Sie fasste in ihre Jacke, zog eine Dose mit Haarspray hervor, sprang heran und zielte direkt auf die Augen des Mannes. Nun war er es, der aufschrie. Instinktiv riss er seine Arme hoch, um sein Gesicht zu schützen. Sie nutzte die Gelegenheit, entriss ihm Blu und rammte ihm zugleich das Knie zwischen die Beine. Ein Wirkungstreffer. Stöhnend ging der Hundedieb in die Knie, als habe jemand die Luft aus ihm gelassen. Männerhände zogen sie zur Seite, Straßenarbeiter in neonorangefarbener Arbeitskleidung, die sich schlichtend in die Auseinandersetzung einmischten.
»Er hat meine Hündin gestohlen!«, brüllte sie und befreite sich. Sie schaute auf Blu, die sich zitternd an sie schmiegte. Sie gab ihr einen Kuss auf die Schnauze, woraufhin sie sie ableckte. Zwischenzeitlich war auch ihr Widersacher wieder auf die Beine gekommen. Sie sah, wie er einen der Arbeiter, der sich um ihn kümmern wollte, wegschubste und die Treppe in den U-Bahn-Schacht hinabhumpelte. Einen Moment lang überlegte sie, die Polizei zu rufen, dann aber kam ihr der Zettel mit dem Erpressungsversuch, den der Dieb am Lastenfahrrad zurückgelassen hatte, in den Sinn. Die heimlichen Tonaufnahmen. Besser, die Polizei stellte keine Fragen. Beim Gedanken an ihr Fahrrad fiel ihr Jewel ein, den sie dort zurückgelassen hatte.
»Alles in Ordnung?«, fragte einer der Straßenarbeiter. Sie nickte, murmelte ein Dankeschön und sah zu, dass auch sie das Weite suchte, bevor jemand anderes die Polizei informierte. Blu zitterte die gesamte Strecke, die sie zurückeilte. Körperlich schien sie aber in Ordnung, und sie hoffte, dass dieses Erlebnis bei ihr keinen Rückfall in ängstlichere Zeiten bewirkte. Als sie um die Ecke bog und ihr Fahrrad in Sicht kam, stiegen ihr Tränen der Rührung in die Augen: Die ältere Dame, sie mochte knapp über siebzig sein, saß halb auf der nach vorn offenen Box des Lastenfahrrads. Zu ihrer Linken wachte ihr Pudel und beobachtete aufmerksam die Umgebung, zu ihrer Rechten hatte Jewel seinen Kopf auf ihrem Bein abgelegt, und sie kraulte ihm den Nacken. Es war wie so oft in ihrem bisherigen Leben: Immer wenn sie gerade endgültig den Glauben an die Menschheit verlieren wollte, erschien von irgendwo ein Engel in Menschengestalt.
5
Winterfeldt setzte sich ohne ein Wort der Begrüßung ihm gegenüber, dorthin, wo bis eben noch sein Klient gesessen hatte. Er war groß und schlank, hatte auffallend grüne Augen, und obwohl er bereits auf Ende sechzig zuging, sah man ihm an, dass er früher einen Schlag bei Frauen hatte.
In der Kanzlei kursierten einige Geschichten über Affären mit Mitarbeiterinnen und aus dem Ruder gelaufene Weihnachtsfeiern. Doch seit der Fusion mit den Amerikanern hatte sich dies alles geändert. Heute gab es strenge Verhaltenskodexe, besonders was sexuelle Beziehungen mit einem Machtgefälle anging. Ein klares Machtgefälle bestand auch zwischen Winterfeldt und ihm, und dies bereitete ihm gerade erhebliche Sorgen.
»Der Mandant war sehr wütend. Er ist in mein Büro gestürmt und hat gesagt, er kündigt uns alle Mandate!«, eröffnete Winterfeldt das Gespräch. Ben schüttelte resigniert den Kopf. »Ach ja, und er hat auch gesagt, Sie sind ein Versager, und er tut das wegen Ihnen!«, ergänzte Winterfeldt, ohne dabei eine Miene zu verziehen. Er war eines der Urgesteine der Kanzlei, nicht nur Seniorpartner, sondern auch Geschäftsführer.
Ben war bislang kein Teilhaber, sondern nur »Associate«, was nichts anderes war als ein angestellter Rechtsanwalt, ein Arbeitnehmer. Und Winterfeldt war sein direkter Chef. Verausgabte man sich als Associate über Jahre, und gelang es einem vielleicht sogar, über seine privaten und geschäftlichen Kontakte neue Mandate für die Kanzlei zu akquirieren, konnte man irgendwann in die Partnerriege aufgenommen werden. Das war dann wie ein Lottogewinn, denn als Teilhaber einer internationalen Kanzlei dieser Größe lockte das große Geld. Von diesem Ritterschlag war Ben noch weit entfernt, seit heute, wie es schien, noch weiter als zuvor. Sein Puls beschleunigte sich, als ihm einfiel, dass Winterfeldt ihn für das, was gerade geschehen war, vielleicht sogar feuern könnte. Er drückte den Rücken durch und machte sich gerade. Winterfeldt kannte den Fall, sie hatten ihn gemeinsam besprochen, wie alle Mandate, die Ben bearbeitete. Die Rollen waren hier in der Kanzlei im Hamburger Hafen klar verteilt: Normalerweise war der Partner derjenige, der mit Mandanten sprach, der vor Gericht auftrat. Die Partner waren die Kapitäne der Kanzleigaleere, und die angestellten Anwälte wie Ben ruderten weit unten im Schiffsbauch. Gestern Abend hatte Winterfeldt sich kurzfristig entschuldigt und das heutige Gespräch mit dem Mandanten ihm überlassen. Obwohl er offensichtlich doch im Büro gewesen war. Vielleicht hatte er sogar geahnt, was geschehen würde, und ihm bewusst den unangenehmen Part überlassen, dachte er.
»Es tut mir leid«, sagte Ben und suchte nach einer weiteren Entschuldigung für sein Verhalten, fand aber keine. »Er hat es einfach nicht verstanden …«
»Herr Lorenz«, setzte Winterfeldt an. »Als Anwalt sind Sie eigentlich ein Dolmetscher. Der Gesetzgeber formuliert die Gesetze so, dass kein Laie sie versteht, und Sie übersetzen das dann in die Sprache des Mandanten.«
Ben dachte an die Fäkalausdrücke, die sein Mandant eben benutzt hatte, und musste beinahe grinsen, als er sich vorstellte, wie er es ihm in seinen Worten erklärte.
»Und Sie sind natürlich auch Psychologe, das dürfte Ihnen nicht neu sein. Übernehmen Sie nie die Emotion Ihres Klienten. Ich bin fest davon überzeugt: Der beste Arzt und der beste Anwalt ist derjenige ohne Empathie.«
Das erklärte einiges, dachte Ben.
»Emotionen verhindern den Blick aufs Wesentliche«, ergänzte Winterfeldt.
»Es war ein Fehler. Wenn Sie möchten, entschuldige ich mich bei Graf von Alvershusen.« Manchmal musste man Demut zeigen, dachte er.
Winterfeldt lehnte sich in seinem Sessel zurück und seufzte.
»Sie sind einer unserer besten angestellten Anwälte, Herr Lorenz. Ich erinnere mich noch, als Sie das erste Mal in mein Büro gekommen sind und ich in Ihnen mich in jungen Jahren gesehen habe. Sie bringen etwas mit, das den meisten Ihrer Kollegen fehlt: Erfolgshunger. Das habe ich sofort in Ihrem Blick gesehen. Sind wir doch mal ehrlich, viele Ihrer damaligen Kommilitonen waren verwöhnte Gören aus wohlhabenden Familien. Denen geht es bestenfalls darum, ihren Wohlstand nicht zu verlieren, viele haben nur studiert, weil Daddy sonst den Geldhahn zugedreht hätte. Sie aber, Sie wollen etwas erreichen im Leben. Deshalb waren Sie auch Jahrgangsbester. Genau wie ich. Wir sind beide Getriebene. Und schauen Sie mich heute an: Es funktioniert.«
Okay, dachte Ben, vermutlich würde er heute keine Kündigung erhalten. Es sei denn, gleich kam das große Aber.
»Aber«, fuhr Winterfeldt fort. »Wissen Sie, was das Problem in unserem Job ist? Man lernt am besten durch Fehler. Am Ende können wir froh sein, wenn unsere Fehler keine schwerwiegenden Auswirkungen haben und dass wir keine Gehirnchirurgen sind. Gott sei Dank geht es bei uns selten um Leben und Tod, sondern meistens nur um Geld.«
Ben nickte. Das war ein gutes Stichwort, um einzuhaken. »Ich weiß, es ist vermutlich nicht der beste Zeitpunkt. Aber ich wollte mit Ihnen über mein Gehalt sprechen.« Als er es ausgesprochen hatte, klang es in dieser Situation noch unangemessener als befürchtet. Aber er hatte keine Wahl, wenn er keine Bank überfallen wollte. Abermals konnte er von Winterfeldts Gesicht keine Reaktion ablesen.
»Ich bin nun seit vier Jahren hier, und ich weiß, dass die Kanzlei überdurchschnittlich gut zahlt. Aber ich habe gerade im vergangenen Jahr auch sehr guten Umsatz gemacht, und ich denke daher, ich hätte eine Gehaltserhöhung verdient.«
Tatsächlich war eine Anwaltsfirma wie Wolters & Hastings vor allem ein Stundenhändler. Sein Arbeitgeber kaufte seine Leistung als angestellter Anwalt mit seinem Gehalt relativ günstig ein und berechnete die von ihm für die Kanzlei geleisteten Stunden an die Mandanten weiter. Da seine Arbeitstage selten weniger als elf Stunden hatten, hatte man so mit ihm im vergangenen Jahr, auch nach Abzug seines Gehalts und der sonstigen Kosten, einen Haufen Geld verdient. Seine Forderung war daher wirtschaftlich gesehen keineswegs unverschämt.
Nachdem er fertig gesprochen hatte, schwieg Winterfeldt weiter. Ben spürte, wie die Stille ihn zunehmend nervös machte. Vielleicht hätte er es doch nicht jetzt ansprechen sollen, wo es so schien, als sei er gerade der Kündigung entgangen. Was, wenn er sich jetzt doch entschied, ihn zu feuern?
Schließlich beugte Winterfeldt sich vor. Ben bemerkte ein Flackern in seinen Augen.
»Eine Frage, Herr Lorenz. Sind Sie Veganer?«
Ben schaute verdutzt. Mit dieser Frage hatte er als Letztes gerechnet.
»Nein«, entgegnete er misstrauisch.
»Vegetarier?«
»Auch nicht.«
»Sie essen also alles? Ich meine jede Art von Fleisch?«
Ben wurde zunehmend irritierter. Was geschah hier gerade?
»Keine Muscheln, keine Schnecken«, sagte er. »Und ich mag keinen Rosenkohl.«
Ein Lächeln flog über Winterfeldts Lippen, so kurz, dass Ben sich nicht sicher war, ob er es sich nur eingebildet hatte.
»Das ist sehr gut! Ich hätte da einen Spezialauftrag für Sie!«
Ben rutschte in seinem Stuhl nach vorn. Plötzlich fühlte er sich unwohl.
»Ich sagte ja vorhin, in unserem Beruf geht es glücklicherweise nicht um Leben und Tod. Ich habe gerade einen Fall auf dem Tisch, in dem das nicht stimmt. Übernehmen Sie dieses Mandat für mich, und ich werde mit meinen Partnern auf der nächsten Sozienversammlung über Ihren Wunsch nach Gehaltsanpassung sprechen.«
Ben verstand nicht ganz, was Winterfeldt ihm sagen wollte. Grundsätzlich musste er sowieso alle Mandate bearbeiten, die sein Vorgesetzter ihm antrug.
»Muss ich den Fall gewinnen, um mehr Gehalt zu bekommen?«, dachte er laut.
Sein Gegenüber grinste. »Keine Sorge, Sie können gar nicht verlieren.«
Diese Antwort verwirrte Ben noch mehr. Jeder erfahrene Anwalt wusste: Es gab keine Fälle, die man nicht verlieren konnte.
»Kommen Sie nachher in mein Büro, dann erkläre ich Ihnen alles.«
Ben nickte. Irgendetwas war hier komisch. »Und soll ich mich noch bei dem Mandanten entschuldigen?«, fragte er. »Im Übrigen erkundigte er sich nach einer Gesellschaft in Polen, die Sie angeblich für ihn gegründet hätten. Ich habe dazu in der Akte nichts gefunden …«
Winterfeldt schüttelte langsam den Kopf. »Vergessen Sie ihn. Er ist ein nutzloses Arschloch. Ich bin froh, dass wir ihn los sind.«
6
Sie saßen auf grauen Holzstühlen und aßen bunte M&M’s mit Erdnüssen und jeder eine kleine Tüte Chips, mehr gab der Snackautomat neben dem Eingang nicht her. Dies war Bens Lunch in der Mittagspause. Zwei Flaschen mit stillem Wasser standen dazu auf dem Tisch, was zur Tristesse der Einrichtung passte: Abgenutztes Laminat in schlecht gemachter Parkettoptik, zehn Tische mit jeweils drei Stühlen, Rasterleuchten in der Decke und, als Highlight, der Snackautomat. Die offizielle Vormittagsbesuchszeit der Justizvollzugsanstalt Billwerder war gerade vorüber, daher waren sie nun allein. Dank seines Anwaltsausweises konnten sie sich auch außerhalb der offiziellen Besuchszeiten treffen. Nick saß ihm gegenüber. Er trug einen weiten grauen Jogginganzug, der nicht viel von seiner Körperform verriet, aber Ben wusste, dass er hier viel Fitnesstraining machte und in der Form seines Lebens war. Vor allem aber war Nick endlich clean. Auch im Gesicht sah er alles andere als gestresst aus, der Aufenthalt im Gefängnis hatte ihm zumindest körperlich gutgetan. Wie es in ihm drinnen aussah, konnte Ben freilich nur erahnen oder auch nicht.
»Ich helfe vielen der Jungs hier bei ihren Rechtsfällen. Ist schon krass, wie viel von deren Anwälten verbockt wird.«
Ben musste lächeln. Er konnte sich nur zu gut vorstellen, wie Nick die Arbeit eines Strafverteidigers auseinandernahm.
»Du warst immer der Beste in unserem Jahrgang«, sagte er. Mittlerweile konnte er es ansprechen, ohne dass er Nick in neue Krisen stürzte. »Hättest du dein Examen bestanden, wäre ich nur auf Platz zwei gewesen.«
Tatsächlich hatte sich während ihres Studiums auf der Bucerius Law School, der deutschen Eliteuniversität für Juristen, rasch gezeigt, dass Nick, der mit vollem Namen Nicolaus hieß, klüger war als alle anderen. Er war so etwas wie ein Genie. Während sie Probleme hatten, etwas zu verstehen, langweilte er sich. Darauf schoben sie auch seine Vergnügungslust nach Ende der Vorlesungen, seine zunehmenden Alkoholexzesse. Beim Feiern war er ebenfalls ganz vorn dabei. Diesem Umstand wiederum gaben sie die Schuld, wenn er, anders als bei den Hausarbeiten, in Klausuren plötzlich nicht ablieferte, unerwartet keine Bestnoten schrieb. Alle wussten, dass er meist mit Kater in die Prüfung ging, wenn er überhaupt nüchtern war. Aber niemand ahnte, dass hinter Nicks immer größerem Versagen etwas ganz anderes steckte: pathologische Prüfungsangst. Dank seines fotografischen Gedächtnisses wusste er alles, und wenn er es nicht wusste, konnte er es sich mühelos herleiten. Aber sobald er sich in einer Prüfungssituation befand, brach er komplett zusammen.
Vermutlich hätte er sich psychologische Hilfe holen können und müssen, aber dafür war er zu stolz, verbarg sein Defizit lieber vor der Welt. Dreimal rasselte er schließlich durchs Examen, dann war für ihn Schluss. Während sie alle, die viel weniger begabt waren als er, ihr Referendariat absolvierten und danach Staatsanwälte und Richter wurden, als Rechtsanwälte in internationalen Großkanzleien Startgehälter von hundertfünfzigtausend Euro und mehr kassierten, stand Nick nach verlorenen Jahren an der Bucerius ohne jeden Abschluss da. Seine wohlhabende Familie, die auch nichts von seinen mentalen Problemen ahnte, schob sein Versagen auf seinen Alkoholkonsum und auf Faulheit und strich ihm ob der Schande, die er über ihren angesehenen Familiennamen gebracht hatte, jede Unterstützung.
Nick, der es gewohnt war, Geld zu haben, und Verzicht nicht kannte, geriet auf die schiefe Bahn. Mit der Leidenschaft, mit der er sich zuvor juristischen Texten und dem Rechtssystem gewidmet hatte, begann er, Drogen zu verticken. Was vor allem deshalb praktisch war, weil er so zu seinem eigenen Dealer werden konnte. Und so schaffte auch er es, wenngleich ihm der Führerschein wegen seiner Prüfungsangst verwehrt blieb, Porsche zu fahren, sogar noch vor den ehemaligen Kommilitonen der Bucerius. Bis zu jenem Abend, an dem seine damalige Freundin Elena unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen war und die Polizei am Ende ihn dafür verantwortlich gemacht hatte. Er war auch an diesem Abend vollgedröhnt gewesen und konnte sich an kaum etwas erinnern. Es war eine kurze und sehr toxische Beziehung gewesen. Beide hatten Drogen genommen. Und auch wenn weder er selbst noch Ben nur eine Sekunde daran glaubten, dass Nick tatsächlich für ihren Tod verantwortlich war, saß er nun seine zwölfjährige Haftstrafe in der JVA Billwerder ab.
»War mal wieder jemand von den alten Jungs hier?«, fragte Ben.
Nick schüttelte den Kopf. Ein bitteres Lächeln huschte über seine Lippen. »Nur du.«
Ben war die ganze Zeit über an Nicks Seite geblieben, hatte schon vor seiner Verhaftung versucht, einen Therapieplatz für ihn zu finden, und war auch beim Prozess als Zuschauer dabei gewesen. Nach der Verurteilung besuchte er ihn regelmäßig, schickte Pakete. Die anderen Freunde aus dem Studium hatten sich nach und nach abgewandt. Kein Wunder, welcher Staatsanwalt wollte schon mit einem verurteilten drogensüchtigen angeblichen Totschläger in Verbindung gebracht werden.
»Was kann ich für dich tun? Du kommst bestimmt nicht, um mit mir Erdnüsse zu knabbern und gesiebte Luft zu atmen«, sagte Nick.
»Ich freue mich immer, bei dir zu sein«, entgegnete Ben.
»Na klar. Ich könnte dir auf Anhieb fünf Tipps geben, wie du hier auf Dauer landest und mir Gesellschaft leisten kannst.«
»Danke, nein.« Ben musste lächeln. Sie kannten sich zu gut. Er beugte sich vor. »Ich bräuchte einen Pass, der auf Mike Lorenz lautet.«
Nick hob die Augenbrauen. »Wer ist das denn?«
»Mein Bruder, ich meine, Halbbruder.«
»Ich wusste gar nicht, dass du einen hast!«
»Seit heute.« Ben erzählte ihm, was am Morgen vor seinem Haus geschehen war. Nick hörte zu, wobei seine Miene immer ernster wurde.
»Wieso habt ihr auf deinem linken Arm nach dem Tattoo geschaut? Es ist doch rechts.«
Ben konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Das Foto, das er dabeihatte, war ein Spiegelselfie von meinem Vater und mir. Als wir damals zusammen im Urlaub waren nach der Sache mit …« Er stockte, warf sich ein M&M’s ein. »Na ja, jedenfalls war da so ein riesiger antiker Spiegel. Da der Typ nur einen vergrößerten Ausschnitt hatte, sah man das Handy in der Hand meines Vaters nicht.«
Über Nicks Gesicht huschte ein Lächeln.
»Ich fürchte aber, sie werden sich mit meiner Geschichte nicht zufriedengeben. Gut, wenn ich mich das nächste Mal als mein Bruder ausweisen kann.«
»Ich bezweifle, dass sie das beruhigt. Was, wenn sie dir vor deiner Kanzlei auflauern? Oder hier?«
Er hatte recht. Bens Idee war viel zu naiv.
»Hast du einen Namen von dem Typen?«
Ben schüttelte den Kopf. Er griff zu seinem Telefon, das er als Rechtsanwalt mit ins Gefängnis hineinnehmen durfte, und zeigte Nick ein Foto. »Von der App der Überwachungskamera an meinem Haus.«
Nick nahm das Telefon und vergrößerte das Bild. »Auffällige Tattoos. Das ist einer von Bojans Leuten. Ich kenne ihn über Elena. Ein ganz harter Junge. Jedenfalls brauchst du dringend Kohle.«
Ben zuckte mit den Schultern. »Ich habe in der Kanzlei heute Morgen bereits nach einer Gehaltserhöhung gefragt.«
»Und?«
»Die Antwort steht noch aus«, kürzte er es ab.
»Du hättest das Erbe deines Vaters ablehnen sollen.«
Ben entgegnete nichts. Die wenigsten wussten, dass man auch Schulden erben konnte, und in seinem Fall waren sie gigantisch. Man konnte ein Erbe innerhalb einer gewissen Frist ausschlagen, dann erbte man weder Vermögen noch Schulden. Aber das hatte er nach reiflicher Überlegung nicht getan, denn er wollte Erbe werden. Dafür gab es einen guten Grund, und das wusste Nick, auch wenn er es nicht verstand.
»Wir beide haben wirklich Scheiße gebaut. Ich sitze deshalb hier im Knast und du im Schuldenturm. Ich habe dir schon gesagt, dass Bojan Mazur vor nichts zurückschreckt. Er ist nicht bloß irgendein Drogendealer oder Zuhälter, sondern Mitglied einer großen Familie. Und dort steht er ziemlich weit oben. Und das sage ich nicht, weil er einmal mit Elena zusammen war.« Tatsächlich war Bojan Mazur Elenas Ex-Freund gewesen, nach Nicks Meinung allerdings eher ihr Zuhälter.
Wieder sagte Ben nichts.
»Ich höre mich hier im Knast mal um!«
Ben nickte dankbar und sammelte die leeren Snacktüten zusammen.
Nick griff nach seinem Arm. »Unterschätze Bojan Mazur nicht«, sagte er.
»Das tue ich nicht«, entgegnete Ben. »Ich habe noch den alten Revolver von meinem Vater.« Er schaute zu dem Wachmann, der sich weiterhin nicht für sie interessierte. Erneut erntete er einen besorgten Blick seines alten Freundes, der sich auf seinem Stuhl zurücklehnte. »Vielleicht sehen wir uns hier tatsächlich bald häufiger, als von mir erhofft«, bemerkte Nick süffisant.
»Darauf kannst du lange warten. Ich muss jetzt zu Winterfeldt und bekomme einen Fall, den ich nicht verlieren darf.« Tatsächlich hatte sein Chef gesagt, dass er ihn nicht verlieren konnte, was ihm immer noch Rätsel aufgab.
»Darüber wollte ich noch mit dir sprechen«, sagte Nick.
»Du meinst über Winterfeldt?«
»Ich hatte dir doch von der Warnung erzählt.«
»Du meinst von dem, was der Betrüger gesagt hat?«
Das Thema hatten sie schon beim letzten Mal diskutiert. Ein Zellengenosse, der die halbe Hamburger Prominenz um ihr Geld betrogen hatte, hatte Nick eines Tages im Besucherraum mit Ben zusammen gesehen. Als Nick im Anschluss von Bens Arbeit bei Wolters & Hastings erzählt hatte, hatte der Zellengenosse gegenüber Nick geunkt: »Dort sind mehr Kriminelle als hier im Knast.« Und auf Nicks Nachfrage, was er damit meinte, hatte der Mitinsasse gesagt: »Er soll sich von Winterfeldt fernhalten, wenn er nicht auch irgendwann hier landen will.« Mehr war aus ihm nicht herauszubekommen gewesen, aber es hatte genügt, damit Nick sich fortan um Ben sorgte.
»Er ist ein Betrüger, Nick. Alles, was er je gesagt hat, war gelogen. Was macht er jetzt überhaupt?«
»Er ist seit Kurzem draußen. Zuletzt schrieb er mir, er bekäme eine eigene Netflix-Serie.«
Ben musste grinsen. »Siehst du, alles Blödsinn.«
Nick schaute gedankenverloren durch ihn hindurch. »Letzte Woche ist jemand aus Santa Fu hierherverlegt worden«, sagte er dann. »Als ich mit ihm plauderte, meinte er, er ist eingefahren, weil er für einen Anwalt Jobs erledigt hat. Einen Anwalt aus einer der ganz großen Kanzleien, und der würde ihn schon bald hier herausholen. Ich fragte ihn, ob er Wolters & Hastings und Winterfeldt meint. Daraufhin ist er ganz blass geworden und mir ausgewichen. Ich wollte mehr von ihm erfahren, aber dann habe ich gehört, dass er auf die Krankenstation verlegt wurde.«
»Lass es!«, sagte Ben eindringlich. »Jeder erfolgreiche Anwalt hat eine Menge Feinde, denn in jedem Prozess gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Und Winterfeldt ist verdammt gut in seinem Job. Es tut mir leid, das zu sagen: Aber die Leute, mit denen du hier eingesperrt bist, sind alle Verbrecher. Denen kann man nicht trauen. Und die Kanzlei ist mein Leben und meine Zukunft.«
Nick grinste matt. »Und wann holst du mich dann endlich hier raus?«, fragte er.
»Ich arbeite dran«, entgegnete Ben. Dies war ihre Standardverabschiedung. Beide wussten, dass Ben wenig Ahnung von Strafrecht hatte. Nicks einzige Chance war, seine Zeit abzusitzen.
7
Sie hatte aufgehört, von der Welt außerhalb zu träumen. Der Gedanke an Freiheit war eine Qual, die sie nicht länger ertragen konnte. Genauso wie die Trennung von dem, was sie instinktiv schützen wollte. Die Erinnerung an den Geruch, die Stimmen, die warme Haut ihrer Liebsten verblasste. Hier drinnen, in der engen Zelle, schmerzte alles, selbst die Gedanken. Die Geräusche waren immer dieselben: dumpf, metallisch, wiederkehrend. Es war das Erste, was sie hörte, wenn sie aufwachte, und das Letzte, bevor sie die Augen schloss. Manchmal fragte sie sich, ob es je anders gewesen war oder ob es je anders werden würde.
8
Enna kam zu spät zur Arbeit. Im »Miniwelt Paradies Hamburg« war es erlaubt, Hunde mit an den Arbeitsplatz zu bringen, und so platzierte sie Blu auf einer Decke direkt unter ihrem Arbeitstisch, während Jewel durch die Räume streunte und sich von den Kollegen verwöhnen ließ. Auf den ersten Blick schien es ihrem kleinen Mischling gut zu gehen. Sie holte sich eine Tasse Kaffee aus dem Bistro und widmete sich ihrer Arbeit. Das »Miniwelt Paradies« war die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Dabei war es weit mehr als eine Modelleisenbahn: Auf mehr als zehntausend Quadratmetern gab es im Maßstab 1 : 87 über zwölf verschiedene Welten von Hamburg über Monaco bis Amerika. Fast dreihunderttausend Figuren sorgten für Leben in der Anlage, und nicht wenige davon hatte Enna gestaltet. Ihre große Leidenschaft war das Zeichnen, doch damit war es schwierig, Geld zu verdienen. Hier war sie eine von über vierhundert Mitarbeitern und konnte ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Doch es war mehr als das. Während sie in der realen Welt beinahe täglich den Schmerz fühlte, schreckliche Ungerechtigkeiten und grausame Zustände nicht verändern zu können, konnten sie hier in der HafenCity eine bessere Welt erschaffen. Der Ehrgeiz von ihr und ihren Kollegen war es, mit den Menschen im Miniformat unterhaltsame Situationen darzustellen, die die Besucher, wenn sie sie näher betrachteten, erfreuen sollten. Oft mit einem Augenzwinkern. Die Welten, die sie schufen, waren wie eine Mischung aus einem Gemälde und Theater.
Neben lustigen Szenen gestalteten sie aber auch nicht selten gesellschaftskritische. Das war Ennas Spezialgebiet. Und auch wenn die Chefs ihnen weitestgehend freie Hand ließen, war es schon vorgekommen, dass irgendein empörter Besucher in den weiten Landschaften etwas entdeckte und es im Internet postete oder sich sogar am Ausgang beschwerte und sie es abbauen mussten. So zum Beispiel die junge Frau mit dem Babybauch, die vor dem Modell des Bundestags für das Recht auf Abtreibung demonstrierte. Einer ihrer größten Skandale war bisher, als sie auf die Massentierhaltung aufmerksam gemacht hatten: Die Modellbauer hatten damals mit Einwilligung der Chefin, die wie sie Veganerin war, ein Modell erschaffen, in dem frisch geborene Säuglinge auf ein Laufband fielen, um wie männliche Küken in der Hühnerproduktion geschreddert zu werden. Und Enna hatte Menschen gestaltet, die anstelle von Säuen zusammengepfercht in Ställen gehalten wurden. Daraufhin gab es viel Applaus, aber auch empörte Proteste von Landwirten, die sich verunglimpft fühlten. Enna war an einem Morgen wegen eines Treckerkorsos gar nicht zur Arbeit durchgekommen. Die Presse berichtete, es gab einen Friedensgipfel mit einem betroffenen Bauern, und sie hatten erreicht, was sie beabsichtigt hatten: Aufmerksamkeit für das Thema Massentierhaltung. Sie liebte ihre Chefin für so viel Courage.
»Enna!« Sie drehte sich um. Hinter ihr stand ihre Kollegin Sigi. Sie war zugleich eine Freundin. Eine beste Freundin hatte sie nicht, schon seit der Schulzeit hatte sie Probleme, sich Menschen zu öffnen.
»Ich hatte mir schon Sorgen um dich gemacht. Du bist sonst nie zu spät.«
Sie erzählte die Geschichte von Blus Diebstahl.
»Warum um Gottes willen hast du eine Dose Haarspray dabei?«, fragte sie überrascht und deutete auf Ennas Ponyhaarschnitt, der offenbar nicht viel Modellierungsaufwand bedurfte.
»Wegen meiner Kohlezeichnungen. Ich versiegele damit am Ende das Bild. Ich hatte sie gerade neu gekauft.«
»Und weißt du, was das sollte? Wer klaut schon einen kleinen Hund?«
Sie zuckte mit den Schultern. Tatsächlich aber wusste sie genau, worum es ging.
»Der neue Chef vom Leitstand hat gestern Abend nach dir gefragt. In Patagonien ist ein Zug unterwegs, in dem in einem Abteil anstatt Menschen nur Pinguine sitzen. Er wollte wissen, ob das dein Werk ist.«
Enna musste kichern. »Ist er böse?«
»Im Gegenteil! Er wollte dir gratulieren und meinte, er hätte in der U-Bahn morgens auch lieber ein Abteil voller Pinguine als die üblichen Verrückten.«
Enna prüfte, ob die Figur, die sie zum Trocknen in einen Klotz aus Steckmasse gesteckt hatte, trocken war. Dann griff sie nach dem Topf mit der Kinderknete, um mithilfe eines Zahnstochers Muskeln zu modellieren. Derzeit entstand in Halle vier ein großer Regenwald, und sie lieferte ein erstes Expeditionsteam dafür. Sie schaute sich um, ob jemand sie hören konnte, aber sie waren allein.
»Sigi«, setzte sie an und öffnete die Schublade unter ihrem Arbeitsplatz, um einen kleinen grünen Kasten hervorzuholen. »Kennst du den Bahnhof mit dem italienischen Restaurant?«
Sigi dachte kurz nach. »Du meinst im Abschnitt Italien?«
Sie nickte. »Dort, wo die Leute sich mit Pizza bewerfen.« Auch die Pizzaschlacht war einer der kleinen Scherze, die sie sich ausgedacht hatten. »Die Box hier werde ich im Gastraum direkt neben dem Pizzaofen verstecken.«
Sigi schüttelte langsam den Kopf.
»Nur damit du es weißt, falls mir etwas passiert«, ergänzte Enna.
»Ich schätze, du wirst mir nicht sagen, was es damit auf sich hat.« Aus ihrer Stimme war Besorgnis herauszuhören, sie wirkte jedoch nicht überrascht.
»Genau. Ich sage es dir, wenn ich den Kasten wieder heraushole.«
»Hat das was mit dem Vorfall von heute zu tun?« Sie deutete in Richtung von Blu, die leise zu Ennas Füßen vor sich hin schnarchte.
»Ich möchte dich nicht anlügen, also frage bitte nicht.«
Sigi kam näher und senkte die Stimme. »Du weißt, ich habe dich immer bewundert für das, was du tust. Aber glaubst du nicht, das geht jetzt zu weit? Ich meine, jemand hat versucht, deine Hündin zu entführen! Als Nächstes bist vielleicht du dran!«
Enna schüttelte energisch den Kopf. »Ich höre erst auf, wenn wir am Ziel sind. Und sich zeigt, dass das, was wir tun, wirkt!«
Sigi strich ihr sanft über den Rücken. »Maus, du weißt, ich hab dich lieb. Pass auf dich auf!«
»Das tue ich«, sagte Enna und widmete sich wieder ihrer Figur. Sie griff nach dem Topf mit der rosa Farbe. Dies würde ein Tarzan werden.
9
Die Büroräume bei Wolters & Hastings wurden nach Wichtigkeit vergeben: Rechtsanwaltsgehilfinnen und Sekretärinnen teilten sich die Räume, die einen Blick in den Innenhof boten. Schlechtergestellt waren nur die Referendare und Praktikanten, die mit fensterlosen Räumen vorliebnehmen mussten, die früher als Magazin oder Kopierraum dienten und erst im Zuge der Platznot zu Arbeitszimmern umfunktioniert worden waren. Die Zimmer der angestellten Anwältinnen und Anwälte verfügten in der Mehrzahl über kreisrunde Fenster mit silberglänzenden Rahmen, die im maritimen Stil an Bullaugen erinnern sollten. Diese waren auch der Anstoß dafür, dass irgendjemand die Arbeit der Associates in der Kanzlei mit Ruderern auf einer Galeere verglichen hatte, ein Running Gag, der bis heute durch die Kanzlei lief. Die Partner hatten Offices mit Blick auf die HafenCity oder den Hafen, die besten Büros waren aber die Eckbüros, die Ausblick auf beides gewährten. Und in einem von zweien residierte Winterfeldt.
Ben saß vor dem rustikalen Schreibtisch, dessen Arbeitsplatte längs aus einem Baumstamm geschnitten war. Sie war so naturbelassen, dass man meinen konnte, irgendein Waldarbeiter hätte sie am Morgen direkt aus dem Wald kommend auf vier gusseisernen Standfüßen aufgebockt. Im Kontrast zur warmen Nussbaumoptik des Schreibtisches war das Büro ansonsten eher kalt mit Möbeln aus Metall und Chrom eingerichtet, wobei Ben sich sicher war, dass selbst das kleinste Accessoire in diesem Raum mehr Geld gekostet hatte als der teuerste Gegenstand in seinem Wohnzimmer zu Hause. Winterfeldt schenkte sich gerade heißes Wasser in einen Becher ein. Er goss damit weder Tee noch Kaffee auf, sondern trank es pur und schwor auf die ayurvedische Wirkung.