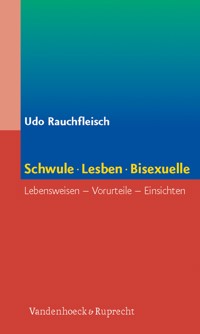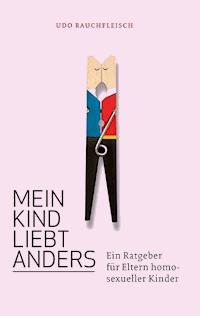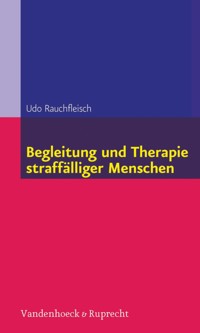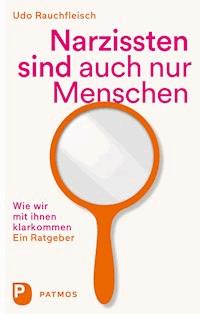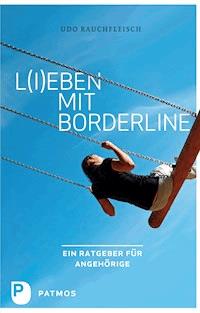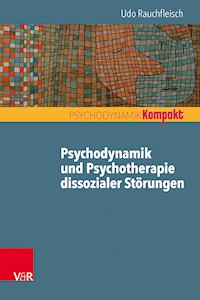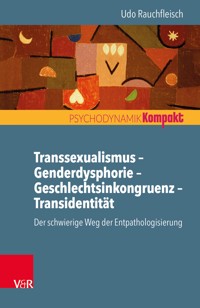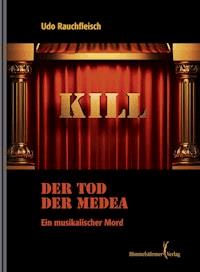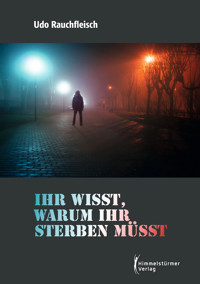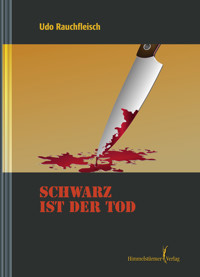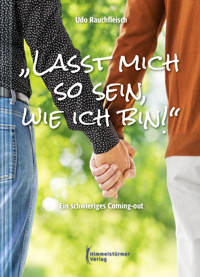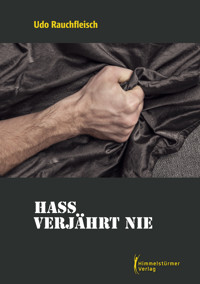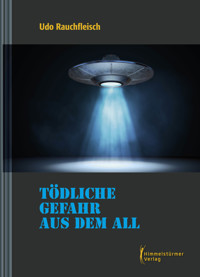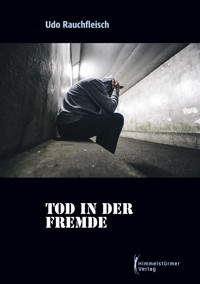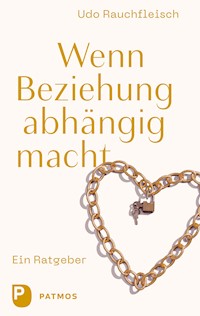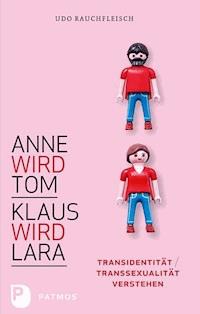
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Nichts scheint so sicher wie der Unterschied zwischen den Geschlechtern. Die Verunsicherung ist daher groß, wenn man eine Frau trifft, die von sich sagt, sie sei ein Mann. Oder wenn der langjährige Kollege Müller ab sofort als "Frau Müller" angesprochen werden will. Und was tun, wenn der eigene Sohn sich plötzlich schminkt und Frauenkleidung trägt? Wie erklärt man seinen Kindern, dass Mama jetzt plötzlich Papa ist? Der Psychotherapeut Udo Rauchfleisch hilft Angehörigen, Freundinnen und Freunden, Kollegen und Vorgesetzten von transsexuellen Menschen, das Phänomen Transsexualität zu verstehen und ohne Berührungsängste mit transsexuellen Menschen umzugehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NAVIGATION
Buch lesen
Cover
Haupttitel
Inhalt
Über den Autor
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Udo Rauchfleisch
Anne wird Tom – Klaus wird Lara
Transidentität/Transsexualität verstehen
Patmos Verlag
INHALT
Einleitung: Warum ein Ratgeber für Angehörige, Freunde und Mitarbeitende von transsexuellen/transidenten Menschen?
1. Ich verstehe die Welt nicht mehr: Eine Frau ist ein Mann und ein Mann eine Frau?
Auf den Punkt gebracht
2. Was ist Transidentität?
Auf den Punkt gebracht
3. Wie sollen wir ihm/ihr begegnen?
Auf den Punkt gebracht
4. Welche Konsequenzen hat der Rollenwechsel? Was muss nach der körperlichen Angleichung geändert werden?
Auf den Punkt gebracht
5. Was sagen wir unseren Verwandten, Freundinnen und Freunden sowie den Arbeitskolleginnen und -kollegen?Coming-out der Bezugspersonen
Auf den Punkt gebracht
6. Kann ein Coming-out am Arbeitsplatz überhaupt gelingen?
Auf den Punkt gebracht
7. Mein Kind ist »trans«
Auf den Punkt gebracht
8. Wird sie/er nicht Opfer von Diskriminierungen und Gewalt?
Diskriminierungen am Arbeitsplatz
Probleme in der Öffentlichkeit
»Transphobie« und Gewalt gegen Transmenschen
Ausgrenzungen im Familien- und Freundeskreis
Ausgrenzung von Transkindern
Diskriminierungen durch Fachleute
Fazit
Auf den Punkt gebracht
9. Meine Frau ist ein Mann – mein Mann eine Frau
Auf den Punkt gebracht
10. Wie sollen wir es unseren Kindern sagen?
Auf den Punkt gebracht
11. Mama wird Papa – Papa wird Mama
Auf den Punkt gebracht
Schluss: Das Wichtigste auf einen Blick
Literatur und hilfreiche Adressen
Literatur
Weiterführende Literatur
Hilfreiche Adressen von Organisationen und Anlaufstellen für Transmenschen und ihre Angehörigen
Anmerkungen
Einleitung: Warum ein Ratgeber für Angehörige, Freunde und Mitarbeitende von transsexuellen/transidenten Menschen?
Da es beim Thema Transsexualität/Transidentität viel begriffliche Verwirrung gibt und Sie möglicherweise bereits beim Untertitel dieses Ratgebers über das Wort »Transidentität« gestolpert sind, möchte ich am Anfang dieses Kapitels zunächst die Begriffe klären, die ich im Folgenden verwenden werde. Ich hoffe, dass Ihnen als Leserinnen und Leser, die noch nicht so vertraut mit dem Thema sind, dies bei der Lektüre dieses Ratgebers helfen wird.
Im Allgemeinen hören Sie die Begriffe »Transsexualität« bzw. »Transsexualismus«. Dies sind die üblichen Begriffe in der öffentlichen Diskussion, aber auch im wissenschaftlichen Bereich. Deshalb wurde mir vom Verlag nahegelegt, auch die Bezeichnung »Transsexualität« im Untertitel aufzuführen. Andernfalls könnte es passieren, dass Menschen, die sich über das Thema informieren wollen, das Buch mittels der Suchmaschinen im Internet nicht finden. Die Bezeichnung »Transsexualität« trifft jedoch nicht das Wesen dieser Menschen, da es bei ihnen nicht um die sexuelle Ausrichtung oder die Art, wie sie ihre Sexualität leben, geht, sondern um ihre Identität. Aus diesem Grund wird in neuerer Zeit, auch unter Fachleuten, eher der Begriff »Transidentität« verwendet, den auch ich bevorzuge und im vorliegenden Ratgeber verwenden werde.
Bei der Beschreibung sogenannter »transidenter« Menschen wird in psychologischen und psychiatrischen Berichten häufig von »Frau-zu-Mann«- bzw. »Mann-zu-Frau«-Transidenten gesprochen. Durch »Mann-zu-Frau« soll ausgedrückt werden, dass ein biologischer Mann sich als Frau wahrnimmt und die Angleichung an den weiblichen Körper wünscht. »Frau-zu-Mann« dient der Beschreibung dessen, dass eine biologische Frau sich als Mann empfindet und die Angleichung an den männlichen Körper sucht. Im Grunde widersprechen diese Bezeichnungen aber dem Erleben transidenter Menschen. Aus ihrer Sicht machen sie nämlich keine Veränderung von Mann zu Frau oder von Frau zu Mann durch, sondern sind von jeher im Innern Frau bzw. Mann gewesen und möchten nun »nur noch« den Körper an diese Identität anpassen lassen und in der dieser Identität entsprechenden Rolle leben.
»Transidente« selbst bezeichnen sich als »Transmenschen« und unterscheiden zwischen »Transmann« (biologische Frau, deren Identität männlich ist) und »Transfrau« (biologischer Mann, dessen Identität weiblich ist). Ich möchte im Folgenden bei meiner Darstellung diese Begriffe verwenden, da sie durch die Charakterisierung Transmann bzw. Transfrau die Selbstdefinition und die soziale Rolle als Frau bzw. als Mann in den Vordergrund stellen und so dem Erleben von Transmenschen am besten entsprechen. Dabei ist mir klar, dass es für Sie als Leserinnen und Leser eine gewisse Gewöhnung an diese Terminologie braucht, da sie nicht – wie sonst üblich – vom biologischen Geschlecht ausgeht und die Person danach benennt, sondern die Identität des betreffenden Menschen in den Vordergrund stellt und ihn dementsprechend bezeichnet.
Gewiss haben Sie schon ab und zu von Transmenschen gehört oder gelesen, meist wahrscheinlich im Zusammenhang mit Travestieshows, außergewöhnlichen Schicksalen oder gar mit Situationen, in denen Transmenschen Opfer von Gewalt geworden sind. Immer aber ging es dabei um Menschen, die Ihnen persönlich fremd waren und an deren Schicksal Sie nur indirekt über die Massenmedien Anteil genommen haben. Nun aber hat sich in Ihrer unmittelbaren Umgebung eine Frau oder ein Mann als »trans« geoutet, und unvermittelt sind Sie mit dem Phänomen Transsexualität bzw. Transidentität konfrontiert.
Sie dachten bisher vielleicht, Sie wüssten gut, was Transidentität ist. Jetzt aber merken Sie durch die Konfrontation mit einem Transmenschen, dass Sie nur eine vage Ahnung davon haben, wie ein solcher Mensch sich fühlt, wie der Weg der körperlichen Angleichung an das andere Geschlecht verläuft und welche Konsequenzen sich daraus für alle ergeben, die mit dieser Transperson in Kontakt stehen.
Außerdem spüren Sie beim Zusammentreffen mit diesem Menschen, dass das Phänomen Transidentität heftige Gefühle in Ihnen auslöst: Irritation, Unbehagen und Hilflosigkeit, ja vielleicht sogar Ablehnung. Sie mögen sich solcher Gefühle schämen oder sind vielleicht über sich selbst erstaunt, weil Sie sich doch für aufgeschlossen und tolerant gehalten haben. Oder Sie haben den Eindruck, mit Recht würden Sie Transidentität für eine psychische Krankheit halten und die Maßnahmen zur Angleichung an das andere Geschlecht völlig zurecht ablehnen – aber nun treffen Sie im Umfeld von Transidenten mit anderen Menschen zusammen, die eine völlig andere Auffassung vertreten, nämlich der Transidentität positiv gegenüberstehen und die betreffende Person auf ihrem Weg in die neue Geschlechtsrolle unterstützen.
Im positiven Fall wird die Wahrnehmung solcher widerstreitenden Gefühle und unterschiedlichen Einstellungen zur Transidentität in Ihnen den Wunsch entstehen lassen, sich genauer über Transidentität zu informieren.
Als Angehörige, Freund oder Kollegin eines Transmenschen werden Sie wahrscheinlich auch bemerken, dass Sie vielfach unsicher sind, wie Sie dieser Person begegnen sollen. Wie verhalten Sie sich zum Beispiel Ihrer Kollegin gegenüber, die Sie jahrelang als »Manuela Meister« kannten und die nun sagt, sie möchte als »Martin Meister« angesprochen werden? Oder wie verhalten Sie sich, wenn Ihnen Ihr Sohn nach der Eröffnung, transident zu sein, eines Tages geschminkt und mit Perücke in Frauenkleidern entgegentritt? Und wie gehen Sie mit den Gefühlen um, die Ihr Ehemann in Ihnen ausgelöst hat, als er Ihnen eröffnet hat, er sei transident und werde in Zukunft als Frau leben wollen? Und nicht zuletzt: Wie vermitteln Sie dies Ihren Kindern, für die der Papa plötzlich zur Mama wird?
Diese und andere Fragen und Probleme möchte ich in diesem Ratgeber behandeln. Da Transidentität keineswegs ein so seltenes Phänomen ist, wie mitunter angenommen wird (siehe Kapitel 2) und mehr Transidente als früher sich heute outen, können viele Menschen im Familien- und Freundeskreis sowie an der Arbeitsstelle mit Transpersonen zusammentreffen.
Ich beschäftige mich als Psychotherapeut und Forscher seit über vierzig Jahren mit transidenten Menschen, die ich beruflich in der psychotherapeutischen Begleitung, im Rahmen von Begutachtungen und auch privat im Freundeskreis erlebe. Aus dieser Erfahrung heraus habe ich mich entschlossen, den vorliegenden Ratgeber zu schreiben, zumal es im deutschsprachigen Bereich keine vergleichbare Publikation gibt. Eine sich eher an Fachleute sowie die Transidenten selbst richtende ausführliche Darstellung dessen, was wir heute wissenschaftlich über Transidentität wissen und wie der Transitionsprozess verläuft, findet sich in meinem Buch Transsexualität – Transidentität (3. Auflage 2012).
Der vorliegende Ratgeber hingegen richtet sich in erster Linie an Sie als Menschen aus dem privaten und beruflichen Umfeld von Transidenten und möchte Ihnen konkrete Hinweise für Ihren Umgang mit diesen Menschen liefern. Immer wieder erfahre ich in der psychotherapeutischen Begleitung von Transmenschen und ihren Bezugspersonen im privaten wie im beruflichen Bereich, wie hilflos ihre Angehörigen und Bekannten im Umgang mit ihnen oft sind und dass sie selbst bei psychologischen und psychiatrischen Fachleuten wenig Hilfe finden, da diese selbst oft keine fundierten Kenntnisse über Transmenschen und das Leben ihrer Angehörigen und Freunde haben.
Wiederholt habe ich in den vergangenen Jahren auch erlebt, dass beispielsweise Vorgesetzte zusammen mit ihren transidenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu mir als Therapeuten gekommen sind, um zu besprechen, wie der Rollenwechsel möglichst problemlos in der Firma vollzogen werden kann. Hinter diesem Anliegen wird auf der einen Seite die Hilflosigkeit der Vorgesetzten gegenüber der transidenten Mitarbeiterin bzw. dem transidenten Mitarbeiter spürbar. Aus ihrem Wunsch, mit der transidenten Person zusammen den Rollenwechsel zu planen, spricht auf der anderen Seite aber auch das Bewusstsein der Verantwortung, die der oder die betreffende Vorgesetzte für die Transperson und das Arbeitsteam empfindet. Die Erfahrung zeigt, dass ein so geplantes, aufeinander abgestimmtes Vorgehen beim Coming-out am Arbeitsplatz große Vorteile hat und erheblich zu einer positiven Entwicklung des Transmenschen und des ganzen Teams am Arbeitsplatz beiträgt.
In elf Kapiteln werde ich im vorliegenden Ratgeber die wichtigsten Fragen und Problembereiche, zum Teil anhand von Beispielen einzelner Transmenschen und ihrer Familien und Arbeitsteams, diskutieren und Hinweise für einen konstruktiven Umgang mit den betreffenden Situationen geben. Die Beispiele habe ich aufgrund realer Situationen von Klientinnen und Klienten formuliert, wobei ich aber jeweils Teile aus verschiedenen Lebensgeschichten zu einem Beispiel zusammengefügt habe, so dass die Anonymität einzelner Personen absolut gewährleistet ist. Die genannten Namen sind fiktiv.
Die Hinweise, die ich bei der Diskussion der verschiedenen Themen gebe, sollten Sie nicht als verbindliche Handlungsanweisungen missverstehen. Transmenschen und ihre Lebensumstände sind so unterschiedlich wie die aller anderen Menschen auch. Deshalb werde ich auch keine ausführliche Lebensgeschichte einer einzelnen Transperson schildern. Würde ich dies tun, so bestünde die Gefahr, dass Sie als Leserinnen und Leser dieses Ratgebers den Eindruck gewinnen, dies sei die »typische« Biographie einer transidenten Person. Und die gibt es nicht! Insofern sollten Sie die Hinweise, die ich in den elf Kapiteln gebe, als Anregungen verstehen, wie Sie mit den betreffenden Situationen umgehen können. Das konkrete Verhalten müssen Sie individuell Ihrer Persönlichkeit, Ihren Lebensumständen und dem Transmenschen, um den es geht, anpassen. Im ersten Kapitel werde ich die Emotionen und Gedanken behandeln, die wohl in allen auftauchen, die zum ersten Mal mit einem Transmenschen zusammentreffen, nämlich das Gefühl, die Welt nicht mehr zu verstehen, wenn ein Mann eine Frau und eine Frau ein Mann sein will.
Im zweiten Kapitel werde ich dann ausführlich schildern, was wir heute über Transidentität wissen und wie der Weg von Transmenschen beim sozialen Rollenwechsel und bei der körperlichen Angleichung an das andere Geschlecht verläuft. Ich habe mich dabei bemüht, Ihnen nicht allzu viel an Fachjargon und theoretischen Überlegungen zuzumuten. Ich denke aber, dass es für Sie als Angehöriger oder Freundin eines Transmenschen wichtig ist, gut über Transidentität informiert zu sein. Dies kann Ihnen dann auch helfen, die Informationen, die Sie im Internet finden oder von Fachleuten erhalten, besser zu verstehen und, falls nötig, auch kritisch zu hinterfragen. Denn gerade beim Thema Transidentität werden Sie immer wieder auf die widersprüchlichsten Angaben stoßen, die Sie leicht in große Verunsicherung stürzen können, wenn Sie nicht einigermaßen gut informiert sind.
Falls Sie mit einigen Informationen, die ich Ihnen im zweiten Kapitel liefere, vielleicht anfangs Probleme haben, wird Ihnen etliches sicher klarer, wenn ich in den folgenden neun Kapiteln auf die verschiedenen Themen eingehe und sie zum Teil an Beispielen von Transmenschen und ihren Bezugspersonen veranschauliche. Es wird um die Frage gehen, wie Sie einem Transmenschen begegnen und welche Gefühle dies in Ihnen auslöst (Kapitel 3), welche Änderungen nach dem Rollenwechsel und der Personenstandsänderung nötig werden (Kapitel 4), und um die Frage, wie Sie als Familienmitglied, Freund oder Freundin eines Transmenschen mit Ihrem eigenen »Coming-out« umgehen, d. h. wenn Sie anderen Menschen eröffnen, dass Ihr Sohn bzw. Ihre Tochter oder Ihr Ehemann bzw. Ihre Ehefrau transident ist (Kapitel 5).
In den folgenden Kapiteln werde ich auf die Sorgen eingehen, die Sie sich um den Ihnen nahestehenden Transmenschen machen, zum Beispiel ob er nach dem Rollenwechsel Probleme am Arbeitsplatz haben wird (Kapitel 6), ich werde die besondere Situation schildern, mit der Sie als Eltern eines Transkindes konfrontiert sind (Kapitel 7), und werde Ihre Sorge diskutieren, Ihr Transangehöriger oder Ihre Transfreundin könne sozial ausgegrenzt oder gar Opfer von Gewalt werden (Kapitel 8).
Die drei letzten Kapitel sind der Familie von Transmenschen gewidmet, nämlich Ihrer Situation als Ehefrau oder Ehemann, der/dem der Partner bzw. die Partnerin eröffnet, transident zu sein (Kapitel 9), dem Problem, wie Sie Ihre Kinder über die Transidentität Ihres Ehepartners informieren können, ohne dass die Kinder dadurch psychischen Schaden erleiden (Kapitel 10), sowie der Frage, wie es für Ihre Kinder ist, wenn Mama zu Papa bzw. Papa zu Mama wird (Kapitel 11).
Das Kapitel 10 wird, neben dem theoretischen Kapitel 2 und dem Kapitel 8, das Ihre Sorgen um eine mögliche Ausgrenzung des Ihnen nahestehenden Transmenschen behandelt, das ausführlichste sein, da es mir wichtig erscheint, gerade der Situation der Kinder von Transmenschen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Das Kapitel 4 über die mit dem Rollenwechsel nötig werdenden Änderungen hingegen ist das kürzeste. Dies bedeutet nicht, dass die darin diskutierten Themen unwichtig wären. Sie sind aber knapper darstellbar, und meine Ausführungen dienen vor allem Ihrer Information, während der Umgang mit Ihren Kindern und die Auseinandersetzung mit möglichen Diskriminierungen von Transmenschen wesentlich komplexer sind und deshalb eine ausführlichere Diskussion erfordern.
Am Ende jedes Kapitels werden die wichtigsten Aspekte noch einmal angeführt, »auf den Punkt gebracht«. Den Abschluss dieses Ratgebers bildet eine thesenartige Zusammenfassung der Hauptthemen. Im Anhang finden Sie einige Angaben zu weiterführender Literatur und die wichtigsten Transsexuellenverbände und -organisationen, bei denen Sie Informationen und Unterstützung finden können.
Der vorliegende Ratgeber richtet sich zwar in erster Linie an Angehörige, Freundinnen und Freunde sowie an Personen aus dem beruflichen Umfeld von Transmenschen. Bei der Darstellung der verschiedenen Problembereiche weise ich aber immer wieder auch auf Themen hin, mit denen die Transmenschen selbst sich auseinandersetzen müssen, zum Beispiel mit Ihrer Wirkung auf andere Menschen und mit den Gefühlen, die sie in Angehörigen und Freunden auslösen. Vielleicht regt die Lektüre dieses Ratgebers Sie ja auch an, gemeinsam die hier angesprochenen Themen zu diskutieren und in einen fruchtbaren Dialog miteinander zu treten. Möge dieses Buch Ihnen eine Hilfe auf dem Weg zum Verständnis und zur Akzeptanz Ihres transidenten Angehörigen oder Ihrer transidenten Freundin sein und dazu beitragen, dass Sie einander besser verstehen und zusammen einen erfolgreichen, für Sie alle fruchtbaren Weg gehen.
Im Sommer 2013Udo Rauchfleisch
1. Ich verstehe die Welt nicht mehr: Eine Frau ist ein Mann und ein Mann eine Frau?
Wir gehen in unserer Kultur und unserer Epoche davon aus, dass es zwei Koordinaten gibt, die absolut festliegen, nämlich das Frausein und das Mannsein. Es scheint uns selbstverständlich zu sein, dass es weibliche und männliche Körper gibt und dass diese eindeutig das Geschlecht bestimmen. Als einzige Ausnahme erkennen wir die Intersexualität an, die bei Menschen besteht, bei denen wir die körperlichen Merkmale beider Geschlechter finden.1
Wenn uns jedoch ein Mann mit einem biologisch eindeutig männlichen Körper eröffnet, er sei eine Frau, oder eine Frau mit einem biologisch eindeutig weiblichen Körper, sie sei ein Mann, stellt dies für uns die Welt gleichsam auf den Kopf und löst bei den meisten Menschen eine extreme Verunsicherung aus.
Obwohl es, wie ich in der Einleitung geschrieben habe, nicht die für Transmenschen typische Persönlichkeit und Lebensgeschichte gibt, ähneln sich die Berichte von Transfrauen und Transmännern doch in einer Hinsicht oft sehr: Die erste Mitteilung ihrer Transidentität löst fast immer bei Angehörigen, Freundinnen und Freunden sowie Kolleginnen und Kollegen im beruflichen Bereich große Irritation aus. Das folgende Beispiel soll das veranschaulichen.
Martin Zöllner, ein 28-jähriger Büroangestellter, hat bereits in seiner Kindheit und Jugendzeit ein großes Interesse an weiblicher Kleidung und weiblichen Tätigkeiten gespürt. So hat er, wenn seine Eltern und Geschwister nicht zu Hause waren, heimlich Unterwäsche der Mutter oder Kleider der Schwester angezogen und ist, sich nur mit Mühe auf den Beinen haltend, mit den hochhackigen Schuhen der Mutter durch die Wohnung stolziert. Gerne hätte er sich auch geschminkt, unterließ dies aber aus Angst, die Schminke vielleicht nicht mehr richtig beseitigen zu können – er hatte die Mutter einmal etwas von »kussechtem« Lippenstift sagen hören. Wenn Martin sich als Mädchen bzw. Frau kleiden konnte, waren dies Momente, in denen er sich »total eins mit mir selbst befand«, wie er später seinem Psychotherapeuten berichtete. Er habe als Kind und Jugendlicher noch nicht gewusst, was mit ihm los sei. Nur eines habe er ganz deutlich gespürt: »Ich bin kein Junge. Ich bin ein Mädchen.«
Die Eltern wussten nichts von diesen heimlichen Aktionen ihres Sohnes. Seine Vorliebe für weibliche Spiele und Tätigkeiten (so wollte Martin in Rollenspielen mit Kameraden immer die Mutter oder ein Mädchen sein) nahmen sie jedoch wahr und versuchten, ihm klarzumachen, dass er »doch ein Junge« sei und sich dementsprechend verhalten müsse. Als Martin älter wurde und immer noch stark auf die Interessen von Mädchen ausgerichtet war, indem er sich beispielsweise fast ausschließlich mit Modezeitschriften für Frauenkleidung beschäftigte und stundenlang selbst Kleider entwarf und Pläne für die Herstellung solcher Kleider zeichnete, reagierten die Eltern mit erheblicher Strenge und verboten ihm diese Beschäftigung schließlich total.
»Du musst dich mehr um den Jungen kümmern«, meinte Frau Zöllner zu ihrem Mann. »Dann wird er sich auch mehr an dir als Mann orientieren.« Obwohl Herr Zöllner Martin in der Folge mit zum Fußballplatz nahm, mit ihm regelmäßig zum Schwimmen ging und ihn für technische Dinge zu interessieren versuchte, spürten die Eltern, dass Martin zwar alle diese Aktivitäten »brav« mitmachte und das Zusammensein mit dem Vater auch durchaus schätzte, dass sein Interesse an der Welt der Frauen damit aber keineswegs verschwunden war.
Als Martin in die Pubertät kam, seinen Bart wachsen sah und sexuelle Regungen verspürte, stürzte ihn dies in eine tiefe Krise. Alles in ihm bäumte sich gegen die Männlichkeit auf, mit der er sich nun auch körperlich konfrontiert sah. Gegenüber den Eltern hielt er diese Gefühle aber geheim und äußerte auf ihre Fragen, was denn mit ihm los sei, ausweichend, er mache sich Sorgen wegen der Schule und seines weiteren Lebens. Da Martins Schulleistungen infolge der Krise, in der er steckte, in dieser Zeit tatsächlich nicht besonders gut waren, gaben sich die Eltern mit dieser Antwort zufrieden. »Das ist halt so in der Pubertät. Ich habe das ähnlich erlebt«, erklärte Herr Zöllner seiner Frau.
Dass das Leiden unter seiner Männlichkeit und der Wunsch, Frau zu sein, für Martin ein zentraler Konflikt war, ahnte in dieser Zeit niemand. Dies umso weniger, als er im Alter von 18 Jahren begann, gemeinsam mit Klassenkameraden anstrengende Hochgebirgstouren zu machen, und sich auch sonst intensiv sportlich betätigte. So meldete er sich bei einem Verein für Kampfsportarten an und trainierte dort intensiv. »Jetzt übertreibt er es aber wirklich«, fanden sogar seine Eltern, die ansonsten froh waren, dass Martin sich so ganz auf die männliche Seite geschlagen zu haben schien. Auch in seinem Äußeren war Martin in der Zeit zwischen seinem 18. und 28. Lebensjahr ein »richtiger Mann«: körperlich trainiert, mit Bart und kurzen Haaren.
Umso überraschender war es, als er an seinem 28. Geburtstag beim Abendessen den Eltern mitteilte: »So kann ich nicht weitermachen!« Unter Tränen gestand er ihnen, dass er sich zehn Jahre lang Mühe gegeben habe, ein Mann zu sein. Doch all die »männlichen« Aktivitäten und sein betont »männliches« Aussehen hätten ihn nicht darüber hinwegtäuschen können, dass er in Wahrheit kein Mann, sondern eine Frau sei. »Ich hasse diese tägliche Verkleidung als Mann und dieses Angesprochenwerden als ›Herr‹ Zöllner!«, brach es aus Martin hervor. »Ich bin das doch gar nicht. Ich bin Martina und nicht Martin. Und ich will mich jetzt behandeln lassen und endlich auch körperlich ganz Frau werden und auch so leben.«
Fassungslos starrten die Eltern den Sohn an. »Das ist doch nicht dein Ernst«, stammelte Frau Zöllner, als sie wenigstens einigermaßen die Fassung wiedergewonnen hatte. »Das ist unmöglich. Du bist ein Mann und keine Frau«, schaltete sich der Vater ein. »Deine Mutter hat dich als Junge zur Welt gebracht, und wir haben dich als Junge aufwachsen gesehen und haben miterlebt, wie du zum Mann geworden bist. Schau doch in den Spiegel. Dann siehst du ja selbst, dass du ein Mann bist. Wie kommst du nur auf diese verrückte Idee, eine Frau zu sein?«
Die letzten Worte des Vaters trafen Martin tief. Er sprang auf und rannte weinend aus dem Zimmer. Die Mutter eilte ihm nach, schloss ihn in die Arme und versuchte ihn zu beruhigen. »Nimm das Ganze doch nicht so schrecklich ernst«, versuchte sie ihn zu trösten. »Du bist offensichtlich in einer schweren Krise. Da zweifelt man manchmal an den selbstverständlichsten Dingen. Am besten meldest du dich bei einem Psychotherapeuten an und besprichst mit ihm deine Probleme. Du wirst sehen, dann vergehen diese Ideen wieder.« Obwohl Martin spürte, dass seine Mutter ihn trösten und ihm Mut machen wollte, fühlte er sich auch durch ihre Worte verletzt und total allein gelassen.
»Begreift ihr denn gar nicht, dass es mir mit dem Frausein total ernst ist? Von Kindheit an habe ich gewusst, dass ich kein Junge bin. Und ihr habt das doch auch gemerkt und mich deshalb mit aller Macht in die männliche Rolle zu schieben versucht. Ich habe ja selbst eine Zeit lang gedacht, ich würde es schaffen und könnte mich mit meiner Männlichkeit aussöhnen. Zehn Jahre lang habe ich dieses Problem verdrängt. Das hat mich wahnsinnig viel Kraft gekostet. So kann ich nicht mehr weitermachen! Es gibt jetzt nur noch einen einzigen Weg: Ich will als die Frau leben, die ich im tiefsten Inneren bin!«
Das Ehepaar Zöllner war über diese Eröffnung ihres Sohnes, als Frau leben zu wollen, völlig entsetzt. »Am Ende willst du dich auch noch umbauen lassen?«, fragte der Vater in einem der vielen Gespräche, welche die Eltern mit Martin führten und in denen sie ihn immer wieder von seinem Plan abzubringen versuchten. »Selbstverständlich werde ich mich bei einem Endokrinologen zur Hormonbehandlung anmelden und mit einem plastischen Chirurgen die Operation besprechen. Außerdem wird man nicht ›umgebaut‹, sondern mein männlicher Körper wird operativ dem weiblichen angeglichen, damit endlich das Äußere dem Inneren entspricht«, war Martins Antwort darauf. »Sprich bitte nicht davon«, bat die Mutter ihn. »Es graust mich bei dem Gedanken, dass du an deinem schönen Körper herumschneiden lassen willst. Das ist ja schrecklich! Letzten Endes ist ein Mann doch ein Mann, und was auch immer du machen wirst: Für mich bleibst du mein Sohn Martin, der du immer warst.«
Vielleicht erkennen Sie sich als Elternteil, Angehöriger oder Freund eines Transmenschen in manchen der Reaktionen des Ehepaares Zöllner wieder. So oder ähnlich ist es Ihnen vielleicht auch ergangen, als Ihre Freundin Ihnen, vielleicht ähnlich wie Martin im Beispiel, unter Tränen und mit starken Schamgefühlen »gestanden« hat, sie sei nicht die Frau, die Sie bisher in ihr gesehen hätten, sondern sie sei im tiefsten Inneren ein Mann. Kopfschütteln, ungläubiges Erstaunen und bagatellisierendes Gutzureden (»Das ist sicher nur so eine Phase. Nimm es nicht so ernst, und steigere dich vor allem nicht da hinein!«) sind vielleicht Ihre ersten, spontanen Reaktionen gewesen, hilflose Versuche, sich die tiefe Irritation, die diese Mitteilung in Ihnen ausgelöst hat, nicht anmerken zu lassen und selbst »den Kopf über Wasser« zu behalten.
Die gleiche, unter Umständen sogar noch heftigere emotionale Reaktion haben Sie vielleicht als Eltern erlebt, als Ihr erwachsener Sohn Ihnen eröffnet hat, er sei kein Mann, sondern eine Frau. Wie im Beispiel der Familie Zöllner hat diese Mitteilung wahrscheinlich eine sehr starke, Sie höchst irritierende Wirkung gehabt. Fassungslos werden Sie vermutlich Ihren Sohn angeschaut und sich nicht vorzustellen gewagt haben, wie er, geschminkt, mit Perücke und in Frauenkleidern, als Frau aussehen würde. »Das ist nicht dein Ernst!« oder »Nun bist du total verrückt geworden« sind vielleicht, wie bei Herrn Zöllner, die ersten Äußerungen gewesen, die Ihnen, obwohl Sie das nachträglich bereuen mögen, nach Überwindung des ersten Schrecks entschlüpft sind. Oder Sie haben ihn fassungslos angestarrt und seine Mitteilung wie einen Schlag ins Gesicht empfunden. »Auch das noch! Als ob wir nicht schon genug Probleme hätten. Das kann, das darf einfach nicht wahr sein«, mag Ihnen durch den Kopf geschossen sein. »Das gibt es doch gar nicht. Ein Mann ist ein Mann und eine Frau ist eine Frau. Basta!«, so wie Frau Zöllner es formuliert hat.
Nicht ganz so heftig, aber auch Ausdruck einer großen Irritation, ist vielleicht Ihre Reaktion als Arbeitskollegin oder -kollege bzw. als Vorgesetzte gewesen, als Ihre Mitarbeiterin Ihnen mitteilte, sie sei ein Mann und wolle in nächster Zukunft im Betrieb in der männlichen Rolle auftreten. Oder ein Mitarbeiter hat Ihnen eröffnet, er sei eine Frau und wolle demnächst auch am Arbeitsplatz den Wechsel in die weibliche Rolle vornehmen.
Alle, die bisher nicht persönlich mit Transmenschen zu tun gehabt haben, empfinden beim ersten Zusammentreffen mit einer solchen Person eine tiefe Verunsicherung, weil dadurch die scheinbar festen Koordinaten von »weiblich« und »männlich« ins Wanken geraten. Am meisten irritiert Sie dabei wohl die Tatsache, dass die Ihnen gegenüberstehende Frau nicht sagt, sie fühle sich wie ein Mann, sondern ihre Situation mit den Worten schildert: »Ich bin ein Mann.« Mitunter nehmen Transmenschen auch das Bild vom Leben im »falschen Körper« zu Hilfe, um das letztlich Nicht-Beschreibbare der Transsituation dem Gegenüber doch noch in irgendeiner Form verständlich zu machen. Aber auch dies ist eigentlich nur ein mehr oder weniger hilfloser Versuch, Ihnen als Eltern, Freundinnen, Freunden, Arbeitskolleginnen und -kollegen oder Vorgesetzten zu erklären, was es bedeutet, eine Transfrau oder ein Transmann zu sein.
Nicht selten drängt sich Angehörigen oder anderen Personen aus dem Umfeld von Transmenschen auch der Gedanke auf, vielleicht gehe es ja gar nicht um den Körper, sondern darum, dass die Person, mit der Sie sprechen, homosexuell sei, dies aber nicht akzeptieren könne und meine, als Frau nur eine Frau lieben zu können, wenn sie ein Mann sei, bzw. als Mann nur einen Mann lieben zu können, wenn er eine Frau sei. Ich werde im folgenden Kapitel noch ausführlicher darauf eingehen, dass dies eine irrige Vorstellung ist. Innerhalb der Transidentität gibt es, wie bei Nicht-Transidenten, den sogenannten »Cis-Menschen«2, ebenfalls Hetero-, Bi- und Homosexuelle. Das heißt: Transidentität hat nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun, was für Sie allerdings die Verunsicherung unter Umständen noch größer werden lässt. Nun will Ihr Sohn lesbisch und Ihre Tochter schwul sein? Spätestens bei dieser Äußerung Ihres Kindes steht die Welt für Sie total auf dem Kopf. Dann könnte der Mann doch Mann bleiben und mit einer Frau zusammenleben, und die Frau Frau bleiben und mit einem Mann zusammenleben, »so wie es üblich ist«.
Diese und ähnliche Gedanken und Gefühle werden in Ihnen auftauchen, wenn sich Ihnen ein Transmensch als solcher zu erkennen gibt, und »dann auch noch« homosexuell ist. Vielleicht verspüren Sie dabei auch den Impuls, nichts weiter davon wissen zu wollen und das ganze Thema als »Laune«, als »verrückte Idee«, wie es im Beispiel Martins Vater ausdrückt, als »eine Phase, die wieder vorbeigeht« oder gar als Symptom einer schweren psychischen Störung anzusehen. Dadurch versuchen Sie, die bisher gültigen Koordinaten Männlichkeit und Weiblichkeit wieder fest zu etablieren und der transidenten Person einen Platz innerhalb dieser Koordinaten zuzuweisen.
So verständlich dieser Wunsch angesichts der großen Irritation ist, die Transmenschen in anderen Menschen auslösen, so wenig wird eine solche Interpretation ihnen indes gerecht. Transidentität ist keine »Laune«, kein exzentrisches Gebaren und hat, wie ich im folgenden Kapitel noch darstellen werde, nichts mit psychischer Krankheit zu tun. Wenn Ihr Sohn oder Ihr Arbeitskollege vorher gesund war, ändert die Mitteilung, dass er ein Transmensch ist, nichts daran. Er ist durch sein Coming-out Ihnen gegenüber ja kein anderer Mensch geworden und bleibt auch nach der Transition in seinem Wesen die gleiche Person, die er immer war.
Insofern ist es verständlich, dass im Beispiel Martin Zöllner sich durch die Reaktion seiner Eltern tief verletzt fühlt. Er befindet sich zwar tatsächlich in einer »schweren Krise«, wie seine Mutter es ausdrückt. Sein Wunsch, nun endlich ganz Frau sein zu können, ist aber in keiner Weise Symptom irgendeiner psychischen Störung, bei der er »an den selbstverständlichsten Dingen zweifelt«, vielmehr hat die permanente Unterdrückung seiner wahren Identität ihn in diese Krise gestürzt.
Ähnlich wie Sie als Angehörige oder Freund eines Transmenschen vielleicht versucht haben oder es immer noch versuchen, ihn davon zu überzeugen, dass ein Mann doch ein Mann und eine Frau eine Frau sei, ergeht es Transmenschen selbst. Sie sind in unserer Gesellschaft aufgewachsen, die nur Männer oder Frauen kennt und auf eine eindeutige Zuweisung zu einem der beiden Geschlechter besteht, und so haben auch sie diese kulturelle Vorgabe selbstverständlich verinnerlicht. Zugleich aber spüren sie, oft von Kindheit an, dass es bei ihnen zwischen »innen« (Identität) und »außen« (biologischer Körper) keine Übereinstimmung gibt. Aus eben diesem Zwiespalt resultiert ja auch ihr Leiden, wie Martin Zöllner es im Beispiel schildert.
Es ist für etliche Transmenschen – nach meiner Erfahrung bei Transfrauen allerdings stärker als bei Transmännern – charakteristisch, dass sie mitunter über Jahre hin krampfhaft versuchen, sich den Verhaltensnormen ihres biologischen Geschlechts anzupassen. Bei Martin Zöllner sind es Hochgebirgstouren, intensives Training in Kampfsportarten und ein betont männliches Aussehen mit Bart und kurzen Haaren. Es ist ein geradezu verzweifelter Kampf gegen sich selbst, der schließlich in einer mehr oder weniger schweren Krise endet, in der etwa eine Transfrau wie Martin Zöllner sich selbst und der Umgebung eingestehen muss: »So kann ich nicht mehr weitermachen! Es gibt jetzt nur noch einen einzigen Weg: Ich will als die Frau leben, die ich im tiefsten Inneren bin.«
Gelingt es Ihnen bei der ersten Mitteilung Ihres Sohnes oder Ihres Freundes vielleicht noch, die Realität des Transseins beiseitezuschieben, so steigert sich die Irritation im Allgemeinen noch einmal, wenn Ihnen dieser Mann zum ersten Mal als Frau gegenübertritt. Möglicherweise ahnen Sie gar nicht, wie viel Mut und Vertrauen in Sie es braucht, damit eine Transfrau diesen Schritt zu tun wagt, besteht doch das große Risiko, dass Sie angesichts dieser »Verkleidung« (wie Sie das Tragen der weiblichen Kleidung unter Umständen bezeichnen) in schallendes Gelächter ausbrechen oder Ihrer Abneigung gegen diese »Aufmachung« mimisch und mit abwertenden Worten Ausdruck verleihen. Es ist in diesem Zusammenhang interessant zu sehen, dass Transmenschen umgekehrt das Tragen der Kleidung, die ihrem biologischen Geschlecht entspricht, häufig als »Verkleidung« empfinden.
Es mag sein, dass die noch wenig im Schminken erfahrene Transfrau es übertrieben hat und auch in der Kleidung »zu dick aufgetragen« hat im Bestreben, möglichst weiblich zu wirken. Seien Sie sich als Angehöriger, Freundin oder Kollege aber darüber klar, dass Transmenschen kein Theater spielen und für sie das Leben in der gegengeschlechtlichen Rolle nicht – wie für Transvestiten (vgl. Kapitel 2) – ein lustvolles, spielerisches Schlüpfen von einer Rolle in die andere und zurück ist, sondern dass es ihnen darum geht, durch das Leben in der gegengeschlechtlichen Rolle endlich ihr Äußeres und Inneres (ihr Bild von sich als Frau bzw. Mann) in Einklang miteinander zu bringen. Die ersten Schritte auf diesem Weg mögen bei manchen Transfrauen mitunter unbeholfen wirken. Als Außenstehende müssen Sie sich jedoch darüber klar sein, dass es um den Kern ihrer Persönlichkeit, ihre Identität, geht. Deshalb sind kritische, entwertende Blicke und Worte über ihr Aussehen ganz besonders kränkend, fühlen Transmenschen sich dadurch doch – und zwar mit Recht – in ihrer Identität abgelehnt. Transmänner haben es diesbezüglich einfacher, weil Frauen sich in unserer Gesellschaft viel leichter männlich kleiden und verhalten können.
Ihre Irritation als Bezugspersonen ist etwas, mit dem Sie sich auseinandersetzen müssen, und wir alle können von Transmenschen profitieren, lehren sie uns doch, dass die Welt bunter und vielfältiger ist, als wir gemeinhin annehmen. Und weisen unsere Irritation und die gegen Transmenschen gerichtete Ablehnung uns nicht darauf hin, wie stark auch wir an den traditionellen Frau-Mann-Koordinaten hängen und in welchem Maße auch wir vorurteilsbeladen sind, obwohl wir uns immer für so tolerant und offen gehalten haben? Indem wir beim Zusammentreffen mit Transmenschen Irritation spüren und Vorurteile in uns aufsteigen sehen, bieten Transfrauen und Transmänner uns die Chance, diese Gefühle und Einstellungen zu hinterfragen und auf diese Weise den Weg zu echter Toleranz und Akzeptanz anderer, von unseren Vorstellungen abweichender Menschen frei zu machen.