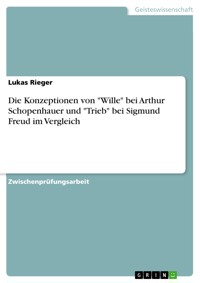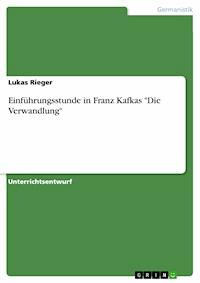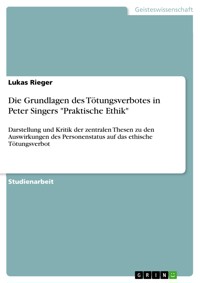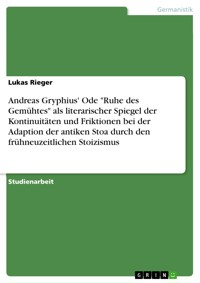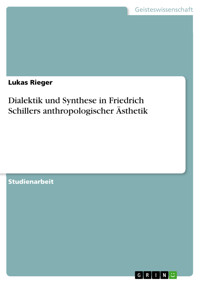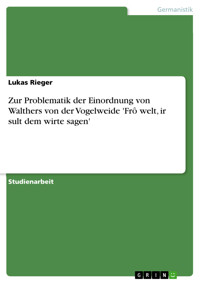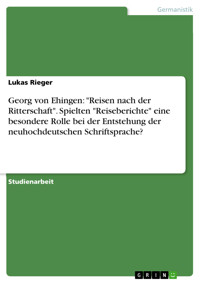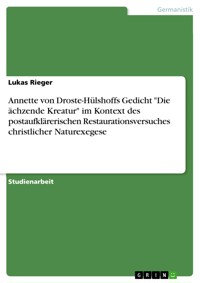
Annette von Droste-Hülshoffs Gedicht "Die ächzende Kreatur" im Kontext des postaufklärerischen Restaurationsversuches christlicher Naturexegese E-Book
Lukas Rieger
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1,0, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Germanistisches Seminar), Veranstaltung: Hauptseminar "Übungen zur Lyrik-Interpretation - Annette von Droste-Hülshoff", Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit verfolgt ausführlich die Entstehungsgeschichte Annette von Droste-Hülshoffs Gedicht "Die ächzende Kreatur"/"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Page 1
Hausarbeit im literaturwissenschaftlichen Hauptseminar
Page 3
I. Deutungsthesen
Der bestimmende thematische Hintergrund des hier analysierten Gedichtes ist eine an die Beobachtung natürlicher Gegebenheiten gekoppelte Reflektion der christlich-katholischen Erbsündenlehre, die vorrangig nicht, wie man es erwarten dürfte, das Verhältnis zwischen dem Sündenerben und Gott als seinem metaphysischen Gläubiger problematisiert, sondern unter Rückgriff auf die Vorstellung einer durch Vererbung fortwirkenden peccati originale originans eine Anthropologie entwirft, in deren Zentrum das sich zwischen gefallenem Menschen und der unter diesem Fall und den dadurch gezeitigten heilsgeschichtlichen Verwerfungen mit-leidenden Kreatur aufspannende Schuldverhältnis den Orientierungshorizont menschlicher Ontologie bestimmt. Das Gedicht eignet sich in diesem Zuge den ihm zugrunde liegenden Passus aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer umdeutend an, statt ihn lediglich poetisch auszudeuten. Dabei arbeitet es auch ein eklatantes Gerechtigkeitsproblem heraus, das im Römerbrief zwar angelegt, aber von den zeitgenössischen Exegeten unbemerkt geblieben ist.
Darüber hinaus ist Annette von Droste-Hülshoffs Werk Beleg für die in spätromantischer Tradition stehende Abwehr des aufklärerischen und im Gefolge naturalistischen Versuchs der Demontage der theistischen Deutungshoheit zur ontologischen Erklärung physikalischer und biologischer Gegebenheiten, wie es zugleich Zeugnis von der postaufklärerischen Dysfunktionalität christlicher Eschatologie gibt.
Als psychologisch lesbares Selbstzeugnis der Dichterin offenbart das Werk zuletzt die oft thematisierte und für das Gesamtwerk der Droste wirkungsvoll ge-wordene Zerrissenheit der Droste zwischen Glaube und Zweifel, die sich, psychoanalytisch gedeutet, zu allererst im Gefühl der Schuld manifestiert und sich als dieses Gefühl im vorliegenden Werk, zugespitzt in seiner letzten Strophe, ihren künstlerischen Ausdruck verschafft.
Ziel dieser Arbeit ist es, diese Thesen in erster Linie am Text des Gedichtes zu plausibilisieren. Dem voraus geht jedoch eine an der Entstehungsgeschichte des
~ 1 ~
Page 4
Gedichtes orientierte Einordnung in den zeitgenössischen Diskurs, vor deren Hintergrund sich der Aussagegehalt des Gedichtes erst ganz entschlüsseln lässt.
II. Entstehungsgeschichte
Annette von Droste-Hülshoffs Gedicht ‚Die ächzende Kreatur‘ ist das letzte von ihr überlieferte Werk. Die Dichterin hat den Bearbeitungsprozess nie ganz abgeschlossen, so dass es heute nicht in einer autorisierten finalen Fassung vorliegt. Der hier zugrunde gelegte ‚Erste Entwurf‘ des Gedichtes ist einer Handschrift aus dem Nachlass entnommen.1Bekanntheit hat das Werk allerdings vor allem in einer durch Schücking im Jahre 1898 herausgegebenen Fassung erlangt.2Diese Fassung setzt im Vergleich zur hier zugrunde gelegten Fassung einige, teilweise erhebliche Autor-Varianten um. Auf die sich ergebenden Unterschiede soll allerdings nur an einzelnen, signifikanten Stellen eingegangen werden. Schon der Titel des Gedichtes stammt so jedenfalls nicht aus der Feder der Autorin selbst, sondern ist ihm durch Schücking erst gegeben worden.
Die Wahl des Titels ‚Die ächzende Kreatur‘ erscheint, die Frage nach editorischer Legitimität hintan gestellt, aus mehrerlei Gründen sinnvoll. So knüpft er sowohl an das in gleichfalls programmatischer wie positioneller Hinsicht zentrale Symbol in Vers 40 des Gedichtes an, wie er im selben Zuge über das Werk hinausweist und den bestehenden intertextuellen Bezug zwischen Gedicht und seiner Inspirationsquelle, dem biblischen Römerbrief, der die ächzende oder ‚seufzende Schöpfung‘3ebenfalls zum Kernbestand seines Motivvorrates zählt, offenbart.
Annette von Droste-Hülshoff hat die uns vorliegende Fassung des Gedichtes im Jahr 1846, vermutlich im August, verfasst.4Den Anstoß hierzu gab ihr der Freund und Förderer Christoph Bernhard Schlüter, der die Droste in einem Brief aus
1Eine fotografische Reproduktion der Handschrift findet sich in A.von Droste-Hülshoff,Historisch-kritische Ausgabe. Band IV,2, S. 702. Dieser Arbeit zugrunde gelegt ist die edierte Fassung, wie sie in A.von Droste-Hülshoff,Historisch-kritische Ausgabe. Band IV,1, S. 207 - 209 wiedergegeben wird. Versangaben im Fließtext dieser Arbeit beziehen sich auf diese Ausgabe.
2Gemeint ist der Abdruck des Gedichtes unter dem genannten Titel in Annette Freiin von Droste-Hülshoffs gesammelte Schriften in drei Bänden. Mit Einleitung von Levin Schücking. Band 2. Das geistliche Jahr. Geistliche Lieder. Größere erzählende Gedichte. Anhang. Zwei religiöse Gedichte aus dem Nachlaß (Das kananäische Weiblein; Die ächzende Kreatur). Stuttgart, Berlin 1898.
3Die Bibel. Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, Römer 8,22.
4Dieses Datum rekonstruiert die Hist.-krit. Ausgabe, Band IV, 2, S. 657.~ 2 ~