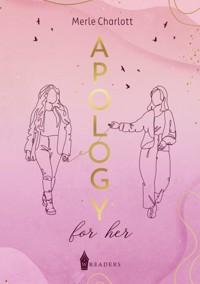
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ember und Sutton lernen sich durch einen Zufall kennen. Doch diese zufällige Begegnung am Bahnhof von Amherst wird sie für immer miteinander verbinden. Während Sutton sich ihrer Sexualität sehr sicher ist und in einem unterstützenden Umfeld groß wurde, ist Ember in ihren antrainierten heteronormativen Strukturen gefangen. Sie wehrt sich gegen die Gefühle, die sie für Sutton entwickelt. Weil sie sich nicht von der Seele reden kann, schreibt sie sie auf. Ihre Gefühle in Worte gefasst bilden eine Vielzahl an Gedichten, die sie Sutton nicht nur widmnen, sondern auch lesen lassen wird. Doch Embers Worte sind vernichtend und die Ablehnung, die Sutton dadurch erfährt, treibt sie in die Arme eines Anderen. Ausgerechent an der Schulter von Embers älterem Bruder Arvin findet Sutton Halt und Zuspruch. Doch bald wird auch Sutton sich eingestehen müssen, dass sie Arvin nur so gerne küsst, weil seine Lippen sie an Ember erinnern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Triggerwarnung
Dieses Buch enthält Inhalte, die triggern könnten.
Diese sind: Mental Health Disorders, Tod, körperliche Gewalt, Homophobie, Alkohol- und Drogenmissbrauch.
Disclaimer
Die Autorin verwendet inklusive und gendergerechte Sprache.
WREADERS E-BOOK
Band 256
Dieser Titel ist auch als Taschenbuch erschienen
Copyright © 2025 by Wreaders Verlag, Sassenberg
Verlagsleitung: Lena Weinert
Umschlaggestaltung: Jessica Rose
Lektorat: Stefanie Wallintin, Annalena Rauh, Barbara Dier
Satz: Ryvie Fux
www.wreaders.de
Für Oma Emma.
Ich wünschte, du könntest dieses Buch in deinen Händen halten.
Für Julia-Marie, die jede meiner Geschichten als Erste lesen darf. Für all diejenigen, die an gebrochenen Herzen leiden. In Erinnerung an die Liebe von Emily Dickinson und Susan Huntington Gilbert Dickinson.
Dear Her.
This.
This is an
apology for you.
This.
This is an
apology for us.
This.
This is a
dedication that
should have never been written.
But here it is.
This.
Story.
This.
Opening Verse.
This …
Dear Her.
This.
This is an apology
for – me.
© 01/2023 Merle Charlott
Her Playlist
ivy – Taylor Swift
Silk Chiffon – MUNA, Phoebe Bridgers
Paint My Bedroom Black – Holly Humberstone
Colorado – Reneé Rapp
Good Luck, Babe! – Chappell Roan
BIRDS OF A FEATHER – Billie Eilish
your house, my house – philine
Robbers – The 1975
Iris – The Goo Goo Dolls
Bette Davis Eyes – BOY
The Tortured Poets Department – Taylor Swift
Lucky – Dermot Kennedy
True Colors – Cyndi Lauper
Part Of The Band – The 1975
A Change of Heart – The 1975
Dress – Taylor Swift
Eat Your Young – Hozier
Any Love – Dermot Kennedy
Bring Me Home – G Flip
All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) – Taylor Swift
Better Days – Dermot Kennedy
About You – The 1975
this is how you fall in love – Jeremy Zucker, Chelsea Cutler
tolerate it – Taylor Swift
The Smallest Man Who Ever Lived – Taylor Swift
emily– Jeremy Zucker, Chelsea Cutler
Prolog
»He forgot – and I – remembered –
’Twas an everyday affair –«
– Emily Dickinson, 1860
Ember
Rational betrachtet war Sue Gilbert die Liebe schon immer suspekt. Allein der Gedanke zu lieben erschien ihr als nicht nachvollziehbar. Zu komplex. Zu undurchsichtig. Zu unerforscht. Zu unkontrollierbar. Oder aber moralisch nicht besonders förderlich, wie der deutsche Philosoph Immanuel Kant wohl sagen würde.
Er behauptete einst, dass die Liebe eine Sache der Empfindung, nicht des Wollens sei. Man könne nicht lieben, weil man es will, noch weniger aber, weil man es soll.
Praktisch gesehen hatte sich Sue also in die Vorstellung verliebt, von einem Mann begehrt zu werden.
Begierde und Liebe waren für sie zwei grundlegend verschiedene Dinge. Ihr Verlangen nach Begierde folgte einem logischen Konzept. Einem logischen, aber ziemlich selbstsüchtigen Konzept. Es ging darum, gewollt zu werden. Denn wo ihr die Liebe vergänglich erschien, überdauerte stets ihr Wille nach Begierde. Aber jeder Wille ließe sich früher oder später brechen. Selbst der Eisernste unter ihnen diente nur dem Zweck, die Wahrheit zu verschleiern.
Sue war unfähig, Austin Dickinson zu lieben. Er hingegen hatte es noch nicht einmal versucht. Er liebte lediglich die Idee von ihr und dem Leben, welches er sich für sie beide ausgemalt hatte. Sue genoss es, von ihm gewollt zu werden, weil sie es nicht ertrug, sich von seiner Schwester Emily lieben zu lassen.
Rational betrachtet war Emily Dickinson die Liebe schon immer suspekt. Allein der Gedanke, zu lieben, erschien ihr als nicht nachvollziehbar. Und wo sie mit ihren Gefühlen an Grenzen stieß, fand sie in der Poesie einen Ausweg.
Emily war unfähig, Sue ehrlich und aufrichtig zu lieben, aber sie hatte es verzweifelt versucht.
Rational betrachtet war Austin Dickinson die Liebe schon immer gleichgültig. Und wo er mit seiner Impulsivität an Grenzen stieß, versteckte er sich hinter den Worten seiner Schwester.
Irrational betrachtet war mir die Liebe schon immer zu gewöhnlich. Allein der Gedanke zu lieben erschien mir als schwach und erbärmlich. Ich hielt mich für zu klug und belesen, um auf so etwas Banales wie Gefühle hereinzufallen. Doch meine kühle Fassade konnte mich nicht ewig vor der Wahrheit schützen und so wurde ich wider Willen zur Autorin meiner eigenen Liebesgeschichte.
Act 1
The poet & her Muse
»But Susan is
a Stranger yet –«
– Emily Dickinson, late 1870s
Kapitel 1
»’Thank you’ ebbs – between us«
– Emily Dickinson, early 1880s
Ember
Ich war der festen Überzeugung, dass alles im Leben einem bestimmten Zweck diente. Nichts geschah ohne Grund. Zufälle gab es nicht. Ich schrieb jedem meiner Gedanken und jeder meiner Handlungen den tieferen Sinn zu, mich in irgendeiner Form zu bereichern. Zufälle würden diese These widerlegen. Dass auch Zufälle dazu in der Lage waren, mich zu bereichern, hielt ich für ausgeschlossen.
Liebe auf den ersten Blick war in etwa so wahrscheinlich, wie von einem Blitz getroffen zu werden. Zufall, wenn man es so nennen wollte. Mir sei nachzusehen, dass ich mich Banalitäten wie diesen versagte, obwohl ich mich der Literatur verschrieben hatte. Einem Ort, an dem Liebe auf den ersten Blick so wahrscheinlich war wie die angemessene Verspätung eines Regionalzuges.
Der Tag, an dem eine zufällige Begegnung meine Sicht auf die Dinge grundlegend veränderte, begann wie jeder zuvor. Da ich bis tief in die Nacht geschrieben hatte, musste ich gegen elf von meiner Mutter geweckt werden. Eigentlich war es nicht meine Art, den halben Morgen mit so etwas Überbewertetem wie Schlaf zu vergeuden. Dennoch würde ich mich nicht als Frühaufsteherin bezeichnen; dafür waren meine spontanen Schreibnächte zu unberechenbar. Zudem kaum vorherzusehen, da sie stark von meiner Inspiration abhängig waren. Und die kam und ging, wie es ihr beliebte.
Die Semesterferien waren wie im Flug vergangen. Mir blieben noch sechs Tage, um ein Essay über Shakespeares versteckten, modernen Feminismus zu verfassen. Ich hatte nicht einmal mit der Recherche begonnen. Lästige oder gar wichtige Dinge aufzuschieben, war eine meiner schlechtesten Eigenschaften. Von meinem ungesunden Egoismus und der abschreckenden Arroganz ganz abgesehen, wie mein Bruder behaupten würde. Er verwechselte meine observierende Verschwiegenheit und meinen trockenen, leicht schwarzen Humor mit Desinteresse und Überheblichkeit. Eine Sympathieträgerin war ich seiner Meinung nach nicht gerade. Doch das hatten fremdernannte Einzelgängerinnen wie mein großes Vorbild Emily Dickinson wohl so an sich. Sie war Dichterin und ich eine Literaturstudentin, die ein wenig zu viel in ihre Werke hineininterpretierte.
An dieser Stelle sei zu erwähnen, dass ich beim Erzählen dazu neigte, vom Wesentlichen abzuschweifen. Ich hoffe, ihr, als die Lesenden meiner Geschichte, seht es mir nach. Meine gelegentlichen Gedankensprünge waren meiner ärztlich anerkannten Konzentrationsschwäche geschuldet. Ebenfalls eine Erklärung dafür, warum ich lästige Dinge oft vor mir herschob und erst auf den letzten Drücker erledigte.
Meine Mutter hatte mich also bereits letzte Woche darum gebeten, meine Tante heute Mittag vom Bahnhof abzuholen. Noch so eine unerfreuliche Sache, die ich gerne um ein paar weitere Stunden aufgeschoben hätte.
Tante Lorna war – gelinde ausgedrückt – etwas exzentrisch. Aber das behaupteten die Leute auch über mich. Sie hatte die letzten sechs Monate in New York verbracht. Im Auftrag des klassischen Surrealismus. Lorna war Galeristin. Obwohl man meinen könnte, dass wir aufgrund unserer kreativen Ader etwas gemeinsam hatten, sprachen wir seit Jahren kaum miteinander. Wann genau sich dies änderte, war mir rückblickend nicht mehr ganz so klar. Die Übergänge waren beinahe fließend. Warum, das hatte zu diesem Zeitpunkt jedoch noch keine inhaltliche Relevanz. Ich käme sicher zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurück, wenn ich wieder einmal dazu neigte, mich in meinen Gedanken zu verlieren und vom Thema abzuschweifen.
Ähnlich wie Tante Lorna war ich das schwarze Schaf der Familie, auch wenn ich eher der Typ für Beigetöne war. Ich versagte in allem, was in meiner Familie von grundlegender Bedeutung war. Insbesondere dem Ansehen und dem Reichtum. Aus Geld machte ich mir nichts. Heuchlerisch von mir, dies zu behaupten, hatte ich mich schließlich auch nie beschwert, so wohlbehütet aufgewachsen zu sein. Doch wie in jeder Familie gab es auch in unserer Dinge, die weniger glanzvoll waren. Dinge, die man lieber vor der Öffentlichkeit versteckt hielt.
Während meine Mutter mich von einem Therapeuten zur nächsten Psychologin schleppte, um herauszufinden, was nicht mit mir stimmte, war mein Vater ausschließlich darauf bedacht, jeden meiner ärztlichen Termine unter Verschluss zu halten. Es geschah nur hinter den zugezogenen Türen des düsteren Palastes, in dem wir wohnten. Dort, wo aus einem Zuhause ein Ort wurde, der mich in Unsicherheiten hüllte, die bis heute geblieben waren.
Ich rebellierte, lautstärker, als es ihm lieb war. Also schickte er mich bis zum Junior Year der Highschool auf ein Mädcheninternat nach Schottland. An einen Ort, wo man mir vergeblich Zucht, Ordnung und Benehmen einzuprügeln versuchte. Das Resultat? Ich rebellierte deutlich schweigsamer, aber umso wirkungsvoller. Etwas, das ich von Lorna kopiert hatte.
Meine jüngere Schwester Lavender ähnelte unserer Mutter mehr, als ihr eigenes Spiegelbild es tat. Wir entfremdeten uns schneller, als es uns lieb war. Genau, wie es bei Mom und Lorna der Fall war.
Lavender sah zudem aus wie unsere Mutter. Blond, groß gewachsen, fraulicher, kurviger Körper, stahlblaue Augen. Jede:r in der Stadt wandte sich nach ihr um. Nach ihrer Art der oberflächlichen Schönheit, die man als Fluch und Segen zugleich bezeichnen könnte.
Sie hätte jede:n haben können, wenn sie gewollt hätte. Aber Lavender wollte nur den einen, der sie nicht wollte. Während mich niemand interessierte. Was Mom missfiel. Lebten wir im neunzehnten Jahrhundert, so hätte sie mich sicher an den Erstbesten verheiratet, nur um mich aus dem Haus zu kriegen. Doch so wie Emily Dickinson beschloss ich, dass ich nichts vom Heiraten hielt, und lebte abstinent. Das Schreiben war der unsichtbare Ehering an meinem Finger.
Und so wie Emily Dickinson hatte man mich nach unserer Mutter benannt, weil ich die Ältere von zwei Schwestern war. Elizabeth. Ember Elizabeth. Für Tante Lorna war ich eine lange Zeit immer nur Emmi gewesen. Für meinen Bruder und meine Schwester war ich Ems. Doch für meine Mutter war ich Ember Elizabeth. Aber der gleiche Name machte aus uns beim besten Willen nicht dieselbe Person. Moms Bestreben, für alle Welt die perfekte Vorzeigeehefrau zu mimen, erschien mir rückschrittlich und veraltet.
Vinnie – wie mein Bruder und ich das Nesthäkchen liebevoll tauften – hingegen träumte, seit sie klein war, von einer Hochzeit in Weiß und dem Augenblick, in dem ihr Mann am Abend von der Arbeit nach Hause kam, über die Schwelle trat und sie küssend in seine Arme schloss.
Wohingegen ich eine schriftstellerische Karriere anstrebte.
»Dafür müsstest du anderen schon zeigen, was du da eigentlich immer so schreibst«, hätte Vinnie jetzt gesagt. Ihr gelang es immer, in meinen Kopf hineinzusehen, obwohl ich meine Gedanken wie meine Gedichte eigentlich für andere unter Verschluss hielt.
Trotz unserer Entfremdung war sie der Mensch, der mir einst am nächsten gestanden hatte. Sie blieb weiterhin die Schwester, mit der ich tagein, tagaus Tür an Tür lebte. Eine Fremde im eigenen Zuhause oder aber eine alte, Freundin aus Kindheitstagen, mit der man nur noch selten sprach.
Als wir uns an diesem Vormittag auf dem Flur begegneten, schüttelte sie nur den Kopf. Durch meine halb geöffnete Zimmertür konnte sie die unzähligen losen Blätter sehen, die ich in dieser Nacht mit Worten gefüllt hatte.
»Poesie ernährt sich von ihrer Leserschaft«, meinte sie und stolzierte die Treppe hinunter. Ihre beiden Kater Thomas und Edward folgten ihr bei Fuß, wie es sonst nur Hunde taten.
Es waren nur zwei ihrer insgesamt vier Katzen. Ich war eher ein Hundemensch, aber Katzen liebten mich. Manchmal überkam mich das Gefühl, Vinnie und ich hatten nichts gemeinsam. Doch wenn ich hörte, wie sie unten am Klavier einem von Taylor Swifts zahlreichen Songs ihre eigene Note aufdrückte, fühlte ich mich ihr gleich viel näher. Musik war das, was uns immer verbunden hatte. Wir verloren uns auf die gleiche, hoffnungslose Weise in den Geschichten, die Taylor in ihren Liedern erzählte. Denn Poesie fand sich nicht nur auf den Seiten eines Buches wieder.
Auf die Worte meiner Schwester resignierte ich jedoch stummschweigend. Ich wollte ihr nicht widersprechen, obwohl ich es anders sah: Poesie ernährte sich nicht von ihrer Leserschaft, sondern von Leid, Schmerz, Liebe und Freude. Kurzum, Emotionen waren das, was Gedichte erst zum Leben erweckte. Ohne Emotionen waren Gedichte nur leere Worte auf einem nicht mehr ganz so ungefüllten Blatt Papier.
Doch in meiner Familie dachte man eher praktisch, anstatt sich von seiner Intuition leiten zu lassen.
Mein älterer Bruder Arvin war eine jüngere Version unseres Vaters. Er trat beruflich in seine Fußstapfen. Studierte Jura in der Hoffnung, unserem guten Namen alle Ehre zu machen. Dafür schaute er jedoch eindeutig vor ganz Amherst zu oft zu tief ins Glas.
Es lag mir fern, über den erschreckend auffälligen Alkoholismus meines Bruders zu urteilen, doch es war schwer, es nicht zu tun. Ich hatte nichts dafür übrig, ihm dabei zuzusehen, wie er sich selbst zerstörte. Welchen Zweck hätte es, die Tatsache, welche tiefgreifenden, persönlichen Probleme wohl dahinterstecken mochten, einfach wegzuignorieren. Ich konnte auch nicht länger die Augen davor verschließen. Arvin litt unter unserem herrischen Vater so, wie ich es tat. Ähnlich, aber anders waren wir doch gleichermaßen eine Enttäuschung für ihn. Unsere kleine Schwester, das Vorzeigekind. Wir, die immer nur Probleme machten. Er, der sich prügelte und in Klausuren betrog, obwohl er es nicht nötig hatte. Ich, verhaltensauffällig und einsiedlerisch. Letzteres verwuchs sich mit dem Alter. Meine ersten Freundschaften schloss ich erst mit dem Beginn meines Studiums vor ein paar Jahren.
Man sagte mir weiterhin nach, dass ich ausnahmslos in meinem Kopf lebte. Eine Behauptung, die ich grundsätzlich nicht verneinen würde. Ich ließ nur ausgewählte Menschen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Das Drehbuch samt all seinen Regieanweisungen hielt ich jedoch unter Verschluss. Die wenigen Bezugspersonen in meinem Leben waren Statist:innen. Statist:innen, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, eines Tages als Nebenfiguren bei der Hauptaufführung besetzt zu werden. Aber ich feilte immer noch an der Generalprobe.
Manchmal ließ ich mich so sehr in meine Gedanken verstricken, dass ich völlig das Gefühl für Raum und Zeit verlor. Die Welt um mich herum schien stehenzubleiben, obwohl sie sich für andere weiterdrehte.
Das Leben, wie John Lennon einst behauptete, war nun einmal das, was geschah, während wir dabei waren, Pläne zu schmieden. Deshalb sah ich davon ab, Tage mit einem bestimmten Ziel zu beginnen.
Als auf dem Weg zum Bahnhof ein Krankenwagen an mir vorbeirauschte, kam ich nicht umhin, mich zu fragen, wessen Pläne gerade aus den Fugen gerieten, weil das Leben einfach passiert war.
Ich hatte keine Ehrfurcht vor dem Tod. Für andere unverständlich, aber wenn er irgendwann vor meiner Tür stünde, würde ich ihn wie einen guten alten Freund begrüßen. Mein Therapeut Dr. Novak schrieb Gedanken wie diesen meinen tiefgreifenden und stetig aufkommenden Depressionen in die Schuhe. Er hatte nicht unrecht, aber ich würde ihm dies gegenüber nie zugeben. Am Gleis angekommen spürte ich die Anwesenheit des Todes in Form einer kühlen Brise, die mir durchs Haar wehte. Er blieb nicht lange, musste gleich schon wieder los, war nur auf dem Sprung. So wie das bei guten alten Bekannten eben der Fall war. Man grüßte sich flüchtig, wenn man sich – zufällig – auf der Straße begegnete.
Der Zug aus New York hatte Verspätung. Es herrschte eine angespannte Unruhe. Die allgemeine Unzufriedenheit der Wartenden ließ sich an ihren starren Mienen ablesen. Ich vermied es, mit irgendjemandem Augenkontakt aufzunehmen, und senkte meinen Blick.
Auf dem Boden lag – einsam und verlassen – ein noch viel zu sauberes, beinahe unberührtes, weißes Schild mit einem halben Schuhabdruck darauf. Daneben ruhte ein nahezu unversehrtes Blumenbouquet aus Klatschmohn. Ihm wurde eine düstere Bedeutung zugesprochen. Ein ziemlich außergewöhnliches Begrüßungsgeschenk. Vielleicht völlig irrtümlich gewählt oder aber es waren jemandes Lieblingsblumen. Jemandes. Als ich die Blumen und das Schild aufhob und Letzteres umdrehte, stand darauf nur ein Name. Sutton.
Ich kannte niemanden mit dem Namen Sutton. Irgendetwas verleitete mich jedoch dazu, mir vorzustellen, wer Sutton war. Es musste eine Frau sein. Ich wollte, dass es eine Frau war. Denn die Geschichte, die ich mir bereits in meinem Kopf zusammenreimte, verlor mit der Besetzung eines männlichen Protagonisten an Ästhetik. Eine Frau, die am Bahnhof vergessen wurde, ließ sich zudem besser vermarkten. Es war auf eine sehr ehrliche Weise mitleiderregend.
Das Schild und die Wahl der Blumen ließen viele Fragen offen, nicht zuletzt die Frage danach, wer beides einfach so achtlos fallen ließ und warum. Was mich jedoch viel brennender interessierte, war, was die Unbekannte nach Amherst brachte. Kam sie zum Studieren her? War sie überhaupt in meinem Alter? Blieb sie nur übers Wochenende zu Besuch? Und wen würde sie hier treffen? Was mich zu meiner Ausgangsfrage zurückbrachte: Wer sollte sie abholen und was hatte dazu geführt, dass das Schild mit ihrem Namen auf dem Boden gelandet war?
Die Szene hatte etwas unscheinbar Schauriges an sich und ich hatte eine – für viele nicht nachvollziehbare – Faszination für kaputte und traurige Dinge. Ich konnte einfach nicht wegsehen, musste mich fragen, was geschehen war. Die Autorin in mir war geweckt worden. Die Autorin in mir brachte mich zum Handeln. Es war eine Angelegenheit, die nicht darum bat, dass ich mich einmischte, und trotzdem tat ich es. In einem der vielen Achtsamkeitsbücher, die meine Schwester reihenweise verschlang und mir danach als unausgesprochenen Seitenhieb vor die Tür legte, las ich, dass man mindestens eine Sache am Tag tun sollte, die einen mit Angst erfüllte. Die Erleichterung, wenn man schließlich erkannte, dass das Resultat der Furcht überwog, würde letztlich in einem Gefühl von Stolz münden.
Die Autorin in mir besaß deutlich mehr Mut, etwas zu tun, was mich mit Angst erfüllte. Sie witterte eine gute Geschichte und war bereit, mich dafür ans Messer meines Schamgefühls zu liefern.
Zögernd holte ich mein Notizbuch und einen Stift aus meinem Rucksack hervor. In der Befürchtung, dass Sutton im anfahrenden Zug saß und gleich nach jemandem Ausschau hielt, der sie nicht mehr abholen könnte, schrieb ich ihren Namen auf ein leeres Blatt Papier. Ich wollte sichergehen, dass jemand bei ihrer Ankunft auf sie wartete. Selbst, wenn ich eine Fremde war.
Tante Lorna war jedes Mal die Letzte, die einen Zug verließ. Sie nahm sich die Zeit, all ihre Sachen zusammenzupacken, und verabschiedete sich noch vom Personal. Sutton, im Gegensatz, war eine der Ersten, die ausstieg. Ich erkannte sie direkt, auch wenn ich sie noch nie zuvor gesehen hatte, denn sie war die Einzige, die sich suchend umsah.
Als sie die Person, die sie eigentlich abholen sollte, nirgends entdeckte, trafen sich unsere Blicke. Um ihr die Panik davor zu nehmen, vergessen worden zu sein, war ich auf eine der Bänke gestiegen und rief ihren Namen, während ich mein Notizbuch in die Höhe hielt. Überwand die Angst, mit der mich das erfüllte, und überhörte mein wild pochendes Herz, welches sich vor Nervosität beinahe überschlug.
Skeptisch lief sie auf mich zu und reichte mir ihre Hand, um mir von der Bank zu helfen.
Ich fühlte mich wie im Film oder direkt in einen Fiebertraum hineinkatapultiert. Das hier hatte etwas von diesem sagenumwobenen Moment, in dem der unwahrscheinliche Zufall von Liebe auf den ersten Blick eintrat.
Unsere Hände nahmen sich einer längst erzählten Geschichte an und die Autorin in mir begann bereits damit, diese umzuschreiben.
Die Protagonistinnen der Gegenwart hörten auf die Namen Sutton und Ember, in der Vergangenheit jedoch nannte man sie Emily und Sue.
»Ich hatte meine Schwester irgendwie anders in Erinnerung«, scherzte Sutton, um die leicht angespannte Situation aufzulockern. Ich konnte den dezent besorgten Unterton in ihrer Stimme jedoch nicht überhören.
»Hi.« In meiner Verzweiflung darüber, ihr nicht die Antworten geben zu können, nach denen sie suchte, lächelte ich verlegen und schnappte mir das Blumenbouquet. »Ich bin Ember.«
»Sutton«, stellte auch sie sich vor. »Aber das weißt du ja bereits.«
Sie nahm mir den Klatschmohn ab. Ihr Blick verriet, dass sie wusste, dass die Blumen nicht von mir waren. Jemand anderes hatte angenommen, dass sich ihr Geschmack in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert hatte.
Sutton wirkte älter, als sie war; ich schätzte sie auf Anfang zwanzig. Sie war etwas kleiner als ich, kaum bemerkbar für andere. Ihre kürzeren, kastanienbraunen Haare fielen ihr in Wellen bis auf die Schultern hinunter. Sutton war individuell gekleidet; die Großstadt hatte ihre Einflüsse hinterlassen. Sie kombinierte eine helle Bluejeans und ein ausgewaschenes Pink Floyd-Shirt zu einem karierten, oversized Blazer. Aus dem Jutebeutel, den sie über der Schulter trug, blitzte ein bunt gemusterter Strickpullover hervor, den sie mit Sicherheit secondhandgeshoppt hatte.
Sutton war nur leicht geschminkt und ihre Augenringe verrieten, dass sie seit Tagen kaum geschlafen oder viel geweint hatte.
»Tut mir leid, dass ich nicht die bin, mit der du gerechnet hast.« Ich suchte vergebens nach einer unangenehmen, anfänglichen Distanz zwischen uns. Stattdessen fand ich mich nur in diesem allgegenwärtigen Gefühl von Dankbarkeit wieder. Ein weiterer Blick in ihre Augen verriet sie. Sutton würde es nicht aussprechen, aber sie war froh darüber, dass ich beschlossen hatte, auf sie zu warten.
Sie war offener, als ich es vorgab zu sein. Irgendetwas an ihr erinnerte mich an die ruhige, urbane Coverversion eines sonst so schnellen und schrillen Achtzigerjahre-Popsongs.
»Also, Ember, darf ich dich für deinen exklusiven Abholservice auf einen Kaffee einladen?«
»Gern.« Ich ließ mein Notizbuch wieder in meinem Rucksack verschwinden. »Die Straße runter gibt es ein …«
Mit stockender Stimme hielt ich mich davon ab, weiterzusprechen. Ein flüchtiger Blick auf die Blumen in ihrer Hand erinnerte mich daran, dass ich gar nicht hier war, um Sutton vom Bahnhof abzuholen, sondern eigentlich auf meine Tante wartete. Was wiederholt die Frage aufbrachte, warum Sutton versetzt worden war.
Es war eine Art Intuition, die mich genau in diesem Augenblick an den Krankenwagen denken ließ, der auf dem Hinweg an mir vorbeigerauscht war.
»Vielleicht solltest du zunächst deine Schwester anrufen und fragen, ob alles okay ist«, legte ich Sutton nahe.
Sie ächzte und wirkte von meiner Aussage genervt. »Meine Schwester war schon früher nie die Zuverlässigste. Aber ja … ich sollte mich wohl mal bei ihr melden.«
Es kam mir falsch vor, ihr nichts von dem Krankenwagen zu erzählen, aber ich wollte Sutton auch nicht unnötig beunruhigen. Vielleicht bestand zwischen dem Nicht-Auftauchen ihrer Schwester und dem Notfalltransporter gar kein Zusammenhang.
»Entschuldige mich bitte kurz.« Sie zog ihr Smartphone aus der vorderen Hosentasche, um einen prüfenden Blick darauf zu werfen. »Lass mich nur kurz –«
»Ember Elizabeth Dawson!« Tante Lorna fiel Sutton ins Wort. »Wirst du mir gefälligst mit meinen Koffern helfen!«
Mit gerunzelter Stirn drehte Sutton sich zu Lorna um. »Entschuldigen Sie bitte, aber geht das vielleicht auch etwas freundlicher?«
»Ach, sieh an! Die freche New Yorkerin, die mir meinen Platz geklaut hat.« Lorna verschränkte die Arme demonstrativ vor der Brust.
»Ich habe Ihnen nicht Ihren Platz geklaut, Ma’am. Es muss eine Doppelbuchung gegeben haben«, versuchte Sutton meine Tante zu beruhigen. Doch mit Logik kam man bei Lorna nicht weit. Für sie gab es nur Richtig oder Falsch – kein Dazwischen.
»Hast du Mom etwas aus Manhattan mitgebracht?« Schnell wechselte ich das Thema. »Sie geht zumindest davon aus und …«
»Ember Elizabeth, kennst du diese unverschämte Person etwa?«, unterbrach meine Tante mich harsch. Lorna hatte sich auf Sutton eingeschossen. Dass diese sich dadurch sichtlich unwohl fühlte, war ihr gänzlich egal. Es interessierte sie nicht, was die Unbekannte nach Amherst gebracht hatte und ob sie vielleicht sogar versetzt worden war.
»Du bist manchmal so vergesslich, Tantchen.« Ich schüttelte lachend den Kopf. »Das ist Susie, meine beste Freundin. Wir kennen uns aus dem Internat.«
Ich hatte den Namen »Susie« vor ein paar Wochen in einem Antiquitätenladen aufgeschnappt. Die Besitzerin hatte mir von ihrer Schwester erzählt, die sie lange nicht mehr gesehen hatte und die sie bald besuchen kommen wollte. Wenn ich genauer hinsah, dann hatte Sutton sogar eine gewisse Ähnlichkeit mit Hunter Grey-Jensen. Sie hatten die gleichen feinen, beinahe wie gemalten Gesichtszüge.
Lorna kniff unterdessen verbissen die Augen zusammen. »Wie auch immer. Dann werde ich mir wohl ein Taxi nehmen müssen. Mit deiner Freundin Susie setze ich mich jedenfalls nicht mehr in ein und dasselbe Fortbewegungsmittel. Wir sehen uns nachher.« Schmallippig raffte sie ihr Gepäck. »Ich bin entsetzt von deiner Achtlosigkeit.«
Dabei war sie selbst eine Meisterin in Achtlosigkeit oder darin, ihre Umgebung nahezu vollständig zu ignorieren. Für Lorna drehte sich die Welt lediglich um sie selbst. Sie war ihr ganz eigener, persönlicher Lebensmittelpunkt. Eine Art der Selbstliebe, die mir nur zu einem gewissen Grad nachvollziehbar erschien. Höchstwahrscheinlich war es letztlich nicht mehr als ein sehr hoher, dorniger Schutzwall.
»Ember Elizabeth Dawson: Eine Enttäuschung auf ganzer Linie. Die Schande der Familie. Unverschämt, selbstsüchtig und alles andere als gehorsam. Stets zu Ihren Diensten. Hoch erfreut!« Ich verdrehte die Augen und sah Lorna dabei zu, wie sie mit ihrem sperrigen Koffer Richtung Ausgang verschwand.
Auch nach all den Jahren, in denen wir kaum miteinander gesprochen hatten, waren wir uns noch viel zu ähnlich. Sie, die Rebellin der Familie, und ihre Schwester, die gehorsame Vorzeigetochter. Was ich sagte, traf sie genau dort, wo es eine jede Person am meisten schmerzte: in ihrem Ego.
Eine Diskussion mit Lorna führte meist ins Leere und war unmöglich zu gewinnen. Sie war stur und eigensinnig. Wenn sie sich ein Taxi nehmen wollte, dann würde ich sie nicht aufhalten. Ich hatte sowieso keine Lust, mir während der gesamten Rückfahrt anzuhören, wie einfältig und unkultiviert die Einwohner Amhersts gegenüber Großstädtern waren. Fraglich, warum sie nicht einfach in New York geblieben war.
Lorna beschrieb sich gerne als rastlos. Ihre Heimat war immer dort, wo sie sich gerade befand. Ihr Arbeitsplatz bewegte sich mit ihr mit. Doch jeder ihrer Wege führte letztlich hierher zurück. Nach Amherst. Zwar behauptete sie, dass sie kein großer Familienmensch war, und dennoch – wahrscheinlich, weil sie diese Art von Tortur als Kunst verstand – lebte sie noch immer in dem Anwesen, in welchem sie einst aufgewachsen war. Northhill. Der Palast hoch oben auf dem Hügel, am nördlichsten Punkt der Stadt. Der Palast, in dem auch ich zeit meines bisherigen Lebens nur ein Gefängnis gesehen hatte. Damals wie heute war jeder Fluchtversuch zwecklos und glich einer Farce. Die Pforte gut bewacht vom engstirnigen Hausherrn.
Für Tante Lorna gab es nur einen Ort in Amherst, an dem sie sich wirklich zu Hause fühlte: Ihr Atelier, welches sie im hinteren Teil unseres Hauses eingerichtet hatte. Regelmäßig veranstaltete sie dort Vernissagen. Meistens ging sie auf Geschäftsreisen und kaufte Kunstwerke ein, die Northhill erst erreichten, wenn sie längst wieder unterwegs war.
Eigentlich hatte sie sich dem Surrealismus verschrieben. Ihr Lieblingsmaler aber war Claude Monet, dessen Schaffensperiode dem Impressionismus zugeordnet wird. Sein häufiger Bruch mit Farben und die Lebendigkeit seiner Werke hatten irgendetwas in Lorna ausgelöst, das sie dazu verleitet hatte, sich einen Pixiecut schneiden und die Haare platinblond färben zu lassen und sich weitaus jünger zu geben, als sie tatsächlich war.
Zweiundfünfzig. Doch wenn sie jemand nach ihrem wahren Alter fragte, dann antwortete sie mit einem koketten »Was schätzen Sie denn?« Vierunddreißig, das war die Lüge, mit der die Leute ihr Honig ums Maul schmierten.
»Du musst meine Tante entschuldigen, sie ist etwas …« Weil ich Sutton keine Rechtfertigung für Lornas Verhalten geben wollte, ließ ich die mir zurechtgelegten Worte wieder fallen. Sie hatte heute einfach wieder einen dieser Tage, an denen sie einen Sündenbock benötigte. Ein Ventil für ihre sprunghaften Launen.
»Exzentrisch?«, beendete Sutton meinen Satz. »Ja, das ist mir auf der Zugfahrt bereits aufgefallen.«
Ich wollte gar nicht wissen, was sie getan hatte, das Suttons Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Von der Tatsache, dass sie sich mit ihr um einen Platz gestritten hatte, mal ganz abgesehen.
»Also …« Sutton schickte noch kurz eine Nachricht an ihre Schwester, dann ließ sie ihr Smartphone wieder verschwinden. »… wohin darf ich dich denn nun auf einen Kaffee einladen?«
Es war nur eine Vermutung, doch die Tatsache, dass Sutton so ruhig auf das Nichterscheinen ihrer Schwester reagierte, ließ darauf schließen, dass ihre Beziehung zueinander kompliziert sein musste. Wenn ich mir vorstellte, Vinnie wäre nicht aufgetaucht, würde ich wissen wollen, ob ihr nicht womöglich etwas passiert war.
»Auf dem Hinweg hierher ist ein Krankenwagen an mir vorbeigefahren«, platzte es schließlich ungefiltert aus mir heraus. Etwas, das mir öfter passierte und mir besonders während meiner Schulzeit einige Stunden Nachsitzen einbrachte.
»Wie bitte?« Dementsprechend verwirrt reagierte Sutton.
»Tut mir leid.« Soziale Interaktionen lagen mir einfach nicht. »Wahrscheinlich besteht keinerlei Verbindung zu deiner Schwester, aber es kam mir gerade einfach in den Sinn.«
Sutton nickte verstehend und griff mit einem nun doch leicht besorgten Blick erneut nach ihrem Smartphone und versuchte vergeblich ihre Schwester zu erreichen. Gleich danach wählte sie die Nummer ihres Schwagers, doch auch damit hatte sie keinen Erfolg.
»Ich bin mit dem Auto hier. Ich könnte dich fahren, wohin auch immer du willst.« Ich wies mit einem Kopfneigen in die Richtung, in die Lorna vorhin abgezischt war.
»Was tust du, wenn du nicht weiterweißt?«, wollte Sutton daraufhin von mir wissen.
»Dann … schreibe ich«, ließ ich sie zögerlich wissen. Es hörte sich mehr wie ein Geständnis an.
»Du schreibst?« Sutton wirkte nicht so überrascht, wie es ihr fragender Unterton vermuten ließ. »Das dachte ich mir schon.«
Stirnrunzelnd ging ich in Richtung des Parkplatzes voraus. »Das dachtest du dir schon?«
»Deine Hände.« Sutton sah an mir hinunter.
Ich war nicht etwa altmodisch und schrieb mit Feder und Tinte. Mir gelang es nur, mich auch mit einem Kugelschreiber regelmäßig zu beschmieren.
»Ja. Ich schreibe«, entgegnete ich ihr zögerlich.
»Was denn so?« Sie lächelte. Gezwungen, aber sie lächelte.
Das hatte mich noch nie jemand gefragt. Nicht einmal Vinnie. Sie nahm aus Prinzip an, dass ich kitschige Liebesbekundungen über Männer aus meinem Literaturkurs schrieb. Womit sie nicht weiter von dem hätte entfernt liegen können, was ich tatsächlich zu Papier brachte.
»Gedichte«, ließ ich sie wissen. »Ich schreibe Gedichte.«
Es laut auszusprechen, machte es zu einer realen, nicht umkehrbaren Tatsache. Ich schrieb Gedichte. Ich war eine Schriftstellerin. Ganz egal, ob das, was ich da Nacht für Nacht verfasste, von jemandem gelesen wurde.
»Und woher nimmst du deine Inspiration?« In Suttons Stimme lag ein unverkennbarer Unterton, doch mir fiel es schwer, diesen einzuordnen. »Meine Schwester hat früher einmal behauptet, dass das Leben immer noch die besten Geschichten schreiben würde. Ich hätte da ’ne Idee. Die Fremde, die man am Bahnhof vergaß.«
Sie versuchte, sich ihre Lockerheit zu bewahren, doch man hörte ihr an, dass sie sich langsam Sorgen machte.
»Ich fahre dich jetzt zum Haus deiner Schwester«, schlug ich ihr vor. »Kennst du die Adresse? Oder sollen wir vielleicht doch direkt ins …«
Ich kam nicht dazu, den Satz zu beenden. Das abrupte Klingeln und Vibrieren von Suttons Smartphone ließ mich verstummen. Das Geräusch war überraschend betäubend.
»Willem?« Sutton telefonierte offensichtlich mit jemandem, der in Verbindung zu ihrer Schwester stand. An der plötzlichen Veränderung ihres Gesichtsausdrucks ließ sich nur erahnen, welche Informationen man ihr gerade mitteilte. Sie wurde kreidebleich. Ihre Mimik versteinerte sich.
Vielleicht hatte Vinnie recht und Poesie wurde durch ihre Leserschaft lebendig. Doch erst eine Muse gab den Worten, von denen sich Schreibende inspirieren ließen, ihre Daseinsberechtigung.
Sutton war keine ausnahmslos zufällige Begegnung. Sutton war eine Geschichte, von der ich noch nicht ahnte, dass sie sich wie von selbst schriebe. Eine Geschichte, in der ich durchaus dazu neigte, sie aus vielen verschiedenen Sichtweisen zu erzählen. Meiner eigenen und der all jener, die daran beteiligt waren.
Denn Geschichten, auch die von zufälligen Begegnungen, gab man am besten wieder, indem man sie von allen Seiten beleuchtete.
Kapitel 2
»Because I could not stop for Death –
He kindly stopped for me –«
– Emily Dickinson, 1863
Ember
Der Tod war mein treuster Begleiter. Ich schrieb Abertausende von Gedichten über ihn. In meinem Kopf besuchte er mich beinahe jede Nacht. Unsere Gespräche waren relativ einseitig. Er sprach gern über seine Arbeit und ich war eine gute Zuhörerin.
Es stellte sich heraus, dass auch Sutton eine Beziehung zu ihm pflegte. Ihre jedoch war weitaus komplizierter.
»Meine Schwester hatte eine Totgeburt«, sagte sie monoton, nachdem sie das Telefonat mit ihrem Schwager beendet hatte.
Wir waren mittlerweile bei meinem Wagen angelangt. Ich hielt tatenlos die Schlüssel in der Hand und traute mich nicht, mich zu regen. Informationen wie diese konnte ich nur schwer verarbeiten. Ich schob sie an einem Ort in meinem Kopf, den ich nicht greifen konnte, und setzte gleichzeitig meinen Körper auf die Werkseinstellungen zurück.
»Sie stand schon am Bahnhof, als die Wehen einsetzten …«, murmelte Sutton und ließ ihr Smartphone wieder in der Hosentasche verschwinden.
Der schrille Klang der Sirenen des Krankenwagens, der auf dem Hinweg zum Bahnhof an mir vorbeigerauscht war, hallte in meinen Ohren wider. Erst das Klirren der Schlüssel, die mir aus den Fingern rutschten, ließ das Geräusch abebben.
»Fährst du mich ins Krankenhaus?« Sutton blickte mich fragend an und sah doch nur durch mich hindurch. »Bitte?«
Ich nickte und hob die Schlüssel auf.
Ja, der Tod war durchaus mein treuster Begleiter, doch nur Sutton kannte ihn persönlich.
Sutton
Ich hatte in der Vergangenheit mehr Zeit in Krankenhäusern als in der Universität verbracht. Mein Studium war zu einer lästigen Nebensache geworden. Das Leben eine qualvolle Herausforderung.
Amherst sollte einem Neustart gleichen. Doch New York und seine Geschehnisse verfolgten mich auf Schritt und Tritt. Wie ein Schatten; unnachgiebig und düster.
Meine neue Heimat zog wie in einem Film an mir vorbei. Wir passierten auf unserem Weg ein Café, welches am Fuße der Altstadt lag. Das Mary’s Crisis sprang mir allein wegen seines außergewöhnlichen Namens ins Auge. Es hatte seinen Platz zwischen einem alternativen Plattenladen und einem urigen Blumenshop gefunden. Direkt gegenüber befand sich der sonderbare Antiquitätenladen meiner Schwester. Hunter hatte mir erst vor ein paar Tagen ganz stolz ein Foto des Greyhouse geschickt. Ich erinnerte mich an die abgenutzte, rote, von der Sonne ganz ausgeblichene Markise, die nun nicht mehr ausgefahren war. Das Geschäft lag an einem vermeintlich friedlichen, frühlingshaften, aber leicht regnerischen Dienstag völlig verlassen da.
Während Ember mich zur Frauenklinik ins Cooley Dickinson fuhr, schwieg sie. Im Radio lief ein Song von Dermot Kennedy. Seine tiefe, kratzige Stimme untermalte die Stille. Er sang von besseren Zeiten, die noch kommen mochten, und ich hoffte inständig, ihm Glauben schenken zu können.
Ember schien sich das Auto mit jemandem zu teilen. Es war ein älteres Modell eines türkis-grauen Toyota Land Cruisers. Der Wagen sah aus, als wäre Ember damit zu schnell über nasse Landstraßen gefahren. Erde, Schlamm und Dreck beschmutzten die Außenverkleidung. Auf der Rückbank verweilte eine halb geöffnete Sporttasche; ein Lacrosse-Schläger und Feldturnschuhe lugten daraus hervor. Zu groß, als dass sie Ember passen könnten. In den Fächern der Beifahrertür fand ich einen Schlüsselbund und ein Namensschild des Second Chance-Tierheims, das Ember potenziellen Besuchenden als ehrenamtliche Helferin vorstellte. Sie hatte auf mich gleich wie jemand gewirkt, der lieber unter sich blieb und die Gesellschaft von Tieren gegenüber der von Menschen bevorzugte.
Mein Blick huschte von dem Duftbäumchen am Rückspiegel, das verdächtig nach Sandelholz roch, zum Radio zurück. Der Song war von der Radiostation längst gewechselt worden. Ein gleichbleibend ruhiger Hit der britischen Indie-Popband The 1975 erfüllte den Wagen mit quälender Sehnsucht und dem Gefühl des Vermissens. Als ich zu Ember hinübersah, konnte ich beobachten, wie sich ihre Lippen passend zum Text bewegten. Sie hatte einen guten Musikgeschmack.
Um nicht daran denken zu müssen, dass wir gerade auf dem Weg ins Krankenhaus waren, versuchte ich mich mit der banalen Frage abzulenken, ob jemand wie The 1975-Frontsänger Matty Healy der Typ Mensch war, den Ember als attraktiv empfand. Stand sie eher auf die emotional gebrochenen, künstlerischen Leute mit schwarz lackierten Fingernägeln oder suchte sie nach einer gradlinigen, mit beiden Beinen im Leben stehenden Person? Denn ich war sicher nicht Letztere.
Das erdrückende Schweigen, das sich zwischen uns aufgetan hatte, erschuf eine scheinbar unüberbrückbare Kluft. Ähnlich wie bei meiner Schwester und mir. Denn auch Hunter hatte bis vor Kurzem seit Jahren kein Wort mit mir gesprochen.
Sie hatte beschlossen, nicht einmal der Beerdigung unserer Tante beizuwohnen. Schickte lediglich einen Brief mit ihrer Beileidsbekundung, als wäre Sophia nur eine entfernte Verwandte. Doch für mich war sie wie eine Mutter gewesen.
Als mich zwei Monate nach ihrem Tod ein weiterer Brief meiner Schwester erreicht hatte, in dem sie mich bat, sie und ihren Ehemann Willem in Amherst zu besuchen, überraschte mich ausschließlich der Grund ihres Schreibens. Sie erwartete ihr erstes Kind und wünschte sich, dass ihre Tochter nicht mit dem Wissen aufwuchs, dass sich ihre Tante in New York verkroch, weil sie mit dem Rest der Familie nichts zu tun haben wollte.
Hunters Sicht auf die Dinge unterschied sich gravierend von meiner. Ich wusste jedoch auch nicht, wie ihr Leben ausgesehen hatte, bevor ich auf die Welt gekommen war. Wann und warum Tante Sophia Boston für Manhattan verlassen und Hunter zurückgelassen hatte, erzählte man mir aus mehreren verschiedenen Perspektiven. Ich entschied mich dafür, unserer Tante Glauben zu schenken, die bereits Jahre vor meiner Geburt versucht haben wollte Hunter zu sich zu holen.
Ich verließ New York also nicht, um längst verjährte Wunden familiärer Streitigkeiten wieder aufzureißen. Ich kam nach Amherst, da mich Sophias Krankenhausrechnungen und mein Studienkredit auf einen immer höher werdenden Schuldenberg klettern ließen.
Meine Tante hatte ein Loch im Herzen gehabt und mehrere Schlaganfälle erlitten. Ich beschloss, sie bis zu ihrem Tod zu pflegen. Doch meine Kräfte schwanden schnell. Ich war müde und konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Die Knie aufgerissen und mit Schürfwunden an den Händen, war ich zusammengesackt und hatte der Kapitulation meinen kleinen Finger gereicht.
»Wir sind da.« Ember hatte den Wagen bereits vor über geschlagenen fünf Minuten auf dem Besucherparkplatz des Cooley Dickinson abgestellt.
»Soll ich lieber sitzen bleiben oder doch mitkommen?«, wollte sie von mir wissen. Gemäß der Tatsache, dass sie eine völlig Fremde für mich war, eine berechtigte Frage.
Allerdings waren mir meine Schwester Hunter und mein Schwager Willem beinahe genauso unbekannt.
»Wenn es dir nichts ausmacht, dann …« Ich musste nicht mehr als das sagen.
Während ich mich abschnallte und zu ihr hinübersah, nickte sie nur und öffnete die Autotür.
Es nieselte leicht, als wir ausstiegen. Das hatte es über den Tag verteilt schon einige Male getan, doch dieser Regenschauer war anders. Er fühlte sich irgendwie erzwungen an. Fehl am Platz. Genau wie ich an diesem Ort. Ich hätte nicht herkommen sollen.
Ember ging voraus. Krankenhäuser lösten bei ihr keinen Fluchtinstinkt aus. Ganz im Gegenteil. Der Tod schreckte Ember nicht großartig ab. Während ich mich von ihm verfolgt fühlte, lief sie friedlich neben ihm her.
»Meine Schwester und ich haben uns das letzte Mal vor elf Jahren gesehen«, ließ ich Ember wissen. Eine für sie völlig unwichtige Information, die ganz plötzlich und unvermeidlich aus mir heraussprudelte. Ähnlich wie vorhin, als sie völlig zusammenhangslos den Krankenwagen erwähnt hatte. »Hunter ist eigentlich nur meine Halbschwester. Ich war das Produkt irgendeines bedeutungslosen One-Night-Stands im Drogenrausch.«
Ember blieb stehen, nickte und enthielt sich einer Antwort.
»Hunter …«, wiederholte sie schließlich den Namen meiner Schwester. »Du bist mit Hunter Grey-Jensen verwandt?«
Ihr Tonfall verriet, dass es sie nicht großartig überraschte.
»Ihr kennt euch?«, schloss ich daraus.
Ember schüttelte den Kopf. »Nein, wir kennen uns nicht. Aber ihr gehört das Greyhouse. Der Antiquitätenladen gegenüber meinem Lieblingscafé. Wir sind auf dem Weg hierher daran vorbeigefahren.«
Ich nickte nur. Während Ember bereits einen Schritt in Richtung des Eingangs machte, blieb ich
noch immer wie festgewurzelt neben ihrem Wagen stehen. Sie schaute über die Schulter zu mir herüber. »Brauchst du noch einen Moment?«
Nun war ich diejenige, die sich unsicher war, ob und wie ich agieren sollte. Ich konnte mich noch nicht dazu überwinden, weiterzugehen. Hielt mich gedanklich daran fest, dass ich auf dem Weg zu meiner Schwester war, über deren Leben ich nicht mehr als das wusste, was auch Fremde mir erzählen konnten. Für mich war Hunter Grey-Jensen genau wie für Ember der Name einer mir unbekannten Frau. Ich konnte nicht sagen, ob Hunter tatsächlich die Art Mensch war, die es erfüllte, einen Antiquitätenladen zu besitzen und Dinge zu verkaufen, die andere nicht mehr haben wollten. Alles, was ich tun konnte, war Mutmaßungen anzustellen und den Worten anderer sowie Hunters Selbstdarstellung der vergangenen zwei Monate Glauben zu schenken.
»Wir wurden von einer Pflegefamilie zur nächsten weitergereicht.« Während ich mich aus meiner Starre löste, begann ich ungewollt, in unliebsamen Erinnerungen zu schwelgen. Es diente der Ablenkung. Ein Trick, um meine Nerven zu beruhigen. »Wie zwei Hunde, die nur Probleme machen und deshalb immer wieder im Tierheim abgegeben werden.«
Tante Sophia hatte unzählige Versuche gestartet, die Vormundschaft für uns zu übernehmen. Doch ihre Lebensumstände waren dem Jugendamt damals nicht stabil genug. Also steckte sie Zeit, Geld und Mühen in das Bestreben, ihr Leben zu ordnen. Hatte ihr Kunststudium abgebrochen, um eine Ausbildung zur Krankenschwester zu machen. So zumindest ging es aus Sophias Erzählungen hervor. Hunter erinnerte sich in ihrem Brief an mich anders. Mittlerweile wusste ich nicht mehr, wem ich Glauben schenken sollte. Nur eines entsprach meiner gelebten Wahrheit.
Unsere leibliche Mutter hatte in den ersten Jahren meiner Kindheit mehreren Entzugskliniken den einen oder anderen Besuch abgestattet. Das flache Vordach über den verglasten, automatischen Flügeltüren des Cooley Dickinson versetzte mich in eine Zeit zurück, vor der ich schlichtweg davonlaufen wollte. Mein Versuch blieb jedoch seit jeher erfolglos.
Mit achtzehn beschloss Hunter, ihr ganzes Erspartes für eine Zugfahrt von Boston nach Québec auf den Kopf zu hauen und auf eine Art Selbstfindungsreise zu gehen. Sie machte Work & Travel in Kanada und ich lernte, wie man bei seiner bewusstlosen Mutter eine Herzrhythmusmassage anwendet. Ich war gerade mal neun Jahre alt, mein zehnter Geburtstag stand kurz bevor.





























