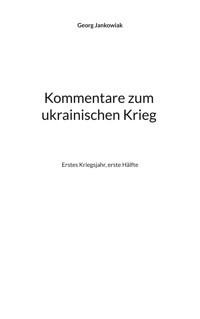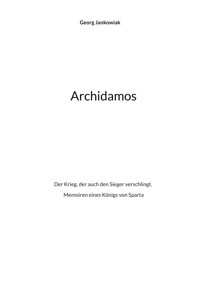
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Ort: Sparta, also der Kriegerstaat der Antike schlechthin. Die Person: Archidamos, einer der zwei Oberkommandierenden Spartas. Die Zeit: vor über 2400 Jahren! Und doch äußert Archidamos Gedanken, die so aktuell sind, dass man im Vergleich meinen könnte, heutige amtierende Politiker kommen aus der Steinzeit. Da ist bei Archidamos der Gedanke, dass ein Krieg zwischen gleich starken Gegnern ein Abnützungskrieg wird. Da ist der Gedanke, dass bei der Beurteilung eines solchen Krieges die Erwartung eines schnellen und sicheren Sieges reines Wunschdenken ist. Da ist die Ablehnung von Wunschdenken, da dies eines echten Strategen unwürdig ist. Da ist die Einsicht, dass man vor dem Lostreten eines solchen Krieges wirklich alle anderen Schritte so gehen muss, dass Provokationen ausgeschlossen sind. Da ist die Einsicht, dass man vor dem Beginnen eines solchen Krieges eine ehrenvolle Exit-Strategie haben muss, oder den Krieg erst gar nicht anfangen sollte. Da ist die Vorsicht davor, sich als Führungsmacht von laut klagenden Alliierten in einen Krieg hineinziehen zu lassen: man lese hier im Buch die Rede der Korinther. Man könnte meinen, dass dies die Worte von heutigen Staaten sind, die um Unterstützung bitten. Und auch da ist Archidamos aktuell: Er ist der eigentliche Erfinder eines Nachrüstungs-Beschlusses, den ja auf den ersten Blick Helmut Schmidt erfunden hat. Ich habe diese Gedanken von Archidamos aus der primären Quelle über ihn entnommen: aus der Geschichte des Peloponnesischen Krieges des Thukydides, eines Zeitzeugen. Und da, wo sich die Rekonstruktion anderer, naheliegender Gedanken anbot, habe ich diese den überlieferten Gedanken hinzugefügt. Videant consules ne quid detrimenti capiant genus humanum orbisque terrarum!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Perikles und Lysistrate
Vorwort des Herausgebers dieser Aufzeichnungen des Archidamos
Redaktionelle Hinweise
Die einleitenden Kapitel
Archidamos' eigenes Vorwort: „Ein Autor aus Sparta???“
Meine hellenische Welt – ein erster Überblick
Die Entwicklung hin zu meiner Zeit: Großgebiete, Poleis und kleinräumige Bündnisse
Die Bildung von Bündnissen von Poleis – das Beispiel Athen
Meine Heimat Sparta: Seine Normen, Sitten und Bräuche
Athens Seeherrschaft und unser Peloponnesischer Bund: Die Eigenart der zwei Bündnisse
Der Peloponnesische Bund – ein solider Fels?
Pentekontaitia – die 50 Jahre zwischen den Perserkriegen und dem Großen Krieg
Vorbemerkung zu den folgenden Kapiteln
Der gemeinsame Sieg und – das erste Misstrauen (Pentekontaitia I)
Meine persönliche Erinnerung an Themistokles
Spartas Könige: Monarchen? Priester? Oberbefehlshaber?
Nach Themistokles: Ohne Alternative in den Konflikt? (Pentekontaitia II)
Athen prescht vor – das Seereich (Pentekontaitia III)
Athen konsolidiert sein Seereich – Sparta wird von den Göttern getroffen (Pentekontaitia IV)
Ich selbst, Archidamos, meine Eigentümlichkeiten, meine Familie
Ithome - Die Festung der Heloten (Pentekontaitia V)
Die Generation der Söhne und Enkel, oder: Vom realistischen Erinnern an den Krieg
Exkurs:
Die Kampfesart zu Lande - die Phalanx
Der Kleine Peloponnesische Krieg:
Die gegenseitige Erbitterung verfestigt sich (Pentekontaitia VI)
Korinth gegen Athen (Pentekontaitia VII)
Die erste große Schlacht und der späte Waffenstillstand (Pentekontaitia VIII)
Exkurs:
Kimon – oder: Das Konzept der Bipolarität
Eine Planänderung zu Deinem Nutzen
Exkurs:
Perikles – der Mann, seine Stadt und seine Konkurrenten
Vom Ende des Waffenstillstandes bis zum athenischen Bauprogramm (Pentekontaitia IX)
Das kurze, gewaltsame Ende des Krieges und der Friedensschluss (Pentekontaitia X)
Der Friedensvertrag und die Führung des Friedens
Athen ist in unaufhörlicher Bewegung
Aspasia, Geliebte des Perikles, und der Prozess gegen sie
Epidamnos und Kerkyra – die vorletzte große Krise vor dem Großen Krieg
(
Und noch eine) Vorbemerkung
Die Ursache der Krise
Die Krise entwickelt sich
Ein Steuern der Krise durch Sparta?
Die Verhandlungspause
Exkurs:
Handel, Geld und Krieg
Epidamnos, Korinth und Kerkyra – die Entfesselung der Gewalt
Athen unter Perikles eskaliert mit
Exkurs:
Die Art des Kampfes zur See
Athen, Epidamnos, Korinth und Kerkyra – der Friede im Zustand der Aushöhlung
Der Ausgang der Krise
Die Folgen der ersten Krise
Die mentalen Auswirkungen
Der Beschluss über Megara – ein neues Instrument einer neuen Art der Kriegführung
Oliganthropia
Der Menschenmangel beeinflusst unsere Entschlusskraft
Poteidaia: Die zweite und letzte Krise vor dem Großen Krieg
Das Eigenleben der Krisen
Poteidaias Lage und seine strategische Bedeutung
Perikles' Dominotheorie
Die weitere Entwicklung der Krise
Poteidaia – der Mühlstein um meinen Hals
Das vorgreifende Hilfs-Versprechen
Die athenische Entschiedenheit in Zahlen – Eskalation ohn' Unterlass
Kein Nachgeben trotz der Pest in ihren Mauern (Vorausblick)
Die Erbitterung gibt sich das Gesetz in Aktion und Reaktion (Vorausblick)
Die Position des spartanischen Königs, des Oberbefehlshabers (Vorausblick)
Die Kriegskonferenz der Spartaner
Die Rede der Korinther
Die Rede der Athener als Reaktion auf die Rede der Korinther
Meine Rede – mein Vermächtnis
Sthenelaidas' Rede
Vor dem ersten Feldzug
Der Fluch des Gottes, oder: Wenn den Falken nichts mehr einfällt
Die Falken der Gegenseite reagieren auf unsere Provokation
Der Kriegsbeschluss bedeutet noch nicht den Kriegsbeginn
Perikles sorgt für die Ablehnung unseres Verständigungsangebotes
Idee und Praxis eines Schiedsgerichtes
Unkontrollierte Leidenschaften – unpassend für unseren Kosmos
Die Un-Gnade der späteren Geburt
„Auf nach Athen“ - Der panhellenische Hass auf Athen
Meine Gedanken für eine Kriegsrede – nach der Friedensrede
Meine Rede an die Kommandeure zu Beginn der Kriegsoperationen
Die Pest und der Kriegsplan des Perikles
Das Schneiden und die Notwendigkeit eines Vermittlers
Für Kriegführung haben wir alle Werkzeuge, für Friedensführung haben wir fast nichts
Die Katastrophe für meine Stadt
Ein sich selbst blockierender Krieg???
Sphakteria I: Die blockierten Blockierer
Sphakteria II: Betteln in Athen
Sphakteria III: Das Unerhörte passiert
Anhang
Worterklärungen
Danksagung und Quellenangaben und Karten
Geleitworte von: Perikles und Lysistrate
εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι ἀνάγκη πολεμεῖν
(Man muss allerdings wissen, dass es absolut notwendig ist Krieg zu führen.)
Perikles, Athens bestimmender Politiker, im Jahr vor dem Beginn der Kampfhandlungen, zur Ablehnung spartanischer Verhandlungsangebote
ἀλλʼ οὐδὲν δεῖ πρῶτον πολεμεῖν
(Aber Krieg führen soll man als erstes mal gar nicht.)
Gesprochen von Lysistrate, der Hauptfigur der gleichnamigen Komödie des Atheners Aristophanes,
im 20. Jahr des Peloponnesischen Krieges
Vorwort des Herausgebers dieser Aufzeichnungen des Archidamos
Leserin! Leser!
Hier übergebe ich Deinen Händen ein einzigartiges Werk! Einzigartig ist es zum einen, weil hier ein Spartaner schriftliche Aufzeichnungen größeren Umfangs hinterlassen hat, zum anderen wegen der gesellschaftlichen Stellung des Autoren in seiner Stadt: Als führender Politiker und Heerführer untersucht er Ursache und Anlass des Peloponnesischen Krieges! Der Heerführer dieses besonderen Militärstaates schildert den Weg in den Abgrund für seine Stadt, aber auch für ganz Griechenland!
Wie einzigartig dieser Krieg war, kann man ersehen aus der Schilderung seiner Dimensionen, die der bekannte Historiker und Zeitzeuge Thukydides, Sohn des Oloros, verfasst hat. Dieser erlebte noch das Ende des Krieges und verfasste das berühmte Werk darüber. Die meisten Wissenschaftler urteilen, dass Thukydides' Buch das Meisterwerk antiker Geschichtsschreibung ist.
Thukydides also urteilte:
„Dieser Krieg dehnte sich schon der Dauer nach lang aus und brachte so vielerlei Leiden über Griechenland wie sonst nie etwas in gleicher Zeit. Nie wurden so viele (griechische) Städte erobert und entvölkert, teils durch Barbaren, teils in gegenseitigen Kämpfen, manche bekamen sogar nach der Eroberung eine ganz neue Bevölkerung!
Nie gab es so viele Flüchtlinge, so viele Tote, durch den Krieg selbst und in den Kämpfen der verfeindeten Bevölkerungsklassen.
Was man von früher immer sagen hörte, aber die Wirklichkeit so selten bestätigte, wurde glaubhaft: Erdbeben, die weiteste Länderstrecken zugleich mit ungeheurer Wucht heimsuchten; Sonnenfinsternisse, die dichter eintrafen, als je aus früherer Zeit überliefert; dazu mancherorts unerhörte Hitze und darauf folgend Hungersnot; und schließlich die Pest – nicht die geringste dieser Plagen, ja, zum Teil die totale Vernichterin ---
All dies fiel zugleich mit diesem Krieg über die Hellenen her.“
Diese Folgen, wie sie der zuverlässige Zeitzeuge Thukydides nach Ende des Krieges formulierte, bestätigen den Titel, den Archidamos schon zu Beginn dieses Krieges seinen Aufzeichnungen gegeben hatte:
„Ein Krieg, der auch den Sieger vernichtet“
Denn:
Sparta gewinnt nach 27 Jahren den Krieg – mit dem Geld des persischen Großkönigs, der ja so etwas wie der „Erbfeind“ des freien Hellas war!
Sparta meint nach diesem Sieg durch fremdes Geld Griechenland allein regieren zu können! Typen wie Sthenelaidas, der Gegenspieler unseres Archidamos, ein konsequenter Kriegsverfechter, geben den Ton an. Die Beauftragten Spartas, die in die Städte Griechenlands als Regenten geschickt werden, versagen moralisch außerhalb ihrer eigenen Heimat, außerhalb des spartanischen „Kosmos“, völlig: sie regieren die Städte wie eine ihrer militärischen Einheiten, befehlen zunehmend willkürlich; gleichzeitig sind sie süchtig nach Luxus und gebärden sich wie orientalische Potentaten. Sie bringen in der Folge die meisten der von ihnen beherrschten Städte gegen sich und gegen Sparta auf; es entsteht eine Empörung, die Sparta mit seiner schwindenden Macht nicht mehr einfangen kann. Und: Bei ihrer Rückkehr nach Sparta verderben diese früheren „Außenbeauftragten“ dort die Moral ihrer in Sparta gebliebenen Mitbürger. Dadurch geht der Rest der früheren Einfachheit ihres „Kosmos“, ihrer ehemals festgefügten Ordnung, zugrunde.
Inmitten all dieser Umwälzungen wird der Sohn unseres Archidamos, Agesilaos, einer von den beiden Königen. Von seinem Charakter wird in den Quellen nur Gutes berichtet. Aber in seinem politischen Handeln stemmt er sich vergeblich und ohne wirkliche Einsicht gegen eine Woge der Veränderungen in Raum und Zeit.
In seine Regierungszeit fällt die erste Niederlage eines spartanischen Heeres in offener Feldschlacht, die Schlacht bei Leuktra, gut 60 Jahre nach dem Beginn des Peloponnesischen Krieges, 30 Jahre nach dessen Ende. Agesilaos selbst war dort nicht anwesend, musste aber die Folgen dieser einzigartigen Niederlage während seiner gesamten restlichen Regierungszeit ertragen. Denn: Dort liegt getötet die Mehrzahl derer, die sich kriegerisch immer für tüchtiger hielten als der Rest der Griechen!!!
Agesilaos selbst musste die nachfolgenden Angriffe einer panhellenischen Allianz gegen Sparta selbst abwehren, was nur noch mit äußerster Mühe gelingt: Schon zur Zeit seines Vaters, also der Zeit des Archidamos, hatte der Verlust von „nur“ 120 echten Spartiaten dazu geführt hatte, dass Sparta in Athen einen Frieden fast erflehte: die Großmacht musste sich also schon damals so weit demütigen, weil die Zahl ihrer Bürger-Krieger schon damals so weit gesunken war.
Agesilaos, Sohn des Archidamos, muss sich noch weiter erniedrigen, weil diese Zahl im Folgenden noch weiter gesunken war, besonders stark natürlich durch die Schlacht von Leuktra: Gegen Ende seiner Regierungszeit - kurz nach dieser Katastophe von Leuktra - kann Sparta schon kein Heer mehr aus seinen Bürger-Kriegern mehr aufstellen: sie liegen alle bei Leuktra.
Es blieb noch: die Schaffung von besonderen Einheiten aus Orten rund um Sparta und das Anwerben von Söldnern – an sich schon eine Schande für eine Gemeinschaft, die sich einst gerühmt hatte:
'Wir brauchen keine Stadtmauern (wie die Städte der übrigen Griechen), die Leiber unserer Krieger sind unsere Stadtmauern.'
Dem Sohn des Archidamos bleibt nichts anderes übrig als sich wie ein Söldner an den Perserkönig zu vermieten für dessen Unternehmungen in anderen Erdteilen, in diesem Fall in Ägypten. - Ähnliches war zuvor dem Athener Xenophon passiert. Einige von Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, werden an Hand von dessen Werk „Anabasis“ das Altgriechische gelernt haben.
So lang und so tief reicht die Wirkung des Kriegsbeschlusses vom Beginn des Peloponnesischen Krieges, damals, im 50. Jahr nach den Schlachten von Salamis und Plataiai, diesen griechischen Triumphen gegen die Perser. Wegen dieser Langzeitfolgen mussten die Söhne und Enkel derer, die den Peloponnesischen Krieg, diesen Krieg zwischen Griechen, beschlossen hatten, sich an den Potentaten vermieten, den ihre Vorfahren bei Salamis und Plataiai zuvor so vollständig besiegt hatten.
Das Griechenland, das in Gestalt zweier großer Allianzen, geführt von zwei großmächtigen Städten, Athen und Sparta, ein eigenständiger Faktor zwischen Persien, Ägypten, den Phöniziern und den Barbaren war, dieses Griechenland liegt erschlagen auf den Schlachtfeldern des Peloponnesischen Krieges.
Es ist der Krieg, vor dem Archidamos gewarnt hatte.
Redaktionelle Hinweise:
Zeitangaben: Archidamos selbst benutzte für die Chronologie der Ereignisse die im gesamten damaligen Griechenland verbreitete Angabe nach Olympiaden. Ich habe dies der leichteren Lesbarkeit wegen verändert: Ich zähle die Jahre ab der Schlacht von Salamis im Jahre 480 vor unserer Zeitrechnung. Hiernach beginnt der Peloponnesische Krieg (431-404 v.u.Z.) im 50. Jahr nach der Schlacht von Salamis.
Hauptquelle: Ich habe diese Passagen aus dem Werk des Thukydides in freier Wiedergabe benutzt: die obige Beschreibung der Folgen des Krieges für Griechenland; die Reden der Korinther und der Athener; die Rede des Archidamos selbst und die seines Gegenspielers Sthenelaidas; schließlich die Perikles-Rede. Die Wiedergaben entstanden unter Benutzung des griechischen Originals und der Übersetzungen von Georg Peter Landmann (Artemis-Verlag) und von Michael Weißengerber (de Gruyter-Verlag).
Unbekannte Begriffe:Griechenland selbst heißt ja bei den Griechen der Antike und heute: Hellas; die Griechen selbst: Hellenen. Ich habe konsequent diese Bezeichnungen beibehalten.
Sonstige Personen, Orte oder Sachverhalte, die mir heutigen Lesern nicht sofort verständlich schienen, sind erläutert im Anhang: Worterklärungen.
Orte
2 Landkarten sind im Anhang beigefügt:
die häufigsten Orte von Festlands-Griechenland
bedeutende Orte auf dem Isthmos von Korinth und in Attika
Die einleitenden Kapitel
Archidamos' eigenes Vorwort.
„Ein Autor aus Sparta??? Das ist ja unerhört!“
Wenn Du, Leser aus Byzantion oder Patras oder Smyrna, schon von diesem Buch gehört haben solltest, denkst Du sicher, dass es sich um ein – wie die Barbaren sagen - „Fake“ handelt.
'Es hat noch nie einen Spartiaten als Autoren gegeben!' so sagt alle Welt.
Und man drückt mit dieser Feststellung aus, dass man allgemein die Tatsache, dass Spartiaten nicht schreiben, für so unumstößlich hält wie wir Spartiaten die Gesetze unseres Lykourgos.
Auch für mich galten die heilsamen Gesetze unseres Gesetzgebers Lykourgos uneingeschränkt, sie formten den Kosmos, in dem ich lebe und in dem ich geformt wurde. Für mich galten sie in besonderem Maße! Denn als Spross eines der Geschlechter, aus welchem die Könige in Sparta stammen, waren sie umso bindender, als ich als „König“ für die religiöse Absicherung meiner Mitbürger verantwortlich bin.
In dieser Sicherheit wuchs ich auf, hielt in meiner Jugend die Vorschriften des Lykourgos und unseren Kosmos für unwandelbar, unverrückbar wie die Sonne. Jetzt aber, am Ende meines Lebens, erfüllt mich ein anderes Gefühl:
Ich habe jetzt ANGST!
Nein, nicht diese Angst von Feiglingen davor, dass mir etwas passieren könnte. Das verbieten schon die Gesetze unseres Lykourgos! Nein, Angst vor dem, was sich nicht fassen lässt, nicht greifen oder angreifen lässt, nicht niederwerfen lässt, wie man normalerweise einen unserer Feinde niederwirft.
Angst, weil ich spüre, dass bei uns im Innern der Bürgerschaft etwas entgegen den Regeln des Lykourgos anwächst, obwohl sich alle an diese Gesetze halten - geradezu verzweifelt halten.
Angst, weil ich spüre, dass auch die Welt außerhalb unserer spartanischen Welt sich stürmisch verändert. Ich stoße immer wieder bei meinen Überlegungen zur Politik darauf, dass die Wege, die wir bisher - getreu den Geboten des Lykourgos - beschritten, nicht mehr ans Ziel führen; dass da Hindernisse auftauchen, die den geraden, den einfach erscheinenden Weg blockieren.
Und die größte Angst habe ich davor, dass die meisten meiner Mitbürger mir ausweichen, wenn ich diese Sorgen anspreche. Sie - geerdet in ihrem Kosmos - wollen keine Veränderungen! Und auf meine Vorhaltungen, dass diese Veränderungen schon da sind, dass sie sich auf sie mit genau derselben Disziplin im Geiste vorbereiten müssten, wie sie diese Disziplin bei den Leibesübungen und den Kämpfen zeigen – darauf reagieren sie mit vollkommenem Unverständnis, Gleichgültigkeit oder wütender Ablehnung.
Ich also, der eigentlich nicht existente Autor aus Sparta, schreibt dies für mich selbst auf – gegen das Ersticken. Ich hoffe, dass meine Ängste nach meinem Tode sich als irreal erweisen werden. Dann können diese für Sparta ungewohnten Gedanken mit diesem Buch vernichtet werden. Dann brauchen sich meine Mitbürger nicht an diesen Tabubruch, den eines schreibenden Spartaners, gewöhnen.
Falls aber meine Ängste reale Entwicklungen voraussehen, so soll dieses Buch nach meinem Tod von Nutzen sein. Vielleicht hilft es unter den Hellenen, denjenigen, die einmal in ähnlichen Umständen handeln müssen. Für sie, die Nachgeborenen, werde ich manches, was uns Zeitgenossen sofort verständlich war, erklären müssen. Und noch mehr Dinge werde ich in eigenen Kapiteln erklären müssen, falls das Buch zu den Nicht-Griechen unseres Mittelmeeres gelangen sollte. Du, Hellene, kannst ja diese Kapitel überspringen.
Schließlich bitte ich den Geist unseres Lykourgos um Vergebung! Ich,der ich aus dem innersten Kreis derer stamme, die sich „die Gleichen“ nennen, kann Sachverhalte, die immer vielfältiger werden, nicht mehr auf lakonische Weise behandeln. Nicht so, wie ich es eigentlich müsste, nämlich mit möglichst wenigen Worten und einfachen Sätzen.
Es geht nicht! Es geht nicht mehr!
Noch vor 50 Jahren konnte unser Leonidas die von Worten überquellende Aufforderung des Großkönigs, doch gefälligst unsere Sperre am Thermopylen-Pass zu räumen, auf lakonische Weise beantworten: „Beweg' Dich, nimm sie!“ Eine Ausdrucksweise, die man dem Großkönig erst einmal erklären musste!!!
Ich hier kann die heutige labyrinthische Situation nicht mehr mit einfachen Hauptsätzen schildern, die - wie früher - Imperative oder Infinitive statt vollständiger Verben enthalten, und Hauptsätze statt eines Gefüges aus Hauptsätzen und Nebensätzen. Ich muss un-lakonisch schreiben!
Vergebt, Mitbürger, dass ich gezwungen bin oft wie einer dieser schwatzhaften Athener zu schreiben, ja, manchmal sogar wie einer von deren Rhetoren, die sagen, dass man jeden lehren kann so zu reden, dass er allen alles beweisen kann. Bei diesen Zwergen der Rhetorik geht es um künstliche Übungen ---- mir hier geht es darum drohende Katastrophen angemessen zu beschreiben.
Meine hellenische Welt ein erster Überblick
Dann, wenn ich nicht mehr sein werde, sind es vielleicht nicht nur Hellenen, die dies lesen werden, sondern auch Menschen aus anderen Ländern rund um unser Meer. Besonders dürften sich die Perser, die Ägypter und die Punier aus Karchedon aus meinen Gedanken Ratschläge für die Gestaltung ihrer eigenen Verhältnisse versprechen.
Wenn diese Voraussetzung zutrifft, kann ich nicht davon ausgehen, dass in späteren Zeiten Menschen aus anderen Räumen die nötige Kenntnis besitzen um meine Gedanken richtig einordnen zu können. Auch Hellenen werden lange nach meinem Tod andere Verhältnisse in Hellas antreffen. Sie besonders werden dann diese Beschreibung des Hellas vor dem Großen Krieg schätzen, auch wenn sie wohl nur mit Wehmut von diesem früheren Hellas lesen werden.
Erfahre also, Leser, grundlegende Informationen zur Welt der Hellenen zu meiner Zeit.
Die Entwicklung hin zu meiner Zeit: Großgebiete, Poleis und kleinräumige Bündnisse
Ich will für Dich eine grobe Gliederung unseres Siedlungsgebietes vornehmen, denn das, was Seeleute und Händler berichten, ist oft eine ungenaue Übertreibung dessen, was sie auf ein oder zwei Fahrten gesehen haben mögen.
Nahezu alle Hellenen bewohnen ein Land voller Berge und Täler, beide Landschaftsformen wechseln sich kleinräumig ab.
Wir Spartaner bewohnen die südliche Seite Halbinsel des Pelops, des Peloponnes. Wir beherrschen neben dem Tal, auf das der Taygetos blickt, eines der alten eingeborenen Völker, die Messenier. Neben uns und diesen gibt es noch die Argiver um Argos, die Achäer zum korinthischen Golf hin, die Eleaten um Elis herum und die Arkadier in der Mitte, im Raum nördlich von uns. Der Peloponnes selbst mündet in drei Halbinseln, wie dies bestimmte Ahorn-Bäume tun, bei denen man von den eigentlich fünf Fingern nur drei ausgeprägte sieht. Er selbst ist ebenfalls eine Halbinsel, denn er ist mit dem übrigen Hellas durch den Isthmos von Korinth verbunden.
Jenseits des Isthmos, ganz im Südosten des Festlandes liegt die Heimat der Athener, Attika. Nach Norden zu schließen sich dann Böotien, Thessalien und noch weiter nördlich Epirus und Makedonien an. Thessaliens und Makedoniens Oberfläche nimmt sogar manchmal die Form einer Ebene haben, was fast untypisch ist für Hellas, das ja gebirgig ist. Dort in Makedonien spricht man auch eine Art der hellenischen Sprache, wir im Süden aber betrachten diese Einwohner der Nordregionen als Halbbarbaren.
Im Osten von Attika, jenseits des Meeres, also schon in Asien, liegt Ionien mit seinen von Hellenen besiedelten Küstenstädten. Die Landverbindung zwischen Festlands-Hellas und Ionien heißt Thrakien. Der Westteil Thrakiens weist wie der Süden der Peloponnes wieder die Gestalt dieser dreifingrigen Blätter auf – in meinen Tagen entbrannte auf dem westlichen Finger einer der letzten Anlässe für den Großen Krieg: Poteidaia.
Die vielfältige Inselwelt zwischen Festlands-Hellas und Ionien nennt man Ägäis, die weniger zahlreichen Inseln westlich des Peloponnes werden zusammen als die Ionischen Inseln bezeichnet. Dort entwickelte sich der andere Anlass zum Großen Krieg.
Frage mich bitte nicht, aufmerksamer Leser, weshalb die Inseln, die am weitesten von Ionien entfernt sind, Ionische Inseln genannt werden! Die Antworten auf manche Rätsel sind tief in der Vorzeit verborgen.
Mein Land ist – wie gesagt – sehr gebirgig, über fast allen Hellenen ragen adlergestaltige Berge auf. Von einem Tal zum anderen winden sich die Wege hoch, sodass man oft Tage von einem zum anderen Tal braucht. Unsere langen Küsten sind sehr reich an Buchten und natürlichen Häfen, also Plätzen, die sich zur Gründung von Seefahrerstädten geradezu anbieten. Diese Gestalt des Binnenlandes und der Küsten bringt es mit sich, dass viele untereinander unabhängige, autonome Städte entstanden sind, die in einem unaufhörlichen, mal freundlichen, mal kriegerischen Austausch sind. Wir nennen diese Städte, die ja eigentlich Städte und gleichzeitig selbstständige Staaten sind, in unserer Sprache Polis, im Plural Poleis.
Kriegerische Anlässe gibt es genug: zuallererst natürlich Fragen der Grenzziehung und Streit um Handelsfragen; weiter Veränderungen in der benachbarten Poleis, die zu einer anderen Orientierung dieser Polis führen; Auszüge unserer jungen Männer, die bei der Nachbar-Polis ihre Kräfte beim Raub von Herden erproben; unfreundliche Behandlung der eigenen Leute in eine der Nachbar-Poleis, wenn sie auf Reisen dorthin kamen, und vieles mehr.
Ja, ich will einen der genannten Anlässe hier schon ausführlicher nennen, denn dieser wird später bei der ersten großen Krise vor dem Krieg noch eine Rolle spielen. In fast jeder Polis findest Du zwei Hauptklassen der Bevölkerung: die Adligen, die wir in unserer Sprache die Aristokraten nennen, und die darunter befindlichen Klassen, das Volk, das wir den „Demos“ nennen. Wenn dieser die Stadt regiert, sprechen wir von Demokratia, also Herrschaft des Volkes oder der unteren Bevölkerungsschichten. Genau betrachtet gibt es in den Reihen des Demos auch wieder Unterteilungen, so etwa diejenigen, die anderen Arbeitsmöglichkeiten geben, und diejenigen, die bei diesen Leuten arbeiten. Bei jenen gibt es wieder diejenigen, die ihre Unternehmung innerhalb der Stadt betreiben und die, welche Waren ein- und ausführen.
Grundlegend für unseren Konflikt mit Athen und den Großen Krieg aber ist die Unterscheidung zwischen Aristokratie und Demokratie. Du vermisst die Könige und die Tyrannen, die so lange einzelne Poleis regierten, etwa Polykrates in Samos? Nun, diese Einzelherrschaften sind in den letzten Jahrzehnten seltener geworden. Aber zurück zum Befund, dass sich bei uns autonome Städte entwickelt haben!
Nun gibt es in Kleinasien, im Herrschaftsbereich des Großkönigs, auch großflächige Gebirge, sodass Du zweifeln könntest, ob die geografische Begründung, die ich für die Entstehung so vieler unabhängiger Poleis angab, zutrifft. Denn bei den Persern gibt es keine Zersplitterung in so viele Poleis, sondern einen Mittelpunkt, von dem aus der Großkönig das Land regiert.
Den Grund für diesen Unterschied zwischen Festlands-Hellas und dem persischen Reich sehe ich im Handel über das Meer. Dieser Handel existiert so für die im Landesinnern liegenden Gebiete der Perser nicht, also konnten sich nicht so viele Städte mit einer Macht bilden, die aus den Gewinnen von Handel stammt und die die Grundlage bildet für Autonomie.
Man sieht diesen Unterschied am deutlichsten an der Küste von Asien, die dem griechischen Hauptland gegenüber liegt, also in Ionien. Auch dort an dieser gebirgigen Küste, die in das persische Binnenland übergeht, liegt an fast jeder Bucht eine Polis, bewohnt von griechischen Menschen: Smyrna, Halikarnassos, Milet, Ephesos. Diese betreiben Handel, sind dadurch kräftig und - immer in Revolte gegen das Zentrum, den Großkönig, der eine unsichere Herrschaft über sie ausübt, die aber von ganz anderer Art ist als seine Herrschaft über den Rest seines Gebietes, welches nicht an der Küste liegt.
Die Bildung von Bündnissen von Poleis – das Beispiel Athen
Dies mag reichen an Information über frühe Zeit der Bildung der einzelnen, autonomen Poleis. Jetzt werde ich die Entstehung der politischen Verhältnisse zu meiner Zeit zu erklären. Denn diese sind dadurch gekennzeichnet, dass sich zwei große Bündnisse von Poleis gegenüber stehen. Die Zersplitterung, die ich eben geschildert hatte, also die Zersplitterung in unabhängige Poleis von Tal zu Tal, mündete erst langsam, dann beschleunigt, in eine Entwicklung zum Zusammenschluss von Poleis.
Auch hier kann der Verstand leicht die Beweggründe erkennen. Waren Poleis im Konflikt, so suchten sie natürlich Bundesgenossen unter den Stämmen, die ursprünglich Griechenland bevölkert hatten: die Poleis, die aus dem Stamm der Achäer hervorgegangen waren, wandten sich also um Hilfe an ihre Stammesgenossen, die Achäer; die dorischen Poleis an die Stammesgenossen der Dorer. Aus vielen solcher Begebenheiten entwickelte sich dann so etwas wie ein Bündnis, hier also der Achäische oder der Dorische Bund. Kein festes Gebilde, bei Apollo, sondern unserem Charakter entsprechend etwas, das zwar dem Namen nach existierte, jedoch auch einmal eine Polis als Mitglied verlor, eine andere aber dazugewann, seine Gestalt also änderte.
So gab es bis zu den Perserkriegen lose Bündnisse etwa unter den Attikern, den Boiotern, den Argivern, den Epirern, und natürlich den erwähnten Achäern und Dorern, und vielen anderen Stämmen. Nur nicht unter den Messeniern! Aber dazu später ...
Diese gleichsam lockeren Verhältnisse existierten bis zu der Erschütterung durch die zwei Kriegszüge der Perserkönige Dareios und Xerxes nach Hellas. In diesen Kriegen gewann Athen ein außerordentliches Prestige durch seine Waffentaten an sich, aber auch durch seine Führung derjenigen Poleis, die nördlich des Isthmos und in Ionien liegen.
Man kann also sagen, dass diese eine Stadt zuerst zur Führerin Attikas, dann zur Anführerin der Ionier und zu der von vielen unserer ägäischen Inseln wurde. Sie alle ergaben sich der Führung und dem Schutz dieser immer mächtiger werdenden Stadt. Wenn Du Dir das Gesagte vor Augen führst, verstehst Du jetzt schon, wieso der Herrschaftsbereich Athens als „Seebund“ oder „Seeherrschaft“ bezeichnet wird: es sind größtenteils über dem Meer gelegene Gebiete. Daher übrigens auch die Entstehung der großmächtigen Flotte Athens; aber auch dazu später ...
Auf dem Festland nördlich des Isthmos außerhalb Attikas konnte Athen dagegen nie richtig Fuß fassen; gleiches gilt für die oben genannte Landbrücke zwischen dem Festland und Ionien, also in Thrakien. Daher dann auch die späteren Versuche Athens dort zuverlässige Stützpunkte zu gewinnen, daher der Konflikt um Poteidaia, die Kämpfe um Amphipolis.
Athen hat sich also von einer an der See gelegenen Poleis zum Hegemon eines Seereiches entwickelt. Es ist daher Beispiel für die Entwicklung erster, noch lockerer Bündnisse hin zu großflächigen Bündnissen von Poleis, die immer festere Gestalt annahmen. Zu meiner Zeit, also vor dem Großen Krieg, war die Entwicklung dann weit fortgeschritten. Es waren nur noch zwei Groß-Bündnisse prägend: Das der Seereich der Athener und unser Peloponnesischer Bund. Eigenständig, vom Typ der lockeren Bündnisse, waren nur noch Gebiete in Thessalien, Epirus, Makedonien und Thrakien; bei uns auf dem Peloponnes die Bündnisse um Argos und Elis.
Meine Heimat Sparta: Seine Normen, Sitten und Bräuche
Ich muss hier zu Anfang dieses Buches auch über meine Stadt schreiben! Selbst unter Hellenen herrschen teils Unwissenheit, teils Halbwissen über diese seltsamste aller griechischen Poleis. Zeuge für diese Besonderheit meiner Stadt ist der große Herodot! In seinem riesigen Werk schildert er Sitten und Gebräuche vieler Völker; unter uns Hellenen hält er das nicht für nötig, außer - im Falle meiner Stadt.
Nun befürchtest Du endlose Seiten, gefüllt mit seltsamen Dingen. Nein, ich schreibe über die Entstehung des größten aller Kriege!Deshalb möchte ich mich mit denjenigen Eigenarten meiner Stadt begnügen, die den größten Bezug zum Thema haben. Es geht um Frauen, Eisenbarren, Sklaven, Fremdenaustreibungen und … Disziplin in Kombination mit Wettkampf.
Da ist zuerst unser Verhältnis zu den Heloten, wie unsere Sklaven genannt werden. Dieses prägt all unser Handeln und Denken. Jedoch nicht in der Hinsicht, wie manches Halbwissen es sich vorstellt, dass wir wirklich mit unserer Jungmannschaft auszögen und Jagd auf die Heloten machten, wenn wir in jedem Jahr symbolisch den Heloten den Krieg erklären. Diese Vorstellung ist Überbleibsel einer tatsächlichen Gewohnheit aus uralter Zeit, aus der Zeit direkt nach den Messenierkriegen, dessen erster ja etwa zur Zeit der ersten Olympiade stattfand. Heute erfolgt diese Kriegserklärung, wie gesagt, nur noch symbolisch. Zwar gibt es die spezielle Jungmannschaft noch, die früher auszog, um aufrührerische Elemente unter den Heloten einzuschüchtern oder zu töten: Wir nennen sie Krypteia. Die Erzählung über ihren jährlichen Einsatz aber hat sich gehalten, da es ja oft unter den Sterblichen gilt, dass gerade das Halbwissen zu den ungeheuerlichsten Vorstellungen führt, welche dann wieder wie Gespenstergeschichten dem Hörer ein wohliges Grauen über den Rücken jagen.
Du fragst, warum überhaupt vor Zeiten diese seltsame Sitte entstehen konnte.
Die Heloten sind unsere Sklaven. Du, freier Hellene oder Ägypter oder Perser, kennst nur die Sklaven, die Dein unmittelbarer Besitz sind, sei es, dass sie Dich persönlich bedienen, sei es, dass sie körperliche Arbeit für Dich auf den Feldern verrichten. Unsere Heloten gehören nicht Einzelpersonen, sondern der Gesamtheit unserer Vollbürger, uns, den „Gleichen“, wie wir uns nennen.
Dieser Sachverhalt macht den gesamten Unterschied aus zu Deiner Sklavenhaltung. Gesetzt den Fall, Du wärst ein extrem tyrannischer Herr Deiner Sklaven, die ja noch in Haus- und Feldsklaven unterteilt sind, so könnte ein Aufstand dieser Sklaven geschehen – man hört ja immer wieder von solchen Dingen. Die Sklaven Deiner Nachbarn jedoch werden sich durch einen solchen Aufstand bei Dir nur in den seltensten Fällen verleiten lassen ihrerseits ebenfalls zu revoltieren. So ist die Erfahrung, denn sie leben ja getrennt voneinander und werden unterschiedlich behandelt. Hinzu kommt, dass sie ja zumeist aus fremden Gegenden vieler Himmelsrichtungen kommen und auch insofern keine einheitliche Gruppe bilden, ja, sich oft nicht einmal untereinander richtig verständigen können.
Unsere Heloten dagegen sind die Nachkommen eines Volksstammes, der unsere Nachbarlandschaft Messenien bewohnte und von unseren Vorfahren unterworfen wurde. Sie wurden also als ein ganzes Volk versklavt, „durften“ aber weiter zusammen da wohnen, wo sie vor der Versklavung gewohnt hatten. Sie sind einzig verpflichtet uns unseren Lebensunterhalt zu erarbeiten, damit wir uns ohne körperliche Arbeit unsererseits nur den Leibesübungen und dem Exerzieren in Waffen widmen können. Es dürfte klar sein, dass diese vereinte Menge an Menschen im Fall einer Revolte eine größere Gefahr darstellt als sie von euren Sklaven droht, die ja - untereinander uneins - Besitz eines Einzelnen sind.
Die Messenier sind uns schon von der Anzahl her überlegen; sie sind untereinander homogen und damit leicht zu gemeinsamen Aktionen befähigt. Wir leben also trotz unseres stolzen Auftretens immer in Furcht vor Revolten. In der Vergangenheit hatte hauptsächlich diese Furcht zur Folge, dass wir uns allein der Vorbereitung auf den Kampf widmeten. Seit dem großen Heloten-Aufstand zu Beginn meines Königtums, etwa 15 Jahre nach Salamis, hat sich dies noch verstärkt: die Heloten bewiesen, dass sie ausdauernde Kämpfer sein können; wir hatten offenbart, dass wir für Formen des Kampfes, die nicht in der regelrechten Schlacht bestanden, kaum gerüstet waren und sogar Hilfe von den Athenern erbeten mussten.
Ausführlich kannst Du dies hier bei mir in dem Kapitel „Ithome - Die Festung der Heloten“ verfolgen.
Ich fasse zusammen: Unsere Lebensweise ist ursächlich bedingt durch unsere Herrschaft über einen ganzen Volksstamm, der versklavt ist, aber weiter zusammen lebt, nicht getrennt nach verschiedener Herkunft und Verwendung in Haus und Feld. Überspitzt gesagt könnte man sogar formulieren, dass wir die Gefangenen unserer Herrschaft über die Sklaven sind. Aber ich will die Kühnheit des ungewöhnlichen Ausdrucks hier nicht zu weit treiben und den Kitzel immer abstrakterer Gedanken den Philosophen und Sophisten Athens überlassen!
Eine weitere Eigentümlichkeit ist unser Verzicht auf Geld aus Edelmetall. Ich persönlich bin gerade auf diesen Zug unserer Gemeinschaft sehr stolz! Das Fehlen der Möglichkeit, in der kleinen Form, die das Edelmetall darstellt, riesigen privaten Reichtum zu erwerben und zu horten, hat uns schon viele innere Konflikte erspart; man denke nur an die Spaltung in Adel und Volk, wie ich sie Dir hier im vorletzten Kapitel als charakteristisch für fast alle Poleis geschildert habe. Denn diese Spaltung hat ihre tiefere Ursache in dem verschiedenen Reichtum der Bewohner der jeweiligen Polis. Wir dagegen nennen uns „die Gleichen“, weil es bei uns keine größeren Unterschiede des Besitzes gibt. Lob unserem Lykourgos, der in seiner Weisheit uns den Verzicht auf Edelmetall-Geld gebot!
Vom inneren Frieden als positive Folge dieser Entscheidung hatte ich schon gesprochen. Der Verzicht auf Edelmetall-Geld führt aber auch dazu, dass wir weniger Kontakt mit der Außenwelt haben. Denn natürlich haben auch wir für Verkäufe untereinander eine Art Geld, welches aber --- aus Eisenbarren besteht. Wie nun sollten wir Handel nach außen treiben, also in Kontakt treten, wenn der Kauf einer schönen Vase zur Folge hätte, dass wir mit diversen schweren Eisenbarren auf einem langsamen Ochsengespann zum Verkäufer fahren müssten?
Dies zu den segensreichen Folgen dieser von Lykourgos stammenden Einrichtung.
Mittlerweile allerdings haben sich leichte Veränderungen in der Wirklichkeit ergeben. Immer wieder müssen die Ephoren, unser Kontrollgremium, feststellen, dass einzelne von uns Gleichen über Mittelsmänner doch den Erwerb von teuren Gegenständen erstreben. In dem Kapitel „Athen prescht vor - Das Seereich“ habe ich Dir geschildert, wie Pausanias bei seinem Kommando in Kleinasien die Sitten der dortigen Menschen annahm. Er begehrte den Luxus und sandte wertvolle, seltene Gegenstände nach Hause. Diese Begierde also, die dieser eigentlich noch geringfügige Luxus damals auslöste, sickert seitdem fast unmerklich in unsere Gemeinschaft ein.
Hier ist übrigens der Ursprung der Fremdenaustreibungen. Vielleicht stellst Du Dir darunter eine gewaltsame Jagd auf alle Nicht-Lakedaimonier vor. Nein, es handelt sich darum, dass wir in bestimmten Abständen all denen, die sich zwischenzeitlich aus anderen Poleis bei unseren Periöken angesiedelt haben, den Befehl erteilen in ihre Heimat zurückzukehren. Das betrifft eigentlich nur Händler oder Inhaber von Geschäften. Diese schaffen es nämlich immer sich gleichsam einzuschleichen, um uns Spartiaten und den Periöken Waren zu verkaufen. Die Austreibungen sind also nötig, weil wir sonst von einem Ring von Verkäufern umgeben wären, die uns den Luxus, fremde Gedanken und fremde Sitten einschleppen würden.
Einen weiteren Zugang findet diese Begierde nach Luxus durch eine andere Eigentümlichkeit unserer Stadt: die Stellung der Frau. Du, Hellene, und Du, Ägypter, ihr habt mir schon manches Mal ungläubig zugehört, wenn ich im privaten Gespräch erzählte, dass bei uns die Frau ihren Körper in der Öffentlichkeit stählt, dass sie auch sonst ein Leben außerhalb des Hauses hat, ja, dass sie sogar Erbin sein kann. Soviel ich weiß, gibt es diese Einrichtung bei keinem anderen unserer Kulturvölker.
Im Kapitel über „Oliganthropia“ stelle ich Dir eine besondere Folge dieser starken Eigenständigkeit der Frau dar. Hier im Moment kommt es mehr auf die Sehnsucht von Frauen nach schönen Dingen an. Diese Sehnsucht führt auf direktem Wege zur Sucht nach Luxus. Die versteckte Möglichkeit solchen Luxus zu erwerben bietet sich Frauen bei uns durch ihren Eigen-Besitz, etwa aus einem Erbe.
Aber nicht nur die eigenständige Frau, auch diejenige Frau findet Zugang zum Luxus, die in einem engen Verhältnis zu ihrem Mann lebt. Das ist zwar bei uns eine Seltenheit, kommt aber dennoch vor. Solch eine enge Beziehung ist das Eingangstor für die Sehnsucht nach dem Schönen. Denn nenne mir einen Mann, der nicht auf Bitten seiner Frau alles daran setzt, ihr das Objekt ihrer Wünsche zu beschaffen! Der Mann ist da oft ein fast wehrloses Opfer, denn natürlich gehört es zu seinem Stolz, so mächtig zu sein, dass er seiner Frau Dinge ermöglicht, die der Durchschnitt der Frauen nicht hat; dies entspringt der Eigenliebe des Mannes. Umgekehrt kann die Frau ihn zur Erfüllung ihrer Wünsche unter Druck setzen, indem sie ihm die Erfüllung seiner Begierden versagt oder diese verzögert. Eine andere besonders wirksame Methode ist das von der Erziehung bei der Frau erzeugte Talent zur schmeichelnden, schmachtenden Bitte. Zwar existiert diese Eigenschaft bei uns kaum, jedenfalls im Vergleich zu den Frauen außerhalb unserer Gemeinschaft; aber es existiert in einer spezifischen Form, die auf unsere Männer trotz ihrer geringeren Intensität wirkt, weil diese die kunstvoll schmachtende Form eurer Frauen ja gar nicht kennen.
Gerade über letztere muss ich Dir, Ausländer, wohl kaum etwas erzählen. Wie ich höre, sind eure in Abgeschiedenheit und Abhängigkeit gehaltenen Frauen da noch wesentlich talentierter!
Jetzt erwartest Du vielleicht noch Dinge zu erfahren, die man bei euch als eine Art spartanischer Skandale ansehen mag, geeignet, die Phantasie zu beschäftigen: das Aushalten von Schmerzen, Spiele, bei denen auch Frauen nackt auftreten, und was da sonst noch über uns an Gerede umläuft.
Für mein Thema sind all dies Randerscheinungen oder Übertreibungen oder folkloristische Überbleibsel. Es bleibt noch eine Eigentümlichkeit zu berichten: die konsequente Erziehung zu Gehorsam. Diese durchzieht bei uns wegen der Heloten das gesamte Leben, während sie bei euch im Grunde nur in Zeiten des Krieges gefordert ist, meist mit geringem Erfolg, da sie euch nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist.
Der Erziehung zum Gehorsam dienen viele einzelne Elemente. Eines von diesen will ich hier – abseits von folkoristischer Ausmalung – kurz schildern. Wie Du weißt, leben die Jungen bei uns von der Zeit, in der ihre Körper sich kräftigen, bis zur Mannhaftigkeit in Gruppen. Nein, ich müsste diese Gruppen Einheiten nennen, denn sie nehmen die taktischen Körper vorweg, in denen sie später kämpfen müssen: sie haben einen Kommandanten, der den nötigen Gehorsam auch mit dem Stock erzwingen kann. Man findet bei uns kaum eine Einheit von Jungen, die – selbst innerhalb der Stadt – nicht in einer Marschordnung daherzieht unter der Führung des Kommandanten, wir nennen ihn „Paidonomos“, was so viel heißt wie „Gesetz für die Knaben“. Falls dieser Paidonomos einmal nicht zugegen sein sollte, so darf jeder erwachsene Vollbürger das Kommando über eine Einheit übernehmen und Verfehlungen mit Schlägen strafen. So sind unsere Jungen eigentlich nie ohne Aufsicht und Kommando.
Du wirst einwenden:
'Wenn jeder solch ein Kommando übernehmen und strafen darf, so ist doch die Gefahr von Missbrauch groß. Wir kennen doch genug schlechte Menschen, die ihre bösen Triebe an Schutzbefohlenen ausleben.'
Nun, ich kann dir versichern, dass dies bei uns nicht geschieht. Zunächst einmal leben wir ja sehr eng zusammen, sodass schon hierdurch jeder jeden kontrolliert; weiter hat natürlich solche ein Erwachsener, der zeitweise den Paidonomos ersetzt, wieder seine Vorgesetzten. Im Übrigen wirkt auch unsere Rhethra in Richtung dieses Ziels. Beide zusammen erzeugen eine wirksame Kontrolle des Verhaltens dieser Erwachsenen.
Du wirst weiter einwenden:
'Archidamos, solch eine dauernde Erziehung zum Gehorsam, besonders die Schläge, bewirkt doch beim Einzelnen, dass er nur noch geduckt einhergeht und keinen eigenen Gedanken mehr fasst.'
Ich antworte, dass unsere Rhetra ein Gegengewicht zu solch einer Haltung bereithält: die dauernden Leibesübungen, die sehr oft in Form von Wettkämpfen stattfinden. Hier kann der Einzelne danach streben über die anderen hinauszuwachsen; für das Streben nach diesem Hervorragen über die Einheit gibt es keine Gehorsamsschranke. Ich kenne viele unserer Jugendlichen, die des Achilles Wahlspruch als den ihren genommen hatten: Aiein aristeuein – immer der Beste sein.
Ich will nicht verschweigen, dass diese Kombination aus Gehorsam und Wettkampf zu Verletzungen führt, die im Aushalten von Schmerzen münden. Von dort aus ist für euch Ausländer eine ganze Serie von Skandalerzählungen entstanden, so etwa die von dem Jungen, dem der junge Fuchs die Brust zerkratzt. Aber dies gehört nicht zu meinem eigentlichen Thema.
Wenn ich zusammenfassen sollte, wie man sich bei uns fühlt, so würde mir zuerst der Stolz auf die Zugehörigkeit zu einer solchen Gemeinschaft einfallen: in Gleichheit des Besitzes und des Verhaltens zusammenlebend, ohne die Anreize zu Bürgerzwist wie in anderen Poleis, werden wir überall außerhalb der Stadt mit Bewunderung oder zum mindesten mit Staunen angesehen. So kommt es, dass unsere Menschen äußerst stolz wirken, trotz ihres dauernden Gehorsams.
Aber ich würde unehrlich sein, wenn ich nicht auch folgendes bemerkte und mitteilte: Gerade diese Fixierung auf die Gemeinschaft und ihre Gebote bringt Denkweisen hervor, die bei den meisten von uns wenig durch Flexibilität geprägt sind. Denn wir sind ja nur mit den engen Verhaltensweisen der Gemeinschaft beschäftigt, sind kaum interessiert an den Dingen außerhalb, sei es aus Gleichgültigkeit, sei es aus Verachtung. Selbst das Streben, der Erste, der Beste zu sein, dieses Gegengewicht gegen zu große Einförmigkeit, bezieht sich ja nur auf die Sitten, Regeln und Gebräuche unserer engen Gemeinschaft.
Gerade in meiner Zeit, der Zeit vor dem Großen Kriege, beobachte ich aus meinem etwas hervorgehobenen Blickwinkel, dass die einengenden Faktoren unseres Lebens immer stärker die freie Erfassung der politischen Faktoren hemmen.
Diese Wahrnehmung habe nur ich und einige ganz Wenige. Bei mir entstand sie durch meine zweite Ehe, meinen behinderten Sohn, meine hervorgehobene Stellung mit ihren Außenkontakten, etwa den zu Perikles. Diese Kontakte schienen mir für meine Position erforderlich, ich habe sie jedoch auch aus einer Art Neugier gesucht. Im Unterschied zu Leuten wie Pausanias jedoch blieb dies reine Neugierde, nicht die Gier so zu leben wie die Leute außerhalb unserer Gemeinschaft.
Athens Seeherrschaft und unser Peloponnesischer Bund: Die Eigenart der zwei Bündnisse
Bisher schrieb ich Dir Grundinformationen zu Griechenland, zu meiner Stadt und zur Bildung des Seereiches der Athener. Du sollst Dich schnell auf das Thema des Großen Krieges einstellen können: deshalb darf hier eine Beschreibung des jetzigen Zustandes der beiden Bündnisse nicht fehlen.
Man darf da nicht nachlässig sein in der gedanklichen Erfassung. Sonst passiert einem, was vielen meiner Mitbürger unterläuft, die geistig eher unbeweglich sind: sie sehen weiter die Welt nur aus Sicht unserer einen Stadt, bekommen höchstens noch mit, was einer unserer Bundesgenossen uns mitteilt. Tatsächlich aber ist unsere Stadt, obwohl sie so tief in dem Peloponnes liegt, durch den Peloponnesischen Bund mit dessen Seestädten immer auch in Kontakt mit Entwicklungen auf See – selbst gegen ihren Willen existiert dieser Kontakt. Denke nur an das große Korinth, wie sehr diese Seestadt als unser Hauptverbündeter uns in das Geschehen auch außerhalb von Hellas verwickeln kann! Das bedeutet hier: bis nach Karchedon und den Säulen des Herkles, zu den italischen Etruskern, den Illyrern hoch im Norden unserer ionischen Inseln, aber auch zu den Persern und dem Pontos, schließlich zu den Ägyptern und den Völkern in Palästina und Syrien.
Das Bündnis selbst führt also dazu, dass man in eventuelle Konflikte, die die Bundesgenossen mit Städten in diesen genannten Gegenden haben, selbst leicht verwickelt werden kann. Daraus entsteht die Frage, inwieweit die Führungsmacht eines solchen Bündnisses über all das informiert ist und in welchem Maße sie Stellung nimmt. Zwischen den Polen des Desinteresses und der sofortigen Einmischung gibt es unzählige Möglichkeiten. Bei uns ins Sparta herrscht oft das Desinteresse vor ...
Ich werde mit dem beginnen, was Dir, Leser, schon etwas bekannt ist: mit dem Attischen Seebund, besser: dem Seereich der Athener, und zwar durch einen Vergleich der Haupteigenschaften dieses Seereiches mit unserem Peloponnesischen Bund. Nur im Vergleich wird für Dich jetzt schon klar, wo die Unterschiede der beiden Haupt-Bündnisse liegen. Falls Du jetzt schon Einzelheiten zum athenischen Seereich wissen willst, solltest Du in den Kapiteln „Athen prescht vor“ und „Athen konsolidiert sein Seereich“ nachlesen, welches die Zeit nach unserem Sieg gegen die Perser beschreibt.
Im Reich der Athener bestimmt nur einer die Politik: der Hegemon, also Athen. Seine Bündner hatten sich ursprünglich einmal zum Kampf gegen den Perser dem Bündnis angeschlossen und sind jetzt unselbstständig. Diejenigen, die ihre Selbstständigkeit zurückerlangen wollten, wurden mit Gewalt erneut in den Seebund gezwungen. So passierte es zuerst der Insel Naxos im 14. Jahr nach Salamis: sie wurde entgegen dem Bündnisvertrag daran gehindert aus dem Seebund auszutreten.
Athen aber herrscht nicht nur durch seine eigene militärische Macht, sondern auch dadurch, dass es bei den Mitgliedern seines Reiches diejenigen bevorteilt, die jetzt in ihrer jeweiligen Stadt mit Hilfe Athens die früher herrschenden Aristokraten unterdrücken. Durch Athen stehen dort jetzt fast überall Demokraten an der Spitze. Athen unterstützte also überall die Entstehung von Demokratien. Es hatte damit bis zur Niederschlagung der ersten Aufstände von Bundesgenossen noch großen Erfolg, weil die Menschen eben meinen, dass in solch einer Demokratie das Volk herrsche, also die Mehrheit der Menschen.
Tatsächlich kann aber Demokratie bei diesen unselbstständigen Mitgliedern des Seereiches ganz viele Bedeutungen und Formen annehmen. Ich führe sie hier auf drei Typen zurück:
Es herrscht jetzt statt der alten Aristokratie eine Fraktion derselben, denn auch früher hatten sich ja schon adlige Familien zerstritten und um die Führung gekämpft. Diese Möglichkeit ist auch diejenige, die eigentlich in Athen herrscht. Denn es ist ja allgemein bekannt, dass Perikles, der führende Kopf Athens, aus dem uraltem Adelsgeschlecht der Alkmaioniden abstammt.
Es herrscht eine mittlere Gruppe der Gesamtbevölkerung, vom Beruf her Handwerksmeister, Besitzer von Manufakturen und Handels-Unternehmer. Diese Leute wehren die gesamte alte Aristokratie ab, aber auch diejenigen Volksgruppen, die es in dieser Stadt unter ihnen selbst gibt.
Ja, es gibt sogar einige Städte im Seereich, in denen diese unteren Volksgruppen herrschen, wobei sie hier auf Teile der gerade genannten mittleren Gruppe rechnen können, teils sogar auf Einzelne aus der Aristokratie, die dadurch sich an die Spitze ihrer Stadt stellen wollen, eben unter dem Schein einer Volks-Herrschaft.
Wichtig für den Seebund ist einfach nur: