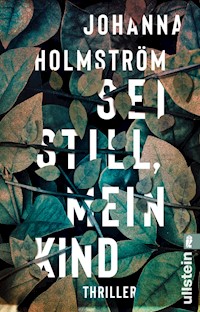8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Klug, rebellisch und bei aller Dunkelheit durchdrungen von zartem Humor Leilas finnische Mutter ist zum Islam konvertiert. Seitdem interessiert sie sich nur noch für die korrekte Auslegung des Korans. Sogar Familienfotos sind verboten. Leilas Vater kommt aus dem Maghreb und ist selbst Muslim – aber dieser Fanatismus ist ihm viel zu anstrengend. Und ihre große Schwester Samira ist längst vor dieser verrückten Familie geflohen. Alleine ist es schwer für Leila, zu Hause den Verstand nicht zu verlieren. Dann wird Samira eines Tages schwer verletzt am Fuß einer Treppe gefunden. Ist sie gefallen? Oder wurde sie gestoßen? Leila versucht herauszufinden, was mit ihrer Schwester passiert ist. Das Leben zwischen den Kulturen ist gefährlich, besonders für Mädchen. Aber Leila weigert sich, Opfer zu sein. Asphaltengel ist einer der beeindruckendsten und hinreißendsten Romane seit langem.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Über das Buch
Leilas finnische Mutter ist zum Islam konvertiert. Seitdem interessiert sie sich nur noch für die korrekte Auslegung des Korans. Sogar Familienfotos sind verboten. Leilas Vater kommt aus dem Maghreb und ist selbst Muslim – aber dieser Fanatismus ist ihm viel zu anstrengend. Und ihre große Schwester Samira ist längst vor dieser verrückten Familie geflohen. Alleine ist es schwer für Leila, zu Hause den Verstand nicht zu verlieren. Dann wird Samira eines Tages schwer verletzt am Fuß einer Treppe gefunden. Ist sie gefallen? Oder wurde sie gestoßen? Leila versucht herauszufinden, was mit ihrer Schwester passiert ist. Das Leben zwischen den Kulturen ist gefährlich, besonders für Mädchen. Aber Leila weigert sich, Opfer zu sein.
»Ein humorvoller und intelligenter Roman über die alltäglicheren Probleme des Islams. Zynisch, ehrlich und zugleich hoffnungsvoll.« Dagens Nyheter
»Eine rebellische, funkelnde und schwarzhumorige Verteidigungsrede aller jungen Frauen.« Göteborgs-Posten
Über die Autorin
Johanna Holmström wurde 1981 in Sibbo geboren. Sie gehört der schwedischsprachigen Minderheit in Finnland an. Seit einigen Jahren lebt sie mit ihren zwei Töchtern in Helsinki und war lange mit einem Araber verheiratet. Sie ist Journalistin und studiert arabische Literaturwissenschaft. Für ihre Erzählungen erhielt sie unter anderem den Literaturpreis des Svenska Dagbladet. Asphaltengel wurde von der finnischen und schwedischen Presse hymnisch besprochen.
Johanna
Holmström
Asphaltengel
Roman
Aus dem Finnlandschwedischen
von Wibke Kuhn
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel Asfaltsänglar
beim Verlag Schildts & Söderströms, Helsinki
Der Verlag dankt FILI für die Förderung der Übersetzung
ISBN 978-3-8437-0959-0
© 2013 by Johanna Holmström
© der deutschsprachigen Ausgabe
2014 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung: semper smile Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: shutterstock / Flas100
Alle Rechte vorbehalten.
Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung,
Verbreitung, Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich
verfolgt werden.
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Für alle Mädchen, die schon mal in einem viel zu kurzen Rock ausgegangen sind.
Only God can judge me, is that right?
Nobody else, nobody else
All you other motherfuckers get out of my business
2 PAC
Oktober 2005
Samira
Kapitel 1
Samira in der Jungfrugränden
Jede verheiratete Frau ist eine Hure.
Sagte Samira, warf sich ihre Tasche über die Schulter und verschwand mit entschlossenen Schritten über die Jungfrugränden. Die Hände hatte sie in die Taschen ihrer kurzen schwarzen Lederjacke gesteckt und das Kinn in ihrem blauen Schal vergraben. Das dunkle Haar fiel ihr in wilden Locken offen auf die Schultern. Ihre hohen Absätze klapperten auf dem Asphalt.
Herbst. Ahorn, Ebereschen und Lügen schwelten leise vor sich hin, und morgens zog sich der Raureif in einem gehauchten Band über die Wiese.
Hinter der Kneipe Valkeat Yöt, wo jetzt schon die Hobbyalkoholiker saßen und in ihr erstes Bier starrten, wartete bereits das Taxi.
Sie beschleunigte ihre Schritte, legte das letzte Stück fast schon im Laufschritt zurück. Ihren Koffer warf sie auf den Rücksitz, sie selbst stieg vorne ein. Das Taxi fuhr los, langsam zunächst, aber sobald es über die Temposchwelle an der Bushaltestelle gefahren war, gab der Fahrer Gas, und der Wagen verschwand.
Oktober 2007
Leila
Kapitel 2
Wie die Überbleibsel von Samiras Leben versteckt und wiedergefunden werden
In einer schlaflosen Nacht vergrabe ich Samiras Leben im Rasen unter unserem Balkon. Das Metallblatt des Spatens gräbt sich tief in die Erde, und ich schwitze in meiner Daunenjacke, als ich die Tüte in der kleinen Grube versenke. Anschließend bedecke ich alles wieder mit einer dicken Schicht Erde.
Am Himmel sind keine Sterne zu sehen. Nur die Fernseher blinken mir aus den dunklen Wohnzimmern entgegen, in den Reihenhäusern, wo die glücklichen Familien wohnen.
Bei Jotunens ist das Rollo heruntergezogen, aber ich weiß noch, wie Samira und ich immer vor ihrem Fenster standen und heimlich die Talentshows mit anguckten – ohne Ton. Ihre Wange so nah an meiner, dass sich unser Atem vermischte.
Die Nacht ist kühl, und die Straßenlaternen sind schon früh angegangen. Ich trample die aufgegrabene Stelle ein bisschen glatt, damit sie nicht so ins Auge fällt, und klettere auf demselben Weg zurück, auf dem ich gekommen bin. Über den Balkon.
In Mamas Zimmer brennt Licht, und ich höre das Geräusch ihrer Computertastatur. Sie sitzt wieder am PC und diskutiert mit ihren Glaubensschwestern in der finnischen umma die halal und haram ihrer Religion. Sie kann auch nicht schlafen. Stattdessen bleibt sie so lange wie möglich auf, um Qiyam al-lail zu beten, eines der freiwilligen Nachtgebete. Um sich die Zeit zu vertreiben, chattet sie im Internet.
Später höre ich sie in der Küche, wo sie alle Messer und anderen scharfen Gegenstände wegräumt, die offen herumliegen. Sie legt sie vor dem Schlafengehen an einen sicheren Platz, weil der Prophet Mohammed gesagt hat, dass man das so machen soll.
Am nächsten Morgen ist der Rasen unter unserem Balkon abgesperrt. Zwischen den Ahornbäumen hat man gelbe Plastikbänder gespannt, auf denen »POLIISI – POLIZEI« steht. Die Bewohner unseres Hauses und der benachbarten Reihenhäuser haben sich rund um das Loch in der Erde versammelt, fast wie bei einer Beerdigung. Man flüstert sich zu, dass in der Nachbarschaft Sachen verschwunden sind, Stereoanlagen, Autoreifen, der eine oder andere Hund, und jetzt erwartet man, dass gleich eine Pfote oder ein Stück Gummi auftaucht.
Stattdessen: eine dünne weiße Plastiktüte von »Alis Halal« unter einer dicken Schicht Erde. Überraschtes Gemurmel, das klickende Geräusch von Feuerzeugen. Man hält mir die Plastiktüte vor die Nase. Ich stehe am äußeren Rand des Kreises und versuche, in der Kapuze meiner Jacke zu verschwinden. Ich nehme die Tüte und halte den Kopf angemessen gesenkt. Nachdem ich die Überbleibsel von Samira in Empfang genommen habe, werde ich noch streng ermahnt, so etwas nicht wieder zu tun.
Der Herbst wartet schon um die Ecke und bläst mir seine Kühle ins Gesicht. Mama in einem langen weißen Bademantel, der ihr bis zu den Knöcheln reicht, einen Handtuchturban auf dem Kopf. Sie starrt die Polizisten mit einer Miene an, dass sie verlegen die Blicke abwenden, als wäre nicht ich diejenige, die etwas Ungesetzliches gemacht hat, sondern sie. Dabei tun sie bloß ihre Arbeit.
Man habe einen Hinweis bekommen, sagt der eine Polizist, dass sich auf dem abgesperrten Rasenviereck irgendetwas Verdächtiges abgespielt habe.
»Und nicht nur das. Hier in der Gegend sind ja auch Sachen verschwunden«, fährt der Polizist fort, der langsam wieder zu seiner respekteinflößenden Pose zurückfindet. »Autoreifen und …«
»Autoreifen! Meine Tochter ist noch nicht mal fünfzehn, die wird ja wohl kaum durchs Viertel laufen und Autoreifen stehlen!«, ruft Mama.
»Es waren auch noch andere Sachen, Hausrat … man kann ja nie ganz sicher sein.«
»Tja, in einer Hinsicht können Sie ganz sicher sein, nämlich dass ich keine Autodiebin großgezogen habe«, antwortet Mama.
»Ja, sieht wohl so aus«, stellt der Polizist fest.
Mama schweigt einen Moment, dann sagt sie:
»Ich würde ja zu gern wissen, wer Ihnen diesen Tipp gegeben hat.«
»Tja … das können wir leider nicht sagen …«, antwortet der Polizist. Doch Mama hat aus dem Augenwinkel schon eine Bewegung wahrgenommen.
Markku Jotunen macht ein paar Schritte zurück und steckt sich eine Zigarette an. Mamas Augen verengen sich.
»Das hätte ich mir ja gleich denken können«, murmelt sie, dreht sich um und teilt Blicke wie Ohrfeigen an die Nachbarn aus, die im Kreis um den schlaffen Rhododendronbusch stehen.
Den hat die Stadt im Sommer gepflanzt, damit die Gegend ein bisschen netter aussieht, aber er wird den Winter wohl kaum überstehen.
Dann geht sie wieder ins Haus. Ich folge ihr. Die Plastiktüte schlägt gegen mein Bein. Der verbotene Inhalt tritt seine letzte Reise an, die Treppe hinauf und in unsere Küche.
»Ich dachte, wir hätten das weggeworfen«, sagt Mama und lässt den Stapel Fotos auf ihren Schoß sinken.
Unsere lächelnden Gesichter grinsen uns von den Bildern entgegen. Samira und ich, zwei braunäugige Kinder mit ebenmäßigen Zähnen und blinzelnden Augen. Die Sonne lässt unsere Gesichter in dunklen Schatten verschwinden.
Mama schaut mich mit einem Blick an, der mir bis ins nafs zu dringen scheint.
»Du weißt genauso gut wie ich, dass wir die nicht aufheben können.«
»Aber die sind doch …«
»Haram, Leila. Sie sind haram. Wie lange hast du die schon?«
»Samira hat sie sich zurückgeholt, nachdem du sie weggeschmissen hattest. Sie hat sie zur Mülltonne rausgebracht, aber es nicht übers Herz gebracht, die Bilder … Sie hat sie aufbewahrt, bis …«
Ich sitze auf meinen Händen und weiche ihrem Blick aus. Ihr Daumen liegt auf meinem Gesicht. Er verdeckt meinen gelben Badeanzug, die aufblasbaren Schwimmflügel, meine zaundürren Beine, die an der Stelle abgeschnitten werden, wo die Wasseroberfläche sie schluckt. Ich presse die Lippen zusammen. Dann klickt ein Feuerzeug, und eine blasse Flamme leckt an den Rändern unserer bunten Kodakmomente.
Samira im Ballettkleidchen – verkohlt. Ich auf einem fetten Pony vor sommergrünem Hintergrund – Asche. Unsere aneinandergeschmiegten Wangen, ein Grinsen, so breit, dass einem die Kiefer wehtun – vom Feuer verzehrt. Eine in die Kamera winkende Samira, die einen knallroten Schlitten in der Hand hält, der Handschuh so schneeschwer, dass er ihr fast von der Hand rutscht, die Haare, die ihr offen über die Schultern fallen, und die braune Cordjacke mit Kapuze und Teddyfutter. Ich, vielleicht ein Jahr alt, im Sitzen, mit einem kunterbunten Paket im Arm, Samira, die gerade gehen gelernt hat, das runde Gesicht und die dunklen Augen schauen zur Kamera hinauf, und Mama und Papa, damals noch glücklich, vor einem glitzernden Weihnachtsbaum mit roten Christbaumkugeln.
Als ich zu ihr aufblicke, sehe ich, dass sie die Lippen ebenfalls zusammenpresst. Dann dreht sie sich weg und sorgt dafür, dass das Feuer in der Spüle unsere Erinnerungen in Rauch aufgehen lässt.
Ich gehe in mein Zimmer, ohne dass sie es mir befehlen müsste, und mache meinen Schrank auf. Früher war das mal unser Wohnzimmerschrank, in dem auch unser Fernseher stand, bis Mama erfuhr, dass die Bilder im Fernsehen ebenfalls verboten waren, und der Apparat fortmusste.
»Haram!«, sagt Mama. Verboten. In einem Haus, in dem es Fotos gibt, wird sich niemals ein Engel zeigen.
Und ein Haus, das die Engel verlassen haben …
Papa und ich versuchten damals zu argumentieren, dass die Bilder ja gewissermaßen nicht im Fernseher sind, sondern durch den Raum schweben und körperlich gar nicht existieren, doch Mama entgegnete, das sei ganz egal, weil die meisten Fernsehbilder sowieso viel zu sündhaft seien. Da kam Werbung für Tampons in der Sprache des Propheten und türkische Popsongs, die sich allesamt nur um zinaa drehten. In Tiersendungen trieben Affen und Löwen verbotene Dinge, und in den Fernsehserien wurde unablässig geflucht. Da wurden Männer gezeigt, die beim Pilgergebet am heiligen Stein, der Ka’ba in Mekka, einschliefen, und Sportlerinnen in hautenger Elastankluft, die mehr enthüllte als verdeckte. Daher war es besser, überhaupt nichts mehr zu sehen und sich stattdessen gedanklich mit Gott zu beschäftigen und dhikr zu machen. So entschied Mama, und damit trug sie den Fernseher zum letzten Mal in den Keller.
Wenn Mama etwas entscheidet, ist sie nicht mehr umzustimmen, und deswegen ist der Platz, an dem früher der Fernseher stand, jetzt leer. Im Schrank liegen bündelweise Fotos. Ich sehe sie durch, bis ich plötzlich eines in der Hand halte, das ich schon fast vergessen hatte.
Mama und Papa am Strand, weit entfernt in Zeit und Raum. Die Luft ist hellblau. Lila am Horizont. Sie haben die ganze Nacht hindurch gestritten, ihre Augen sind verheult und müde, sandig von dem ganzen Dreck, den sie sich gegenseitig ins Gesicht geworfen haben, seit sie ihren hitzigen Wortwechsel begonnen haben.
Jetzt treffen sich ihre Blicke. Sie haben die Nacht überstanden, nun kommt das Licht zurück. Bald werden alle erwachen, die Vögel zwischen den Kastanienblüten und auch die Taxifahrer, die in ihren Autos gedöst haben. Aber in diesem Moment fühlt es sich noch so an, als wären sie vollkommen allein auf der Welt.
Im Hintergrund spielt Stevie Wonders Ribbon in the Sky, und ihre Hände finden sich, halten einander kurz fest. Dann gleiten sie wieder auseinander, bis sich nur noch die Fingerspitzen leicht berühren. Stevie fängt an zu singen, ganz sachte: If allowed, may I touch your hand, and if pleased, may I once again, so that you too will understand, there’s a ribbon in the sky for our love.
Das Ganze ist viel zu kitschig, um wahr zu sein. Meine Mutter. Mein Vater. Der Strand und der Morgen, der niemals anbricht. So hat Papa es mir erzählt.
Das Bild ist wichtig. Es bedeutet, dass Mama und Papa einmal glücklich gewesen sind. Um sich daran zu erinnern, braucht man Beweisfotos. Ich habe mehrere. Sie liegen sicher verwahrt ganz hinten in meinem Schrank, in dem so ein Chaos herrscht, dass nicht mal Mama, die ansonsten alles unter penibelster Kontrolle hat, Ordnung schaffen kann. Sie sitzt immer nur seufzend davor und sagt:
»Leila …«
Und ich antworte.
»Ja, ja … ich mach schon.«
Und dann bleibt alles beim Alten, bis sie irgendwann wieder in der Stimmung ist.
»In ein Haus, in dem es Bilder gibt, kommen keine Engel«, sagt Mama.
Ich frage sie, ob das für das ganze Haus gilt, und wie sie die Leute dazu bewegen will, die Satellitenschüsseln abzunehmen, die an jedem Balkongeländer montiert sind, oder wie sie unsere Nachbarn zwingen will, ihre Zeitungsabos zu kündigen, was sie selbst schon längst getan hat. Ich frage sie, ob sich die Engel einfach in Zimmern nicht wohlfühlen, in denen sich Bilder befinden, und ob die Engel, die ja eigentlich immer auf meinen Schultern sitzen und meine guten und bösen Taten notieren sollen, gar nicht ins Zimmer kommen können, wenn sich Bilder darin befinden. Ich frage auch, wie es überhaupt sein kann, dass sie immer bei jedem Menschen sind, bei Muslimen wie Nicht-Muslimen, mit ihren Notizblöcken in der Hand, wenn sich doch in den meisten Zimmern Bilder befinden. Ich erinnere Mama daran, dass sie selbst auch Zeit in solchen Räumen verbringt, zumindest in der U-Bahn, wo auf jeder freien Sitzbank Gratiszeitungen liegen, und bei der Arbeit vorm Computer, wo sich auf dem Tisch im Kundenbereich Kreuzfahrtprospekte stapeln.
Aber Mama lässt sich von solchen Details nicht aus dem Konzept bringen. Sie stellt nur fest, dass ich mir nicht den Kopf über das Wie und Wo und Warum zerbrechen soll, denn Gott sieht und hört alles, ganz besonders naseweise Fragen und Mädchen, die ihren Eltern Widerworte geben.
Samira hat mir beigebracht, dass man alles aufheben muss, was man auf der Straße findet, da man nie weiß, wann man es brauchen kann. Deswegen hielt Samira den Blick immer gesenkt auf ihre schwarzen Turnschuhe, die die Straße auf und ab liefen.
Was auf der Straße liegt, muss jemand verloren haben, also war es irgendwann einmal etwas, was jemand gebraucht hat, und deswegen ist es notwendig, sagte sie. Und dann hob sie triumphierend einen braungelben Plastikkamm auf, der halb versteckt unter gelb raschelnden Haufen verwelkten Ahornlaubs lag, und hielt ihn ins Licht. Er war nur ein bisschen abgenutzt, und es fehlten nicht einmal Zinken, wie sonst bei Kämmen, die man auf der Straße findet.
Genau wie Samira hebe ich grundsätzlich alles auf, was ich auf der Straße finde. Haargummis, die dicken und auch die ganz dünnen, mit denen man sich so gut einen Pferdeschwanz machen kann. Samira hatte bestimmt hundert solche dünnen Haargummis, aber auch dicke und weiche. Damit sich das Haar ab und zu erholen kann, meinte sie.
Jedes Mal, wenn ich ein Haargummi finde, denke ich, dass sie es verloren hat. Mein Herz fängt an, wie wild zu klopfen, und ich renne um die Ecke und erwarte sie zu erblicken, aber die Straße ist jedes Mal wieder genauso leer.
Die Leere, die Samira hinterlassen hat. Sie ist überall. Langsam breitet sie ihre Nichtigkeit über alles und lässt es verschwinden.
Doch die Sachen liegen immer noch auf dem Bürgersteig. Kämme, Schmuck (vor allem Ohrringe, ich habe die weltweit größte Sammlung von einzelnen Ohrringen), Schlüssel, Kunstnägel mit kleinen aufgeklebten Strasssteinchen, Büroklammern, Radiergummis, Sicherheitsnadeln, Reflektoren, Handschuhe (meine Sammlung einzelner Handschuhe ist mindestens die zweitgrößte weltweit) und sogar Schuhe. Ich frage mich immer, wie das geht, dass man einen Schuh verliert. Ohne es zu merken.
In meiner Sammlung wertloser Sachen befinden sich auch solche, die früher einmal Samira gehört haben. Manchmal weiß ich nicht, ob ich sie für sie aufbewahre oder ob ich sie übernommen habe, aber eines ist sicher: Sie waren auch in der Plastiktüte, die ich vergraben hatte, damit sie für immer unter einem halben Meter Erde ruhen. Die aber schon am nächsten Tag wieder ausgegraben wurde und nun auf dem Boden meines Zimmers liegt.
Ganz obenauf befindet sich eine blutige Unterhose mit einer gebrauchten Binde. Die blutige Hose ist meine. Die hatte ich einfach gleich noch mit reingesteckt, weil die Tüte ja sowieso vergraben und vergessen werden sollte, und das war besser, als zu versuchen, sie in den Müll zu schmuggeln, vorbei an Mamas wachsamen Augen. Aber dann kam es eben anders, und als sie die Binde fanden, drehte sich der jüngere Polizist mit einem angeekelten Ausruf weg, als müsste er sich gleich übergeben, und der ältere kniff die Lippen zusammen. Eigentlich ganz schön lächerlich, wenn man sich vor Augen hält, dass die im Laufe ihrer Karriere wahrscheinlich schon Köpfe und andere Körperteile aus Gott weiß wie vielen Mülldeponien gegraben haben.
In gewisser Hinsicht kann ich ihre Reaktion verstehen. Während sie unter unserem Rasen nach Autoreifen und Satellitenschüsseln suchten, glaubten sie, ich müsste ein Junge sein. Bis der Inhalt der Tüte das Gegenteil bewies.
Tatsächlich gibt es eine Menge Leute, die glauben, dass ich ein Junge bin. Und meistens habe ich gar nichts dagegen. Wenn ich die Kapuze aufhabe und auf den Boden gucke, kann man eigentlich keinen Unterschied erkennen. Manchmal gehe ich in die Angel Bar, wo die Skinheads sitzen, stelle mich an den Tresen oder die Jukebox, senke die Stimme und rede wie sie. Sie haben keine Ahnung, dass ich ein Mädchen bin, mit ziemlich vielen dunklen Haaren auf dem Kopf, und ich möchte auch gar nicht wissen, was sie tun würden, wenn sie es wüssten.
Ein paar Tage später ist der Rasen immer noch abgesperrt. Ich glaube, die Polizei versucht, die Leute abzulenken, indem sie so tut, als würde hier noch weitergearbeitet, dabei hat sie sich nie mehr vor unserem Balkon sehen lassen.
Kapitel 3
Affen können nicht Bus fahren
In unserer Familie fährt man mit dem Bus. Nicht, weil wir besonders umweltbewusst wären oder so Lifestyle-Hippies. Wir können uns einfach keine Fahrräder leisten, und wir brauchen auch keine. Mama sagt immer, wir sollten froh sein, dass wir in unmittelbarer Nähe der wirklich großartigen öffentlichen Verkehrsmittel wohnen: Die Bushaltestelle ist direkt vor der Haustür, und die U-Bahn-Station nur ein paar Steinwürfe entfernt. Je nachdem, wie gut man werfen kann.
Außerdem ist Papa Busfahrer. Früher fand ich das ganz schön cool, dass manche von ihren Vätern in die Schule gefahren wurden, während mein Vater den ganzen Rest in die Schule fuhr. Aber seit Papa auf Rashids Sofa schläft und mit Mama nur noch streitet und alles andere auch so schrecklich kompliziert geworden ist, versuche ich, wenn ich von der U-Bahn hochkomme, schon aus der Ferne zu erkennen, wer im Bus am Steuer sitzt. Wenn es Papa ist, tue ich so, als müsste ich woandershin. Vielleicht in die Bibliothek. Oder zum Kiosk auf der anderen Straßenseite. Und wenn er vorbeigefahren ist, nehme ich den anderen Bus. Der hält am entgegengesetzten Ende der Siedlung, so dass man einen halben Kilometer mehr laufen muss. Dann gehe ich durch den Laden und kaufe irgendwas, und zu Hause zeige ich meine Einkäufe vor und behaupte, dass ich beim Bäcker vorbeigekommen bin oder so.
Aber wenn die Sonne richtig runterknallt oder wenn es so regnet, dass die Windschutzscheibe des Busses voll schlieriger Streifen ist, kann ich nur einen Arm in blauschwarzer Uniform mit eingenähten Reflektoren erkennen oder ein Käppi, das jeder aufhaben könnte. Dann muss ich mit allen anderen die Straße überqueren und in den Bus steigen.
Wenn Papa am Steuer sitzt, starre ich unablässig auf meine Schuhe, bis ich meine Karte abstempeln muss, blicke verstohlen auf und nicke kurz, und er nickt unmerklich zurück. Manchmal fasst er mich am Arm und flüstert mir zu, dass ich Mama dies oder jenes ausrichten soll. An solchen Tagen versuche ich mich so hinzusetzen, dass er mich nicht im Rückspiegel sehen kann, während ich mich frage, warum er ausgerechnet diese Tour fahren muss. Wo er doch weiß, dass Mama mich, sobald ich durch die Haustür komme, sofort fragen wird, ob Papa gefahren ist.
Am schlimmsten ist es aber immer, mit Papa zu fahren, wenn er mal wieder wütend auf die ganze Welt ist und zu schnell fährt. Dann mache ich mich ganz klein auf meinem Sitz und spanne die Bauchmuskeln an, während ich den Haltegriff so fest umklammere, dass meine Hand ganz kalt wird. Manchmal murmelt jemand etwas von Verkehrsrowdys und Verkehrsregeln, und ich versinke noch tiefer auf meinem Sitz und starre in den Straßengraben.
Einmal konnten wir nicht weiterfahren, und das mitten in der Rushhour. Die hintere Tür ging nicht mehr zu – sie hatte sich am Bordstein verkeilt und saß fest wie so ein Himbeerkernchen in einem Zahn. Die Leute hatten es eilig und wurden immer gereizter.
Anfangs versuchten sie Papa noch gute Ratschläge zuzurufen, und ich sah an seinen Augen, wie er langsam nervös wurde. Schwitzend fummelte und hantierte er an der Tür herum, aber nichts tat sich. Die Tür hatte sich hoffnungslos verkeilt, und der Bus rührte sich nicht vom Fleck. Er pfiff auf die Tipps, die ihm die Fahrgäste immer wütender zuriefen, setzte sich ans Steuer und begann panisch, abwechselnd Gas zu geben und zu bremsen. Der Bus bewegte sich zehn Zentimeter vorwärts, um dann gleich wieder zurückzurollen.
Die Minuten verstrichen quälend langsam. Die Stimmung im Bus schlug um. Man grinste sich an. Ich sah es schon in ihren Gesichtern. Und dann sagte einer:
»Diese Scheißneger immer …« Und die anderen lachten und nickten.
Mütter mit Kindern, Rentner, junge Männer im Anzug, alle hatten sie bloß darauf gewartet, dass jemand genug Mut besaß, es laut auszusprechen, und nun stimmten sie schmunzelnd zu.
»Scheißaffe. Geh doch zurück nach Afrika, wenn du nicht mal Bus fahren kannst.«
Irgendjemand machte einen Affen nach, und ich wartete. Ich sah Papas Augen im Rückspiegel. Unsere Blicke trafen sich kurz, und ich wusste, dass er nichts sagen oder machen würde. Nicht, solange ich dabei war. Dabei hätte ich mir nichts sehnlicher gewünscht.
Als der Bus endlich loskam und er mit hämischem Applaus und Pfiffen belohnt wurde, musste ich die Zähne zusammenbeißen, um nicht loszuheulen. Es fühlte sich genauso an, wie wenn jemand im Klassenzimmer Anna den Papierkorb über den Kopf stülpte und sie einfach sitzen blieb, ohne ihn abzunehmen, während die anderen klatschten und immer weitermachten.
Ich hielt mir die Hand vor den Mund und starrte auf die Straße, die schneller und schneller vorüberglitt, während der Bus befreit seinem Ziel entgegengaloppierte. Als ich ausstieg, ging ich nicht wie sonst zur Vordertür, und ich blickte auch nicht mehr auf. Ich stieg aus wie jeder andere Fahrgast, und auf dem Heimweg hoffte ich, dass Mama nicht zu Hause war.
Kapitel 4
Großmutter und Morra
Wenn Mama nicht gerade mit Papa oder Samira streitet, dann streitet sie mit Großmutter. Früher hat sie auch mit Großvater gestritten, aber der ist vor ein paar Jahren im Sommer plötzlich gestorben, und ihr letzter Streit konnte nicht mehr abgeschlossen werden. Nach Großvaters Tod lief Mama mehrere Wochen mit ganz leerem Blick herum. Sie sah aus wie die Male, als Papa ohne einen Cent von dem ganzen mitgenommenen Geld aus Dar El-Shams zurückkam. Sie fühlte sich immer so hintergangen, wenn sie am Geldautomaten stand und feststellen musste, dass das ganze Konto leergeräumt worden war.
Mama und Großvater bekamen nie Gelegenheit, fertigzustreiten. Nicht so wie Mama und Großmutter. Die haben noch jede Menge Zeit. Aber so sehr sie auch streiten, es sieht so aus, als würden sie nie richtig fertig werden. Jedes Mal, wenn wir zu Großmutter fahren, sagt Mama, dass sie dieses Mal, inshaallah, ganz bestimmt keine schlechte Laune bekommen wird. Diesmal wird es, so Gott will, richtig, richtig nett werden.
Und vielleicht geht es die erste halbe Stunde tatsächlich ganz gut, solange sie bloß auf dem Hof spazieren gehen und Großmutter Gunni mit ihren Sommerskistöcken auf die Krokusse zeigt, die ihre blauen Köpfe verdutzt aus der kalten Erde gereckt haben, um nachzusehen, wer ihren Schlaf stört. Es geht auch noch nett weiter, wenn Mama in den Birken nach Fledermäusen Ausschau hält und Gott für all die Schönheiten der Welt mit einem mashaallah dankt, allerdings ganz leise, damit Großmutter es nicht hört. Die mag es nämlich nicht, wenn Mama Arabisch spricht, obwohl das Gottes Sprache ist. Doch sobald wir uns an die Kaffeetafel gesetzt haben, passiert es. Eine von beiden – wenn man sie fragen würde, würde natürlich jede behaupten, dass es die andere war – marschiert zielstrebig auf ein Minenfeld, und schon stecken wir mitten in Verteidigungsstrategien und Luftangriffen, und wenig später ist ein astreiner Atomkrieg entbrannt.
Später wird genau ermittelt, wer was gesagt und getan hat, und dann sitzt man da wie der Internationale Gerichtshof in Den Haag und verhängt mittellange Strafen für Kriegsverbrechen, während die beiden sich immer noch feindselig gegenübersitzen und sich misstrauisch mit dem Fernglas beobachten, damit sie bei der geringsten falschen Grimasse gleich wieder losfeuern können.
Eigentlich ist mir gar nicht so richtig klar, was für ein Grund hinter diesen Streitereien steckt, und wenn ich Mama frage, schüttelt sie bloß den Kopf und sagt:
»Sie beherrscht einfach die Kunst, einen Menschen wahnsinnig zu machen. Sie weiß genau, welche Knöpfe sie bei mir drücken muss, um mich …«
Und wenn man Großmutter fragt, sagt sie:
»So war sie schon immer. So überempfindlich. Schon als Kind. Man konnte nichts sagen, ohne dass sie sich gleich auf den Schlips getreten fühlte.«
Als Samira noch dabei war, sagte sie immer:
»Herrgott, ich will von dem ganzen Blödsinn echt nichts hören! Okay?«
Mama behauptet, dass Großmutter »anstrengend« ist. Jünger sein möchte, als sie ist. Sich nach Kräften amüsieren will und sich dafür immer die völlig falsche Art aussucht.
Großmutter ist schon über sechzig, aber es kann immer noch jederzeit vorkommen – vor allem im Sommer –, dass sie mit ihren Freundinnen ins Auto springt, und dann fahren sie alle zusammen kreischend und johlend los, lassen das frisch gefärbte Haar im Wind flattern und gehen in der Stadt in die Kneipe. Da trinken sie dann Mai Tais und tanzen. Ich glaube, vor allem das mit dem Tanzen bringt Mama auf die Palme.
Frauen wie Großmutter und ihre Freundinnen sehe ich fast jedes Mal, wenn ich ins Trix gehe. Sie sind grundsätzlich am betrunkensten. Sie haben grundsätzlich die engsten Kleider an, mit Glitzer und Leopardenmuster, und sie machen grundsätzlich die wildesten Posen auf der Tanzfläche. Außerdem machen sie im Trix alles völlig falsch. Wenn der DJ alte finnische Scheißsongs auflegt, damit die Leute aufhören zu tanzen und stattdessen Getränke kaufen, rennen solche Frauen wie Großmutter Gunni los und stellen sich mitten auf die Tanzfläche. Sie recken einen Finger in die Luft und nicken mit dem Kopf, dass ihnen die Haare ins Gesicht fallen, während sie zu Nahkatakkinen tyttö rumspringen.
Und dann könnte man meinen, sie hätten einen Elektroschock von einem der Kabel unterm DJ-Pult abgekriegt. Sie beginnen, den ganzen Körper zu schütteln, so dass die Umstehenden erschrocken zurückweichen. Und wenn sie so tun, als würden sie sich die Nase zuhalten und untertauchen, während sie powackelnd in die Knie gehen, zeigen wir mit dem Finger auf sie, stoßen uns gegenseitig mit dem Ellenbogen in die Seite und lachen.
Ich kann verstehen, dass Mama es nicht mag, wenn jemand über Großmutter lacht. Schließlich hat sie drei Kinder geboren und großgezogen, von denen eines meine Mutter ist. So ein Mensch muss mit Respekt behandelt werden, sagt der Prophet Mohammed. Doch Großmutter will das Leben genießen. Sie will sich die grauen Strähnen färben, die man dann ein paar Monate später am Scheitel nachwachsen sieht, und manchmal will sie sich an einem Wochentag völlig grundlos betrinken, nur um zu spüren, wie es im ganzen Körper rauscht. Sie will sich unpassende Klamotten anziehen und ausgehen und tanzen und so laut und hässlich lachen, dass die Leute sich nach ihr umdrehen. Ich weiß, dass Mama und Großmutter sich darüber streiten, aber das ist nicht ihr Lieblingsthema. Ihr Lieblingsthema, auf das sie immer wieder zurückkommen, ist Mama selbst.
Von Mama sagt man, dass sie über Nacht religiös wurde. Und wenn man das sagt, senkt man die Stimme und schaut sich verstohlen um, und dann murmelt man es seinem Gegenüber ganz im Vertrauen zu. Als würde man sagen, dass jemand über Nacht verrückt geworden ist oder ganz plötzlich gestorben. Mama selbst schnaubt nur, wenn sie das hört. Sie sagt, dass sie »zu Gott zurückgefunden hat«.
Auf jeden Fall wird sie niemals so werden wie Großmutter. Jedes Mal, wenn ich das höre, muss ich innerlich lachen, denn ich kenne niemanden, der Großmutter ähnlicher ist als Mama in diesem Moment.
Wer über Nacht religiös wird, der schafft einen gewissen Abstand zwischen sich und den anderen. Wie ein Tuch. Mama nennt dieses Tuch hijab.
Mama fing an, den hijab zu tragen, als sie schon ein Jahr mit Papa in Dar El-Shams wohnte, kurz nach Samiras Geburt.
»Das machte es einem leichter. Man wurde einfach mit Respekt behandelt …«, seufzt sie.
Und wenn man sich erst mal für den hijab entschieden hat, kann man ihn nicht einfach so wieder ablegen, wie Mama immer betont. Sie konvertierte eigentlich erst ein paar Jahre später, aber am Kopftuch hielt sie schon bei ihrer Rückkehr nach Finnland fest. Es war ihr Freund und ihre Stütze in den schwersten Momenten, und je mehr Widerstand sie erfuhr, umso mehr wuchs ihre Überzeugung, dass sie recht hatte. Inzwischen beschränkt sich Mamas Job darauf, Anrufe von Leuten entgegenzunehmen, die Kreuzfahrten zu den europäischen Hafenstädten buchen wollen. Früher saß sie hinterm Tresen des Reisebüros und hatte direkten Kundenkontakt, aber als sie anfing, den hijab zu tragen, wollte man den fröhlichen Reisenden ihren Anblick ersparen. Man befürchtete, dass das Kopftuch der Stimmung einen Dämpfer verpassen könnte, und so musste sie sich mit einem geringeren Gehalt und schlechteren Arbeitszeiten abfinden. Aber das gleicht sie aus, indem sie viele Überstunden macht.
Als Großmutter Mama zum ersten Mal mit hijab sah, blieb sie jäh stehen, um dann schleunigst grußlos die Straßenseite zu wechseln.
Ein paar Tage später bekam Mama eine Karte, auf der eine dunkle, formlose Gestalt mit grinsendem Mund und kleinen, runden Augen zu sehen war. Auf der Karte stand: »Die Bedrohung hat das Mumintal erreicht. Herzlichen Glückwunsch!«
Die Karte stellte Morra dar. Mama riss sie in Fetzen und warf sie in den Papierkorb.
Mama sagt, wenn man den hijab trägt, muss man sich nicht mehr darum kümmern, wie man aussieht. Sie behauptet, dass sie Unsummen spart, seit sie keine unnötigen Chemikalien mehr kauft, die obendrein gesundheitsschädlich sind. Großmutter schnaubt bloß.
»Demnächst kommst du wahrscheinlich noch in so einer Burka daher, und dann siehst du nach überhaupt nichts mehr aus.«
Großmutter behauptet, dass Mama immer jemanden gebraucht hat, an den sie sich dranhängen kann. Erst war es Großvater, der sie mit dem Gürtel erzog, dann war es Papa, und als sie Papa nicht mehr folgen konnte, verfiel sie auf die Idee, dass sie stattdessen Gott folgen könnte. Mama antwortet, dass sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben vollkommen frei fühlt.
Großmutter dagegen nennt Mama eine Landesverräterin und sagt, dass sich Suffragetten vor Pferde geschmissen haben, damit keine Frau der Welt derart rumlaufen muss. Sie tut so, als wäre Mama schuld an buchstäblich jedem Problem, dem Frauen in ihrem Leben begegnen können: Vergewaltigungen, schlechtere Löhne, Diskriminierung am Arbeitsplatz, Kinderehe. Mama hält Großmutter ihr Tuch hin und ruft, dass es doch nur ein Stück Stoff ist.
»Ein Stück Stoff, das man sich um den Kopf wickelt, damit die Gedanken beieinanderbleiben«, sagt sie.
»Wenn es nur ein Stück Stoff ist, dann kannst du auch ohne auskommen«, antwortet Großmutter.
Mama findet, dass für Frauen wie sie, die nun mal nicht zur Kategorie »very fuckable« gehören, der hijab die einzige Möglichkeit ist, sich vor den verdammten Blicken zu schützen, die ihr unablässig sagen, dass sie nicht aussieht wie diese retuschierten vierzehnjährigen Models in der Elle und der Vogue, und dass Gott sein großes Verständnis und Gnade für das weibliche Dilemma bewiesen hat, indem er gebot, dass alle, jung wie alt, sich von Kopf bis Fuß verhüllen sollen. Eine Frau, die selbst entscheidet, was ein Mann von ihr sehen darf, und seinem Blick etwas entgegenstellt, ist eine Revolutionärin, die sich die Kontrolle über den eigenen Körper zurückgeholt hat.
»Ihr habt BHs verbrannt, und wir binden Kopftücher um. Aus genau dem gleichen Grund. Und niemals«, fügt sie hinzu, »sind mir die Männer mit solchem Hass begegnet wie seit dem Moment, in dem ich entschieden habe, was sie von mir nicht zu sehen bekommen sollen.«
Großmutter hingegen vertritt die Ansicht, dass Frauen im Leben genauso gut vorankommen können, wenn sie die Brust rausstrecken, mit ihren falschen Wimpern klimpern und den Rocksaum noch ein wenig höher rutschen lassen. Mama schnaubt nur und meint, da benutze sie doch lieber ihr Hirn, oder sei das etwa ein Privileg der Männer? Außerdem weiß Großmutter Gunni ganz genau, dass Mamas Chefin eine Frau ist, der man mit einem tiefen Ausschnitt garantiert nicht besonders imponieren kann.
Manchmal wird Großmutter so wütend, dass sie auf den Balkon geht und erst mal eine raucht, bis sich die Nachbarn beschweren und behaupten, sie kriegen chronischen Husten von dem ganzen Rauch, der durch die Fenster hereinzieht, und Großmutter schreit zurück, dass sie doch alle selbst rauchen, also warum zum Teufel jammern sie hier so rum?
Aber sosehr sich Mama und Großmutter auch streiten, Mama lässt sich nicht von ihrem hijab abbringen.
»Es gibt genug nackte Körper in dieser Welt. Ich finde, meinen muss man nicht auch noch sehen«, sagt sie.
Als ich jünger war, hat Mama sich manchmal hingesetzt und in den Reklamebroschüren geblättert, die früher immer bei uns auf den Flurboden plumpsten, und jedes Mal schüttelte sie den Kopf und schnaubte laut, wenn sie zu den Seiten mit der Unterwäsche kam. Wenn ich neben ihr saß und ihr über den Arm spähte, strich sie mir die Haare hinters Ohr und sagte:
»Es gibt noch mehr Arten, eine Frau zu sein. Vergiss das nie.«
Dann klebte sie eines Tages einen Zettel neben unseren Briefschlitz, und seitdem kamen keine Kataloge mehr.
Kapitel 5
Der Turm zu Babel
Wir wohnen im Turm zu Babel, dem einzigen Hochhaus in einer Reihenhausgegend. Papa sagt, dass die Behörden die vom Glück weniger Begünstigten hier hingepflanzt haben, damit die Steuerzahler mit eigenen Augen sehen können, wie gut ihre Gelder angelegt werden.
In unserem Treppenhaus werden sieben verschiedene Sprachen gesprochen. Die Polizei dreht regelmäßig ihre Runde im Viertel, und einmal haben sie auch bei uns eine Razzia durchgeführt. Die somalischen Familien rannten mit klappernden Sandalen hin und her und schrien und wedelten mit ihren Pässen, aber die Polizei führte sie trotzdem ab. Als sie später zurückkamen, erzählte Fayzad aus 42B Mama, dass man ihnen nicht mal Zeit gelassen hatte, in den Kommodenschubladen ihre Papiere zu suchen, sondern sie einfach mitgenommen hatte.
Von unserem Balkon schaut man auf ein kleines, halbkahles Grasviereck und die Reihenhäuser gegenüber. Dort wohnen die Glücklichen. Die Rentner, die sich beinahe ein eigenes Haus zusammengespart hätten, es dann aber doch nur bis zum Reihenhaus gebracht haben. Die Familien, traute Einheiten, bestehend aus Mama, Papa, Hund, Auto und zwei Komma fünf Kindern.
Direkt gegenüber wohnt Familie Jotunen, und Jotunens Auto, das brandneue Gefährt, das Markku jeden Samstagmorgen wieder ausgiebig bewundert. Er redet mit den Nachbarn über sein Auto, während er es mit einem trockenen Lappen und Windex auf Hochglanz poliert.
Wenn Peltonens Eerika und Sami in ihren ewig gleichen Freizeitklamotten aus der Tür gejoggt kommen, hebt er seine Sprühflasche zum Gruß.
Das Rentnerglück wird in erster Linie von Herjulas altem Hund und Herjula selbst verkörpert. Der Hund hat sie an der Leine, während sie mit ihrer grauen Dauerwelle und der lila Steppjacke an ihrem Tulpenbeet steht. Ihre Haare sind manchmal ebenfalls lila, wenn sie mal wieder die Schüler von der Friseurschule rangelassen hat. Dann fummelt sie an ihrer Frisur herum und tut so, als würde sie ihr mit den Fingerspitzen mehr Volumen verleihen.
»Na ja, diesmal ist es eben so geworden. Ein bisschen Abwechslung ist nie verkehrt.«
Obwohl es immer dasselbe Lila in derselben Dauerwelle ist.
In den Reihenhäusern wohnt auch die neue Familie von Huopala mit sieben Kindern verschiedenen Alters und verschiedener Nationalität. In ihrer Familie werden vier Sprachen gesprochen. Die Mütter und Väter kommen am Wochenende und holen die Kinder ab und bringen sie wieder zurück. Schwer zu sagen, wer eigentlich zu welcher Familie gehört und welche Kinder hier Halb- und Vollgeschwister sind. Wenn sie sich scheiden lassen, ziehen sie aus.
Es ziehen oft Leute aus diesem Reihenhausglück aus. Ich stehe meistens am Fenster und schaue ihnen zu, wie sie verschwinden. Mama hält die halben Kinder fest, und Papa steht mit den Händen in den Hosentaschen da. Mit hängendem Kopf und mahlendem Kiefer schaut er die Kinder an, den Hund, der willenlos danebensteht, den Umzugslaster, der mit den ganzen Dingen davonfährt, die tags zuvor noch ihnen gemeinsam gehört haben.
Papa ist fast genauso oft bei uns eingezogen, wie er ausgezogen ist. Momentan schläft er bei Rashid, behauptet er, aber diesmal ist er länger weg als sonst.
Wenn Papa auszieht, bricht normalerweise auch jeder Kontakt ab. Manchmal ruft er an, aber die Schweigepausen am Telefon sind lang und anstrengend. Rashid wohnt in Esbo, und ich werde ganz bestimmt kein teures Ticket für die Regionalbahn lösen, um Papa zu besuchen. Rashid mag ich zwar, aber ich habe keine Zeit, und Papa auch nicht. Der arbeitet sowieso die ganze Zeit, und zu unmöglichen Zeiten. Oft übernimmt er die Nachtfahrten, um noch mehr Geld zusammenzukratzen, das er seiner Familie in Tunesien schicken kann.
Jedes Mal, wenn Papa verschwindet, rufe ich Samira an, um Bericht zu erstatten, und jedes Mal sagt sie:
»Glaub mir, das ist nur vorübergehend. Die beiden können sich doch niemals in Frieden lassen.«
Und das hat sicherlich auch etwas Beruhigendes.
Oktober 2005
Samira
Kapitel 6
Die entlaufene Braut
Zwei Wochen nachdem Samira die Jungfrugränden verlassen hatte, zog sie aus dem Frauenhaus in die Wohnung, die das Sozialamt für sie organisiert hatte. Sie schaute auf einen asphaltierten Innenhof mit Teppichstangen, Maschendrahtzaun, einen Sandkasten und ein paar Schaukeln. Eine kleine Küche, nicht mehr als eine Kochnische. Eine Badewanne, auf deren breiten Rand man brennende Kerzen stellen könnte. Mikrowelle und Dunstabzugshaube. Zwei Zimmer, Einbauschränke, ein kleiner Laden im Erdgeschoss und eine geheime Adresse.
Sie ging durch die Zimmer und betrachtete die Wände, die glatten, hellgelben, kühlen, halbmeterdicken, die kein Geräusch durchließen. Es war ein altes Haus. Eine Burg, in der ihre Zukunft lag. Die Situation kam ihr nur zu bekannt vor.
Zugegeben, im Nachhinein sah der Schachzug mit dem Frauenhaus vielleicht ein bisschen übertrieben aus, das gab Samira selbst zu. Aber sie wollte unbedingt von zu Hause ausziehen und wusste nicht, wie sie es sonst anstellen sollte. Als sie Papa gefragt hatte, ob sie ausziehen dürfe, hatte er nein gesagt. Sie beharrte, sie sei achtzehn, und mit achtzehn dürfe man in Finnland zu Hause ausziehen. Da hatte er auf die Tür gezeigt und gesagt:
»Da draußen ist Finnland. Hier drinnen ist Maghreb! Wenn du unbedingt Miete zahlen willst, kannst du sie ja mir geben.«
Und dann wurde nicht weiter darüber gesprochen.
An einsamen Abenden brachte der Verkehr unten auf der Straße sie in Gedanken weit weg von zu Hause. Wenn sie die Hupen hörte, kamen die Erinnerungen hoch, und sie folgte dem Geräusch bis nach Dar El-Shams.
In Papas Viertel war zur Hochzeit geblasen worden, und alle waren eingeladen. Hunderte von Gästen, ganze Familien und Clans. Mitten auf der Straße hatte man ein Zelt aufgestellt, Stühle und lange Tische. Es war egal, dass damit die Straßen hinter den weißen Häusern mit den Flachdächern blockiert waren, es sollten ja sowieso alle zur Hochzeit kommen. Als die Kolonne mit der Braut angefahren kam, lauter blitzblanke gemietete Mercedes und eine weiße Limousine, tönten schon die Trommeln, die pulsierende Musik sollte drei Tage und drei Nächte nicht verstummen, und die lauten Rufe der Frauen schwirrten über dem wilden Gehupe der Autos. Man tanzte. Man feuerte Gewehrsalven in die Luft.
Am Vormittag waren die Braut und der Bräutigam vom Imam getraut worden, ohne sich im selben Raum oder auch nur im selben Stadtteil aufzuhalten. Die Frauen hatten ihr eigenes Fest gehabt und die Männer ebenso. Jetzt traf sich das Brautpaar, immerhin nicht zum ersten Mal. Unter den wachsamen Augen der Verwandten hatten sie sich schon vorher kennenlernen dürfen. Aber trotzdem. Hier waren zwei Menschen, die sich kaum kannten. Zwei Menschen, die sich sieben-, achtmal unterhalten hatten, sollten jetzt ein ganzes Leben miteinander beginnen. War sie unberührt? Im besten Fall ja. Und er? Wohl kaum. Wusste er etwas über Frauen? Nicht mehr als sein Vater und dessen Vater vor ihm.
Die Musik stampfte weiter, bald würden die Leute anfangen zu tanzen. Hochzeit im Maghreb. Niemand könnte glücklicher sein als die Braut und ihr Bräutigam. Noch eine Weile.
Samira blinzelte durch den Dunst, der den Blick behinderte, als sie über die Straße schaute.
Es gab keine Drohungen. Eigentlich. Aber sobald Samira sechzehn war, begann Papa sie mit anderen Augen zu betrachten. Als sie noch klein war, zog er sie immer mit beiläufigen, spielerischen Fragen auf:
»Na, hast du schon einen Freund, Samira?«
Und sie antwortete fröhlich:
»Ja, natürlich«, und zählte sämtliche Jungen aus ihrer Klasse auf.
Als sie ein bisschen älter war und verstand, was mit dem »Freund« gemeint war, kicherte sie bei seiner Frage und drehte sich verlegen weg.
Im Laufe der Jahre bekam dieses »Hast du denn schon einen Freund, Samira?« einen anderen Unterton. Forschend, zögerlich, immer in der Erwartung, dass sie eines Tages feuerrot werden würde.
Samira konnte sich noch an ihre Cousinen zu Hause in Dar El-Shams erinnern. Wie sie jedes Mal Ohrfeigen kassiert hatten, wenn sie in viel zu kurzen Röcken nach Hause kamen. Weinend waren sie in ihre Zimmer gelaufen. Ihre Väter patrouillierten mit dem Auto langsam am Schulhof vorbei und versuchten ihre Töchter zu erspähen. Waren Masha und Amira irgendwo in den Grüppchen aus Schülerinnen in formlosen rosa Überwürfen, die alle Schulmädchen tragen mussten? Wenn sie sie nicht ausmachen konnten, gab es hinterher zu Hause ein Verhör, wo sie zu diesem oder jenem Zeitpunkt gewesen waren, und wenn sie sich nicht erinnern konnten, setzte es was. So wurden die Mädchen zu Hause in Dar El-Shams erzogen, und so war auch Farid aufgewachsen. Er hatte das alles miterlebt – wie sollte er da anders denken können?
»Wenn es um ihre Töchter geht, sind alle Männer gleich. Ganz egal, wie normal sie sonst wirken, wenn es um die Mädchen geht, kriegen sie alle einen Kurzschluss im Hirn«, sagte Samiras beste Freundin Jasmina.