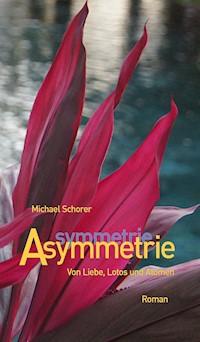
5,20 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Italien der Renaissance stolpert ein Mönch zufällig über das Geheimnis der Asymmetrie in Atomen. Fast ein halbes Jahrtausend später gelangt seine in den Tiefen der Vatikanischen Bibliothek schlummernde Entdeckung in die Hände von Leuten, die etwas von Atomphysik verstehen. Ein Wettlauf setzt ein, um mit diesem Wissen die Nukleartechnik in ein neues Zeitalter zu führen. In diesen Wettlauf gerät eine junge Zwangsarbeiterin in einer Fabrik in Vietnam. Ihr gelingt mit einem Nuklearingenieur aus Europa die Flucht auf die Philippinen. Schritt um Schritt verknäueln sich dort die bösartigen Schatten ihrer Vergangenheit und das Ringen um das Geheimnis der Asymmetrie zu einer unheimlichen Bedrohung. Unsentimental, mit Verstand, Witz und Raffinesse sucht die junge Frau Auswege aus der Gefahr - ein Science Thriller aus der Welt der Atomphysik, eingebettet in die augenzwinkernd erzählte Geschichte zweier Menschen, deren grundverschiedene Lebenswege sich überraschend kreuzen und vereinigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Michael SchorerAsymmetrie
Michael Schorer
Asymmetrie
Eine ernsthaft unernste Geschichte von Liebe, Lotos und Atomen
© 2017 Michael Schorer
Erstausgabe
Umschlaggestaltung und Karten:
Michael Schorer
Lektorat und Korrektorat:
Catherine De Kegel, Hannelore Blum, Marie-France Aepli
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN Paperback:
978-3-7439-1793-4
ISBN e-Book:
978-3-7439-1794-1
Das Werk, einschliesslich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie: detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Vorangestelltes Nachwort des Autors
Dieser Roman erzählt eine frei erfundene Geschichte, geschrieben aus der Lust am Fabulieren. Alle hier auftretenden Personen entspringen der Fantasie des Schreibenden – alle, ausser Nguyen Tuong Vy.
Mit ihrer Namensgeberin hatte ich im Dezember 1980 in Singapur eine flüchtige Begegnung. Sie war damals ein schmächtiger Teenager, geflohen aus Südvietnam auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Aus Gründen, die sich mir heute nicht mehr erschliessen, ist mir ihr Name in Erinnerung geblieben. Die reale Tuong Vy hat jedoch – ausser dem Namen und dem Flüchtlingsschicksal – nichts mit der Kunstfigur im Roman zu tun.
Real sind hingegen die Orte der Handlung – alle, ausser Rocky Island. Diese paradiesische Tropeninsel gibt es zwar tatsächlich. Sie befindet sich aber an einem anderen Ort.
Die Geschichte spielt an der Wende zu unserem Jahrtausend. Und noch ein Wort zur Asymmetrie in Atomen: Die hier dargelegte Lösung des Radioaktivitätsproblems im Kernbrennstoff ist Science-Fiction. Die geschilderten nuklearphysikalischen Prozesse sind zwar aufgrund der bekannten Naturgesetze nichta prioriunmöglich. Dass so etwas in der Praxis funktioniert, ist hingegen äusserst unwahrscheinlich. Leider.
Bern, im Frühsommer 2017
Über den Autor
Michael Schorer, Dr. phil. nat., ist 1955 in Bern geboren und hat dort physikalische Geographie studiert. Seinen beruflichen Weg begann er bei der Berner Tageszeitung «Der Bund» als Redaktor und Wissenschaftsjournalist. Im Laufe seiner beruflichen Tätigkeiten hat er sich immer wieder intensiv mit der friedlichen Nutzung der Kernenergie auseinandergesetzt.
Michael Schorer ist verheiratet und Vater von vier erwachsenen Kindern (Vierlingen).
Inhalt
Prolog
Flucht
Neuanfang
Im Passatwind
Eskalation
Hitze
Stellungskrieg
Am Lotosteich
Duell der Feen
Prolog
Endlich hatte der Sterbende im Graben vor ihm aufgehört zu stöhnen. Sebastiano d’Alessandria bog vorsichtig die Zweige auseinander und spähte mit dem gesunden Auge aus dem Gebüsch, das ihm als Versteck gedient hatte. Bisher hatte er Glück gehabt, dass ihn die Plünderer übersehen hatten.
Man schrieb den 24. Februar 1525. Die Morgennebel hatten sich in die feuchten Niederungen des Ticino-Flusses zurückgezogen. Die bleiche Spätwintersonne beleuchtete auf dem Schlachtfeld vor der Festungsstadt Pavia eine gespenstische Szene. Wie riesige schwarze Totenvögel sprangen die Bauern aus der Umgebung zwischen den erschlagenen Franzosen, Italienern und Schweizern umher und rafften alles an sich, was die kaiserlichen Sieger nicht schon genommen hatten. Die Luft roch nach Tod und Verwesung.
Sebastiano drückte ein schmutziges Tuch auf sein zerquetschtes Auge und versuchte, Herr über den wütenden Schmerz zu werden. Er verfluchte den Bolzen aus einer habsburgischen Armbrust. Er verfluchte den französischen König und den habsburgischen Kaiser. Er verfluchte sich selbst, dass er sich auf das Kriegshandwerk eingelassen hatte.
Sebastiano war noch keine zwanzig Jahre alt, aber er hatte die Schnauze gestrichen voll. Voll davon, am Lagerfeuer die Heldenepen zu hören, voll davon, sich vom Versprechen von Ruhm und Ehre und Geld blenden zu lassen. Im blutigen Desaster von Pavia war ihm klargeworden, dass er ein Mann des Buches war. Dass es ihm bestimmt war, den Stein der Weisen zu suchen und die Welt in ihrem innersten Kern zu ergründen.
Sebastiano beschloss, Mönch zu werden.
Fast fünfhundert Jahre später in Rom
Als Enrique Ramirez auf der Flucht vor einem plötzlichen Wolkenbruch eine Bar im Trastevere-Quartier in Rom betrat, hatte er noch nie etwas von der Schlacht bei Pavia gehört. Enrique war mit seinem Freund – oder genauer: seinem Liebhaber – von den Philippinen nach Rom geflogen, um mit dem Papst die letzten Ostern im ausgehenden 20. Jahrhundert zu feiern – oder genauer: um mit seinem Liebhaber einige ungestörte Tage zu verleben und sich vor Ort über die neuesten italienischen Modetrends zu informieren.
Enrique war schlecht gelaunt. Die Leute hier in der Fashion-Szene sprachen – wenn überhaupt – ein lausiges Englisch, der Papst sah live nicht anders aus als im Fernsehen und sein Lover hatte Durchfall vom Olivenöl und war auch sonst ein Reinfall.
Finster um sich blickend suchte er sich im Zigarettenrauch einen freien Platz an der Bar. Immerhin: Der Kaffee, der hierzulande viele verwirrende Namen hatte, war schwarz, bitter und gut. Er fand eine Lücke neben einem Priester und bestellte einen Espresso.
«Carpe diem», meinte der Priester und lächelte Enrique an.
«Sorry, I don’t speak any Italian», knurrte Enrique.
«Macht nichts, ich bin Franzose», antwortete der junge Mann belustigt und strich seine Soutane glatt. «Und überdies war meine Begrüssung in Latein. Und heidnisch. Sinngemäss etwa: Nutze die Zeit, die dir bleibt, für dein Vergnügen! Denn du weisst ja nie, ob heute der letzte Tag deines Lebens ist.»
Sein Englisch war noch schauderhafter als das der Italiener, befand Enrique, aber mit einem charmanteren Akzent. Seine Laune besserte sich. Der Priester begann ihm zu gefallen.
«Ich bin selbständiger Modefotograf aus Cebu City auf den Philippinen», stellte er sich vor.
«Ich bin Bibliothekar in der Vatikanischen Bibliothek hier in Rom», antwortete der Priester. «Ich heisse François.»
Sie blickten sich in die Augen. Man verstand sich.Carpe diem.
Am nächsten Morgen setzten sich die beiden in der unordentlichen kleinen Küche des Priesters zum Frühstück. Um Platz nehmen zu können, musste Enrique ein Bündel Papiere aus dem Weg räumen. «Excuse-moi», meinte François und schob das Bündel hastig in eine Ecke.
«Die sehen aber sehr alt aus», meinte Enrique und versuchte einen Scherz. «Sind das verbotene Manuskripte aus den geheimnisvollen Abgründen der Vatikanischen Bibliothek, die vor den Augen der sündigen Menschen verborgen bleiben sollen?», grinste er.
Das war, wenn auch ohne Absicht, ein Volltreffer. Der Priester errötete. «Bitte… äh… verrate mich nicht. Nicht nach dieser wunderbaren Nacht. Ich… ich tue eigentlich nur… nur meine christliche Pflicht», stotterte er.
Enriques Neugier war damit definitiv geweckt und er blickte den Priester freundlich, aber erwartungsvoll an. François knetete nervös seine Hände. Unschlüssig starrte er durchs Fenster ins fahle Morgenlicht, das den mächtigen Petersdom als dunkle Silhouette vor dem zarten Rosa des Himmels erscheinen liess. «Ach, es handelt sich nur um obskure Aufzeichnungen eines Renaissance-Mönchs», versuchte er abzuwiegeln.
Dabei war ihm sichtlich unwohl, denn das war nicht die ganze Wahrheit. Die Papiere stammten von einem Benediktinermönch namens Sebastiano d’Alessandria, und in ihnen steckte irgendein Geheimnis. Erhalten hatte er sie vom bejahrten Kardinal S., seinem obersten Chef. Der Kardinal hatte ihm auf dem Sterbebett die Manuskripte überreicht mit dem Auftrag, sie einem alten Priesterkollegen irgendwo in Ostasien zu übergeben. Er hatte François dazu nur erklärt, dass er als junger Mann mehr durch Zufall in einem abgelegenen Regal der Vatikanischen Bibliothek auf dieses Material gestossen war. Und dann viele Jahre damit verbracht habe, die schwer lesbaren lateinischen Aufzeichnungen ins Französische zu übersetzen und zu verstehen.
Enrique, dem die Nervosität des Priesters nicht entgangen war, witterte Morgenluft. Der Geschäftsmann in ihm erwachte. «Worum geht es?», erkundigte er sich. «Vielleicht kann ich etwas für dich tun.»
François lief in die Falle. Er schüttelte den Kopf. «Ach nein, kaum», meinte er. «Es ist nur der Bericht eines Alchimisten, der offenbar vor fünfhundert Jahren eine bahnbrechende Entdeckung bei Atomkernspaltungen gemacht hat. Natürlich ohne es zu merken», ergänzte er, da beim damaligen Wissensstand nichts über dieátomabekannt gewesen sei, den kleinsten gedanklich nicht weiter teilbaren Materieteilchen der antiken griechischen Philosophen.
«Das tönt toll», meinte Enrique amüsiert, «und ich habe echt keine Ahnung, wovon du sprichst. Würdest du dich bitte zwischendurch etwas Nützlichem zuwenden und mir eine Tasse Kaffee anbieten?»
François’ Gedanken blieben andernorts. «Irgendwie geht es um Symmetrien oder Asymmetrien. Jedenfalls um komplizierte Physik und Mathematik», murmelte er vor sich hin. «Aber ich stehe in der Pflicht. Der sterbende Kardinal wollte sein Geheimnis weitergeben. Jemandem, der etwas von Atomen versteht.»
Er nickte, sich selbst bestätigend. Dann wurde ihm die Anwesenheit von Enrique plötzlich bewusst und er blickte erschrocken auf. «Selbst wenn ich die Vorschriften des Vatikans grob verletzt habe – ich habe die Papiere des Kardinals uneigennützig zu mir genommen», verteidigte er sich, ohne beschuldigt worden zu sein. «Schliesslich… schliesslich war es der Wille eines Sterbenden.» François wischte sich den Schweiss von der Stirn.
«Zweifellos hast du richtig gehandelt», beruhigte ihn Enrique und setzte sein sanftes Verhör fort: «Und was tust du jetzt damit? Kann ich irgendwie helfen?»
Enriques subversive Taktik ging auf. François wurde immer unsicherer. «Ich weiss nicht – ich… ich habe wie vom Kardinal gewünscht einen Brief an die Adresse des Priesters im Fernen Osten geschrieben, aber nie eine Antwort erhalten. Dafür tauchte vor zwei Tagen ein unheimliches Schlitzauge auf und…» Der Priester unterbrach sich, errötete erneut und blickte Enrique schuldbewusst an. «Excuse-moi, ich wollte dich natürlich nicht ausgrenzen.»
Enrique musste lachen. «Macht nichts. Wir haben auf den Philippinen auch böse Namen für Leute wie dich. Wir sind ein stolzes Volk.Pinoy Pride, wie man bei uns sagt, wenn wir uns positiv vom Rest der Welt abheben wollen.»
Der Priester nickte erleichtert. «Und jetzt – jetzt weiss ich nicht, was ich tun soll.» Er öffnete das Bündel und zeigte Enrique einige Blätter mit seltsamen Zeichnungen. «Ich habe keine Ahnung was das alles bedeutet – kennst du vielleicht einen Kernphysiker oder Nuklearingenieur, der damit etwas anfangen kann?», fragte er mehr zu sich selbst, ohne eine Antwort zu erwarten.
Bevor Enrique etwas sagen konnte, klingelte es an der Tür zum Vorgarten. François stand auf, trat in den Flur und öffnete die Tür.
Daraufhin geschah alles sehr schnell.
Später konnte sich Enrique nur daran erinnern, dass es unter der Tür zu einem Handgemenge gekommen war und der oder die Angreifer blitzartig davonliefen. Als er seinem neuen Freund zu Hilfe eilen wollte, war es schon zu spät. François lag am Fuss der kurzen Freitreppe. Aus einer tiefen Wunde am Kopf floss Blut. Aus dem Flüstern des Sterbenden entnahm Enrique, dass er um aller Heiligen Willen die Papiere des Kardinals verschwinden lasse solle – um weiteres Unheil zu verhindern, falls sie in falsche Hände gelangen sollten.
Enrique bezwang sein Entsetzen. Er bekreuzigte sich hastig, bedeckte respektvoll das Antlitz des Toten mit einem Handtuch aus der Küche, holte das Papierbündel und machte sich aus dem Staub. Mit diesem Überfall wollte er nichts zu tun haben und noch viel weniger mit der Römer Polizei.
Die Manuskripte behielt er bei sich. Denn – ja, einen Nuklearingenieur kannte er: seinen alten Freund Jean-Michel Balliol. Wenn er ihm das Bündel aushändigte, wäre dem Willen des Kardinals genüge getan, beruhigte er sein Gewissen. Und vielleicht steckte in diesen Papieren etwas, das man zu Geld machen konnte.
Carpe diem– wie recht der arme François hatte.
Hanoi, Vietnam
Der Mann in mittleren Jahren stand reglos am Fenster und schaute in den Nebel hinaus. Aus der Tiefe der Strasse brandete Verkehrslärm herauf. Es war ein grauer, trister Tag, wie es viele gab in Hanoi. Das Wetter im frühlingshaften Rom war eindeutig besser gewesen als hier in Vietnam, und auch die Weine Italiens hatten es ihm angetan. Aber er war vergeblich um die halbe Erde gereist. Er war zu spät gekommen. Und das nur wegen der lahmarschigen Bürokraten, die Monate benötigt hatten, um ihm die Reisepapiere auszustellen.
Es war vor gut drei Monaten gewesen, als er in der Morgenpost den Brief aus Rom gefunden hatte. Das private Schreiben war von der Zensurbehörde abgefangen, geöffnet und, da darin von nuklearen Dingen die Rede war, an die zuständige Fachstelle des Geheimdienstes weitergeleitet worden. Diese hatte festgestellt, dass der Adressat – ein ausländischer Priester ohne Angehörige in Vietnam – inzwischen verstorben war. Da Tote nicht sprechen können und auch keine Spionagetätigkeit ausüben, erlosch das Interesse der Geheimdienstler. Sie leiteten den Brief an das Ministerium für Wissenschaft und Technologie weiter.
Dort landete er auf dem Schreibtisch von Pham Hoang Lac. Und der reagierte sofort. Es war der Hinweis auf Asymmetrie im Brief, der ihn alarmiert hatte. Als ausgewiesener Nuklearfachmann hatte er sich bereits seit vielen Jahren mit diesem Thema herumgeschlagen. Er hatte sogleich das Potenzial dahinter erkannt und beschlossen, sofort nach Rom zu reisen, um an den jahrhundertealten Schatz heranzukommen.
Das Ganze hatte sich jedoch unter einem unglücklichen Stern abgespielt. Der Absender des Briefs in Rom – ein junger französischer Priester namens François – zeigte sich halsstarrig und wollte schriftliche Beglaubigungen sehen. Lac biss auf Granit. Alle seine Schwüre, dass er den in Vietnam verstorbenen Priester persönlich gekannt habe und dieser sein Lehrer gewesen war, liessen den Römer Schwarzrock kalt. Dabei war das nicht einmal gelogen.
Lac bedauerte nach seinem ersten Besuch beim Priester, dass er ihm keine jener Geschichten aufgetischt hatte, die gebildete Westler so gerne hören, wenn dadurch ihre politisch korrekten Vorurteile bestätigt werden. Vielleicht hätte er mit einem Gejammer über die imperialistische Ausbeutung seines Landes durch Europäer mehr Erfolg gehabt. Er beschloss, gröbere Mittel einzusetzen.
Doch wie man in Vietnam sagt: Besudelst du dir die Hände, so bleibt auch dein Gesicht nicht frei von Schmutz. Die beiden Idioten vom Wachpersonal der vietnamesischen Botschaft in Rom, die den Priester an der Tür nur ein bisschen hätten einschüchtern sollen, liessen sich vom heftigen Widerstand des Gottesmannes überraschen. Im Handgemenge stürzte der Priester die Treppe hinunter und schlug mit dem Kopf so unglücklich auf das Scharreisen, dass er sich eine tödliche Wunde zuzog.
Als Lac kurze Zeit später den Toten hinter ein Gebüsch gezogen und die offenstehende Wohnung durchsucht hatte, war von den im Brief beschriebenen Manuskripten nichts aufzufinden. Jemand hatte bereits abgeräumt.
Damit war alles vermasselt und sein Türöffner zum vatikanischen Geheimnis tot. Lac seufzte und starrte weiter in die Nebel Nordvietnams. Beim Verlassen der Wohnung in Rom hatte er gelobt, zwei Kerzen anzuzünden – eine für das Seelenheil des unglücklichen jungen Priesters, und eine für den anderen Schwarzrock, der in Vietnam verstorben war. Er selbst war zwar bekennender Atheist, aber mit katholischen Wurzeln, und das war er den beiden irgendwie schuldig.
Als er am folgenden Tag im Petersdom in Gedanken versunken seinem Kerzengelübde Folge geleistet hatte, war er mit einem elegant gekleideten Filipino zusammengestossen, der ebenfalls eine Kerze anzünden wollte. «Oh, sorry», hatten sie sich gegenseitig entschuldigt. Dann waren beide ihrer Wege gegangen.
Visayas, Philippinen
Ihr Name war Christina. Sie war eines der Busenwunder von Enrique, der mittels seiner fotografischen Künste einschlägige Magazine und Websites mit ihren Kurven belieferte.
Enrique hatte sie auf die Ausfahrt mit dem Katamaran mitgenommen, um seinem langjährigen heterosexuellen europäischen Freund Jean-Michel Balliol Ablenkung und Unterhaltung zu bieten. Er brauchte den Miteigentümer Jean-Michel, um das grosse Boot sicher durch die Strömungen und Korallenriffe der Gewässer rund um die Inseln Cebu und Bohol in den philippinischen Visayas zu steuern. Dafür waren mindestens vier segelerfahrene Hände nötig. Und einer, der am Abend auf dem Deck blieb und Wache schob, wenn er, Enrique, sich mit seinem neuen Liebhaber in die Kabine zurückzog.
Nach seiner überstürzten Rückkehr aus Rom hatte er einige Zeit enthaltsam gelebt, um seinen Schock wegen François wie auch die Enttäuschung mit seinem Reisebegleiter zu verarbeiten. Doch bald darauf – das lag in der Natur seiner Arbeit – war er einem attraktiven Schauspieler und Dressman aus Manila begegnet. Dem wollte er mit dem Katamaran imponieren. Und dazu brauchte er Michel, wie er kurz unter Freunden genannt wurde.
Und Christina.
Christina war ein nettes Mädchen. Sie hatte eben ihren Liebhaber zum Teufel gejagt – zur Recht, wie Enrique fand – und war gerne der Einladung gefolgt. Denn die Gesellschaft von Michel versprach einen kurzweiligen Abend.
Michel, der seit einigen Jahren regelmässig seinen Urlaub auf der kleinen Insel Mactan vor Cebu verbrachte, war in den einschlägigen Damenkreisen um Enrique inzwischen gut bekannt. Dies nicht zuletzt deshalb, weil er ein attraktiver, grossgewachsener junger Ingenieur aus gutem Haus war – mit viel Leichtsinn im Kopf und mehr Geld in der Tasche, als seinem Alter angemessen war. Aber auch deshalb, weil er Humor hatte und sehr sanft sein konnte. Manche hätten Jean-Michel oberflächlich genannt. Aber das war nicht ganz richtig. Es gab Momente, da neigte er zum Grübeln. Aber was andere von ihm dachten, war ihm eigentlich egal. Wer genug Geld hat, braucht sich nicht um seinen Ruf zu kümmern.
Der Wind stand günstig und gegen Abend ankerten sie vor der Küste von Bohol. Nach dem Nachtessen verzog sich Enrique mit seinem Dressman nach unten. Michel und Christina – die Deckwache – richteten sich oben neben der Hausbar bequem ein. Sie mixten sich Drinks, plapperten fröhlich miteinander und Michel kam nicht umhin, ihre Brüste zu bewundern. Sie waren riesig, und er konnte sich eine Bemerkung über die Launen der Natur nicht verkneifen, wie er höflich zu formulieren glaubte. Sie meinte dazu ungerührt, dass nicht alles so sei, wie es scheine. Manchmal verberge sich unter der schönen Oberfläche ein Geheimnis.
Michel stutzte und goss beinahe seinen Drink über ihren Busen. Ihre nicht eben erotische Bemerkung blieb in seinem Gehirn haften. Er versuchte, sich auf den aufkeimenden Gedanken in seinem Kopf zu konzentrieren, was allerdings seiner Libido nicht eben förderlich war.
Christina merkte das natürlich und motzte, ob ihm ihr Busen denn nicht gefalle. Michel verschob das Grübeln auf später, wandte sich wieder den näher liegenden Dingen zu und versank in Christinas üppigen Formen. Sie dankte es ihm, und der mondhelle Abend wurde so schön wie die palmengesäumte Bucht, in der das Boot auf der sanften Dünung dümpelte.
Die Idylle wurde erst gestört, als Enrique mit seinem Lover aus der Kabine trat, mit einem breiten Grinsen den Suchscheinwerfer einschaltete und das Deck in grelles Licht tauchte. Christina fand das lustig und warf sich in Pose, während sich Michel im grossen Schatten ihres Busens zu verstecken suchte. Enrique, du mit deinen rüden Scherzen, ärgerte er sich – um gleich darauf steil aufzusitzen und dabei vergessend, dass die beiden genau das erreichen wollten.
Enrique – ja das war es! Enrique hatte ihm vor einigen Tagen Manuskripte übergeben, die er offenbar von einem Priester in Rom erhalten hatte mit dem Versprechen, sie einem Nuklearingenieur zu zeigen. Darunter befand sich ein wunderschön gestaltetes Dokument, über und über bedeckt von kunstvollen Ornamenten. Und diese altersmorschen Manuskripte, hatte Enrique behauptet, müssten etwas mit «asymmetrischer Kernphysik» zu tun haben. Michel hatte sich höflich bedankt und die Papiere achtlos zur Seite gelegt, obwohl Enrique auch von Geld gemurmelt hatte, das man vielleicht damit machen könne.
Michel beschloss, der geheimnisvollen Sache im Licht von Christinas Bemerkung über die Natur ihres Busens nachzugehen. Sobald er neben der Affäre mit Christina Zeit dazu fand. Denn sie war wirklich ein nettes Mädchen. Und unkompliziert.
Quang Tri, Vietnam
Von alledem hatte die junge Frau, die wie jeden Morgen bei Sonnenaufgang zur Arbeit in die Lebensmittelfabrik in der Provinz Quang Tri im ehemaligen Südvietnam ging, keine Ahnung. Anders als das leichtlebige Völkchen auf dem Katamaran lebte sie am unteren Ende der sozialen Leiter. Nach der monatelangen Quälerei war sie erschöpft und ihre sonst robuste Gesundheit war am Schwinden.
An diesem Tag küsste sie ihr reich verziertes Kreuz an der Halskette, bevor sie am Arbeitsplatz die lärmige Maschine einschaltete – als Dank dafür, dass sie seit fast einer Woche vom Vorarbeiter nicht geschlagen worden war. Trotzdem näherte sie sich unerbittlich dem Punkt der finalen Entscheidung – ihren Glauben an einen gütigen Gott aufzugeben wie auch ihr sinnlos gewordenes Dasein.
Wenn ihr jemand an diesem Morgen prophezeit hätte, dass die Asymmetrie in Atomen ihr Leben demnächst fundamental umkrempeln würde – sie hätte diese Person für übergeschnappt erklärt. Auch wenn sie durchaus etwas von komplexen Geometrien verstand. Aber das war Wissen aus einer anderen, verlorenen Welt.
Flucht
1
Die Nacht war pechschwarz und es regnete. Jean-Michel hatte versucht, sich so bequem wie möglich auf dem sumpfigen Waldboden auszustrecken und dem tropischen Dickicht rund um ihn herum auszuweichen. Die Stichwunde in der Schulter schmerzte, obwohl, wie er zugeben musste, der aufgelegte Pflanzenbrei etwas Linderung verschafft hatte. Tuong Vy hatte mit Verweis auf Père Louis kurz vor dem Einnachten einige Blätter und eine beerenartige Frucht gesammelt. Mangels Alternativen hatte sie mit ihrem Speichel das schleimige Zeug zu einer Paste geknetet und auf die Wunde gestrichen.
Sein dünner Regenschutz war dem Tropengewitter nicht gewachsen. Unerbittlich drang die Nässe in seine Kleider. Obschon die Nacht warm war, fröstelte er. Das alles hat doch keinen Sinn mehr, sagte er sich, und schämte sich gleichzeitig für seinen Kleinmut. Im Dunkeln spürte er, dass seine Begleiterin wegen seiner Unruhe aufgewacht war. Sie hatte sich beim Verblassen des letzten Tageslichts wie eine Katze eingerollt, sodass ihr Gesicht von den Haaren völlig bedeckt war. Ein Feuer anzuzünden hatten sie nicht gewagt. Das wäre auch sinnlos gewesen, denn der Wolkenbruch hatte nicht lange auf sich warten lassen.
«Ist dir kalt?», fragte er leise in die Finsternis.
«Oh, ça va», flüsterte sie zurück. «Wir haben heute schon Schlimmeres überstanden.»
Ihr Gleichmut beeindruckte ihn. Seit sie auf der laotischen Seite des Sepon-Flusses erschöpft aus dem Wasser geklettert waren, schien sie ihren Mut wiedergefunden zu haben. Ganz im Gegensatz zu ihm. Er spürte, dass seine Bedrückung langsam der Verzweiflung wich. So ziemlich alles war schiefgegangen, und dabei hatte er die Flucht aus Vietnam doch perfekt geplant.
Mist. Beim Grübeln über seine Lage erinnerte er sich an einen Lehrsatz von Clausewitz, wonach auch die besten Pläne Makulatur werden, sobald man sie durchzuführen beginnt. Der alte preussische General mag zwar Recht haben, fluchte er innerlich, aber das half ihm jetzt auch nicht weiter.
«Rücke näher zu mir, dann können wir uns gegenseitig wärmen», schlug er vor.
«Non, non, ça va» wiederholte sie. «Ich habe schon ganz anderes ertragen.» Aber sie rückte dann doch etwas näher, sodass er sie auf Armlänge ertasten konnte. Inzwischen waren beide hellwach.
«Du bist unruhig», flüsterte sie. «Sinnierst du immer noch dem Soldaten nach?» Michel knurrte etwas Unverständliches. «Tant pis», murmelte sie. «Das war Pech – für uns und für ihn.»
Eine Weile blieben beide stumm.
«Übrigens könnten wir beide tot sein und er noch lebendig. Und wir können das Geschehene nicht ändern, also vergiss es», meinte sie schliesslich unsentimental. «Im Krieg passieren viel schlimmere Dinge. Jetzt sind wir immerhin jenseits der Grenze in Sicherheit.»
Michel hatte da so seine Zweifel und ächzte, als er sich umdrehte, um eine bequemere Stellung zu finden.
«Hast du starke Schmerzen?», fragte sie.
«Ça va, nur wenn ich lache», gab er zurück, aber das war eine sehr freie Umschreibung des Sachverhalts.
Sie merkte das natürlich. «Morgen, sobald ich etwas sehe, kaue ich dir einen neuen Verband. Das wird den Schmerz lindern. Jetzt, im Dunkeln, würde ich es verpfuschen und alles noch schlimmer machen. Bis dahin musst du durchhalten. Bitte.»
Ihr Mitgefühl war echt, und das half ihm. «Ich habe dich vor dem Einschlafen in mein Gebet eingeschlossen», fügte sie aufmunternd hinzu.
Immerhin, das ist doch auch etwas, dachte Michel, und in dieser Lage hilft es vielleicht sogar. Denn auch ihr Beten war echt. Soviel er bisher von ihr verstanden hatte, war ihr fast kindlich anmutender Glaube mit ein Grund für die Kraft, die sie in Vietnam am Leben erhalten hatte.
Aber ihre christliche Barmherzigkeit hatte klare Grenzen. «Hör jetzt auf, über diesen Soldaten nachzudenken», insistierte sie, wie wenn sie seine Gedanken lesen könnte. Das kann sie vielleicht wirklich, schoss es Michel durch den Kopf. Ich weiss ja so wenig von ihr.
Sie blieb hartnäckig. «Dein Grübeln macht ihn auch nicht wieder lebendig. Und um den war es ohnehin nicht schade. Er hatte einen verschlagenen Ausdruck im Gesicht. Und er hat mich lüstern angestarrt. Der war einsalaud.»
Michel widersprach. «Zum Anstarren hatte der gar keine Zeit. Und auch ein Mistkerl ist ein Mensch.»
«Nur bedingt», gab sie zurück. «Du bist seltsam… du scheinst aus einer Welt zu kommen, in der alle Leute irgendwie nett sind. In meiner Welt dagegen gibt es Menschen wie du und ich, und Typen, die eine Uniform anziehen, um andere drangsalieren zu können. Und der war von dieser Sorte, vom Grenzschutz. Die sind besonders brutal.»
«Ich glaube eben an das Gute im Menschen», meinte er schwach.
«Das ist ein Fehler.»
«Vielleicht. Vielleicht ist es auch ein Fehler, wenn ich einer jungen Frau, die ich durch eine gut gemeinte Dummheit in einer vietnamesischen Fabrik kompromittiert habe, aus Anstand zu helfen versuche. Und mich in einem stinkenden Dschungel in einer trostlosen Lage wiederfinde.»
Sie schwieg eine Weile. Ein Punkt für mich, dachte Michel. Aber er bereute den Gedanken, kaum dass er ihm gekommen war.
«Excuse-moi», bat er, «meine Stimmung ist derzeit schwärzer als diese verdammte Nacht.»
«Nein, das war keine Dummheit», glaubte er ihr Flüstern zu verstehen. «Gottes Wege sind unerforschlich, pflegte Père Louis zu sagen, aber manchmal wunderbar. Für mich bist du fast wie ein Sendbote des Himmels. So wie dein Namensgeber, der Erzengel Michael.»
Das war ihm nun doch etwas zu schwülstig, besonders in einer Regennacht unter freiem Himmel. «Wäre ich ein Engel», knurrte er, «würden wir jetzt auf einer bequemen, geheizten Wolke sitzen. Und mit Halleluja nach Singapur fliegen. Und nicht in diesem elenden Sumpf in Laos feststecken.»
«Bitte, mach dich nicht lustig über mich. Ich meine das ernst», wies sie ihn zurecht. «Hab Vertrauen. Wir sind ein gutes Team. Wirklich. Zusammen kommen wir weit, auch nach Singapur. Wir sind jung.» Aber beide nicht gesund, ergänzte Michel für sich.
Ihre magere Hand tastete im Dunkeln nach seiner, fand sie und drückte sie fest.«Michel, tu n’est pas défaitiste, non?Wer sich geschlagen gibt, der hat schon verloren.» Ihre Stimme wurde weich. «Verzweifle jetzt nicht. Nicht nach allem, was du schon geleistet hast.» Dann wurde sie pathetisch: «Du hast das Herz eines Kriegers, wie mein Vater. Morgen, wenn die Sonne aufgeht, sieht die Welt wieder besser aus.»
«Hoffentlich.»
«Du bist für mich wie der normannische KönigRichard Cœur de Lion, von dem mir Père Louis erzählt hat», hielt sie das Gespräch aufrecht.
«Dein Richard Löwenherz war ein englischer König», wandte Michel müde ein.
«Nein, er stammte aus der Normandie, wie Père Louis. Der musste es ja wissen.»
Michel wollte das richtigstellen, doch dann wurde ihm das Absurde dieser Diskussion bewusst. Sie hatten fürwahr andere Probleme, als sich über einen König im mittelalterlichen Europa zu streiten. Und doch war er Löwenherz dankbar. Denn ihre Gesprächstherapie begann Wirkung zu zeigen. Michel wurde es etwas wärmer, zumindest ums Herz. Sie ist ein feines Mädchen, diese Nguyen Tuong Vy, dachte er. Die lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Ihre Zuversicht begann auf ihn abzufärben. Doch trotz der seelischen Entspannung meldete sich sein Verstand zurück. Er setzte sich auf.
«Du grübelst zu viel», seufzte Tuong Vy. «Manchmal ist es besser, wenn man nicht zu viel nachdenkt. Das gilt auch für Ingenieure wie du einer bist.»
Michel knurrte etwas vor sich hin.
«Bitte verstehe. Ich versuche ja nur, dir zu helfen.»
Sie war rührend in ihrem Bemühen, ihn moralisch wieder aufzurichten. Umso schmerzlicher wurde ihm bewusst, dass er sich aus der Verantwortung, die er sich aufgebürdet hatte, nicht einfach verabschieden konnte.
«Wir wurden beobachtet», meinte Michel nach einer Weile. «Das gefällt mir nicht.»
«Beobachtet? Wo?»
«Als wir den Fluss überquerten. Oben im Wald, auf der vietnamesischen Seite, blinkte kurz etwas auf, wie ein Fernglas.»
Sie wiegelte ab. «Ach was. Ich bin sicher, wir waren allein. Vielleicht hatte das Glänzen eine einfache Ursache.» Es gebe einen Pilz hier, behauptete sie, der ganze Blätter überwuchere. Sein Schleim glänze manchmal, wenn die Sonne aus einem bestimmten Winkel darauf scheine.
Michel vermochte das nicht ganz zu überzeugen, aber er war zu erschöpft, um darüber weiter nachzusinnen. Dass die Sonne bei der Flussüberquerung hinter Gewitterwolken verborgen war und keine noch so seltsamen Pilze glitzern konnten, fiel ihm nicht auf. Und Tuong Vy tat das ihre, um ihn von diesem Umstand abzulenken.
«Ich gäbe viel darum, wenn es hier Whisky-Bäume gäbe, deren Saft man abzapfen kann, wie bei einem Gummibaum», scherzte sie. «Das würde dich aufheitern.»
Sie spürte in der Dunkelheit, wie er zusammenfuhr. «Tuong Vy! Du bist genial!»
Er wühlte in seinem Rucksack, der ihm als Kissen diente, und kramte einen Flachmann hervor. «Den hatte ich völlig vergessen. Ich habe ihn in Vientiane mit Cognac gefüllt, als Notration.» Er nahm einen kräftigen Zug und atmete tief durch. «Möchtest du auch einen Schluck?»
Sie zögerte, nippte aber dann doch an der Flasche, um ihm eine Freude zu machen. Sie musste husten und entschuldigte sich, denn sie hatte noch nie etwas Schärferes getrunken als warmes Bier.
«Seltsam», fand sie. «Das schmeckt wie die Medizin, die Père Louis von Zeit zu Zeit von seinen Ordensbrüdern aus Frankreich zugeschickt erhielt.»
Wie beabsichtigt, entlockte sie damit Michel ein Kichern. Er war ihr ja so dankbar, dass sie ihn vom Grübeln über ihre Lage ablenkte, die er zurzeit ohnehin nicht ändern konnte. Er nahm noch einen kräftigen Schluck, dann schwiegen sie beide. Nur noch die Geräusche des nächtlichen Dschungels waren zu hören. Darüber schliefen sie beide wieder ein. Die Erschöpfung forderte ihren Tribut.
2
Im ersten Licht der Morgendämmerung stand Michel auf, um sich die steifen Beine zu vertreten. Viel geschlafen hatte er nicht, doch Tuong Vy schien mit der Nacht besser klar geworden zu sein. Sie erwachte durch seine Bewegung, blinzelte ins Dämmerlicht, rollte sich aus und streckte sich wie eine Katze. Als sie sein Tun erkannte, erschrak sie.
«Lass das sein!», rief sie ihm halblaut zu. «Geh nicht ins Gebüsch. Bleib auf dem Pfad, um Himmelswillen!»
Michel blickte sie überrascht an. «Bonjour!Was ist? Ich brauche nur etwas Bewegung, um den Kreislauf in Gang zu bringen.»
«Nom de Dieu! C’est vachement dangereux!»Tuong Vy hob warnend die Hand. «Die Minen! In dieser Gegend liegen Tausende dieser Biester! Fiese, hinterhältige, kleine Personenminen. Und Bomben, die nicht explodiert sind. Aus dem Krieg.» Sie hatte ihm diesen Umstand bisher verschwiegen und diskret dafür gesorgt, dass sie immer auf ausgetretenen Pfaden marschiert waren.
Michel erschrak. Auf dem Hinweg zum Treffpunkt mit ihr beim Tempel auf der vietnamesischen Seite war er querfeldein marschiert, nach dem Kompass. Das hatte er beim Militär gelernt, und darauf war er stolz.
«Merde!», fluchte er. «Das hättest du mir früher sagen können! Nochmalsmerde!Der Krieg ist doch seit einem Vierteljahrhundert vorbei!»
«Kriege schlagen schwer heilbare Wunden, nicht nur seelische. Diese kleinen Biester sind Teufelszeug. Niemand weiss mehr, wer genau sie verlegt hat und wo.» Sie zog ihn an der Hand zurück. «Verzeih mir. Ich wollte dich nicht noch zusätzlich beunruhigen.» Sie lächelte ihn an. «Wenn man um die Dinger weiss und bestimmte Regeln einhält, sind sie nicht besonders gefährlich.»
Michel schenkte ihr einen dankbaren Blick und beschloss, ihr das zu glauben.
Dass in dieser Region in den vergangenen Jahren Dutzende von Menschen ein Bein oder beide durch diese perfiden Sprengsätze verloren hatten, behielt Tuong Vy für sich. Auch dass sie viele dieser Opfer gesehen hatte, als sie jeweils mit Père Louis in einem klapprigen Auto die Tour durch die Krankenhäuser in den Bergen machte, um die eitrigen Wunden zu säubern und Mut und Zuversicht zu verbreiten. Das war nicht der Moment, ihn mit dieser Lebenserfahrung zu belasten. Sie versuchte daher, sein Denken auf eine abstraktere Ebene zu lenken.
«Weisst du, meine Mutter und Père Louis haben mir viel vom Krieg erzählt. Hier, durch diese Region, verlief der Ho-Chi-Minh-Pfad, beidseits der Grenze.»
«Davon habe ich gelesen», nahm Michel wie erwartet den Ball auf. «Das muss eine schlimme Sache gewesen sein.»
«Oh, ja.» Sie war froh, dass er sein unmittelbares Problem verdrängt hatte. «Der Vietcong und die Leute aus dem Norden verlegten Minen, um Raids gegen ihre Transportkolonnen zu erschweren. Die Amerikaner und unsere Leute antworteten mit Brandbomben und giftigen Chemikalien, um die Bäume zu entblättern, die ihnen Deckung boten. Es war furchtbar. Das hat mir Père Louis erzählt.»
Michel hörte ihr zu, ohne etwas zu sagen. Sie beide, schoss es ihm wieder einmal durch den Kopf, stammten aus zwei grundverschiedenen Welten. Er aus einem friedlichen, wohlhabenden Land im Herzen Europas, wo sich die Menschen mangels echter Probleme laufend künstliche schaffen. Und sie aus einem Land, das zwischen Ideologie und Geopolitik zerrieben worden war.
Tuong Vy sah, dass er schon wieder zu grübeln begann, und machte dem ein schnelles Ende. «Ich habe Hunger, und ich glaube, dir geht es ebenso.»
Das Morgenessen bestand aus den letzten beiden BüchsenCorned Beefaus den Beständen von Michel. Danach versorgte Tuong Vy seine Wunde mit dem bewährten Speichelrezept. So gestärkt begannen sie, dem Pfad vom Vortag folgend, ihren Aufstieg auf einen Bergrücken, hinter dem sich ein langgezogenes, offensichtlich bewohntes Tal erstreckte.
Jetzt, hier im Ausland in Laos, schämte sich Tuong Vy. In ihrer blauen, zweiteiligen Arbeitskluft aus der Fabrik sah sie scheusslich aus.
3
Als Michel zwei Wochen zuvor auf dem Flughafen in Singapur auf seinen Flug nach Hué gewartet hatte, war er inhigh spiritsgewesen. Fast ein Jahr lang hatte er diszipliniert in den firmeneigenen Labors in Singapur gearbeitet. Dann hatte sein Vater und oberster Chef der Balliol Engineering Corporation befunden, er solle geschäftlich nach Vietnam fliegen.
«Du bist seit dem Ende der Affäre mit dieser philippinischenchica– wie hiess sie nur? Ja, richtig, dieser Stella – also, seither bist du nicht mehr ganz so nichtsnutzig wie zuvor», hatte er bissig hinzugefügt.
Okay, ganz falsch lag der Alte nicht, gestand sich Michel ein. Nach dem Erkenntnisdurchbruch mit Enriques vatikanischen Papieren dank Christinas Busen – oder genauer: nach dem Desaster mit Stella, der Nachfolgerin von Christina – hatte er auf den Pfad der Tugend zurückgefunden und Wein, Weib und Gesang entsagt – oder genauer: seine Aktivitäten auf diesen Gebieten markant zurückgefahren – und sich auf das in den alten Manuskripten des Mönchs Fra Sebastiano aus Alessandria versteckte Geheimnis gestürzt.
Je länger er die Unterlagen studiert hatte, desto überzeugter war er, dass die darin von Kardinal S. skizzierte unkonventionelle Hypothese über die ideale Geometrie – oder genauer: Asymmetrie – von nuklearem Brennstoff tatsächlich funktionieren könnte. Und wenn sie in der Praxis funktioniert, würde das die Herstellung von revolutionär neuartigem Kernbrennstoff für herkömmliche Atomkraftwerke ermöglichen. Kernbrennstoff, der nicht schmelzen konnte und fast keinen langlebigen radioaktiven Abfall hinterliess. Ein überaus verlockendes Entwicklungsprojekt für die Balliol Engineering.
Michel erschwatzte sich einen Planungskredit von seinem Vater und machte zusammen mit Wang Xiu Min, dem Chef des firmeneigenen Entwicklungslabors in Singapur, Besuche bei Fachkollegen rund um den Globus. Dabei sondierten sie diskret, was diese Peers von ihrer Idee hielten. Die meisten fanden ihre Asymmetrietheorie ebenso originell wie spekulativ. Auch war man sich einigermassen einig, dass offenbar die Gesetze der bisher bekannten Physik damit höchstens geritzt, aber nicht wirklich verletzt würden. Sonst aber blieb die grosse Mehrheit äusserst skeptisch, denn in diese Richtung hatte noch kaum jemand Versuche gewagt.
Michel und Xiu Min waren über den dogmatischen Konservativismus mancher ihrer Kollegen – «Was nicht in Lehrbüchern steht, ist Voodoo-Wissenschaft» – eigentlich ganz froh. Denn so erwuchs ihnen aus dieser Ecke keine Konkurrenz.
Doch es gab auch positivere Reaktionen. Zum Beispiel vom Vietnamesen Pham Hoang Lac, der sich, wie Michel überrascht feststellte, mit Festkörperphysik ausserordentlich gut auskannte. Professor Pham war um die fünfzig Jahre alt, ein anerkannter Kernphysiker und ein hohes Tier im Ministerium für Wissenschaft und Technologie in Hanoi. Michel hatte ihn bereits früher an internationalen Tagungen getroffen und mochte ihn. Pham war kompetent und vertrauenswürdig, mehr Wissenschafter als Beamter. Und er verblüffte Michel, der ihn inzwischen bei seinem Vornamen Lac ansprechen durfte, immer wieder mit konkreten Fragen und Einwänden zu seiner Asymmetrietheorie für Kernbrennstoffe.
Echte Wissenschafter sind von Natur aus neugierig, und Vietnam plant den Einstieg in die Kernenergienutzung, erklärte sich Michel das offensichtliche Interesse von Lac an seinem neuartigen Kernbrennstoff. Wenig überraschend versuchte Lac bei jeder Gelegenheit, mehr über den Ursprung der Asymmetrietheorie zu erfahren. Doch Michel war von seinem Vater mit deutlichen Worten gewarnt worden und verschloss sich in diesen Momenten wie die Muschel vor dem hungrigen Kraken. «Kein Sterbenswort über die Quelle und die Art unseres Wissens», hatte ihm der Alte eingeschärft. «Du bist noch jung und naiv. Du bist zu vertrauensselig. Und in unserem Business noch feucht hinter den Ohren.»
Michel hatte zu diesen Ermahnungen geschwiegen. Er wollte deswegen keinen Streit.
«Wie man so sagt: Traue keinem über dreissig, und ganz besonders nicht, wenn es um Geld geht», hatte der Vater nachgehakt. «Deine Entdeckung im Jahrhunderte alten Staub des Vatikans ist eine potenzielle Goldmine. Eine Riesenbonanza. Das weckt Begehrlichkeiten – in starker Ausprägung nennt man das Gier. Bei uns wie bei den anderen. Begehrlichkeit kennt keine Schranken, nur Steigerung. Das wussten schon die alten Römer.»
Geheimhaltung war das Gebot der Stunde. Michel und das Singapurer Team arbeiteten deshalb so diskret wie möglich, um mit theoretischen Überlegungen wie auch praktischen Experimenten die Vermutungen des seligen Kardinals zu überprüfen. Die praktischen Messungen im ringförmigen Teilchenbeschleuniger im Labor in Singapur liessen sich gut an und bestärkten sie, auf dem richtigen Weg zu sein.
Beim Manipulieren der Atome in diesem Zyklotron fühlten sie sich wie vor einem halben Jahrtausend die Alchimisten im goldenen Gässchen auf der Prager Burg. Nur waren in Singapur das Essen besser und das Bier dünner, wie John McGregor, der Amerikaner im Team, trocken anmerkte. Aber bestimmte chemische Elemente liessen sich tatsächlich ohne grosse Energiezufuhr von aussen gezielt ineinander überführen, wenn man wusste wie. Und das funktionierte auch für die stark radioaktiven Atome aus der Kernspaltung von Uran und Plutonium, die man elegant in stabile, nicht mehr radioaktive Atomkerne überführen und dabei erst noch Energie freisetzten konnte. Wenn man wusste wie.
Erstaunlicherweise war das leichter an winzigen Proben im Zyklotron getan als wissenschaftlich erklärt. Zunächst fast unbemerkt, dann immer deutlicher, näherte sich die Forschergruppe Schritt um Schritt der Krise. Trotz aller Anstrengungen weigerte sich die Theorie hartnäckig, die Realität der Experimente zu erklären. Das bisher mühsam erarbeitete Dokument mit den mathematisch-physikalischen Grundlagen, intern zur Tarnung mit dem nichtssagenden Code 435-2 gezeichnet, sperrte sich gegen die Vollendung. Irgendwo steckte der Wurm drin. Wang Xiu Min, als Chinese, nannte das poetisch eine «stehende Wolke über dem Teich der Perlentränen». John hingegen, der unsentimentale Yankee, sprach vomcanyon of despair, in dem schon viele Träume in den dunklen Schatten der Aussichtslosigkeit zugrunde gegangen seien.
In den letzten Wochen war das Entwicklungsteam schliesslich ganz im Schlamm mathematischer Widrigkeiten steckengeblieben – was im Experiment beobachtbar passierte, stand im Widerspruch zur den theoretischen Berechnungen. «Das kann uns doch egal sein», fand Michel. «Hauptsache, es funktioniert.»
Die Erfahreneren in der Firma lachten ihn aus. Einen völligen neuartigen nuklearen Brennstoff den Behörden zur Bewilligung vorzulegen ohne solides theoretisches Fundament, ohne wirklich zu verstehen, was im Brennstoff im Detail passiert – «das kannst du vergessen», lautete ihr einhelliges Urteil. «Da brauchst du nicht auf Greenpeace zu warten. Da kannst du dich gleich selbst am nächsten Wahrscheinlichkeitsbaum aufhängen.» Nein, definitiv – wer die grundlegende Physik dieser Vorgänge nicht verstehe, könne nicht nachweisen, dass er das Phänomen jederzeit unter Kontrolle habe.
In dieser misslichen Situation war die Offertanfrage von Pham Hoang Lac an die Balliol Engineering wie gerufen gekommen. «Flieg nach Vietnam», entschied der Alte, «da kannst du den Kopf auslüften. Und abgesehen davon wünscht Lac ausdrücklich, dass du kommst. Wahrscheinlich hat ihn die Neugier nach unseren Versuchen wieder einmal übermannt.» Er grinste. «Vergiss nicht die alte Weisheit: Klug zu schweigen ist noch schwieriger als klug zu reden. Also bleib verschwiegen wie ein Fisch, der seinen Mund hält, um der Angel auszuweichen.»
Bei der Offertanfrage von Lac ging es um eine starke Strahlenquelle für eine Lebensmittelfabrik in der Provinz Quang Tri, gleich südlich der ehemaligen Demarkationslinie zwischen Nord- und Südvietnam. Diese Fabrik hatte offenbar massive Qualitätsprobleme mit bakteriell verseuchten Dosenfrüchten und Dosengemüsen, und da wollte es Lac mit radioaktivem Kobalt-60 zur Sterilisierung versuchen. Michels Aufgabe bestand darin, sich die Fabrik anzusehen und sich zu vergewissern, dass das nötige Know-how für den Betrieb der Strahlenquelle vorhanden war und die Mitarbeiter landesüblich bezahlt wurden. Das verlangten allein schon die Governance-Regeln seines Unternehmens. Ohne diese Überprüfung durfte er keine Lieferofferte zuhanden der Planungsbehörden in Hanoi entwerfen.
4
In Vietnam wurde Michel am Flughafen der alten Kaiserstadt Hué von Lac abgeholt. Allerdings, so war das eben in Vietnam und bei nuklearen Dingen, wurde er von zwei jungen Männern mit den offenbar unverzichtbaren dunklen Sonnenbrillen begleitet, die Michel für sich «die Aufpasser» nannte.
Nach kurzer Fahrt quartierte sich die Gruppe in einem Hotel in der Provinzhauptstadt Dong Ha ein – einem reizlosen Ort, der im Krieg wegen seiner Nähe zur ehemaligen Trennlinie zwischen den beiden Vietnam fast vollständig zerstört und lieblos wieder aufgebaut worden war.
Beim gemeinsamen Abendessen versicherte Lac, die Lebensmittelfabrik sei gut geführt, da werde es kaum Probleme geben. Alles wies auf eine problemlose Angelegenheit hin. Michel war froh darüber, denn das war der erste potenzielle Kunde in Vietnam – nach den wirtschaftlichen Reformen der letzten Jahre versprach dieses Land ein vielversprechender Zukunftsmarkt zu werden. Diesen Auftrag durfte er nicht verpfuschen.
Nach dem Essen tauschten sie an der Bar Erinnerungen an frühere Begegnungen aus und tratschten über Fachkollegen und Gerüchte aus der Branche. Lac sorgte dafür, dass der Alkoholnachschub nicht ausblieb, und so wurde es Michel immer behaglicher, bis er seinen eigenen blöden Spruch vergass, den er einmal im Suff geboren hatte: Durch der Flasche Engnis zwängt sich der reine Geist – doch auch Verhängnis.
Als er schliesslich ins Bett stieg, war ihm nicht mehr ganz klar, worüber sie alles gesprochen hatten. Unter anderem auch über das Projekt in Singapur, darüber war er sich im Klaren – aber nur harmlose Dinge, wie er sich einredete. Denn er war, wie er glaubte, von den vielen Drinks derart angeschlagen, dass er keinen wirklich präzisen Gedanken mehr fassen, geschweige denn aussprechen konnte.
Völlig entglitten war ihm, dass er damit geprahlt hatte, dem Papst in Rom ein Geheimnis entwunden zu haben, von dem dieser nicht einmal wusste, dass es in seiner Bibliothek geschlummert hatte.
Am nächsten Tag fuhr Lac mit Michel zunächst zum Amtssitz des Gouverneurs und Parteichefs von Quang Tri. Tran Xich Long war ein Freund aus alten Zeiten, wie Lac versicherte. «Wir haben uns seit Jahren nicht mehr gesehen. Aber es ist auch ein Höflichkeitsbesuch – aus taktischen Gründen. Wenn der hiesige Platzhirsch weiss, was wir in der Fabrik vorhaben, kann er sich auf die Brust trommeln und es als seine eigene Initiative verkaufen. Damit sichern wir uns seine Unterstützung für das Projekt.Muốn ăn cá phải thả câụ. Wer Fische essen will, muss zuerst angeln.»
Michel hatte einen Moment Mühe, ernst zu bleiben. Wie sein Vater gesagt hatte: Hüte dich vor den Angelleinen!
Sie betraten das weitläufige Gebäude und Michel bewunderte in der Eingangshalle gebührend die Gemälde im Stil des sozialistischen Realismus – die wehenden roten Fahnen über muskulösen und kühn blickenden Arbeitern und Bauern, umkreist von der Blüte der vietnamesischen Weiblichkeit, herausgeputzt mit blumengeschmückten Zöpfen und unförmigen blauen Einheitsgewändern. Dabei fragte sich Michel, ob Lac sein Lob für diesen Kitsch eigentlich angemessen oder peinlich fand. Lacs Lächeln hatte sich nicht verändert.
Von einem herbei geeilten unterwürfigen Faktotum in olivgrüner Uniform wurden sie darüber informiert, dass der Gouverneur leider wegen dringender Pflichten abwesend sei. Lac blickte den Boten, der sich offensichtlich unwohl fühlte, streng von oben herab an. «Con Co?», fragte er schliesslich. Der Uniformierte nickte kaum erkennbar und war sichtlich erleichtert, als Lac ihn fragte, ob er seinem Gast – er wies auf Michel – das kleine Lokalmuseum im Südflügel zeigen könne, um die Zeit bis zum Meeting in der Fabrik zu überbrücken.
«Oh ja, sehr gerne», meinte der Olivgrüne überglücklich und verbeugte sich. «Wir haben es letztes Jahr neu gestaltet. Soll ich den hohen Herrn und seinen Begleiter führen?»
«Nicht nötig, ich kenne mich hier aus», knurrte Lac, dem die Servilität des Mannes offensichtlich auf die Nerven ging. Schliesslich war man hier in einem kommunistischen Land, das die Gleichheit aller Menschen zelebrierte. Michel gelang es, ein schadenfreudiges Grinsen zu unterdrücken.
Das Museum erwies sich als eine Sammlung von Devotionalien der Partei, ergänzt um einigen Kriegsschrott und eine zerschlissene amerikanischen Fahne. «A proposUSA», meinte Michel, als sie wieder allein waren. «Es gibt Gerüchte, die sagen, dass die Marinebasis Cam Ranh ausgerechnet den Amerikanern zur Verfügung gestellt werden soll, die den Hafen im Krieg gegen Hanoi ausgebaut haben. Als vorsorglicher Schutz gegen die Chinesen. Offenbar eure Erbfeinde seit Jahrhunderten, die hier im Meer nach Öl bohren wollen.»
Lac seufzte. «Michel, ich mag dich. Darum sage ich dir, dass Long und ich, dass wir beide im Krieg die Seite gewechselt haben, zum Vietcong. Weil wir Patrioten waren und jung und an den Sozialismus glaubten. Und… euh… weil wir nach dem Abzug der Amerikaner zur Einsicht gekommen waren, dass der Norden gewinnen wird.»
Er schaute etwas verlegen zu Boden. «Wer in dieser Welt überleben will, muss die Dinge pragmatisch angehen», meinte er schliesslich. «Hier in Vietnam haben wir ein Sprichwort: Auch der Klügste kann einem ganzen Haufen Verrückter nicht widerstehen.» Was Cam Ranh betreffe, erklärte er Michel, so habe sich dort seit jeher jeder getummelt: die Franzosen, die Flotte des Zaren, die Japaner, die Amerikaner, dann die Sowjetrussen und jetzt eben vielleicht wieder die Amerikaner. «Warum nicht? Der Feind deines Feindes ist dein Freund. Das war schon immer so.» Michel glaubte, aus Lacs Worten eine gewisse Bitterkeit herauszuhören. Vor dem Krieg ist nach dem Krieg ist vor dem Krieg. Und die Toten beklagen sich nicht.
Das wirklich Interessante im Museum waren jedoch die alten Fotografien. Sie zeigten den Untergang der Provinz Quang Tri im Krieg und den Wiederaufbau aus den Ruinen. Während Michel fasziniert diese Zeugen einer blutigen Vergangenheit musterte, blätterte Lac in einem Fotoalbum, das an einem Kettchen gesichert zum Durchblättern einlud.
«Das wurde offenbar zu Ehren unseres Gouverneurs aufgelegt und zeigt die Höhepunkte seiner Karriere», erklärte er Michel. «Hier schau mal, da sind Bilder aus der Zeit seiner Amtseinsetzung vor dreizehn Jahren. Da war er…» Lac brach abrupt ab und starrte auf eines der Bilder. Dann wandte er sich ab, trat ans Fenster und schaute in den nebligen Morgen hinaus.
«Was ist?», fragte Michel.
«Oh nichts, nur eine plötzliche Erinnerung an etwas, das ich vergessen zu haben glaubte», murmelte er unbestimmt. «Komm, gehen wir an die frische Luft.»
Beim Hinausgehen warf Michel einen verstohlenen Blick ins Album. Das schwarzweisse Bild zeigte einen Parteimann, der auf einem kleinen Platz zwischen schmucklosen zweigeschossigen Häusern die befohlene Huldigung des Volks entgegennimmt. Die Gesichter der Menschen in der Menge waren gut zu erkennen, hager und ernst. Offenbar regnete es, denn eine junge Frau hielt einen grossen Regenschirm über den Redner, während eine andere Frau ihm den Redetext hinhielt. Über allem flatterten die Fahnen des Nordens. Im Hintergrund ragte ein riesiges Siegesdenkmal in den wolkenverhangenen Himmel.
Michel konnte mit all dem nichts anfangen. Flüchtig bemerkte er den Ausdruck «Con Co» in der Bildlegende – das seltsame Wort, das Lac kurz zuvor dem Wachmann gegenüber erwähnt hatte. Er zuckte mit den Achseln. Vietnam war für ihn bis auf Weiteres ein Land unter sieben Siegeln. Aber schliesslich konnte ihm die Vergangenheit von Pham Hoang Lac und Tran Xich Long egal sein. Dachte er.
5
In der Lebensmittelfabrik wurden sie vom Betriebsleiter empfangen. Nachdem sie sich die üblichen Statistiken des volkseigenen Betriebs über sich hatten ergehen lassen – die Fabrik hielt unter anderem auch 592 Hühner zu Versorgung des Personals – begann der Rundgang. Es handelte sich um einen ausgedehnten Industriekomplex, dessen Maschinenpark zwar nicht der neueste war, aber, soweit erkennbar, gut gewartet. Die Produktionshallen waren sauber, ebenso die Menschen, die dort arbeiteten. Es gab sogar eine Firmenkantine.
Als sie an einem Nebengebäude vorbeigingen, fiel Michels Blick auf eine halb geöffnete Tür, durch die Lärm herausdrang. Das sei ein Teil der Dosenproduktion, meinte der Betriebsleiter und wollte rasch weitergehen. Michel war seine Eile nicht entgangen und auch nicht der unfreundliche Blick des sie begleitenden Vorarbeiters. Gerade deshalb äusserte er den Wunsch, da hinein zu gehen. Der Betriebsleiter blickte ihn unglücklich an, willigte dann aber widerstrebend ein. Im Vorvertrag war festgelegt worden, dass der Vertreter des Lieferanten alle Produktionsanlagen besichtigen dürfe.
Michel betrat den Raum. Die Luft war hier deutlich schwüler und stickiger als in der grossen Fabrikhalle. In einer Ecke krabbelte widerliches Getier. Es roch nach Gemüseabfall und altem Maschinenfett. Dazu herrschte ein unbeschreiblicher Lärm. Er stammte von einer Maschine, die aussah, wie wenn sie seinerzeit mit den ersten französischen Kolonialtruppen ins Land gekommen wäre.
An der Maschine sass eine grossgewachsene, magere Frau, die aus rohen Blechen Konservendosen formte. Sie war in ein weites, zweiteiliges blaues Gewand gekleidet, wie es die chinesischen Kulis in westlichen Comics tragen. Die Haare hatte sie zu einem Knoten zusammengebunden. Die kleinen Füsse, mit denen sie die Pedale der Maschine bediente, steckten in Flipflops. Michel räusperte sich, so laut er konnte, um den Lärm zu übertönen. Sie hörte ihn erstaunlicherweise und drehte den Kopf in seine Richtung.
Er wollte etwas sagen, doch dann sah er ihre Züge. Ihr Gesicht war oval und regelmässig geformt, mit einer markanten, geraden Nase. Sie war offensichtlich noch jung, aber die Arbeit hatte ihrem Teint schwer zugesetzt. Ihre Haut war bleich und voller Ekzeme. Was aber Michel am meisten überraschte, waren ihre Augen. Sie waren graugrün, sehr klar und blickten ihn hellwach an. Sie passten überhaupt nicht zu ihrer übrigen Erscheinung. Sie passten überhaupt nicht an diesen Ort.
Diese unglaublichen Augen wandten sich plötzlich von ihm ab und fixierten einen Punkt hinter ihm. Pham Hoang Lac, der Betriebsleiter und der Vorarbeiter hatten ebenfalls den Raum betreten.
Ihre Anwesenheit brachte die Arbeiterin derart durcheinander, dass sie mit der Hand ausrutsche und sich an einer Blechkante in den Finger schnitt. Sie stellte die Maschine ab, und der Lärm erstarb.
Michel, hörte, wie Lac überrascht den Atem einzog und dann hustete. Offenbar machte der Anblick dieser Frau auch ihm zu schaffen.
Die Arbeiterin stillte die Blutung am Finger mit ihrem Speichel und rückte die Dose wieder an den richtigen Platz in der Maschine. Sie wollte offenbar die Arbeit wiederaufnehmen.
Michel fühlte plötzlich eine unbestimmte Wut in sich aufsteigen und vergass die Ratschläge, die ihm sein Vater gegeben hatte. Bleibe immer höflich und behalte deine Meinung für dich, hatte der ihm eingeschärft. Wahre dein Gesicht und das deiner Gesprächspartner. Doch Michels manchmal ungestümes Temperament liessen ihn alle Vorsicht vergessen. Ohne gross zu überlegen rief er: «Stop! What are you doing here?»
Er war überrascht, dass sie ihm auf Englisch antwortete: «Ich mache Konservendosen, für die Früchte und das Gemüse.»
«Das sehe ich. Aber warum bist du hier?»
«Das ist meine Schicht.» Ihr Englisch hatte einen Akzent, den Michel bestens kannte. Deshalb wechselte er, von Haus aus mehrsprachig aufgewachsen, ins Französische.
«Tu m’as mal compris. Das habe ich nicht gemeint. Ich meine…» Er suchte nach Worten. «Ich meine: Warum arbeitest du hier, in dieserinfâme poubelle,in diesem Dreckloch, und nicht in einem Büro oder in der Spedition?»
An diesem Punkt wollte sich der Vorarbeiter einmischen. «Sie ist ein schlechter Mensch. Ein Hurenkind der imperialistischen Feinde. Der Abschaum unseres…»
Doch der Betriebsleiter schnitt ihm das Wort ab. Lac hatte ihm einen Wink gegeben. «Sie ist eine unserer Arbeiterinnen, und jemand muss eben diese Arbeit machen», erklärte er an Stelle des Vorarbeiters. «Lấy bát mồ hôi đổi bát cơm», fügte er an. «Ein Schälchen Schweiss – ein Schälchen Reis.»
«Aber doch nicht in einem solchen Stinkloch!», ärgerte sich Michel.
«Die Modernisierungsarbeiten unseres volkseigenen Betriebs sind noch nicht abgeschlossen. Die Verbesserung der Fabrik ist im laufenden Fünf-Jahres-Plan unserer ruhmreichen Partei vorgesehen», verteidigte sich der Chef.
Diese Phrasen erinnerten Michel unmissverständlich daran, wo er sich befand. Er lächelte höflich und meinte, das freue ihn, und er möchte später mehr davon hören. Lac, nervös geworden durch Michels Hartnäckigkeit, atmete erleichtert auf.
Michel wandte sich wieder an die junge Frau, die reglos vor ihrer Maschine sitzen geblieben war. «Ich werde dich später nochmals sprechen», meinte er bestimmt. Sie zuckte mit den Achseln und wandte sich wieder ihren Dosen zu.
«Das geht nicht», warf der Vorarbeiter ein. «Sie muss arbeiten.» Der Betriebsleiter blickte fragend zu Lac, der nickte, und gab dem Vorarbeiter einen scharfen Befehl auf Vietnamesisch, worauf sich dieser murrend entfernte. Michel glaubte zu sehen, wie sich die Arbeiterin etwas entspannte und Lac einen dankbaren Blick zuwarf, den dieser mit einem kurzen Lächeln quittierte.
«Ich will sehen, was sich machen lässt», meinte der Betriebsleiter. «Gehen wir weiter.» Beim Verlassen des Gebäudes hörte Michel, wie der infernalische Lärm der Maschine wieder einsetzte.
Der restliche Rundgang nahm er mehr mechanisch war. Was er noch zu sehen bekam, schien ihm soweit in Ordnung. Zurück im Sitzungszimmer wollte der Betriebsleiter mit Michel den Ablauf des nächsten Besuchstags besprechen. Doch Lac, der seit dem Zwischenfall in der Dosenmacherei ungewöhnlich schweigsam geblieben war, unterbrach ihn und hielt ihm einen längeren Vortrag auf Vietnamesisch, an deren Ende sich beide lächelnd die Hände schüttelten.
«Man wünscht, dass Sie mit unserer Arbeiterin aus der Dosenproduktion sprechen können», erklärte der Betriebsleiter dem überraschten Michel. «Ich bin einverstanden. Sie wird am Ende ihrer Schicht vor der Fabrik auf Sie warten.» Lac nickte befriedigt.
Sie besprachen das Programm des kommenden Tages ohne weitere Schwierigkeiten.
6
Wie versprochen, wartete die Arbeiterin am Abend vor dem Fabriktor. Sie sass, immer noch in der schmutzigen blauen Arbeitskleidung, auf einer Bank bei einem Lotosteich im kleinen Park nebenan. Michel setzte sich neben sie.
«Salut»,begann er die Konversation.
«Salut.»
«Comment t’appelles-tu?»
«Nguyen Tuong Vy.»
«Engnüén…excuse-moi, ich habe Mühe, deinen Namen auszusprechen.»
«Nguyen. N-G-U-Y-E-N. Das ist mein Familienname.» Pause.
«Das ist ein häufiger Name in Vietnam», nahm Michel den dünnen Gesprächsfaden wieder auf.
«Ja.»
«Mein Name ist Jean-Michel. Jean-Michel Balliol. Aber meist ruft man mich nur Michel. Ich komme aus Europa.»
«Ja, ich weiss.»
«Was weisst du?»
«Du bist hier, um eine Maschine zu verkaufen. Für die Qualitätssicherung.»
«Woher weisst du das?»
«Man hat es mir gesagt.»
«Wer, wann?»
«Als man mir befahl, hier zu warten.»
«Ach so.»
Pause.
Sie blickt auf, erstmals. «Michel ist ein schöner Name.
Wie beim Mont-Saint-Michel.»
Michel blickte sie überrascht an.
«Der Mont-Saint-Michel. Die Klosterburg im Meer», präzisierte sie. «In der Normandie.»
«Die kenne ich.»
Sie schien interessiert: «Warst du schon einmal dort?»
«Ich, äh… nein, eigentlich nicht. Aber ich habe Bilder gesehen.»
«Ich auch.»
Erneute Pause.
So konnte es nicht weitergehen. Michel beschloss, den Stier bei den Hörnern zu packen. «Du hast eine Schramme im Gesicht, die du vorhin noch nicht hattest.» Sie strich erschrocken über die rote Linie auf ihrer Wange.
«C’est un petit rien. Das geht dich nichts an.» Sie wies mit ihren Augen in Richtung des Fabriktors, wo die beiden Aufpasser von Lac müssig herumstanden und rauchten.
«Die können uns nicht hören. Und Professor Pham, der Mann aus Hanoi, der mich begleitet, hat gesagt, wir dürfen miteinander sprechen. Ich sitze hier sozusagen mit dem Segen der Regierung.»
«Du scheinst ein wichtiger Mann zu sein. Man hat mir sogar zehn Tage frei gegeben. Das haben sie noch nie gemacht.» Offenbar war sie jetzt etwas aufgetaut.
«Zehn Tage? Das ist gut», Michel dankte Lac im Stillen. «Nein, wichtig bin ich nicht, aber Hanoi will unbedingt eine Maschine von meiner Firma kaufen. Wir verkaufen aber nur – wir dürfen nur dann verkaufen nach den internationalen Regeln – wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Und die darf – muss – ich kontrollieren.»
Sie erfasste sofort den springenden Punkt. «Du kannst sie unter Druck setzen? Auf Befehl aus Hanoi?», fragte sie überrascht und zeigte den Anflug eines Lächelns, das aber schnell wieder erstarb.
«Das nicht gerade. Aber immerhin. Also erzähl mir: Warum arbeitest du in diesem Loch?»
«Warum nicht?»
«Du gehörst nicht hierhin. Du hast wundervolle Augen.»
«Merci,aber was hat das mit meiner Arbeit zu tun?»
«Jemand, der so in die Welt blickt wie du, darf nicht so behandelt werden.»
«Niemand sollte so behandelt werden dürfen.»
«Richtig, und darum sitze ich hier.»
Sie dachte eine Weile nach und blickte wieder zu den beiden Aufpassern, die immer noch rauchten.
«Mit denen habe ich nichts zu tun», versicherte Michel nochmals. «Mühsame Typen. Für die bin ich nur Dreck.» Das sprach offenbar für ihn, denn sie nickte zustimmend. «Versteh mich richtig», insistierte er. «Der Mann aus Hanoi will Ärger mit mir vermeiden. Er will, dass du mir deine Geschichte erzählst.»
Das half, und sie begann in ihrem akzentfreien Französisch zu erzählen. Erst mühsam und stockend, dann immer flüssiger, je länger Michel zuhörte und von Zeit zu Zeit zu erkennen gab, dass ihn das wirklich interessierte. Ganz ohne Hintergedanken, wie er betonte, und das glaubte sie ihm offenbar.
Eigentlich sei alles ganz einfach, begann sie. Sie habe Pech gehabt. Sie sei zur falschen Zeit am falschen Ort geboren worden. Hier in Quang Tri, in einem Militärspital, in den letzten Tagen des Krieges, zwischen Verwundeten und Sterbenden. Ihre Mutter Hong Nhung war eine Tochter aus einer angesehenen Familie in Quang Tri, ihr Vater ein amerikanischer Militärberater, ein Offizier des U.S. Army Corps of Engineers, dessen Familie ursprünglich aus Irland stammte. Sie hätten sich auf einem Ball kennengelernt, ineinander verliebt und sie wollten heiraten, doch wegen des Kriegs habe der Termin immer wieder verschoben werden müssen.
Am Tag ihrer Geburt herrschte Chaos in Quang Tri. Aus der Ferne war bereits der Kriegslärm zu hören, und rundum packten die Leute ihre Habe, um vor den anrückenden Soldaten des Nordens nach Süden zu fliehen. Der Vater habe am nächsten Tag im improvisierten Feldspital vorbeigeschaut und wollte Mutter und Kind in seinem Jeep mitnehmen.
Doch die Mutter war dazu nach der Geburt viel zu schwach, und Père Louis, ein Benediktinermönch, der sich im Spital um die Sterbenden kümmerte, habe kategorisch widersprochen. Das würden Mutter und Kind niemals überleben. Der Vater beschloss, an der Küste Hilfe zu holen, einen Lastwagen mit Bahren, um seine kleine Familie zusammen mit Verwundeten nach Süden zu evakuieren.
Ein Freund der Familie, der ebenfalls zu Besuch gekommen war, warnte jedoch den Amerikaner, die Hauptstrasse zu nehmen. Die sei bereits unsicher. Er beschrieb ihm einen Schleichweg durch die Felder, der noch sauber sei. Der Vater eilte weg, und seither hat niemand wieder etwas von ihm gehört. Er verschwand im Krieg, wie zuvor schon die beiden Brüder ihrer Mutter. Drei Tage später erreichten die Soldaten des Nordens das Spital.
Tuong Vy macht eine kurze Pause. Der Rest war schnell erzählt: Die Mutter fand Zuflucht im Pfarrhaus, beim Benediktinermönch Père Louis, ihrem Beichtvater. Der war vor vielen Jahren aus Frankreich gekommen, aus der Normandie. Doch nach dem Ende des Kriegs und dem endgültigen Sieg des Nordens waren eines Tages Uniformierte gekommen. Sie erklärten, ihre Mutter sei eine imperialistische Hure, sie müsse in ein Umerziehungslager und das Kind in ein Waisenhaus. Père Louis leistete Widerstand, und die Uniformierten lenkten ein, in Anerkennung seiner Verdienste um die Verwundeten beider Seiten, wie sie meinten.
Mutter und Kind durften bei Père Louis bleiben – «wie in einem Kloster» –, doch der Preis war hoch: Sie wurden beide aus der Gemeinschaft der Werktätigen ausgeschlossen, was unter anderem bedeutete, dass sie citoyens de troisième classewurden, ohne Zugang zu staatlichen Leistungen wie medizinischer Versorgung oder Bildungsinstitutionen.
Ihre Mutter verschwand spurlos, als Tuong Vy zwölf Jahre alt war. Die Uniformierten erklärten ihr, die Mutter sei krank geworden und gestorben. Wo die Mutter begraben liege, wollten sie nicht sagen.
Tuong Vy durfte weiterhin nicht zur Schule gehen und theoretisch nicht einmal mit Gleichaltrigen spielen. Sie wurde zu einer unerwünschten Fremden im eigenen Land, weil sie die falschen Eltern hatte. Nach einer weiteren kurzen Pause kam sie mit ihrer Erzählung zum Schluss: «Vor rund einem Jahr, kurz nach meinem vierundzwanzigsten Geburtstag, starb Père Louis. Er war sehr alt geworden. Danach war es mit seinem Schutz natürlich aus.» Und so habe irgendein hohes Tier wiederum Uniformierte vorbeigeschickt. «Und dann… und dann…»
Sie stockte, überlegte eine Weile und erklärte dann kurz angebunden, dass man sie nach einigem Hin und Her in diese Fabrik geschickt habe. Um ihre Schuld am Volk abzuarbeiten, wie sie sagten.
Das sei das Wesentliche, schloss sie und blickte betreten zu Boden. «Ich habe keine Verwandten», murmelte sie. «Ich bin allein. Mit Ausnahme von meiner Mutter und mir hat niemand aus meiner Familie den Krieg und die anschliessenden Säuberungen überlebt.» Sie kämpfte einen kurzen Moment mit den Tränen. «Manchmal», flüsterte sie darauf fast unhörbar, «manchmal glaube ich, dass eine böse Fee bei meiner Geburt anwesend war.»
Weder sie noch Michel ahnten damals, dass sie damit der Wahrheit ziemlich nahe kam.





























