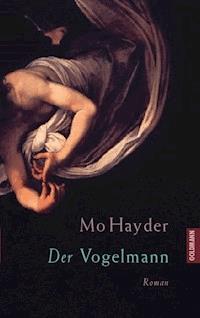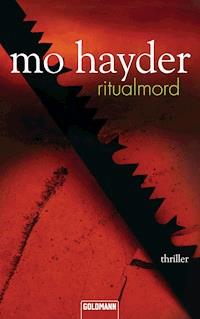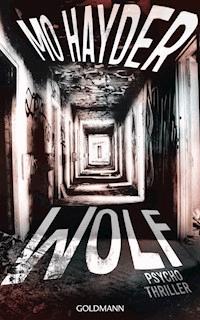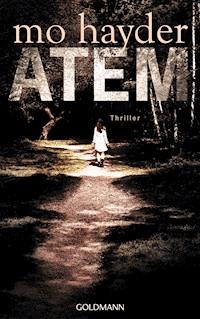
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie würde für ihr Kind sterben. Aber würde sie auch dafür töten?
Sally Benedict ist sich sicher: alles fing mit dem Mord an Lorne Wood an, dem 16-jährigen Mädchen, das in dieselbe Schule ging wie ihre Tochter Millie. Eines Abends kehrte sie nicht mehr nach Hause zurück, man fand sie tot am Kanal, mit einem Tennisball im Mund und einer Plane bedeckt. Aber dies ist nicht das Einzige, was Sally zu schaffen macht: Ihre Ehe ist gescheitert, das Geld wird knapp, und sie hat das Gefühl, die Kontrolle über ihr Leben zunehmend zu verlieren. Als ihre Tochter immer größere Forderungen stellt, schlägt Sally einen Weg ein, der sie immer tiefer in kriminelle Kreise führt. Und dann übernimmt auch noch ihre Schwester Zoë, die bei der Polizei arbeitet, den Fall Lorne Wood – und es geschieht etwas im Leben der beiden Schwestern, das sie für immer aneinander binden wird …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 626
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mo Hayder
Atem
THRILLER
Ins Deutsche übertragen von Rainer Schmidt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »Hanging Hill« bei Bantam Press, einem Imprint von Transworld Publishers, London.
Copyright © der Originalausgabe by Mo Hayder 2011
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-07252-0V003
www.goldmann-verlag.de
Die Beerdigung fand in einer anglikanischen Kirche auf einem Hügel etwas außerhalb der alten Bäderstadt Bath statt. Die Kirche, über tausend Jahre alt, war nicht größer als eine Kapelle und die Zufahrt viel zu schmal für die Reporter und Fotografen, die sich hier nach den guten Plätzen drängten. Es war ein warmer Tag, und der Duft von Gras und Geißblatt wehte über den Friedhof, als die Trauergäste eintrafen. Ein paar Rehe, die nachmittags für gewöhnlich hierherkamen und das Moos von den Grabsteinen knabberten, wurden durch den lebhaften Betrieb verschreckt. Sie sprangen davon, setzten über die niedrige Steinmauer und verschwanden im angrenzenden Wald.
Die Leute schoben sich in die Kirche, nur zwei Frauen blieben draußen steif auf einer Bank unter dem weißen Sommerflieder sitzen. Schmetterlinge flatterten und schwirrten zwischen den Blüten über ihren Köpfen umher, aber die Frauen schauten nicht zu ihnen hinauf. Sie waren vereint in ihrem Schweigen – immer noch benommen und fassungslos angesichts der Kette der Ereignisse, die sie hierhergeführt hatte. Sally und Zoë Benedict. Schwestern, auch wenn man es ihnen nicht ansah. Die große, langbeinige war Zoë, um ein Jahr älter als ihre Schwester Sally, die viel kleiner und gefasster war und immer noch das runde, aufgeräumte Gesicht eines Kindes hatte. Sie saß da und schaute hinunter auf ihre kleinen Hände und das Papiertaschentuch, das sie geknetet und in kleine Fetzen gerissen hatte.
»Es ist schwerer, als ich dachte«, sagte sie. »Ich meine – ich weiß nicht, ob ich da reingehen kann. Ich dachte, ich könnte es, aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher.«
»Ich auch nicht«, sagte Zoë leise. »Ich auch nicht.«
Eine Zeitlang saßen sie stumm da. Ein oder zwei Leute kamen die Treppe herauf, Leute, die sie nicht kannten. Dann zwei Freunde von Millie: Peter und Nial. Unbeholfen sahen sie aus in ihren feinen Anzügen und mit ihren ernsten Gesichtern.
»Seine Schwester ist hier«, sagte Zoë nach einer Weile. »Ich habe auf der Treppe mit ihr gesprochen.«
»Seine Schwester? Ich wusste nicht, dass er eine hat.«
»Er hat eine.«
»Seltsame Vorstellung, dass er eine Familie hat. Wie sieht sie aus?«
»Kein bisschen wie er, Gott sei Dank. Aber sie hat gefragt, ob sie mit dir sprechen kann.«
»Was will sie?«
Zoë zuckte die Achseln. »Sich entschuldigen, nehme ich an.«
»Was hast du gesagt?«
»Was glaubst du? Nein. Natürlich ist die Antwort nein. Sie ist reingegangen.« Sie warf einen Blick über die Schulter zur Kirchentür. Der Vikar stand da und sprach leise mit Steve Finder, Sallys neuem Freund. Er war ein guter Mann, dachte Zoë – einer, der Sally Halt geben konnte, ohne sie zu sehr zu erdrücken. So jemanden brauchte sie. Er blickte auf, sah, dass Zoë ihn anschaute, und nickte. Dann hob er das Handgelenk und tippte auf seine Uhr, um zu signalisieren, dass es Zeit war. Der Vikar legte die Hände an die Türflügel, um sie zu schließen. Zoë stand auf. »Komm. Bringen wir’s hinter uns.«
Sally rührte sich nicht. »Ich muss dich etwas fragen, Zoë. Zu dem, was passiert ist.«
Zoë zögerte. Jetzt war nicht der richtige Augenblick, um darüber zu reden. Sie konnten nicht ändern, was geschehen war, indem sie darüber diskutierten. Aber sie setzte sich wieder. »Okay.«
»Es hört sich bestimmt komisch an.« Sally verdrehte die Taschentuchfetzen mit beiden Händen. »Aber glaubst du im Rückblick … glaubst du, du hättest es kommen sehen können?«
»Oh, Sally – nein. Nein, das glaube ich nicht. Polizisten sind ja keine Hellseher. Auch wenn die Öffentlichkeit das gern hätte.«
»Ich hab mich nur gefragt. Weil …«
»Weil was?«
»Weil ich rückblickend glaube, ich hätte es kommen sehen können. Ich glaube, ich habe eine Warnung erhalten. Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich glaube es. Es gab eine Warnung. Oder eine Vorahnung. Oder einen Blick in die Zukunft. Wie immer du es nennen willst.«
»Nein, Sally. Das ist verrückt.«
»Ich weiß – und in dem Moment dachte ich es auch. Es war blöd, dachte ich. Aber jetzt kann ich mir nicht helfen: Ich denke dauernd, wenn ich darauf geachtet hätte, wenn ich das alles hier vorausgesehen hätte« – sie spreizte die Hände und deutete auf die Kirche, den Leichenwagen, der unten an der Treppe angehalten hatte, die Übertragungswagen und die Fotografen –, »dann hätte ich es verhindern können.«
Zoë dachte eine Weile darüber nach. Vor nicht allzu langer Zeit hätte sie über eine solche Äußerung gelacht. Doch jetzt war sie nicht mehr sicher. Die Welt war ein seltsamer Ort. Sie schaute zu Steve und dem Vikar hinauf und sah dann wieder ihre Schwester an. »Du hast mir nie etwas von einer ›Warnung‹ erzählt. Was für eine Warnung war das? Und wann hast du sie bekommen?«
»Wann?« Sally schüttelte den Kopf. »Ich bin nicht ganz sicher. Aber ich glaube, es war an dem Tag, als die Sache mit Lorne Wood anfing.«
Erster Teil
1
Es war ein Frühlingsnachmittag Anfang Mai gewesen, als die Abende wieder länger wurden und die Primeln und Tulpen unter den Bäumen schon zerfranst und unordentlich aussahen. Die ersten Anzeichen wärmeren Wetters hatten alle in gute Laune versetzt, und zum ersten Mal seit Monaten war Sally zu Isabelle zum Lunch gekommen. Die Sonne stand noch hoch am Himmel, und ihre halbwüchsigen Kinder waren im Garten. Die beiden Frauen machten eine Flasche Wein auf und blieben in der Küche. Die Fenster waren offen, die Baumwollvorhänge wehten leicht im Wind, und von ihrem Platz am Tisch aus konnte Sally die Teenager beobachten. Sie kannten einander seit dem Kindergarten, aber erst seit ungefähr einem Jahr kam Millie wirklich gern hierher. Jetzt waren sie eine Bande, eine richtige kleine Clique: zwei Mädchen, zwei Jungen, zwei Jahre auseinander, aber auf derselben Privatschule, Kingsmead. Sophie, mit fünfzehn Isabelles Jüngste, machte im Garten Handstand, und ihre dunklen Locken schwangen wild umher. Millie, genauso alt, aber einen Kopf kleiner, hielt ihre Beine fest. Beide Mädchen trugen ähnliche Jeans und Neckholder-Tops, aber im Vergleich zu Sophies Kleidern waren Millies Sachen ausgeblichen und verschlissen.
»Ich muss da was machen«, sagte Sally nachdenklich. »Ihre Schuluniform hält auch nicht mehr lange. Ich war bei der Hausmutter, um zu sehen, ob ich eine Second-Hand-Uniform kriegen kann, aber sie hatte in Millies Größe nichts mehr da. Anscheinend kaufen alle Eltern von Kingsmead nur noch Second Hand.«
»Alle müssen den Gürtel etwas enger schnallen«, sagte Isabelle. Sie machte einen Sirupkuchen und beschwerte gerade den Teigboden mit einer Handvoll Murmeln, die sie in einem Glas auf dem Kühlschrank aufbewahrte. Die Butter und der goldene Sirup blubberten im Topf und erfüllten die Küche mit ihrem schweren, nussigen Duft. »Ich habe Sophies Sachen immer der Hausmutter gebracht.« Sie hatte die Murmeln auf dem Teig verteilt und schob die Form in den Ofen. »Aber von jetzt an hebe ich sie für Millie auf. Sophie trägt eine Nummer größer als sie.«
Sie wischte sich die bemehlten Hände an der Schürze ab, blieb einen Moment stehen und betrachtete ihre Freundin. Sally wusste, was sie dachte: Ihr Gesicht war blass und faltig, ihr Haar ungewaschen. Wahrscheinlich sah Isabelle vor ihrem geistigen Auge die pinkfarbene Schürze der Gebäudereinigungsfirma »HomeMaids«, die Sally sonst über verblichenen Jeans und einem Top mit Blumenmuster trug, und empfand Mitleid. Nach all der Zeit fing sie langsam an, sich an Mitleid zu gewöhnen. Natürlich war es die Scheidung. Die Scheidung und Julians neue Frau und ihr Baby.
»Ich wünschte, ich könnte ein bisschen mehr tun, um zu helfen.«
»Du hilfst doch, Isabelle.« Sie lächelte. »Du sprichst noch mit mir. Das ist mehr, als die anderen Mums in Kingsmead tun.«
»Ist es so schlimm? Immer noch?«
Schlimmer, dachte sie. Aber sie lächelte. »Es wird schon wieder.«
»Wirklich?«
»Wirklich. Ich meine – ich habe mit der Bank gesprochen und meine Kredite hin und her geschoben, sodass ich nicht mehr so hohe Zinsen zahlen muss. Und ich kriege jetzt mehr Stunden von der Agentur.«
»Ich weiß nicht, wie du das schaffst.«
Sally zuckte die Achseln. »Das schaffen andere Leute auch.«
»Ja, aber andere Leute sind solche Arbeit gewöhnt.«
Sie sah zu, wie Isabelle an den Herd trat und im Sirup rührte. Daneben standen offene Tüten mit Mehl und Haferflocken. Auf allen Artikeln standen Namen wie »Waitrose« oder »Finest« oder »Goodies Delicatessen«. Zu Hause im Cottage bei Sally und Millie stand »Aldi« oder »Lidl« auf den Packungen, und das Gefrierfach war voll von dem kümmerlichen, faserigen Grünzeug, das sie mühsam im Garten herangezogen hatte. Das war eine Lektion, die Sally sehr schnell gelernt hatte: Gemüsezucht war eine Beschäftigung für Reiche, die nichts zu tun hatten. Viel billiger war es, so etwas im Supermarkt zu kaufen. Jetzt nagte sie am Daumennagel und sah zu, wie Isabelle in der Küche hantierte, sah den vertrauten, kräftigen Rücken, die zweckmäßigen schlammfarbenen Shorts, die Bluse, die mit Blütenzweigen bedruckte Schürze. Sie waren seit Jahren befreundet, und Isabelle war der Mensch, dem Sally am meisten vertraute und bei dem sie sich zuallererst Rat holte. Trotzdem genierte sie sich jetzt ein wenig, über das zu sprechen, was sie beschäftigte.
Aber schließlich ging sie doch zu ihrer Tasche und zog eine blaue Mappe heraus. Sie war schäbig und wurde nur mit einem Gummiband zusammengehalten. Sally kam damit zum Tisch, legte sie neben die Weingläser, zog das Gummiband ab und nahm den Inhalt heraus. Handgemalte Karten, geschmückt mit Perlen, Schleifen und Federn, alles mit klarem Lack überzogen. Sie legte sie auf den Tisch und saß unschlüssig da, halbwegs bereit, alles wieder zusammenzuraffen und in ihre Tasche zu stecken.
»Sally?« Isabelle nahm den Topf vom Herd und rührte weiter darin, als sie herüberkam, um sich die Karten anzusehen. »Die hast du doch nicht etwa selbst gemacht, oder?« Sie betrachtete die oberste. Sie zeigte eine Frau mit einem violetten, mit Sternen besetzten Tuch, das sie sich vor das Gesicht gezogen hatte, sodass nur noch die Augen zu sehen waren. »Gott – wie schön. Was ist das?«
»Tarotkarten.«
»Tarot? Hast du plötzlich ein Faible für Esoterik? Wirst du uns allen die Zukunft weissagen?«
»Selbstverständlich nicht.«
Isabelle setzte den Topf ab und nahm die zweite Karte in die Hand. Abgebildet war eine hochgewachsene Frau, die einen großen, durchsichtigen Stern auf Armlänge vor sich hielt. Es sah aus, als schaue sie durch ihn hindurch zu den Wolken und der Sonne hinauf. Ihre zerzausten, grau gesträhnten Locken reichten weit über den Rücken hinunter. Isabelle lächelte verlegen. »Das bin doch nicht etwa ich, oder?«
»Doch.«
»Im Ernst, Sally? Das Dekolleté schmeichelt mir aber, wenn ich das sagen darf.«
»Wenn du sie alle anschaust, wirst du jede Menge bekannte Gesichter entdecken.«
Isabelle blätterte in den Karten und hielt ab und zu inne, wenn sie jemanden erkannte. »Sophie! Und Millie. Du hast uns alle gemalt. Die Kinder auch. Sie sind wunderschön.«
»Ich hab mich gefragt«, sagte Sally zögernd, »ob ich sie vielleicht verkaufen kann. Zum Beispiel an den Hippieladen in Northumberland Place. Was meinst du?«
Isabelle drehte sich um und warf ihr einen seltsamen Blick zu, halb verwundert, halb amüsiert, als wüsste sie nicht, ob Sally einen Witz machte oder nicht.
Sofort war Sally klar, dass sie einen Fehler begangen hatte. Hastig schob sie die Karten zusammen und spürte, wie ihr vor lauter Verlegenheit die Röte am Hals heraufkroch. »Nein … ich meine, natürlich sind sie nicht gut genug. Das wusste ich schon.«
»Nein, räum sie nicht weg. Sie sind toll. Wirklich toll. Es ist nur so, dass … meinst du wirklich, du kriegst dafür so viel, dass es dir – du weißt schon, dass es dir bei deinen … Schulden hilft?«
Sally starrte die Karten an. Ihr Gesicht glühte. Sie hätte gar nicht davon anfangen sollen. Isabelle hatte recht; sie würde für diese Karten kaum etwas bekommen. Auf keinen Fall genug, um ihren Schuldenberg auch nur anzukratzen. Sie war dumm. So dumm.
»Aber nicht, weil sie nicht gut sind, Sally. Sie sind ausgezeichnet! Ehrlich, sie sind toll. Sieh dir die hier an!« Isabelle hielt Millies Porträt hoch. Die kleine, verrückte Millie, immer kleiner als die andern und das genaue Gegenteil von Sally, mit ihrem Zickzackpony und dem wirren, zottigen roten Haar, mit dem sie aussah wie ein kleines nepalesisches Straßenkind. Ihre Augen waren so wild und rund wie die eines Tieres – genau wie bei Millies Tante Zoë. »Sie ist einfach super. Genau so sieht sie aus. Und die hier mit Sophie – sie ist hinreißend. Hinreißend! Und Nial. Und Peter.« Nial war Isabelles schüchterner Sohn, ihr älteres Kind, und Peter Cyrus war sein gut aussehender Freund, ein Draufgänger und besonders beliebt bei den Mädchen. »Und Lorne – sieh sie nur an … und noch mal Millie. Und noch mal Sophie, und dann ich. Und …« Sie brach plötzlich ab und starrte eine Karte an. »Oh«, sagte sie schaudernd. »Oh.«
»Was?«
»Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht mit der Farbe auf dieser da.«
Sally zog die Karte heran. Es war die Prinzessin der Stäbe. Sie trug ein wirbelndes rotes Kleid und hielt mit Mühe einen Tiger zurück, der an der Leine zerrte. Auch hier war Millie das Modell gewesen, aber auf dieser Karte war etwas mit ihrem Gesicht passiert. Sally strich mit dem Finger darüber und drückte darauf. Vielleicht war das Acryl rissig geworden oder hatte sich irgendwie gelöst, denn Körper, Kleidung und Hintergrund waren noch so, wie sie sie gemalt hatte, aber das Gesicht war verschwommen. Es sah aus wie auf einem Gemälde von Francis Bacon oder Lucian Freud. Auf einem dieser erschreckenden Bilder, auf denen man durch die Haut der Figuren hindurchzuschauen und geradewegs das Fleisch zu sehen glaubte.
»Igitt«, sagte Isabelle. »Ich bin froh, dass ich an solchen Kram nicht glaube. Sonst wäre ich jetzt wirklich beunruhigt. Als wär’s eine Warnung oder so was.«
Sally sagte nichts. Sie starrte das Gesicht an. Es war, als sei da eine Hand gewesen und habe Millies Züge verwischt.
»Sally? Du glaubst doch nicht an solche Sachen, oder?«
Sally schob die Karte unter den Stapel. Sie hob den Kopf und klapperte mit den Lidern. »Natürlich nicht. Sei nicht albern.«
Isabelle trug den Topf zurück zum Herd. Sally legte die Karten unordentlich zusammen, verstaute sie wieder in ihrer Tasche und trank hastig einen Schluck Wein. Sie hätte das Glas gern auf einen Zug leergetrunken, um das Unbehagen loszuwerden, das sich in ihrem Magen zusammengezogen hatte. Gern hätte sie sich ein bisschen angesäuselt mit Isabelle draußen in der Sonne in einen Liegestuhl gelegt, wie sie es früher getan hatten – damals, als sie noch einen Mann hatte und mit ihrer Zeit anfangen konnte, was sie wollte. Damals war ihr nicht bewusst gewesen, wie viel Glück sie hatte. Jetzt konnte sie nicht in der Sonne sitzen und trinken, nicht mal sonntags. Den guten Wein, den Isabelle trank, konnte sie sich nicht leisten. Und wenn der Lunch hier vorbei wäre, würde sie nicht in den Garten, sondern zur Arbeit gehen. Vielleicht, dachte sie und rieb sich müde den Nacken, hatte sie genau das ja verdient.
»Mum? Mum!«
Die beiden Frauen drehten sich um. Millie stand in der Tür, rot und atemlos. Ihre Jeans war voller Grasflecken, und sie hielt ihnen ihr Telefon in der erhobenen Hand entgegen.
»Millie?« Sally richtete sich auf. »Was ist denn?«
»Können wir Ihren Computer einschalten, Mrs. Sweetman? Sie twittern alle darüber. Es ist wegen Lorne. Sie ist verschwunden.«
2
Auf dem Polizeirevier, nur zwei Meilen weit entfernt im Zentrum von Bath, war Lorne Wood das einzige Gesprächsthema. Die sechzehnjährige Schülerin einer Privatschule am Ort – der Faulkener’s – war beliebt und nach Auskunft ihrer Eltern ziemlich zuverlässig. Vom ersten Augenblick an hatte Sallys Schwester, Detective Inspector Zoë Benedict, keine Sekunde lang daran geglaubt, dass man sie lebend wiedersehen würde. Vielleicht war das einfach Zoës Art – sie war viel zu pragmatisch –, aber als dann ein Mitglied des Suchtrupps, der das Unterholz am Ufer des Kennet and Avon Canal absuchte, um zwei Uhr nachmittags eine Leiche fand, überraschte sie das kein bisschen.
»Nicht, dass ich solche Sprüche bringen würde wie ›Was hab ich gesagt?‹ oder so«, sagte sie leise zu Detective Inspector Ben Parris, als sie zusammen den Leinpfad entlanggingen. Sie hatte die Hände in den Taschen der schwarzen Jeans, die sie, wie der Superintendent ihr immer vorhielt, als leitender Officer nicht tragen sollte. »Diese Worte wirst du aus meinem Munde niemals hören.«
»Selbstverständlich nicht.« Er wandte den Blick nicht von der kleinen Menschentraube vor ihnen. »Das passt nicht zu dir.«
Der Fundort war bereits abgesperrt, und tragbare Sichtblenden standen quer auf dem Weg. Davor lungerten zehn, zwölf Leute herum, Bootsbesitzer hauptsächlich, aber von der Presse war auch schon einer da. Er trug eine schwarze Regenjacke, und als die beiden DIs sich mit erhobenen Dienstausweisen vorbeidrängten, hielt er seine Nikon hoch und machte ein paar Aufnahmen. Er war ein sicheres Anzeichen dafür, dass die Sache sich mit einem Tempo herumsprach, bei dem die Polizei nicht mehr mithalten konnte, dachte Zoë.
Die abgesperrte und vor den Augen der Öffentlichkeit abgeschirmte Fläche war fast zweitausend Quadratmeter groß. Der Weg war mit lockerem Kies bedeckt und auf der einen Seite von den Binsen des Kanalufers gesäumt, auf der anderen von struppigem Unkraut – Wiesenkerbel, Brennnesseln und Gras. Die Polizisten hatten einen Abstand von ungefähr fünfzig Metern zwischen den äußeren Sichtblenden und der inneren, durch Flatterband markierten Absperrung gelassen. Etwa dreißig Meter weiter, in einem Teil des Gestrüpps, der einen natürlichen Tunnel bildete, stand ein weißes Zelt.
Zoë und Ben stiegen in die weißen Overalls der Spurensicherung, streiften die Kapuzen über und zogen Handschuhe an. Dann duckten sie sich in das Zelt. Drinnen war es warm und stickig; es roch nach zertretenem Gras und Erde, und überall auf dem Boden verteilt lagen leichte Trittplatten aus Aluminium.
»Sie ist es.« Der leitende Kriminaltechniker stand gleich hinter dem Zelteingang und machte sich Notizen auf einem Clipboard. Er blickte nicht auf, als sie hereinkamen. »Kein Zweifel. Lorne Wood.«
Hinter ihm, am Ende einer Reihe von Trittplatten, ging der Spurensicherungsfotograf um eine schlammverschmierte Plane herum und machte Videoaufnahmen.
»Mit solchen Planen bedecken sie Brennholz auf den Wohnbooten. Aber auf diesem Kanalabschnitt vermisst niemand eine. Der Kerl hat sie damit zugedeckt. Wenn man sie so sieht, könnte man meinen, sie läge im Bett.«
Er hatte recht. Lorne lag auf dem Rücken, als schlafe sie. Ein Arm ruhte auf der Plane, die ihr wie eine Bettdecke über die Brust gezogen worden war. Ihr Kopf war zur Seite gerollt, das Gesicht dem Zelteingang abgewandt. Zoë konnte es nicht sehen, aber das T-Shirt konnte sie sehen. Grau – mit der Aufschrift »I am Banksy« quer über der Brust. Lorne hatte es getragen, als sie gestern Nachmittag das Haus verlassen hatte. »Wann wurde sie als vermisst gemeldet?«
»Um acht«, sagte Ben. »Da sollte sie auf dem Heimweg sein.«
»Wir haben ihre Schlüssel gefunden«, sagte der Spurensicherer. »Aber immer noch kein Telefon. Nachher kommt eine Tauchereinheit und sucht den Kanal ab.«
In einer Ecke des Zelts warf ein Kriminaltechniker ein Paar schwarze Ballerinas in einen Beutel. Er spießte ein rotes Fähnchen in den Boden, versiegelte den Beutel und setzte seine Unterschrift quer über das Siegel. »Hat man sie da gefunden?«, fragte Zoë ihn.
Er nickte. »Genau hier. Alle beide.«
»Weggeschleudert? Abgestreift?«
»Ausgezogen. Sie standen so.« Der Techniker streckte beide Hände aus und hielt sie säuberlich parallel nebeneinander. »Einfach hingestellt.«
»Ist das Erde, was da klebt?«
»Ja. Aber nicht von hier. Die stammt vom Leinpfad irgendwo.«
»Und dieses Gras – wie das plattgedrückt ist?«
»Vom Kampf.«
»Viel ist es nicht«, stellte sie fest.
»Nein. War anscheinend schnell vorbei.«
Der Fotograf war mit seinen Videoaufnahmen fertig. Er wich zurück, damit Zoë und Ben an die Leiche herantreten konnten. Am Fußende der Plane verzweigten sich die Trittplatten in zwei Richtungen und führten um den Leichnam herum. Ben und Zoë gingen mit vorsichtigen Schritten zu der Seite, der Lornes Gesicht zugewandt war. Eine ganze Weile standen sie schweigend da und schauten auf sie hinunter. Sie waren beide seit über zehn Jahren bei der Kriminalpolizei, und in dieser Zeit hatten sie nur mit einer Handvoll Morde zu tun gehabt. Und keiner davon war vergleichbar mit dem hier.
Zoë blickte auf und sah den leitenden Techniker an. Sie spürte die aufsteigenden Tränen. »Was hat ihr Gesicht so entstellt?«
»Wissen wir nicht genau. Wir glauben, sie hat einen Tennisball zwischen den Zähnen.«
»O Gott«, sagte Ben. »O Gott.«
Der Kriminaltechniker hatte recht: Ein Streifen Klebeband spannte sich quer über Lornes Mund. Er hielt einen kugelförmigen Gegenstand fest, der dort hineingedrückt worden war, so weit es ging. Oben und unten schimmerte leuchtend grüner Flausch hervor. Der Unterkiefer war so weit aufgestemmt, dass es aussah wie Zähnefletschen oder Schreien. Die Nase war zu einem blutigen Klumpen zerschlagen, und die Augen waren zusammengekniffen. In ihren Haaren war noch mehr Blut; zwei rote Linien führten unter dem Klebstreifen hervor und liefen am Unterkiefer entlang nach hinten bis zu den Ohren. Sie musste auf dem Rücken gelegen haben, als das Blut geflossen war.
»Wo kommt das her?«
»Aus dem Mund.«
»Hat sie sich auf die Zunge gebissen?«
Der Kriminaltechniker zuckte die Achseln. »Vielleicht ist die Haut geplatzt.«
»Geplatzt?«
Er berührte seine Mundwinkel. »Wenn man einen Tennisball gewaltsam in den Mund presst? Das würde die Haut an diesen Stellen stark dehnen.«
»Aber Haut platzt nicht …«, fing sie an, doch dann erinnerte sie sich, dass Haut durchaus platzen konnte. Sie hatte es schon gesehen: auf dem Rücken und im Gesicht von Selbstmördern, die aus großer Höhe gesprungen waren. Der Aufprall ließ die Haut oft platzen. Bei dem Gedanken daran spürte sie einen kalten Klumpen im Magen.
»Haben Sie die Plane schon zurückgeschlagen?« Ben bückte sich und versuchte, unter das Segeltuch zu spähen. »Können wir mal sehen?«
»Der Rechtsmediziner hat darum gebeten, dass niemand sie anrührt. Sie sollen zur Obduktion kommen, sagt er. Er – ich – wir beide möchten sie so, wie sie ist, ins Leichenschauhaus bringen. Mit Plane und allem.«
»Dann darf ich vermuten, dass ein sexuelles Vergehen vorliegt?«
Der Spurensicherer zog die Nase hoch. »Ja. Kann man entschieden so sagen. Ein schweres sexuelles Vergehen sogar.«
»Und?« Ben sah auf die Uhr und wandte sich an Zoë. »Was willst du jetzt tun?«
Sie riss den Blick von Lornes Gesicht los und sah, wie der Officer am anderen Ende des Zelts ein Etikett auf den Beutel mit den Schuhen klebte. »Ich glaube …«, murmelte sie, »… ich glaube, ich will ein paar Schritte gehen.«
3
Eine Zeitlang hatte Lorne Wood zu Millies und Sophies kleiner Clique gehört. Aber dann, vor ungefähr einem Jahr, hatte es ausgesehen, als entferne sie sich nach und nach von den anderen Mädchen. Vielleicht hatten sie von Anfang an nicht allzu viel miteinander gemeinsam gehabt; sie war auf einer anderen Schule und ein Jahr älter gewesen, und Sally hatte schon immer den Eindruck gehabt, sie sei weiter entwickelt. Sie war die Hübscheste von allen, und sie schien es zu wissen. Blond, mit milchweißer Haut und klassischen blauen Augen. Eine echte Schönheit.
Jetzt, an diesem Mittag, versammelten sich die Teenager um den Computer in Isabelles Arbeitszimmer und suchten auf Facebook und Twitter allen möglichen Tratsch und Klatsch zusammen, um Stück für Stück herauszufinden, was passiert war. Viel Neues gab es nicht; die Polizei hatte keine weitere Presseerklärung herausgegeben, nachdem sie am Morgen bestätigt hatte, dass Lorne vermisst wurde. Anscheinend hatte ihre Mutter sie zuletzt am vergangenen Nachmittag gesehen, als sie zu Fuß in die Stadt auf Einkaufstour gegangen war. Seitdem hatte es auf Lornes Facebook-Seite kein Update gegeben, und mit ihrem Handy war auch nicht mehr telefoniert worden. Als ihre Eltern sie angerufen hatten, war das Telefon anscheinend abgeschaltet gewesen.
»Vielleicht steckt nur ein kleiner Streit dahinter«, meinte Isabelle, als die Kids wieder draußen waren. »Sie war sauer auf ihre Eltern und ist mit einem Jungen weggelaufen. Das hab ich in dem Alter auch getan. Man will es seinen Eltern mal so richtig zeigen. So was eben.«
»Wahrscheinlich.« Sally nickte. »Vielleicht.«
Es war kurz vor halb zwei. Zeit zum Gehen. Sie fing an, ihre Sachen einzupacken, und dachte dabei an Lorne. Sie war ihr nur ein paarmal begegnet, aber sie erinnerte sich an ein entschlossenes Mädchen mit einer etwas traurigen Ausstrahlung. Einmal hatte sie mit ihr im Garten gesessen, als sie und Millie noch bei Julian in der Sion Road wohnten, und Lorne hatte aus heiterem Himmel gesagt: »Millie hat großes Glück. Wissen Sie – weil es nur sie gibt.«
»Nur sie?«
»Keine Geschwister.«
Sally war überrascht gewesen. »Ich dachte, du verstehst dich gut mit deinem Bruder?«
»Eigentlich nicht.«
»Ist er nicht nett zu dir?«
»O doch, er ist sehr nett. Und er ist klug.« Sie strich sich das Haar aus dem hübschen Gesicht. »Er ist vollkommen. Er tut alles, was Mum und Dad wollen. Das meine ich ja. Millie hat Glück.«
Dieses Gespräch war Sally im Gedächtnis geblieben, und sie erinnerte sich jetzt so klar und deutlich daran, als hätte es erst gestern stattgefunden. Sie hatte noch nie gehört, dass jemand es als Nachteil empfand, einen Bruder oder eine Schwester zu haben. Vielleicht dachten manche Leute so etwas, aber sie hatte noch nie erlebt, dass es jemand aussprach.
»Ich wünschte, sie würden das nicht tun.« Sally blickte auf. Isabelle stand am Fenster und schaute stirnrunzelnd hinaus in den Garten. »Ich weiß nicht mehr, wie oft ich es ihnen gesagt habe.«
Sally stand auf und ging zu ihr. Der langgestreckte Garten war mit Obstbäumen bepflanzt und von hohen Pappeln gesäumt, die beim leisesten Windhauch raschelten und sich bogen. »Wo sind sie denn alle?«
Isabelle streckte den Zeigefinger aus. »Siehst du? Da am Ende. Sie sitzen auf dem Übertritt am Zaun. Ich weiß, was sie im Sinn haben.«
»Ja?«
»O ja. Pollock’s Farm. Sie überlegen, ob sie sich da heimlich hinschleichen können.«
Isabelles Haus stand eine Meile nördlich von Bath, wo der steile Hang von Lansdown allmählich in ebeneres Gelände überging. Im Nordwesten lag das Tiefland mit den Golfplätzen, und im Osten grenzte Pollock’s Farm an Isabelles Garten. Die Farm verfiel seit drei Jahren, nachdem der Eigentümer, der alte Pollock, verrückt geworden war und, wie man erzählte, angefangen hatte, Desinfektionsmittel für Schafe zu trinken. Die Ernte verrottete auf den Feldern und erstickte im Unkraut, und welke braune Maiskolben hingen an den Stielen. Halb zerlegte Maschinen rosteten auf den Feldwegen, die Schweinetröge waren voll von abgestandenem Regenwasser, und in die verfaulenden Silage-Pyramiden waren die Ratten eingefallen und hatten sie zernagt, bis sie aussahen wie die Ruinen einer vergessenen Kultur. Jeder Schritt dort war gefährlich – nicht nur wegen der Hinterlassenschaften auf den Feldern, sondern auch, weil das Gelände mittendrin jäh abbrach: Ein uralter Steinbruch zog sich als tiefer Einschnitt durch die Hanglandschaft. Das Bauernhaus stand auf dem Grund dieses Steinbruchs; man konnte oben auf dem Feld stehen und durch die Bäume auf das Dach hinunterschauen. Da war der alte Pollock gestorben, in seinem Sessel vor dem Fernseher. Monatelang hatte er da gesessen, während die Jahreszeiten wechselten, das Haus verfiel und der Strom abgeschaltet wurde, bis ein Speed-Junkie auf der Suche nach einem ungestörten Plätzchen ihn gefunden hatte.
»Die Jungs sind noch schlimmer, seit das passiert ist. Ehrlich, es wirkt wie ein Magnet auf sie. Sie machen sich gegenseitig heiß. Es macht ihnen einfach Spaß, einander Angst einzujagen und sich herauszufordern.« Seufzend wandte Isabelle sich vom Fenster ab und ging zurück zum Herd. Die Siruptorte kühlte daneben auf einem Gitter ab. »Ich kann sagen, was ich will. Sie tun so, als gingen sie nicht hin, aber ich weiß, dass sie es doch tun. Und wenn nicht sie, dann auf jeden Fall irgendjemand. Ich war vor ungefähr einem Monat unten, und es ist furchtbar. Das Haus ist übersät von Chips-Tüten, Cider-Flaschen und allen Abscheulichkeiten, die du dir nur vorstellen kannst. Nicht mehr lange, und einer von ihnen tritt auf eine Spritze. Vorgestern hab ich in Nials Papierkorb eine Bierdose gefunden, und Peter traue ich nicht. Ich habe gesehen, dass er Krusten am Mund hat. Weißt du, was das bedeutet?«
»Nein.«
»Ich auch nicht, hab aber automatisch an Drogen gedacht. Vielleicht sollte ich es seiner Mutter sagen – wer weiß? Jedenfalls – dieser Bauernhof.« Sie zeigte zum Fenster. »Es hilft alles nichts. Je eher die Erbschaftsverhältnisse geklärt sind und der Hof verkauft ist, desto besser. Ich hab dem Gärtner immer wieder gesagt, er soll den Zaunübertritt versperren, aber er kommt einfach nicht dazu. Sie sind in diesem Alter, und man denkt unwillkürlich …«
Ein kleiner Schauer lief ihr über den Rücken, und ihr Blick huschte kurz zu Sallys Tasche. Vielleicht dachte sie an Millies Gesicht auf der Tarot-Karte. Oder an Lorne Wood. Vermisst seit sechzehn Stunden. Dann hellte ihre Miene sich auf. »Keine Sorge«, sagte sie. »Ich behalte sie im Auge. Und um sechs fahre ich sie rüber zu Julian. Du hast absolut keinen Grund, dir Sorgen zu machen.«
4
Lorne Wood hatte in diesem Frühjahr die Gewohnheit gehabt, zum Shoppen in die Stadt und dann zu Fuß nach Hause zu gehen. Ihr Weg führte durch Sydney Gardens und dann weiter zu dem Leinpfad, an dem ihr Haus stand, etwa eine halbe Meile weiter östlich. Sydney Gardens war der älteste Park in Bath, berühmt für den Nachbau des römischen Minerva-Tempels. Er war außerdem ein berüchtigter Schwulentreff; man brauchte nur einen Schritt vom Weg abzuweichen, und schon sah man einen jungen, hübsch gekleideten jungen Mann, der mit hoffnungsvollem Lächeln im Gebüsch stand. Eltern schoben ihre Kinder mit Entschlossenheit an den Toilettenhäuschen vorbei und lenkten ihre Aufmerksamkeit durch lautes Reden ab, und Hundehalter suchten regelmäßig die Tierärzte der Umgebung auf, weil ihre Hunde sich an benutzten Kondomen verschluckt hatten, die sie im Gestrüpp aufgestöbert hatten. Durch den Park führte eine Bahnlinie, die von der Polizei bereits gründlich abgesucht worden war, weil es schon vorgekommen war, dass ein rasender Zug eine Leiche so sehr pulverisiert und verstreut hatte, dass sie praktisch verschwunden war. Aber jetzt suchte die Polizei keine Leiche mehr. Sie suchte nach Hinweisen darauf, wie Lorne aus der Stadt an die Stelle gekommen war, wo sie ermordet worden war.
Zoë und Ben gingen am Kanal entlang, ohne zu reden. Von Zeit zu Zeit blieb einer von ihnen stehen und spähte in das Gebüsch auf der rechten Seite des Weges oder hinunter in das undurchsichtige Wasser des Kanals, immer in der Hoffnung, etwas Wichtiges zu sehen, das den Teams entgangen war. Als sie ungefähr eine Viertelmeile weit in die Stadt zurückgegangen waren, blieb Zoë an einem kleinen Tor in einer Mauer stehen. Die hölzernen Äste einer Glyzinie ragten darüber, und die herabhängenden violetten Blütentrauben öffneten sich gerade erst. Das Tor führte nach Sydney Gardens hinein. Wahrscheinlich war Lorne hier auf den Leinpfad gekommen. Zoë und Ben standen einander mit gesenktem Kopf gegenüber und betrachteten den Flecken Erde zwischen ihnen.
»Ist es das, was sie an den Schuhen hatte?«, fragte er.
»Die Farbe ist die gleiche.«
Ben hob den Kopf und ließ den Blick über den Pfad wandern. Pfützen glänzten im Kies. Am Tag zuvor hatte es geregnet, aber jetzt ließ die Sonne das Wasser verdunsten. »An vielen Stellen in Bath findet man Erde von dieser Farbe. Das ist der Kalkstein im Boden.«
Zoë beäugte die Pfützen und dachte an die Schuhe. Ballerinas. Zum Gehen eigentlich ungeeignet, doch die Mädchen trugen sie in letzter Zeit alle.
Ben schob die Hände in die Taschen und blinzelte zum Himmel hinauf. »Und?«, fragte er leise. »Was glaubst du, was unter der Plane ist?«
»Boss?« Detective Corporal Goods, der zum Team gehörte, kam den Weg entlang auf sie zu und winkte, um sie auf sich aufmerksam zu machen. »Ich hab da eine Frau, die mit Ihnen sprechen will.«
»Eine Frau?«
»Von einem der Wohnboote. Ein paar der Eigentümer hatten gute Sicht auf den Tatort, bevor die Absperrungen aufgestellt waren. Sie konnten sehen, was los war. Und diese hat die Leiche gesehen – nur kurz. Sie möchte Ihnen was erzählen.«
»Super.« Zoë ging eilig den Weg hinunter, und Ben kam ihr nach. Ihr schwirrte der Kopf. Es wäre wirklich schön – wirklich schön –, wenn sie einen aufgeklärten Mordfall in ihr Album kleben könnte. Wenn sie vor die Kollegen und vor Lorne Woods Familie treten und verkünden könnte, sie habe den Mörder gefunden. Den Menschen, der ihrer Tochter einen Tennisball in den Mund gerammt hatte. Und der Himmel wusste, was er sonst noch mit ihr gemacht hatte.
Das Boot lag nicht weit vom Park und mindestens eine Viertelmeile vom Tatort entfernt. Es war bunt bemalt; die Kajüte war mit lauter Blumen betupft, und quer über das Heck war der Name Elfwood geschnitzt. Auf dem Dach, neben dem kleinen Schornstein, stapelten sich Vorräte: Kohlen, Holz, Wasserflaschen, und ein Fahrrad war auch da. Ben klopfte zweimal auf das Dach, sprang dann auf das Achterdeck und bückte sich, um in die Kabine zu schauen. »Hallo?«
»Ich bin hier«, sagte eine Stimme. »Kommen Sie rein.«
Ben und Zoë stiegen die Treppe hinunter und zogen die Köpfe ein, um an der niedrigen Decke nicht anzustoßen. Es war, als steige man in Aladdins Höhle – jede Oberfläche, die Decke, die Wände, die Schränke, alles war mit holzgeschnitzten Baumnymphen geschmückt. Vor den Fenstern hingen glitzernde Gardinen in Violett- und Rosatönen, und es roch nach Katzen und Patschuli-Öl. Nicht viel Sonne drang herein, nur so viel, dass sie eine Frau von etwa fünfzig Jahren mit sehr langen, hennaroten Locken sehen konnten, die mit einer selbstgedrehten Zigarette in der Hand vor dem Schott saß. Sie trug einen Blumenkranz im Haar und ein weites, am Hals geschlossenes Samtcape, das so weit aufklaffte, dass man eine Spitzenbluse und einen mit winzigen goldenen Spiegeln bestickten Rock erkennen konnte. Ihre nackten Beine und die Füße, die in Sandalen mit Gummisohlen steckten, waren sehr weiß, so weiß wie die Gläser mit Entenschmalz, die man im Sommer reihenweise auf dem Französischen Markt in Bath sehen konnte.
»Gut.« Sie nahm einen tiefen Zug von ihrer Zigarette. »Schön zu sehen, dass die Polizei mal was Sinnvolles tut, statt Unschuldige zu verhaften.«
»Ich bin Detective Inspector Benedict.« Zoë streckte die Hand aus. »Freut mich, Sie kennenzulernen.«
Die Frau klemmte die Zigarette zwischen die Lippen und schüttelte ihr die Hand. Sie blinzelte durch den Rauch und taxierte Zoë. Nach ein paar Augenblicken war sie anscheinend zufriedengestellt. »Amy«, sagte sie. »Und er? Wer ist er?«
»Detective Inspector Ben Parris.« Ben reichte ihr die Hand.
Amy schüttelte sie und beäugte ihn misstrauisch. Dann nahm sie die Zigarette aus dem Mund und forderte die beiden mit einer Handbewegung auf, sich zu setzen. »Tee gibt’s keinen – der Generator ist mir vor zwei Wochen krepiert, und meine Nummer mit dem Gaskocher wollen Sie wirklich nicht sehen.«
»Ist schon okay. Wir bleiben nicht lange.« Zoë holte ihr Notizbuch heraus. Nach all den Jahren und trotz aller verfügbaren Technologie sah man es bei der Polizei immer noch gern, wenn alles handschriftlich notiert wurde. Trotzdem machte sie sicherheitshalber immer auch eine Tonaufnahme mit ihrem iPhone. Theoretisch durfte sie das nicht, ohne um Erlaubnis zu bitten, aber sie tat es einfach. Sie hatte eine Technik entwickelt, eine schnelle Handbewegung über ihre Jackentasche, und sie wusste, ohne hinzusehen, wohin sie tippen musste. Ein kurzes Piep-Piep mit den Fingern, und die Tonaufzeichnung lief, während sie so tat, als sei sie mit ihrem Notizbuch beschäftigt. »Unser Constable sagt, Sie hätten da etwas, worüber Sie sprechen möchten.«
»Ja«, sagte Amy. Ihr Blick war sehr intensiv, denn ihre Augen waren von geplatzten Gefäßen spiralförmig durchzogen. »Ich hab die Leiche gesehen. Viele von uns haben sie gesehen.«
»Das war unglückselig«, sagte Ben. »Wir tun unser Möglichstes, um Tatorte zu sichern. Manchmal klappt’s nicht.«
»Wussten Sie«, sagte Amy, »dass man sehen kann, wie die Seele den Körper verlässt? Wenn man angestrengt genug hinschaut, sieht man es.«
Zoë senkte den Kopf und kritzelte etwas in ihr Notizbuch. Wenn Goods sie hierhergelotst hatte, damit sie sich Geschichten von Seelen und Geistern anhörten, würde sie ihn erschlagen. »Also – Amy. Haben Sie die Seele gesehen? Als sie den Körper verließ?«
Sie schüttelte den Kopf. »Sie war schon weg. Schon längst.«
»Seit wann?«
»Seit ihrem Tod. Gestern Abend. Sie halten sich nicht mehr auf. Das muss in der ersten halben Stunde passieren.«
»Und woher wissen Sie, dass es gestern Abend war?«
»Wegen des Armbands.«
Ben zog eine Braue hoch. »Wegen des Armbands?«
»Sie trug ein Armband. Das hab ich gesehen. Als sie die Leiche fanden, hab ich das Armband gesehen.«
Amy hatte recht. Lorne hatte ein Armband getragen. Ein loses Amulettarmband mit einem versilberten Totenschädel und einem winzigen Besteck: Messer, Gabel und Löffel. Und einer Glückszahl, der »16«, die sie zum Geburtstag bekommen hatte. Die Eltern hatten es bei der Vermisstenanzeige aufgeführt.
»Was ist mit diesem Armband? Warum ist es wichtig?«
»Weil ich es gehört habe. Gestern Abend.« Sie nahm wieder einen tiefen Zug, behielt den Rauch in der Lunge und ließ ihn dann in einem langen, bläulichen Strom entweichen. »Man hört alles. Wenn man hier drin sitzt, hört man jeden Laut. Sie benutzen ja alle den Leinpfad, nicht wahr? Man hört die Prügeleien und die Streitereien, die Partys und die Liebespaare. Meistens sind es nur Fahrradklingeln. Gestern Abend war es ein Mädchen, das etwas Klingelndes bei sich trug. Klingeling, machte es.« Sie hielt Daumen und Zeigefinger hoch und klappte sie auf und zu wie einen kleinen Schnabel. »Klingeling.«
»Okay. Sonst noch was?«
»Außer dem Klingeling? Nicht viel.«
»Nicht viel?«
»Nein. Es sei denn, Sie nehmen das Gespräch dazu.«
»Das Gespräch?«, wiederholte Ben. »Da hat ein Gespräch stattgefunden?«
»Am Telefon. Irgendwann kann man hören, dass es ein Telefongespräch ist. In der ersten Zeit, nachdem ich hier eingezogen war, dachte ich immer, sie reden mit einem Geist. Spazieren da vorbei und schwatzen, und niemand antwortet. Es hat ewig gedauert, bis ich es rausgefunden hatte. Mit Technik hab ich nichts am Hut. Ich hab kein Handy, und ich will auch keins. Vielen Dank.« Sie lächelte kurz und höflich, als hätte Ben ihr ein kostenloses Mobiltelefon angeboten, und sie habe sich gezwungen gesehen, es freundlich zurückzuweisen.
»Und Sie glauben, das war Lorne?«
»Ich bin sicher, dass sie es war.«
»Gesehen haben Sie sie nicht?«
»Nur ihre Füße. Sie trug dieselben Schuhe, die neben der Leiche standen. Die hab ich auch gesehen, als die Leiche gefunden wurde. Ich merke mir so was.«
»Um welche Zeit war das?«
»Kurz vor acht? Es war ruhig; der Trubel war vorbei. Ich würde sagen, halb acht? Viertel vor acht?«
»Sind Sie sicher?«
»Ich bin sicher.«
Zoë und Ben wechselten einen Blick. Nachdem Lorne als vermisst gemeldet worden war, hatte der für den Fall zuständige Officer eine rückwirkende Funkzellenauswertung zu ihrem Handy beschafft, die ergeben hatte, dass sie am vergangenen Abend ein Gespräch mit einer Freundin geführt hatte – und dieses Gespräch war um neunzehn Uhr fünfundvierzig beendet worden. Das musste es gewesen sein, was Amy gehört hatte. Damit hatten sie eine präzise Zeitangabe, wann Lorne auf dem Leinpfad gewesen war.
»Amy«, sagte Ben, »haben Sie gehört, worüber sie gesprochen hat?«
»Ich habe einen Satz gehört. Nur einen. Sie hat gesagt: ›O Gott, ich hab genug …‹«
»›O Gott, ich hab genug…‹?«
»Ja.«
»Das heißt, sie war aufgebracht?«
»Ein bisschen genervt vielleicht. Aber sie hat nicht geweint oder so was. Es klang traurig, allerdings nicht, als hätte sie Angst.«
Ben schrieb sich etwas auf. »Und sie war auf jeden Fall allein? Sie haben sonst niemanden bei ihr gehört?«
»Nein«, sagte Amy entschieden. »Sie war allein.«
»Sie hat also gesagt: ›O Gott, ich hab genug‹, und dann …?«
»Dann ist sie einfach weitergegangen. Klingelingeling.« Amy klemmte die Zigarette zwischen die Zähne, kniff im aufsteigenden Rauch die Augen zusammen und wedelte mit der Hand in Richtung Tatort. »Da runter. Dahin, wo es passiert ist. Danach hab ich nichts mehr gehört. Bis sie tot aufgefunden wurde. Und vergewaltigt, nehme ich an. Ich meine, darum geht’s ja meistens. Männer und ihr Hass auf Frauen.«
Und vergewaltigt, nehme ich an. Zoë schaute aus dem Fenster hinaus in die Sonne, die auf den Pfad schien, und fragte sich, was unter der Plane war, mit der Lorne zugedeckt war. Wenn sie ehrlich war, hätte sie sich gern vor der Obduktion gedrückt. Aber das konnte sie natürlich nicht. So etwas würde sich im Handumdrehen unter den Kollegen herumsprechen.
Sie blieben noch eine Weile sitzen und redeten mit Amy, doch abgesehen von dem Telefongespräch hatte sie zu den Ermittlungen nichts weiter beizutragen. Schließlich stand Ben auf. »Sie haben uns sehr geholfen. Vielen Dank.«
Zoë folgte ihm. Er war schon an Deck, und sie war noch in der Kombüse, als ein lautes, vielsagendes Husten hinter ihr ertönte. Sie drehte sich um und sah, dass Amy lächelnd einen Finger an die Lippen hielt. »Was ist?«
»Er«, tuschelte Amy und deutete mit dem Finger nach oben. »Hat keinen Sinn, dass Sie Ihre Zeit mit ihm verschwenden. Er ist schwul. Das sieht man an der Art, wie er seine Sachen trägt.«
Zoë schaute zur Treppe hinüber. Ben wartete an Deck in der Sonne, und sein Schatten reichte ein kleines Stück weit die Treppe herunter. Sie sah seine Schuhe, sauber geputzt, teuer. Es gelang ihm, seinen Anzug – wahrscheinlich von der Stange bei Marks & Spencer – so zu tragen, als sei er von Armani. Amy hatte recht: Er sah aus wie jemand aus einer Aftershave-Anzeige. »Über so etwas sollten wir nicht reden«, sagte sie leise. »Nicht unter diesen Umständen.«
»Ich weiß. Aber er ist es doch, oder?« Amy lächelte. »Na los. Er muss es sein.«
»Ich hab wirklich keine Ahnung. Über so was hab ich noch nie nachgedacht. So.« Sie sah auf die Uhr. »Ich muss los. Danke, Amy. Sie haben mir reichlich Stoff zum Nachdenken gegeben.«
5
Sally war bestrebt, am Wochenende nicht zu arbeiten, aber der Job, den sie am Sonntag hatte, wurde gut bezahlt und war nicht so einsam wie die anderen, denn die Agentur setzte sie mit zwei anderen Putzfrauen zusammen ein. Marysien´ka und Danuta, zwei gutmütige Blondinen aus Gdan´sk, die dick geschminkt zur Arbeit kamen und sich die Nägel in dem neuen koreanischen Nagelstudio in der Westgate Street machen ließen. Sie konnten den pinkfarben lackierten Honda Jazz der Agentur benutzen, auf dem das HomeMaids-Logo in Lila klebte. Marysien´ka fuhr immer; ihr Freund hatte einen Job bei der First Bus Company, und er hatte ihr beigebracht, sich im britischen Straßenverkehr zu bewegen wie eine Rallye-Fahrerin. »Regel Nummer eins«, behauptete sie, »wer zögert, ist schon gefickt.« Daraufhin kreischte Danuta vor Lachen, während das kleine HomeMaids-Auto in den Verkehr hinausschoss und die gesetzten Fahrer im nördlichen Bath zur Vollbremsung zwang. Die beiden Polinnen waren nette Mädels, die Zigarettenpausen machten und manchmal ein bisschen nach Fish and Chips rochen. Vielleicht wohnten sie zusammen über einem Imbiss. Sally stellte sich immer vor, dass sie nach Feierabend über sie redeten und sich gegenseitig gelobten, niemals so verzweifelt, so geknechtet zu sein wie sie.
Heute holten sie Sally am Ende der langen Zufahrt zu Isabelles Haus ab. Sie trugen weiße Jeans und hohe Absätze unter ihren pinkfarbenen Arbeitsschürzen, und sie hatten die Fenster heruntergedreht, ließen die Arme heraushängen, rauchten und schlugen im Takt der Radiomusik an das Blech des Autos. Sie waren in den Zwanzigern, und mit einer Schülerin aus der feinen Hälfte der Stadt würden sie nichts anfangen können; also sprach Sally nicht über die vermisste Lorne. Sie saß auf dem Rücksitz, kaute ein Airwaves, um den Weingeruch ihres Atems zu vertreiben, und schaute hinaus auf die vorüberfliegende Hecke. Sie überlegte, was sie sonst noch über Lorne wusste. Der Mutter war sie einmal begegnet. Sie hieß Polly. Oder Pippa oder so ähnlich … Vielleicht hatte Isabelle ja recht. Vielleicht war das Mädchen weggelaufen, weil zu Hause irgendetwas vorgefallen war. Aber vermisst? Wirklich richtig vermisst? Das klang nicht gut. Und nach dem, was die Kinder auf Twitter erfahren hatten, nahm die Polizei die Sache sehr ernst, als sei ihr etwas Furchtbares zugestoßen.
Ihr Kunde an diesem Tag – David Goldrab – wohnte draußen hinter der Rennbahn, abseits der Ausfallstraße, die aus Bath hinausführte. Am Rande von Hanging Hill, wo vor fast vierhundert Jahren die große Schlacht zwischen Royalisten und Parlamentsanhängern stattgefunden hatte. Es war eine komische Gegend, bemerkenswert hauptsächlich wegen eines markanten Wahrzeichens, das in der Gegend als Caterpillar – »die Raupe« – bekannt war, einer Reihe von Bäumen auf dem Höhenkamm eines gegenüberliegenden Hügels, die man im meilenweiten Umkreis sehen konnte. Sally fand Hanging Hill irgendwie unheimlich. Und als habe die Geschichte dieser Anhöhe die Anwohner infiziert, schien ein Hauch von Verderbnis über allem zu schweben. Man munkelte, das bei dem Brink’s-MAT-Raub erbeutete Gold sei hier von einem Goldhändler aus Bristol in Formkästen eingeschmolzen worden, und irgendetwas an David und an seinem Haus, Lightpil House, bereitete Sally Unbehagen. Das Grundstück mit seinen Sträuchern, Kieswegen, Baumschulen, Teichen und entlegenen Wäldchen war in den letzten zehn Jahren von Landschaftsarchitekten mit Baggern und Planierraupen gestaltet worden und sah hier völlig deplatziert aus. Auch das Haus war modern und schien seine Umgebung zu erdrücken. Es war aus dem buttergelben Stein erbaut, den man überall in Bath benutzte, und sollte an eine palladianische Villa erinnern: Es hatte einen riesigen Portikus, so hoch wie zwei Geschosse, eine Orangerie mit einer Reihe von verglasten Bögen, und der Eingang war durch ein elektronisch gesteuertes Tor gesichert, das von vergoldeten Ananasfrüchten gekrönt war.
Marysien´ka steuerte den Honda auf einem Fahrweg um das Anwesen herum zu einem kleinen Parkplatz am unteren Ende des Besitzes. Von hier aus schleppten sie ihre Putzsachen den langen Weg hinauf, der sich am Swimmingpool vorbei und zwischen makellos gepflegten Rhododendron- und Kreuzdornhecken hindurchschlängelte. Die Tür war offen, im Haus war es still, nur in der Küche lief der Fernseher. Das war nichts Ungewöhnliches; nicht selten bekamen sie David gar nicht zu sehen. Die Agentur hatte unmissverständlich erklärt, er wolle nicht gestört oder angesprochen werden. Ab und zu wanderte er in einem Frotteebademantel und mit FitFlops an den Füßen durch die Küche, das Handy unters Kinn geklemmt und eine Fernbedienung in der Hand, und verzog schmerzlich das Gesicht oder schüttelte enttäuscht den Kopf, weil die Sky-Box ihm nicht gehorchen wollte. Aber oft hatte er sich auch in seinem Arbeitszimmer im Westflügel eingeschlossen, oder er war drüben im Mietstall, wo sein Turnierpferd Bruiser stand. In der Küche lag immer eine Liste mit Aufträgen für die Mädels, und ein Umschlag mit Bargeld war auch dabei. Er bekam nicht viel Besuch, und auch wenn er nicht durch besondere Ordnungsliebe oder Sauberkeit auffiel, war es merkwürdig, Böden und Toiletten und Waschbecken zu schrubben, die seit ihrem letzten Einsatz gar nicht benutzt worden waren. Sie hätten die Türen verriegeln, sich hinsetzen und ihre Nägel lackieren können – und am Ende bloß eine Wolke Möbelpolitur versprühen müssen. Niemand hätte etwas gemerkt. Aber insgeheim hatten sie alle ein bisschen Angst vor David mit seinen Sicherheitssystemen und elektronischen Toren und der Kamera über der Haustür. Also gingen sie auf Nummer sicher und putzten das Haus, ob es nötig war oder nicht.
Sie machten sich an die Arbeit. Die dicken Teppiche reichten in verschiedenen Schattierungen von Blau und Rosa von Wand zu Wand. Blankpolierte Messingleuchter hingen an den Wänden, und jedes Fenster war mit einer Schabracke versehen und mit gerafften Fransenvorhängen aus üppiger goldener oder blauer Seide umrahmt. Überall musste Staub gewischt werden. Es gab zwei Seitenflügel, die durch Korridore mit dem Herzen des Hauses verbunden waren, wo sich Küche und Wohnräume befanden. Die Polinnen übernahmen jeweils einen Flügel, und Sally fing im Hauswirtschaftsraum an zu bügeln.
Hier lag immer ein Stapel der Nadelstreifenhemden aus Baumwoll-Popeline, die David in verschiedenen Pastellfarben trug, in Pink und Peppermint und Primel. Alle waren mit handgestickten Etiketten versehen, auf denen in verschnörkelter Schrift »Ede & Ravenscroft« zu lesen war. Vermisst, dachte Sally, als sie Wasser in das Dampfbügeleisen laufen ließ und das erste Hemd ausbreitete. Vermisst war niemals gut. Nicht, wenn es sich um einen Teenager aus einer guten Familie handelte. Und dann fragte sie sich, ob die Polizei sie würde vernehmen müssen. Ob ein Mann in Uniform zum Cottage kommen würde. Ob er vielleicht bemerken würde, wie Millie und Sally heutzutage lebten, und ob er Zoë darüber berichten würde. Zoë würde kein bisschen überrascht sein, dass ihre dämliche Schwester mit dem hoffnungsvollen Lächeln und den Flausen im Kopf endlich ihre Quittung von der Welt bekommen hatte und auf den Platz gesetzt worden war, der ihr zustand.
Sie bügelte seit zehn Minuten, als sie David draußen bemerkte. Er kam zielstrebig von der Garage über die kiesbedeckte Zufahrt auf das Haus zu. Er war nicht groß, aber kräftig – die Polinnen nannten ihn den »dicken Mann« –, von stämmiger Statur, mit kurzgeschnittenem grauen Haar und einer ganzjährigen Sonnenbräune. Heute trug er ein zitronengelbes Polohemd von Gersemi, eine Reithose samt Reitstiefel, und er schlug sich beim Gehen mit der Gerte an den Schenkel. Sicher war er oben in Marshfield bei den Stallungen gewesen. Er hatte zum Reiten seinen Schmuck nicht abgenommen; die Sonne blitzte auf der goldenen Kette an seinem Hals und dem Goldstecker am Ohr. Er kam durch die Orangerie herein, machte kurz Station in der Küche und schlug die Kühlschranktür zu. Dann erschien er in der Tür zum Hauswirtschaftsraum.
»Die einzige Methode, eine gute Dressur-Session zu beenden.« Er hielt ein schlankes Bleikristallglas mit Champagner Rosé in der einen Hand und eine Tüte Erdnüsse in der anderen. »Erdnüsse, um das Salz zu ersetzen, das ich verloren habe, und der Heidsieck, um meine Pulsfrequenz hochzuhalten. Die einzige Methode. Hab ich von den besten Dressur-Boys im Piemonte gelernt.«
Sein englischer Tonfall wechselte zwischen Australien, East London und Bristol. Sally hatte keine Ahnung, wo er herkam, aber sie war sicher, dass er nicht in einer Riesenvilla wie dieser hier geboren war. Sie unterbrach ihre Bügelei nicht. Anscheinend störte ihn ihre mangelnde Begeisterung nicht. Er ließ sich in einen Drehsessel in der Ecke fallen und vollführte damit eine halbe Drehung, sodass er die Füße auf den Arbeitstisch legen konnte. Er roch nach Aftershave und Pferd, und quer über seine Stirn zog sich immer noch die Kerbe, die von der Reitmütze stammte.
»Ich bin ein Glückspilz, wissen Sie das?« Er riss die Erdnusstüte mit den Zähnen auf, schüttete sich ein paar in die hohle Hand und warf sie in den Mund. »Ich habe Glück, weil ich einen Riecher für Leute habe, denen ich vertrauen kann. Immer schon. Das hat mich vor vielen Problemen bewahrt. Und Sie, Sally? Sie hab ich schon. Hab Sie hier oben.« Er tippte sich an den Kopf. »Schon in die richtige Schublade gesteckt. Ich weiß, was Sie sind.«
Sally war seine gelegentlichen Predigten gewohnt. Sie hatte schon gehört, wie er am Telefon mit seiner Mutter über das Neueste redete, das er in den Fernsehnachrichten gesehen hatte: wie es ihn aufregte und wie seine ohnehin düstere Sicht auf die Menschheit mit jedem Tag düsterer werde. Vor allem hatte sie gelernt, dass er von ihr keine Reaktion auf seine Monologe erwartete, sondern nur reden wollte. Aber jetzt wurde es doch ein bisschen persönlicher als sonst. Sie bügelte weiter, hörte allerdings aufmerksamer zu.
»Sehen Sie, ich weiß etwas, das Sie niemals zugeben werden.« Er sah lächelnd zu ihr auf. Es war ein träges Lächeln, bei dem man alle seine Zähne sah. Sally musste an Ratten und Reptilien denken. »Ich weiß, das hier bringt Sie um. Eine Frau wie Sie? Die Scheiße aus fremder Leute Klo kratzen? Für so was sind Sie nicht geboren. Die polnischen Schlampen? Die sehe ich an, und ich denke: Putzfrauen. Das sind sie jetzt, und das werden sie noch mit achtzig sein. Aber Sie? Sie sind anders. Sie haben schon was Besseres gesehen, und Sie hassen das Putzen. Sie hassen es sogar mächtig. Jeder Boden, den Sie schrubben, jedes fleckige Laken, das Sie von einem Bett abziehen, bringt Sie um.«
Röte kroch an Sallys Gesicht herauf, wie es immer passierte, wenn sie nicht wusste, was sie sagen sollte. Sie versuchte, sich auf das Hemd zu konzentrieren, schüttelte es aus, strich den Kragen glatt und drückte prüfend auf den Sprühknopf am Bügeleisen. Ein zischender Dampfstrahl schoss hervor, und sie erschrak ein bisschen.
David beobachtete sie amüsiert. Mit Hilfe seiner Füße auf der Arbeitsplatte drehte er sich mit dem Stuhl hin und her. »Sehen Sie, Sally, ich finde, ein Mädel von der Klasse wie Sie verdient einen richtigen Job.«
»Was meinen Sie damit, einen ›richtigen Job‹?«
»Ich will es Ihnen erklären. Ich will Ihnen eine mundgerechte kleine Lektion in David-Goldrab-Kunde erteilen. Wenn ich arbeiten gehe – nicht, dass ich das heutzutage noch oft tun muss, Gott sei Dank –, aber wenn ich es tue, dann muss ich mit Leuten umgehen. Und zwar direkt, von Angesicht zu Angesicht, wenn Sie verstehen. Das hier ist meine Zuflucht, und hier suche ich die Einsamkeit. Das Letzte, was ich haben möchte, ist Gedränge im Paradies. Das können Sie verstehen, oder? Ich habe gern Platz um mich herum. Aber ich habe vier Hektar Grundbesitz und dreihundertsiebzig Quadratmeter Wohnraum, und ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass so ein Anwesen liebevolle und sorgfältige Pflege benötigt. Außen rum ist alles geregelt: Der Poolmann kommt alle zwei Wochen, und da unten in dem Cottage zwischen diesem und dem nächsten Anwesen wohnt ein Trottel, der sich um die Fasane kümmert und eine Jagd für mich organisiert, wenn ich blöd genug war, Leute aus London einzuladen. Ich lege denen eine Liste mit den Dingen hin, die getan werden müssen; so wie ich es bei euch auch mache. Ich überweise ihren Lohn direkt auf ihr Konto und brauche nur am Telefon mit ihnen zu sprechen. Super. Ist bloß nicht genug, denn da ist noch das Haus. Man braucht ihm nur eine Sekunde den Rücken zuzuwenden, und ehe man sichs versieht, stürzt die Hütte um einen herum ein. Jetzt können Sie mich einen Snob nennen« – er legte eine Hand auf sein Herz und machte ein Märtyrergesicht –, »aber ich finde es einfach widerlich, mit diesen beschissenen Mistbauern zu reden, die herkommen, um die nötigen Arbeiten zu erledigen; und die dann ihre widerlichen Fingerknöchel über den Boden schleifen lassen und mit ihrem einen beschissenen Auge plinkern.«
Er warf sich ein paar Erdnüsse in den Mund und schwenkte das Champagnerglas hin und her.
»Ich will diese Affen nicht mal ansehen müssen. Ich will oben sitzen und zugucken, wie Britney Spears auf MTV ihre Nummer abzieht, und nicht mal ahnen, dass da unten so ein Halbidiot meine Abflüsse reinigt. Und an der Stelle kommen Sie ins Spiel. Ich will immer noch, dass Sie putzen, aber ich will auch, dass Sie jede Woche im Haus herumgehen und eine Liste der Dinge aufstellen, die gemacht werden müssen. Und dann will ich, dass Sie es organisieren, beaufsichtigen, die Scheißer ins Haus lassen, ihnen Kaffee kochen und ihnen überhaupt geben, was ihr kleines, inzüchtiges Herz begehrt. Sie bezahlen sie und führen Buch über das, was ich so hinblättere. Wissen Sie, was ich meine?«
»Im Grunde suchen Sie eine Hausmeisterin?«
»Ja, wie sich das anhört, könnten Sie genauso gut gleich sagen: ›Im Grunde, David, suchen Sie eine Schwanzlutscherin.‹ Ich biete Ihnen zwanzig Pfund die Stunde. Netto, cash. Steuerfrei. Sechs Stunden die Woche, an zwei Nachmittagen. Sagen wir, dienstags und donnerstags. Wenn ich der Agentur meine fünfzehn Pfund pro Stunde für Sie zahle, was nehmen Sie dann mit nach Hause? Bar auf der Hand?«
Sie senkte den Blick; es war ihr peinlich, dass es so wenig war. »Vier Pfund die Stunde. Sie ziehen mir die vorläufige Steuer ab.«
»Sehen Sie? Da müssten Sie fünf Stunden arbeiten, um zu verdienen, was ich Ihnen für eine anbiete.«
Sally schwieg einen Moment und rechnete nach. Er hatte recht. Es war eine Menge Geld. Und sie hatte an den beiden Nachmittagen noch Zeitfenster, die sie schon lange hatte schließen wollen.
»Na los, Sally. Sagen Sie der Agentur, Sie stehen an zwei Nachmittagen in der Woche nicht zur Verfügung, und kommen Sie zu mir.« Er legte den Kopf in den Nacken und schüttete sich den Rest der Nüsse aus der Tüte in den Mund. Er kaute knirschend, schluckte und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. »Sie brauchen gar nicht so zu gucken. Es ist kein Trick, und ich will Sie nicht anbaggern.«
»Und was ist mit den beiden? Danuta und Marysien´ka?«
»Die schmeiße ich raus. Ich sag der Agentur, ich brauche keine Putzfrauen. Ich verkehre sowieso nicht mit gewöhnlichen kleinen Schlampen wie denen, die ihre Titten überall rumbaumeln lassen.«
»Aber – sie sind darauf angewiesen.«
David zuckte die Achseln. Er stieß sich mit den Füßen ab und ließ den Stuhl kreiselnd zurückrollen. Als er zum Stehen gekommen war, grinste er sie an. »Wissen Sie was, Sally? Sie sind eine gute Christin, und nachdem Sie es jetzt so formuliert haben, sehe ich, dass ich auf dem falschen Wege war. Diese dummen Polacken sind auf das Geld angewiesen; also werde ich tun, was richtig ist.« Er stand auf und ging zur Tür. »Ich rufe die Agentur an und rede über meinen Vertrag. Ich werde mich über Ihre Arbeit beschweren und sagen, die sollen Sie abziehen. Die polnischen Flittchen können bleiben.« Er zwinkerte. »Ich sag Ihnen was: Vielleicht werde ich den beiden sogar den doppelten Lohn zahlen. Da dürften sie strahlen.«
6
»Ich habe mich gescheut, am Tatort schon irgendwelche Aussagen zu machen.« Der Rechtsmediziner stand neben Ben und Zoë am Seziertisch und schaute hinunter auf Lorne Woods Überreste. Der kleine Obduktionssaal der Klinik war geschlossen; draußen vor der Tür saß ein uniformierter Polizist, und nur ein Assistent und der Fotograf waren anwesend. »Nach meiner Erfahrung mit Fällen wie diesem? Da begrenzt man die Ausbreitung der Informationen. Man begrenzt die Zahl der Leute, die Einzelheiten kennen.«
Der Fotograf ging um die Leiche herum und fotografierte sie aus allen Blickwinkeln, und dabei kam er dicht an die Plane heran, die immer noch bis über Lornes Brust hinaufgezogen war – so, wie man sie gefunden hatte. Zoë sah mit gespitzten Lippen zu. Sie war schon öfter hier in diesem Raum gewesen, mit demselben Arzt, aber es hatte sich immer um unkomplizierte Mordfälle gehandelt. Schrecklich und tragisch allesamt, aber schlicht und einfach: Die Opfer waren meistens bei Kneipenschlägereien ums Leben gekommen. Einmal war jemand erschossen worden – die Frau eines Bauern. Aber natürlich würde dieser Fall hier mit all den anderen nicht vergleichbar sein.
Als der Fotograf die nötigen Aufnahmen gemacht hatte, stellte sich der Arzt neben Lornes Kopf und leuchtete ihr mit einer kleinen Taschenlampe in die Nasenlöcher. Dann zog er beide Lider hoch und leuchtete ihr in die Augen.
»Was für Blut ist das?«, fragte Zoë. »Das da aus ihrem Mund kommt.«
Der Mediziner runzelte die Stirn. Er schälte ein winziges Stück des Klebstreifens zurück und trat beiseite, damit Zoë es sich anschauen konnte. Die Haut an Lornes Mundwinkeln spannte sich um den Tennisball. Und die Mundwinkel waren tatsächlich gerissen, auf beiden Seiten ungefähr einen blutigen Zentimeter weit. Wie der Chef der Spurensicherung es gesagt hatte.
Zoë nickte knapp. »Danke«, sagte sie steif. Sie richtete sich auf und trat einen Schritt zurück.
»Ich glaube, der Ball hat ihr auch den Kiefer ausgerenkt.« Der Arzt schob die Hände unter Lornes Ohren und betastete die Gelenke, den Blick zur Decke gerichtet. »Yep.« Er richtete sich auf. »Ausgerenkt.« Er schaute den Fotografen an, um seine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. »Wollen Sie ein paar Aufnahmen machen, während ich den Klebstreifen zurückhalte?«
Es war still im Raum, als der Fotograf seine Arbeit machte. Zoë vermied es, Ben anzusehen, und sie vermutete, dass auch er keine Lust hatte, ihr in die Augen zu schauen. Auf der Fahrt hierher hatten sie beide kein Wort gesprochen, aber sie war sicher, dass ihm die gleichen Fragen im Kopf herumgegangen waren wie ihr. Zum Beispiel: Was verbarg sich unter der Plane? Der Arzt ließ sich quälend lange Zeit mit dem Fotografen, bevor er Proben von Lornes Haar und Fingernägeln nahm. Erst nach einer halben Ewigkeit wandte er sich der Plane zu.