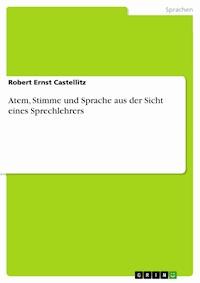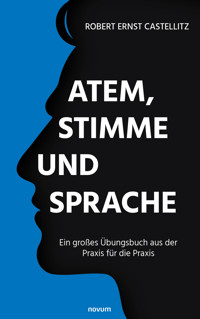
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wir kennen das Miauen der Katze oder das Bellen des Hundes, wenn sie etwas von uns Menschen wollen. Lebewesen mit Stimme nutzen jene, um sich dem anderen mitzuteilen und ihre Gemütszustände zu transportieren. Der Mensch hat im Laufe der Evolution eine Stimme ausentwickelt, die im Tierreich kein Pendant hat. Wie unser Stimmsystem aufgebaut ist, wie die Stimme funktioniert und welche unterschiedlichen Laute es gibt, zeigt Robert Ernst Castellitz in seinem neuen Buch "Atem, Stimme und Sprache". Darüber hinaus gibt er uns zahlreiche praktische Übungen an die Hand, wie wir unsere Stimme verbessern bzw. verfeinern können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2024 novum publishing
ISBN Printausgabe:978-3-99146-983-4
ISBN e-book:978-3-99146-984-1
Lektorat:Tobias Keil
Umschlagabbildung: Djvstock | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen: Suzie Leger; Robert Ernst Castellitz
www.novumverlag.com
Hinweis
Das Manuskript, einschließlich all seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikrovervielfältigungen und Einspeicherung und/oder die Verarbeitung in elektronische Systeme.
Herausgeber
Robert Ernst Castellitz
Wien
Über den Autor
Robert Ernst Castellitz ist Atem-, Stimm- und Sprechtrainer, Coach, Kulturmanager und Dozent für Kulturmanagement und -vermittlung. Er hält Seminare für Firmen und Institutionen im In- und Ausland ab, seine Einzelcoachings zu wichtigen Themen des Lebens sind sehr gefragt, diese werden in Deutsch und Englisch, auch online, abgehalten.
1998 erhielt er für seine Lehrtätigkeiten in Österreich die „Auszeichnung für Lehrtätigkeiten des Landes Niederösterreich“.
Der Autor stiftete 2024 den Senta-Wengraf-Ring für das Rollenfach „Salondame“ Die erste Preisträgerin dieses Theaterpreises für Schauspielerinnen ist die Künstlerin Sona MacDonald.
Erläuterung
Beim Sprechen handelt es sich um eine ganzkörperliche Angelegenheit!
Es ist das Zusammenspiel aus Haltung, Atem, Stimme, Sprache und Persönlichkeit. All diese Punkte hängen unmittelbar miteinander zusammen und beeinflussen den perfekten Transport der Sprache.
Die Sprach-PERSÖNLICHKEIT lässt sich trainieren. Dieses Buch dient mit all seinen praktischen Anleitungen und Wortgutsammlungen als Übungsbuch aus
Zitat
Sprechen ist wie Singen, nur etwas schneller!
Einleitung
Dieses Buch ist ein Übungsbuch für JEDERMANN/JEDERFRAU!
Allen Lebewesen mit Stimme ist es eigen, Seelenzustände durch Laute zu äußern. Wir kennen aus der Tierwelt die Lock- und Balzrufe der Vögel, das Hungergebrüll der Löwen und das ängstliche Aufkreischen einer Stimme infolge von Gefahr oder Schmerz. Lautäußerungen dieser Art werden bei Tier und Mensch durch Reize ausgelöst und über Nervenbahnen zum Phonationsstrom weitergeleitet.
Die menschliche Stimme ist an bestimmte, von der Natur vorgegebene Eigenschaften des Organismus gebunden. Diese sind nicht veränderbar, aber „veredelbar“.
Die Größe der Lunge, die Länge und Stärke der Stimmbänder, die Beschaffenheit der Resonanzräume sind fixe Größen, die auch durch viel Fleiß nicht verändert werden können. Die Muskulatur aber, welche die Hauptorgane der Sprach- und Lautgestaltung umgibt und funktionstätig macht, kann durch gezieltes Üben angeregt werden.
Ein Ton ist zunächst stimmlos, erst durch die Schwingungselemente der Resonanzräume erhält er seinen spezifischen Klang.
Die Tonhöhe hängt von der Länge und Spannung der Stimmbänder und somit von der Anzahl der Schwingungen (Frequenz) ab.
Die Lautstärke ist vom Luftvolumen abhängig, das durch die Hilfe der Atmungsmuskulatur gesteuert wird und die entsprechende Schwingungsweite (Amplitude) in den Stimmbändern hervorruft.
Die Klangfarbe (Timbre) entsteht aus der Form der Schwingung und aus der individuellen Nutzung der Resonanzräume, wobei der aus der Stimmbandschwingung entstehende Primärton entsprechend abgewandelt und verstärkt wird.
Die Wort- und Begriffsgestaltung ist mit einem Denkprozess verbunden. Bei diesem Prozess werden die Impulse durch eine verbale Äußerung vom Sprechzentrum im Gehirn an das Sprechzentrum im Kehlkopf weitergeleitet, dort, wo die Phonation des Lautes durch die entsprechende Einstellung der Stimmlippen zueinander vor sich geht. Für die Bildung der Sprachlaute (Phoneme) ist vor allem die formgebundene Gestalt der Mundhöhle und des Ansatzrohres sowie das Zusammenwirken der einzelnen Artikulationsorgane maßgebend.
Der Stimmumfang eines erwachsenen Menschen erstreckt sich etwa über zwei Oktaven. Die Sprechstimme in ihrer natürlichen Mittellage umfasst meist sechs Töne. Die männliche Stimme liegt im Allgemeinen zwischen G und E, die weibliche Stimme liegt um ca. eine Oktave höher.
Dieser Atem-, Stimm- und Sprechführer ist leicht verständlich und als reines Übungsbuch aus der Praxis für die Praxis bestimmt. Animiert zum Schreiben dieses Buches haben mich in meiner fast 30-jährigen Lehrtätigkeit viele meiner Studenten und Klienten. Diese kamen immer wieder auf mich zu, fragten bei mir hartnäckig nach Übungen und einem Übungsbuch nach. Sie wollten immer mehr und mehr Informationen haben, Informationen, die ich erlernt habe, aber nicht in Fachbüchern zu finden waren. Viele Studenten/Klienten haben mich nach einem Übungsbuch für die Praxis gefragt, das all meine vorgetragenen Übungen und Wortgutsammlungen zusammenfasst. Ein Buch, das die Atem-Stimm-Sprechtechnik einfach erklärt und umsetzbar macht. Ein großes Nachschlagewerk. Hier ist es nun.
Ich habe alle meine in diesem Buch zusammengefassten Übungen aus vielen Himmelsrichtungen und Kontinenten zusammengetragen, aus verschiedenen Seminaren und aus eigenen Überlegungen entwickelt bzw. verändert. Ich habe alles selbst ausprobiert, bevor ich es weitergegeben habe. Nun gibt es all das Erlernte und Erfahrene zusammengeschrieben für JEDERMANN/JEDERFRAU, für alle, die sich mit der Thematik Atem-, Stimm-, Sprechtechnik praktisch ausprobieren und verändern wollen.
Im Jahre 1999 ging ich nach New York, um dort ein Praktikum an der bekannten Schauspielschule Lee Strasberg Institut zu machen und englische Sprechtechnik zu studieren. Es war unwahrscheinlich interessant, aufregend und anstrengend, aber sehr lehrreich. Ich habe in diesem Jahr in New York durch die englische Sprache sehr viel über meine Muttersprache Deutsch gelernt.
Deutsch ist eine wunderbare, aber auch eine komplizierte hart klingende Sprache mit all den Verschlusslauten T, K, und P, mit seinen Verhärtungen am Wortende und dem großen Vokabular. Die deutsche Sprache besteht aus blumigen Formulierungen, langen verstrickten Sätzen, harten Endungen, vielen Füllwörtern, die gleichzeitig Nähe und Distanz erzeugen können.
So nun aber genug der Theorie, auf zur Praxis.
VIEL SPASS BEIM AUSPROBIEREN, ÜBEN UND UMSETZEN!
PROLOG
Gut drauf sein – Attraktivität ausstrahlen!
In Stimmung bringen durch Lächeln und Füße spüren
Bevor Sie nun wirklich anfangen, lege ich Ihnen noch zwei Übungen ans Herz, die Ihren Tag verändern und Ihre Stimmung steigen lassen werden. Probieren Sie es aus, jetzt gleich.
Ziehen Sie sich an einen ruhigen Ort zurück, horchen Sie in sich hinein. Wie fühlen Sie sich? Wie nehmen Sie Ihre Stimmung, Ihren Körper wahr?
Nun beginnen Sie zu lächeln, ziehen Sie Ihre Mundwinkel so hoch wie möglich; auch wenn Ihnen vielleicht gar nicht danach ist, einfach loslächeln. Bleiben Sie so, während Sie weiterlesen.
Sie setzen jetzt gerade einen chemischen Prozess in Gang, der durch Ihre Blutbahn weitergegeben wird und Ihre Stimmung verändert.
Das Lächeln ist zuerst einmal nur ein Anspannen Ihres Muskelkorsetts. Dadurch wird jedoch Ihrer körpereigenen Informationszentrale signalisiert, dass etwas ganz GROßARTIGES erlebt wird. Diese gibt diese erfreuliche Botschaft sofort ungeprüft an Ihr ahnungsloses emotionales Zentrum weiter. Dadurch wird Ihre Stimmung am Muskelkorsett angepasst – in Richtung POSITIVE STIMMUNG!
Diese beglückenden Emotionen strömen nun vom Blut transportiert durch den ganzen Körper und erhellen dadurch jede Zelle mit guter Laune.
Wie geht es Ihnen jetzt? Lächeln Sie sich weiter und lesen Sie weiter.
Nun kommen wir gleich zur Fußspürübung. Nicht das Lächeln vergessen.
Stellen Sie sich ca. hüftbreit auf Ihre Füße und versuchen Sie bewusst, den Boden unter Ihren Füßen zu spüren. Nehmen Sie nun die Gleichgewichtsverteilung auf beiden Füßen wahr, schließen Sie die Augen. Beginnen Sie mit geschlossenen Augen leicht vor- und zurückzupendeln und seitlich von links und rechts, dann ziehen Sie kleine Kreise – gehen Sie leicht nach vorn, zur linken Seite, nach hinten, zur rechten Seite und wieder nach vorn. Wechseln Sie auch die Richtung. Verlagern Sie das Gewicht jeweils von einem Bein auf das andere, von den Fersen auf die Zehen. Probieren Sie sich aus. Dabei nicht das Lächeln vergessen!
Nun pendeln Sie sich wieder in der Mitte ein und spüren nach, wie Sie jetzt dastehen. Haben sich die Empfindung und Wahrnehmung verändert?
Gut, dann gehen wir einen Schritt weiter. Stampfen und trampeln Sie ganz fest auf, werden Sie dabei immer schneller, machen Sie das einen Augenblick lang und stehen dann wieder still. Spüren Sie wieder nach. Das Ganze mit einem Lächeln. Wie geht es Ihnen jetzt? Ich hoffe, Sie fühlen sich wach, geerdet und gut gelaunt.
Dann sind Sie bereit, um weiterzustöbern und sich weiter auszuprobieren!
1 KAPITEL
Grundinformationen
1.1 Das Atmungsorgan
Das Atmungsorgan des Menschen ist die aus zwei Flügeln bestehende Lunge. Der rechte Flügel besteht aus drei, der linke aus zwei Lappen. Jeder der beiden Lungenflügel ist von einem luftleeren Sack umgeben, der Brustfell oder Pleura genannt wird. Der den Lungenflügel anliegende Teil wird Lungenfell, der den Rippen anliegende Rippenfell genannt. Die Organe der Bauchhöhle werden gegen den Brustraum durch das Zwerchfell (Diaphragma) geschützt.
Lunge
Bei der Aufnahme der Atemluft passen sich die durch Vakuum aneinandergehaltenen Pleurablätter der durch Muskeltätigkeit hervorgerufenen Weitung des Brustraumes elastisch an. Innerhalb der Lungen entsteht ein inspiratorischer Sog, der das Brustfell an die Wände des Brustkorbes bzw. an das Zwerchfell heranzieht.
Beim Einatmen (Inspiration) gelangt die Luft durch die Mund- oder Nasenhöhle in die Luftröhre (Trachea – ein ca. 12 cm lange aus einzelnen Knorpelringen bestehendes Verbindungsrohr zwischen Kehlkopf und Lunge, das mit Schleimhaut ausgekleidet ist). Bei ihrer Einmündung in die Lunge teilt sich die Luftröhre in zwei Stränge, die sich wieder in kleine und kleinste Äste (Bronchien, Bronchiolen) verzweigen, um sich am Ende in eine riesige Anzahl von Bläschen (300–400 Millionen!) zu erweitern (Bronchialbaum). Die Lungenbläschen (Alveolen) sind von einem feinen Gefäßnetz umgeben, in welchem der Kohlendioxyd-Sauerstoff-Austausch stattfindet.
Ein physikalisches Gesetz besagt, dass bei Arbeit Energie verbraucht wird. Für die Umsetzung von Energie in Arbeit ist Sauerstoff nötig. Die Lungenbläschen entnehmen den Sauerstoff aus der Atemluft und leiten ihn über das Gefäßnetz in die Blutbahn, von wo aus jedes Organ, jeder Muskel, jede Zelle mit dem für die Arbeitsleistung erforderlichen Treibstoff versorgt wird. Das freiwerdende Kohlendioxyd wird über das Blutgefäßnetz zu den Alveolen zurückgeführt und bei der Ausatmung (Expiration) ausgeschieden.
Die gesamte Oberfläche der Lunge beträgt 80–100 m2. Der Luftaustausch erfolgt ca. 16 x in der Minute. Bei normaler, ruhiger Atmung wird etwa ½ Liter Luft gewechselt. Bei stärkster Ein- und Ausatmung wird eine Luftmenge von 3,5–5 Liter ausgetauscht. Man bezeichnet diese Leistung als Vitalkapazität der Lunge. Es bleibt jedoch immer eine Rest- oder Residialluft von ca. 2,5–3 Liter in der Lunge zurück.
Die Duplizität der Luftaufnahme durch Nase und Mund
Die drei lebenswichtigen Substanzen, die der Mensch für seine Aufrechterhaltung des Organismus benötigt, sind Sauerstoff, Flüssigkeit und feste Nahrung.
Der Mensch vermag einige Wochen ohne Nahrung zu leben, einige Tage ohne Flüssigkeit, aber nur wenige Minuten ohne Sauerstoff. Wir haben zwei Möglichkeiten, um Luft aufzunehmen: über die Nase oder den Mund.
Die Nase ist das vorzügliche Organ für die Aufnahme der Atemluft. Sie verfügt über Schwellkörper, Drüsen und Flimmerzellen, welche die Aufgabe haben, die Luft zu erwärmen, zu befeuchten und zu reinigen, bevor sie den Kehlkopf und die Lunge erreicht.
Die Mundatmung sollte nur als Ersatzatmung bei Erkrankung der Nase, bei übergroßer körperlicher Leistung oder bei raschem Redefluss verwendet werden.
1.2 Die Atemstütze
Zum Begriff Stützorgan gehören jene Muskeln, die am Atmungsvorgang und damit auch an der Stimmführung unmittelbar beteiligt sind und diese Vorgänge wesentlich beeinflussen. Da die Lunge selbst über keine Muskeln verfügt, ist die sie umgebende Muskulatur von besonderer Wichtigkeit für die Atemführung.
Die Atmungsmuskulatur besteht in erster Linie aus Zwerchfell (Diaphragma) und der Zwischenrippenmuskulatur (Interkstalmuskulatur) sowie aus der mit beiden in Verbindung stehenden Bauch- und Flankenmuskulatur.
Das Zwerchfell ist für die Atmung der stärkste und wichtigste Muskel. Es handelt sich dabei um eine flache, hochelastische quergelagerte Muskel-Sehnenplatte, die den Brustraum gegen die Bauchhöhle abschließt. Seine Randmuskeln reichen tief in die Bauchhöhle hinunter. Sie stehen mit allen anderen am Atmungsvorgang beteiligten Muskeln in nervlicher Verbindung. Im Zustand der Ruhe, im ausgeatmeten Zustand also, ist das Zwerchfell, gemäß der Struktur seiner Muskelfasern und infolge des Eingeweidedruckes (abdomineller Druck), nach oben in den Brustraum hinein gewölbt. Das Zwerchfell wird von der größten Schlagader des Körpers, der Aorta und der Speiseröhre sowie von Nervensträngen durchstoßen.
Es ist die Stelle, wo der zwischen den Lungenflügeln befindliche Herzbeutel mit dem Gewebe des Zwerchfells verwachsen ist und die den ruhenden Punkt innerhalb seines Bewegungsbereiches darstellt. Infolge der durch den Befehl aus dem verlängerten Rückenmark ausgelösten Abflachung der Zwerchfellkuppen werden die Baucheingeweide nach unten verdrängt, was ein seitliches Ausweichen der Organe zur Folge hat.
Zwerchfell
Eine Spannung der Bauchdecke und Weitung des Leibes unterhalb der Rippen bis nach hinten zu beiden Seiten der Wirbelsäule wird fühlbar. Neben dem Zwerchfell sind Bauchdecken- und Flankenmuskeln an dieser Bewegung beteiligt. Das Zwerchfell wird durch seine Kontraktion und die damit verbundene Verschiebung von Organen (Leber, Milz, Lunge) sowie durch den Druck auf Magen und Darm zu einer merklich fühlbaren Kraft gegen den Eingeweidedruck. Außerdem übt es auch eine Massagefunktion für die Baucheingeweide aus, die mit jedem Atemzug angeregt und durchblutet werden.
Zwerchfell Lunge
Infolge dieser Vertikalhebung ermöglicht das Zwerchfell die maximale Ausdehnung der Lungen gegen den Weichteilbereich des Unterbauches und damit die Nutzung der gesamten Lungenkapazität. Es trägt somit den Hauptteil des Atmungsgeschehens.
Die Zwischenrippenmuskeln sind auf die Tätigkeit des Zwerchfells genau abgestimmt. Durch die Inspirationsstellung des Zwerchfells nimmt auch der Brustkorb die Einatmungsstellung ein. Diese Bewegung gewährleistet die maximale Ausdehnung der Lungen im Bereich des Brustraumes. Die von den äußeren Intercostalmuskeln aufgebaute Weitung des Brustkorbes durch die Einatmung wird erst am Ende der Phonation durch die Gegenwirkung der inneren Intercostalmuskeln abgebaut. Ihre Aufgabe ist es den Brustkorb bei der Ausatmung zusammenzuziehen.
Der Brustkorb wird bei der Luftaufnahme in seinem unteren Bereich fassartig geweitet und im Verlauf der Ausatmung lang und schmal. Schultergürtel, Brust- und Schlüsselbein bleiben am Atmungsgeschehen nahezu unbeteiligt!
Der Raum für die maximale Entfaltung der Lunge wird demzufolge bereits vor dem Einfließen der Atemluft geschaffen und bleibt über die Phase der Phonation bestehen. Bei dem Streben nach Kontinuität der Atemführung fällt dem Zwerchfell die Aufgabe zu, einerseits dem Kleinerwerden der Lunge nicht erschlaffend nachzugeben, andererseits dem aus der Bauchhöhle nach oben wirkenden Druck der Eingeweide standzuhalten, ohne dabei die eigene Spannungselastizität einzubüßen. Das Zwerchfell ist als hochelastische Membrane, die sich zwischen Eingeweidedruck und Atemdruck in Schwebebewegung befindet, zu verstehen. Das Zwerchfell ist für die Dosierung und Zügelung der Expirationsluft bei der Gestaltung des sprachlichen Ausdrucks von großer Bedeutung. Es wird als federnd gespannte Membran zu einem idealen Sprungbrett für die Stimmlaute.
Als Stützorgan fällt dem Zwerchfell die Aufgabe zu, durch Spanndruck gegen die Baucheingeweide die Sogspannung im Pleuralbereich aufrechtzuhalten, welche das Zusammenfallen des Lungengewebes verhindert und die Dosierung des Atemstromes ermöglicht.
1.3 Die richtige Körperhaltung
Die Grundvoraussetzung für die richtige Atemführung ist die aufrechte Körperhaltung mit gestreckter Wirbelsäule und waagrecht stehendem Becken.
Beckenstellung
Erfüllt dieses seine natürliche Funktion als „Schale für die Eingeweide“, erübrigt sich ein Einziehen der Bauchdecke, welches die Beweglichkeit und Elastizität der Atmungsmuskulatur blockiert. Dies würde zu Verspannungen im Bereich der Bauchdecke führen und die Atemluft beim Einfließen in die Tiefe der Lungen behindern. Die Folge davon wäre eine isolierte Brust-/Schlüsselbeinatmung.
Das Gewicht des Brustkorbes, des Schultergürtels und der Arme, das jeweils auf der Lunge lastet, würde beim Einatmen deren Entfaltung, beim Ausatmen die Dosierung der Ausatmungsluft zu einem gleichmäßig, kontinuierlich, langsamen Strom verhindern.
Das mühsame Heben des Brustkorbes und Schultergürtels beim Einatmen führt nicht nur zu Verspannungen der Halsmuskulatur, sondern könnte auch durch gewaltsames Einsaugen der Luft Überdehnungen der Lungenbläschen zur Folge haben und mitunter sogar organische Leiden hervorrufen.
Die starke Muskulatur zu beiden Seiten der Wirbelsäule streckt das Rückgrat vom Kreuzbein bis zum Nackenwirbel und hebt den Oberkörper selbsttragend aus dem Becken heraus. Durch bewusste Zwerchfellatmung mit der organischen Verlagerung des Atemschwerpunktes in das Becken erhält der Körper Kraft und Stabilität. Die Durchlüftung des Brustraumes bei der Intercostalatmung fügt dem Körpergefühl der Stabilität noch die Empfindung der Leichtigkeit hinzu, die sich positiv auf den Ansatz der Laute sowie auf sämtliche Bewegungen des Körpers auswirkt.
1.4 Die Elastizität der Atmungsorgane
Jeder kennt die hohe Oberflächenspannung eines qualitativ guten Gummiballes. Der Aufprall des Balles am Boden und die Delle, die dabei entsteht, er aber auf Grund der Qualität seines Materiales sofort auszuspannen im Stande ist, lässt sich auf die Funktion des Zwerchfelles übertragen. Auch hier kommt es auf die rasche Wiedererlangung seiner Spannung an, um die beim Sprechen abgegebene Luft möglichst leicht und geräuschlos zu ergänzen.
Die Bewegung eines Kolbens im Zylinder eines Verbrennungsmotors veranschaulicht die Vertikalbewegung des Zwerchfelles innerhalb der Bauchhöhle. Der Augenblick der abgeschlossenen Intensiv-Ausatmung (-t) ist dem Zündungsmoment gleichzusetzen. Durch Explosivkraft wird der Kolben abwärts getrieben, wobei fast gleichzeitig im Zylinder der Sog für die Ansaugung des Kraftstoff-Luftgemischs erfolgt.
Zwischenrippen Frontansicht - Rippenatmung
Im menschlichen Körper bewirkt der durch das Hinabschnellen des Zwerchfells entstehende Sog das Hinabziehen der Lungen und gleichzeitig das Einströmen der Atemluft.
Das dritte Beispiel soll das Augenmerk auf die Horizontalbewegung der Atmungsmuskulatur legen.
Ein Gummiballon mit Ausströmventil wird mit zwei Fingern zusammengedrückt. Es entströmt Luft. Sobald der Druck der Finger aufhört, kehrt der Ballon wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Durch das elastische Zurückschnellen des Gummimantels entsteht innerhalb des Ballons ein Sog, der die verbleibende Luft an die Wand heranzieht und Raum für das Einfließen neuer Luftteile von außen schafft. Das Luftvolumen wird so wieder ergänzt.
Zwischenrippen Rückenansicht - Einatmung
Beim Menschen erfolgt das Hinauspressen der Luft durch Kontraktion der Lungenbläschen unter Mithilfe der die Rippen zusammenziehenden inneren Intercostalmuskulatur. Dies übt Druck auf die Flankenmuskulatur aus, wodurch die ausgespannte Zwerchfellmuskulatur wie eine erschlaffende Feder entspannt und in ihre Ruhelage zurückkehrt. Der Brustkorb wird lang und schmal. Er überlappt die gehobenen Zwerchfellkuppen. Beim Nachlassen des Druckes seitens der Intercostalmuskeln entsteht sogleich im Zwerchfell wieder die Inspirationsspannung.
1.5 Das Stimmorgan
Das stimmgebende Instrument des Menschen setzt sich aus Ton erzeugenden und Ton verstärkenden Organen zusammen.
Das Organ ist der Kehlkopf (Larynx), in dem durch Schwingungen der Stimmbänder ein Ton erzeugt wird.
Querschnitt Ansatzrohr
Das Gerüst des Kehlkopfes besteht aus zwei miteinander korrespondierenden Knorpeln. Das sind: der Ringknorpel, der unmittelbar an die Luftröhre anschließt, und der sich darüber befindliche Schildknorpel, beide sind durch Muskel und Bänder miteinander verbunden. Sie werden mittels zweier Gelenke gegeneinander bewegt. Die ungeheure Elastizität und Dehnbarkeit der Luftröhre ermöglichen die Gegeneinanderbewegung der beiden großen Kehlkopfknorpel zur Spannung der Stimmlippen wie auch das Auf- und Abwärtswandern des Kehlkopfes bei jedem Schlucken.
Die beiden Stimmmuskeln entspringen im vorderen inneren Winkel des Schildknorpels (Adamsapfel) und führen quer über den Ringknorpel nach hinten zu den Ansatzpunkten der beiden Stellknorpel. Diese, auch Aryknorpel genannt, sind dreiseitige, pyramidenförmige Körper. Der stumpfe Winkel derselben stellt jeweils die Gelenkverbindung zum Ringknorpel dar. An einem der beiden Winkel setzt der Stimmmuskel, am anderen der Stellmuskel an.
Ansatzrohr
Die Bezeichnung des Stimmmuskels als Band ist allgemein üblich, gleicht aber eher einem flachen Prisma, dessen Seitenflächen von elastischen Muskelfasern durchzogen sind und in verschiedene Richtungen laufen, für dessen Kante die Bezeichnung Stimmlippe üblich ist.
Bei der Verschiebung der Stellknorpel entlang des hinteren Ringknorpelrandes entsteht zwischen den Stimmlippen eine Spalte, die Stimmritze oder Glottis genannt wird.
Die Form der Stimmritze hängt von der Stärke des Luftstromes und der Art der phonatorischen Art ab.
1.5.1 Die 5 Grundformen der Stimmritze
1. Respirationsstellung
Bei normaler Atmung ist die Stimmritze so weit wie ein spitzwinkeliges Dreieck geöffnet.
Respiration
2. Phonationsstellung
Stimmlippen und Stellknorpel liegen locker aneinander; der den Ton tragende Luftstrom versetzt die Stimmmuskeln leicht in Schwingungen. Der dabei entstehende Stimmlippenton wird Ur- oder Primärton genannt. Die Schwingung des Stimmmuskels ist vorwiegend eine gegeneinanderschlagende Horizontalbewegung mit zusätzlichen vertikalen Öffnungen.
Phonation
3. Flüsterton
Die Stimmlippen liegen aneinander, zwischen den Schenkeln der Stellknorpel und dem Ringknorpel bleibt ein kleiner dreieckiger Raum offen, in dem beim Durchströmen der Luft das Flüstergeräusch entsteht. Die Stimmmuskeln selbst sind durch den Verschluss an der Schwingung gehemmt und können keinen Klang entfalten.
Flüsterton
4. Vollverschluss
Die Stimmritze ist auch im Bereich der Stellknorpel geschlossen, da die Schenkel derselben aneinanderliegen. Der Vollverschluss erfolgt beim Schluckakt oder in Presssituationen (Husten, Räuspern).
Vollverschluss
5. Vollatmungsstellung
Die Stellmuskulatur zieht die Muskelfortsätze der Stellknorpel nach hinten, die Stimmfortsätze rücken auseinander und die Glottis öffnet sich in der dem Luftvolumen bzw. dem Laut entsprechenden Weite. Sie nimmt dabei die Form eines Fünfecks an.
Vollatmung
1.6 Der Kehlkopf
Bei besonders lockerer Stimmmuskeleinstellung durch tiefen Kehlkopfstand werden die oberhalb der Stimmlippen befindlichen Haupttaschen (Morganischen Taschen) auseinandergezogen. Sie tragen zur Erweiterung der Kehlkopfhöhle bei und ermöglichen den lockeren Stimmlippen das Durchschwingen.
Die Organe, die den Ton verstärken, sind die Resonanzräume des Kopfes und der Brust. Durch das Schwingen dieser Teile erhält der Primärton seinen charakteristischen Klang und seine Verstärkung. Die Muskeltätigkeit innerhalb der Resonanzräume bewirkt deren Umgestaltung bzw. Verformung zum Zweck der Verstärkung und Nuancierung des im Kehlkopf erzeugten Stimmlippentones. Dieser durchströmt sämtliche Höhlen des Schädels und erreicht, an Volumen und Farbnuancen bereichert, seinen Anschlagpunkt ganz vorne in der sogenannten Maske, bevor er durch die Öffnung des Mundes oder der Nase entströmt.
Kehlkopf
Der Ansatz des Stimmlautes: Phonation
Ein Laut entsteht im Sprachzentrum des Gehirns, wo er direkt an den Kehlkopf weitergeleitet wird. Dort wird er über die Funktion der Phonation und Artikulation verwirklicht.
Durch das Einsetzen des Sprechwillens wird die Stimmritze in Phonationsstellung gebracht. Das heißt: Zwecks Umsetzung des Gedankens in Lautung stockt der Atem, um für die Gestaltung des phonatorischen Ausdrucks entsprechend dosiert zu werden.
Die Stimmlippen legen sich für diesen kurzen Moment aneinander, um sogleich wieder von dem Expirationsstrom, der den Laut trägt, geöffnet zu werden.
In der deutschen Sprache sollte der Vokaleinsatz sanft, aber nicht behaucht erfolgen, denn ein Stimmlippenverschluss, der durch einen „harten Schlag“ auf die Glottis gesprengt wird, könnte eine Schädigung des Stimmmuskels hervorrufen. Die Stimmlippen würden in der Folge durch Überdehnung nicht mehr exakt aneinanderliegen. Die Reinheit der Phonation wäre dadurch beeinträchtigt.
Die Weitung des Pharynx
Um dem Stimmlaut den Weg in die entsprechende Resonanzhöhle zu öffnen, ist eine größtmögliche Weitung des Rachenraumes erforderlich. Das Gaumensegel der Mundhöhle, der Raum zwischen Zungenwurzel, Rachenraum und Velum, benötigt eine starke Dehnung, um den Vokal ungehindert in die Mundhöhle einströmen zu lassen (Gähnstellung).
Stimmbänder geschlossen
Die Weitung des Kehl- und Mundrachens ergibt sich aus einer Tiefstellung des Kehlkopfes, dem Anheben des Velums mit Hilfe der dafür vorgesehenen Hebe- und Spannmuskulatur (Levator- und Tensormuskel) im Bereich des Nasenraumes, einer Kontraktion der Gaumenbögenmuskulatur sowie der Öffnung des Kehldeckels auf Grund der bewussten Schwere durch die nach vorne verlagerte Zunge. In der Praxis werden diese Bedingungen bei der Gähnstellung eingenommen.
Stimmbänder geoeffnet
1.7 Die Artikulationsorgane
Der artikulatorische Gestaltungsvorgang von Lauten zu Elementen einer Sprache ist sowohl im Hinblick auf die Eigenart einer Sprache als auch hinsichtlich der artikulatorischen Fähigkeiten des Menschen unterschiedlich. Die Präzision der Lautgestaltung hängt von der Stellung der einzelnen Organe zueinander sowie von deren Elastizität und Trainierbarkeit ab.
Sprachfehler können durch Fehlfunktion einzelner Artikulationsorgane oder deren ungünstigen Stellung zueinander auftreten. Meistens ist es möglich, diese durch Übungen und intensives, gezieltes Training zu korrigieren.
Die Aufgabe der Artikulation liegt einerseits darin, die Passage für einen Laut ungehindert freizugeben, andererseits erforderliche Verschlüsse oder Engen zu errichten.
Als Artikulationsorgane werden die Teile der Mundhöhle bezeichnet, die durch Einstellung zueinander für die Bildung der Laute verantwortlich sind.
1.7.1 Der Unterkiefer (Mandibula)
Der Unterkiefer oder Kinnlade ist ein gebogener Knochenkörper mit zwei aufsteigenden Ästen, die je zwei Fortsätze besitzen. Dabei handelt es sich um eine Drehgelenksverbindung zum Jochfortsatz des Schläfenbeines und um eine Muskelverbindung. Diese ermöglichen die Beweglichkeit des Unterkiefers, die durch Lockerungsübungen noch gesteigert werden kann.
Schädel
1.7.2 Die Lippen (Labia)
Das Präzisionsorgan für die Artikulation der Laute sind die Lippen. Ihre Stellung und die Spannung ihrer Muskeln geben der Mundhöhle und damit dem Vokal die gewünschte Form. Ein fester Verschluss der Lippen ist für die Bildung explosiver Laute, ein weicher für die klingenden Konsonanten und labialen Engelaute erforderlich. Eine lockere, aber dennoch präzise Lippenstellung ist für die richtige Stellung der Zischlaute maßgebend. Die Flinkheit beim Öffnen und Schließen ist ebenso wichtig wie das elastische Nachgeben der Wangenmuskulatur beim Fallenlassen des Unterkiefers. Auch diese Muskulatur kann durch spezielle Lippenübungen trainiert werden.
Lippen
1.7.3 Die Zunge (Lingua)
Das kräftigste und beweglichste Artikulationsorgan ist die Zunge. Es gibt Laute, die aus der passiven Ruhestellung der Zunge gebildet werden, und solche, die durch ihre Aktivität entstehen. Beides ist für die Lautbildung von Bedeutung. Bei der Artikulation gewisser Laute wird die Zunge zu einem ungemein sensiblen Tastorgan. Sie ermöglicht durch die Spannungsfähigkeit ihrer Muskeln eine äußerst kraftvolle Lautgestaltung und durch ihre Lebendigkeit einer sehr schnellen Lautfolge.
Das Zungenbein ist oberhalb des Kehldeckels mit dem Larynx verwachsen. Das Zungenbändchen, mit dem der vordere Teil der Zunge am Boden der Mundhöhle befestigt ist, verhindert das ungewollte Aufsteigen und Einrollen der Zungenspitze. Es hält diese bei der Bildung von Lauten an den Alveolarrand der unteren Schneidezähne fest.
Lediglich bei der Bildung der Laute L, N, D, T und rollendes R verlässt sie ihre Ruhestellung. Bei der Bildung des Lautes SCH verschiebt sich die Zungenspitze geringfügig nach hinten.
Um schwierige Lautkombinationen mühelos zu bewältigen und möglichst große Geläufigkeit sowie Leichtigkeit beim Sprechen zu erreichen, ist es erforderlich, die Zunge durch gezielte Übungen zu trainieren.
Zunge Querschnitt
Zunge
1.7.4 Das Zäpfchen (Uvula)
Das letzte Artikulationsorgan innerhalb der Mundhöhle ist das Zäpfchen. Es bildet den hochelastischen Ausläufer des Gaumens. Unmittelbar über dem Zahndamm wölbt sich der harte unbewegliche Teil des Gaumens empor und setzt sich in den weichen Gaumen (Gaumensegel oder Velum) fort. Das Velum geht auf beiden Seiten in zwei Hautfalten, den vorderen und den hinteren Gaumenbogen, seitlich in die Rachenwand über. Durch Muskelzüge (Tensor und Levator) werden Gaumensegel und Gaumenbögen gehoben. So erhält die Mundhöhle im Rachenbereich ihre maximale Öffnung (Gähnstellung).
Um den Verschluss des Nasenrachens herzustellen (Velarverschluss), nähert sich ein Muskelwulst dem über die Gaumenplatte nach hinten ziehenden Zäpfchenmuskel aus der hinteren Rachenwand, der sich mit dem herabhängenden Zäpfchen des gespannten und gehobenen Velums vereinigt.
Die Beweglichkeit des Zäpfchens sowie seine Schwirrfreudigkeit bei der Bildung des Rachen-R können auch durch spezielle Übungen trainiert werden.
Zäpfchen
1.8 Das Ansatzrohr
Jener Teil des Atmungsapparates, der oberhalb der Stimmritze beginnt, heißt Ansatzrohr. Er dient zur Verstärkung des bei der Schwingung der Stimmmuskulatur entstehenden Primärtones. Der Teil, der unterhalb der Stimmritze an die Luftröhre anschließt, wird Windrohr genannt.
Das Windrohr wirkt als Resonanzraum. Das Ansatzrohr dagegen ist ein kompliziertes System von Höhlen, die zur Entfaltung einer gewaltigen Klangfülle ineinander übergehen, aber auch für spezielle Klänge genützt werden können.
Das Ansatzrohr beginnt mit den Morganischen Taschen. Dabei handelt es sich um kleine Höhlen, die sich oberhalb der Stimmritze zwischen den echten und den falschen Stimmlippen befinden und den ersten tonverstärkenden Raum innerhalb des Ansatzrohres bilden. Es schließen drei weitere, große, ineinander übergehende Höhlen an: Rachen, Mundhöhle und Nasenhöhle.
Ansatzrohr
Der Rachen (Pharynx) gliedert sich in drei Etagen: Kehl-, Mund- und Nasenrachen. Bei normaler Nasenatmung steht er, infolge des auf der Zungenwurzel ruhenden Zäpfchen, in offener Verbindung mit der Nasenhöhle. Der Weg der Atemluft durch die Mundhöhle muss erst durch das Ausstrecken des Zäpfchens gegen die hintere Rachenwand freigegeben werden, wodurch der obere Teil des Rachens, der Nasenrachen(Epipharynx), von den beiden darunter liegenden Teilen des Rachens abgeschlossen wird.
Die Mundhöhle (cavum oris) beginnt mit dem Mundvorhof. Das ist der Raum zwischen Lippen und Zähnen. Hinter den Schneidezähnen beginnt die eigentliche Mundhöhle. Diese nimmt den Raum zwischen Gaumen, Zäpfchen und Zunge ein. Das Zäpfchen bildet den beweglichen Verschluss zwischen der Mundhöhle und dem Rachen. Das Heben oder Senken des Zäpfchens ermöglicht die wechselweise Isolierung der Mundhöhle oder Nasenhöhle vom Gesamtsystem des Ansatzrohres.
Die Nasenhöhle (cavum nasi) ist unten von der Gaumenplatte, seitlich durch den Oberkiefer, oben von Siebbein, Keilbein und Stirnbein sowie vorne durch das Nasenbein begrenzt. Die Nasenhöhle wird durch die Nasenscheidewand in zwei Hälften geteilt. Die Nasenlöcher öffnen die Nasenhöhle nach vorne. Im hinteren Bereich mündet sie in den Nasenrachen. Auf der Seitenwand einer Nasenhälfte befinden sich jeweils drei Muscheln (Schwellkörper), zwischen welchen die Nasengänge verlaufen. Diese stehen mit den Nebenhöhlen des Gesichtsschädels (Stirn-, Keilbein-, Oberkieferhöhle und Siebbeinzellen) in Verbindung.
1.9 Die Verstärkung des Stimmlautes: RESONANZ
Die durch den Expirationsstrom ausgelöste tonlose Schwingung der Stimmmuskeln setzt sich in den mit Atemluft erfüllten Räumen des Wind- und Ansatzrohres fort. Sie regt diese innerhalb des Brust- und Kopfraumes zum Mitschwingen bei der sich aufschaukelnden Schwingung an.
Durch die Tätigkeit verschiedener Muskeln ist es möglich, das Stimmorgan und die Verstärkerorgane in ihrer Gestalt zu verändern und den Primärton in verschiedener Weise abzuwandeln. Durch diese bei der Verformung entstehenden Klangcharakteristik erhält die menschliche Stimme ihre spezielle Klangfarbe (Timbre).
Die menschliche Stimme verfügt über zwei Resonanzbereiche. Das sind die Brust- und Kopfresonanz. Die Trennung zwischen den beiden Resonanzräumen bildet die Stimmritze. Die Zuordnung in den entsprechenden Resonanzraum hängt von der Spannung der Stimmlippen sowie der sich daraus ergebenden Schwingweite der Stimmmuskeln ab.
Brustresonanz
Unter diesem Begriff wird die Verstärkung eines Grundtones, der sich durch Schwingungen in den Räumen des Brustkorbes über Brustbein, Schlüsselbein, Schultergürtel und Rippen fortsetzt, verstanden. Es entsteht ein volltönender, tiefer, langsam, schwingender Laut, der durch die Nutzung des gesamten Resonanzraumes in seiner Klangcharakteristik geprägt und verstärkt ist.
Kopfresonanz
Der Ausgangston ist wieder der Primärton. Dieser ordnet sich durch eine größere Spannung der Stimmlippen aber mit rascher, kürzerer Schwingung in den Resonanzbereich des Ansatzrohres ein, um in jener, der Charakteristik des Lautes entsprechenden Höhle des Mundes oder der Nase weiter abgewandelt zu werden. Das Ansatzrohr öffnet über den dreietagigen Rachen sowie über die Mund- und Nasenhöhle die Resonanzräume des Kopfes.
Indifferenzlage
Unter Indifferenzlage versteht man die vollklingende Mittellage einer gut ausgebildeten, geschmeidigen Sprechstimme. Für jede Sprechstimme lässt sich die jeweilige Indifferenzlage bestimmen. Diese befindet sich im unteren Drittel des Gesamtstimmumfanges und umfasst etwa drei ganze Töne. In dieser ist eine optimale Stimmgebung mit dem kleinstmöglichen Aufwand an Muskelspannung der Kehlkopfmuskulatur und Atemdruck möglich. Jeder Laut umfasst mit seinen Randschwingungen beide Resonanzräume – die des Kopfes und die der Brust. Der Tonbereich unterhalb der Indifferenzlage heißt Lösungstiefe.
Die Stimmlagen des Mannes: Tenor, Bariton, Bass.
Die Stimmlagen der Frau: Sopran, Mezzosopran, Alt
1.10 Lautphysiologie
Das Lautinventar der deutschen Sprache besteht aus Vokalen und Konsonanten, die auf unterschiedliche Weise miteinander verbunden werden können. Den Lauten der sprechsprachlichen Ebene sind in der schreibsprachlichen Ebene Buchstaben zugeordnet. Diese Zuordnung ist jedoch nicht immer eindeutig, da demselben Laut mehrere Buchstaben zugeordnet werden können. Ebenso kann ein Laut durch mehrere Buchstaben bzw. ein Buchstabe durch mehrere Laute dargestellt werden. Die Besonderheit der einzelnen Laute ergibt sich aus ihrer Bildungsweise und ihren Kombinationsmöglichkeiten, sowohl in der geschriebenen als auch in der gesprochenen Sprache.
2 KAPITEL
Gedanken, Tipps und technische Details
Atem ist Leben und wenn du gut atmest, wirst du lange leben auf Erden!
(unbekannter Autor)
2.1 Atem und Haltung
Unser Dasein auf Erden beginnt mit dem Atem. Wir werden geboren; bevor wir schreien, müssen wir einatmen. Wir werden zu Erwachsenen und plötzlich vergessen wir durch all unsere Hast im Alltag das Atmen. Wir vergessen, dass wir atmen dürfen, um zu leben. Viele von uns lassen sich keine Zeit für das Sprechen. Sie hassten wie im Alltag mit Lauten um sich und wundern sich, warum ihnen niemand zuhört, warum sie nicht verstanden werden.
Menschen werden geprägt durch Vererbung, Erziehung und Selbstdisziplin. Erziehung bestimmt die Sprache, die man als Erwachsener sprechen wird.
Vier wichtige Punkte machen ein Wachsein für das Sprechen aus:
Sinnesempfindung, Gefühl, Denken, Bewegung.
Dauernde Entspannung verlangsamt die Muskeltätigkeit und macht sie schwach; dauernde Anspannung führt zu ruckartigen, eckigen Bewegungen.
Das heißt: Erst denken, dann handeln! Bewusstheit ist Bewusstsein und die Erkenntnis dessen, was im Bewusstsein vor sich geht, oder dessen, was in uns vor sich geht, während wir bei Bewusstsein sind.
Platte Sätze werden nur dann zu einer sprudelnden Quelle von Formen, Figuren und Bezügen, die neue Kombinationen und Entdeckungen ermöglichen, wenn von diesen Sinnen die Gefühle, Sinne und Vorstellungskraft sich reizen lassen.
Das heißt: wenn Sie in Bildern denken, in einer Ihnen eigentümlichen geistigen Kombination.
Ein Gleichnis, das aus Tibet stammt, sagt, dass ein Mensch, der sich seiner nicht bewusst ist, einem Wagen gleiche, dessen Fahrgäste die Begierden, dessen Pferde die Muskeln sind, und der Wagen selbst sei das Skelett. Die Bewusstheit ist der schlafende Kutscher. Solange er schläft, wird der Wagen ziellos bald hierhin, bald dorthin gezerrt. Jeder Fahrgast will an ein anderes Ziel, jedes der Pferde zieht in eine andere Richtung. Ist der Kutscher wach und hält die Zügel, so wird er Pferd und Wagen derartig lenken, dass jeder Fahrgast sein Ziel erreicht. In den Augenblicken, da es der Bewusstheit gelingt, mit Gefühl, Sinnesempfindung und Denken gemeinsame Sache zu machen, wird der Wagen seine Straße halten und auf ihr leicht und schnell vorankommen. Das sind die Augenblicke, in denen Entdeckungen gemacht werden, in denen einer erfindet, erschöpft, Neues erkennt. In ihnen begreift er seine kleine Welt und jene sowie die große um ihn sind eins, und in dieser Einheit ist er nicht mehr allein.
Wenn wir Gewohnheiten ändern möchten, ist bewusste Arbeit nötig, bis die richtige Haltung sich als die normale anfühlt und selber zu einer neuen Gewohnheit wird. Wer es einmal versucht hat, weiß, dass eine Gewohnheit schwerer zu ändern ist, als man meint.
2.2 Wirbelsäule
Die Wirbelsäule besteht aus:
einem Steißbein, fünf Lendenwirbeln, zwölf Brustwirbeln und sieben Halswirbeln.
Wirbelsäule
2.3 Einige technische Details
Atemvolumen
Die Luft wird beim Ausatmen nicht vollständig entleert und beim Einatmen nicht maximal gefüllt. Bei normaler Atmung atmen wir nur etwa 0,5 Liter Luft ein und aus – Respirationsluft oder auch normales Atemvolumen genannt. Wenn wir maximal einatmen, können wir 1,5 bis 2 Liter Luft aufnehmen – inspiratorische Reserveluft. Atmen wir dagegen vollständig aus, können wir zusätzlich zur Respirationsluft 1,5 bis 2 Liter ausatmen – expiratorische Reserveluft. Was auch nach tiefster Ausatmung in der Lunge zurückbleibt, sind etwa 1,5 Liter Restluft – Residualluft.
Zwerchfell
Das Zwerchfell ist unser größter Muskel im Körper. Das heißt, es sind eigentlich mehrere miteinander funktionierende Muskelpartien, die sich unter der Lunge quer durch den Oberkörper spannen.
Eutone – Balance
Zustand zwischen Erschlaffung und Überspannung d. h. körperliches und seelisches Gleichgewicht, das zu ungeahnten Kräften verhilft.
Vitalkapazität
maximales Atemvolumen – normale Vitalkapazität: 3,5–6 Liter Luft
Angemessene Körperhaltung
Es geht mehr um Beweglichkeit, Durchlässigkeit und Transparenz. Haltung soll nicht nur körperlicher Gesundheit dienen, sondern auch Freude, Kreativität und Leichtigkeit fördern. Haltung soll die Möglichkeit schaffen, dem inneren persönlichen Potential Ausdruck zu verleihen. Eine stimmige Körperhaltung bietet eine Form, ein Gefäß für die Qualitäten, die durch sie zum Ausdruck kommen. Diese Qualitäten äußern sich im Anmut der Bewegung, in der Klarheit der Gesten, vielleicht auch Humor in der Mimik oder Sehnsucht und Freiheit im stimmlichen Ausdruck. Eine elastische aufrechte Körperhaltung ermöglicht die optimale Atmung und ein entspanntes lebendiges Sprechen.
Üben
Stimme und Körper bilden eine Einheit und sind unmittelbar miteinander verbunden. ÜBEN ist das liebevolle Hinwenden zu sich selbst. ÜBEN bedeutet das bewusste Erleben der persönlichen Rhythmen, des Wechselspiels von Aktivität und Passivität, von Spannung und Entspannung sowie anderer Gegensätzlichkeiten der menschlichen Natur. Es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob Übungen wirken oder nicht, und die besteht darin, sie auszuprobieren.
Lebendigkeit
Je lebendiger wir sind, desto mehr Energie haben wir, strahlen wir aus und umgekehrt. Es ist wichtig, dass wir die Knie zu jeder Zeit elastisch halten und den Bauch nicht einziehen, sondern locker und elastisch halten. Natürliches entspanntes Atmen zieht beim Einatmen/Einfließen nach unten und außen. Das Zwerchfell zieht sich zusammen und senkt sich, der Bauchraum vergrößert sich. Während dieses Prozesses erweitert sich auch der Brustraum nach vorne außen.
Entspanntes lockeres Atmen bezieht sich hauptsächlich auf den Bauch- und weniger auf den Brustraum. Lachen und Weinen kommen aus dem Bauch. Der Klang der kräftigen Stimme hängt unmittelbar mit der Atmung zusammen. Seien Sie in Kontakt mit Ihrem Körper. Das heißt, seien Sie nicht perfekt, sondern lebendig! Strahlen Sie lebendige Kraft aus.
2.3.1 Ziele, die es zu erreichen gilt
Geräuschlose Vollatmung:
Zwerchfell-, Flankenatmung
Einsetzen der verschiedenen Resonanzen:
Optimale Verbindung zwischen Brust- und Kopfresonanz
Lockere unverkrampfte Tongebung:
Lockere Halsmuskulatur
lockererer Kiefer
aktive Zwerchfellatmung
optimale Körperhaltung
Aktive genaue Artikulation:
Geschmeidige Lippen
Lockerer Unterkiefer
Elastische Zunge
Farbige lebendige Rede:
Klarheit der Stimme
Plastik der Sprache
Pointierung der Gedanken
Kontakt zum Publikum (Zuhörer)
2.3.2 Fehler, die vermieden werden sollen
Atmung:
Flache, kurze Atmung
Geräuschvolle Atmung
Stauen des Atems,
Luftverschwendung (Verblasen von Luft)
Zu viel Atemschöpfen
Heben der Schultern bei der Einatmung
Tonbildung:
Zu hohe Stimmlage
Pressen,
knödeliger, halsiger Ton
flache, resonanzarme Tongebung
Artikulation:
Mundfaulheit
Trägheit der Lippen
Geschlossene Zahnreihen
Schwere Zunge
Fehler bei der Bildung von S/R
Rede:
Monotones Sprechen
hastiges schnelles Sprechen
falsches Pathos
Allgemein:
Alle Verkrampfungen des Sprechapparates
3 KAPITEL
ÜBUNGEN
3.1 Körperübungen
ÜBUNG 1 – Wahrnehmung des Atems im Stand
Aufrecht stehen – in einer gewohnten Haltung, Augen schließen, den Atem in Ihrem gewohnten Rhythmus kommen und gehen lassen. Während des Kommens und Gehenlassens stellen Sie fest – ohne etwas zu verändern –, ob die Luft durch die Nase oder den Mund ein- und ausfließt bzw. vielleicht durch die Nase ein – durch den Mund aus oder umgekehrt. Stellen Sie fest, ob Ein- und Ausatemzüge gleich lang oder ob das Einatmen oder das Ausatmen länger ist.
ÜBUNG 2 – Wahrnehmung des Atems in der Rückenlage
Rückenlage am Boden, Arme und Beine bequem ausgestreckt und locker neben dem Körper legen, Beine ausgestreckt locker nebeneinander, nun auch in der Liegeposition feststellen, wie der Atem kommt und geht und ob es Unterschiede zwischen Ein- und Ausatmung gibt (wie in Übung 1).
In diesen beiden Übungen geht es um das Erfahren und Erkennen seines eigenen individuellen Atems. Es wird noch nichts verändert. Sie wollen nur in sich hineinhören und feststellen, wie der Atemrhythmus fließt. Gleichmäßig? Fließt der Atem durch die Nase ein und aus oder durch den Mund? Fließt die Luft vielleicht durch die Nase ein und durch den Mund aus oder umgekehrt? Welche Teile des Körpers bewegen sich beim Atemvorgang? Beantworten Sie sich diese Fragen.
ÜBUNG 3 – Körperdurchdenken liegend
Rückenlage am Boden, strecken Sie die Beine aus und lassen Sie die Arme links und rechts neben dem Körper locker liegen, der Atem kommt und geht – Inspiration (Einfließen lassen) und Expiration (ausfließen lassen)! Nun langsam gedanklich den ganzen Körper, beginnend bei den Zehenspitzen, bewusst durchwandern. Von den Zehenspitzen weiter zu den Fußsohlen – Fersen – Knöchel – Unterschenkel – Knie – Oberschenkel – Becken, dann weiter vom Steißbein ausgehend langsam die Wirbelsäule entlang Richtung Kopf, dabei feststellen, welche Teile des Körpers aufliegen und welche nicht. Weiter über die Halswirbelsäule zu dem Punkt, mit dem der Kopf aufliegt, weiter über den Schädel zur Stirn – die Schläfen entlang weiter zu den Wangen und zum Kiefer, feststellen, ob der Mund geöffnet oder geschlossen ist, ob die Zähne zusammengebissen oder der Kiefer locker ist. Dann gedanklich zurückwandern, wieder über Wangen, Schläfen und Stirn, Schädel zurück zur Halswirbelsäule, zu den Schultern – Schulterblättern – Rücken entlang Richtung Becken, links und rechts neben der Wirbelsäule nach vor zum Bauch kommen, dabei feststellen, wie sich dieser beim Atmen bewegt, weiter zum Brustkorb – Schlüsselbein – Oberarme – Ellbogen – Unterarme und zu den Händen. Dabei auch linke und rechte Körperseiten vergleichen, die Unterschiede der Auflageflächen bzw. die Zwischenräume, den Abstand zum Boden kontrollieren und gedanklich festhalten, wie man aufliegen. Nichts verändern – nur feststellen! Danach wieder den Atem kontrollieren und überprüfen, ob sich dieser verändert hat. Langsam wach werden und langsam aufrichten.
ÜBUNG 4 – Entspanntes Körperdurchdenken – sitzend
Nehmen Sie eine bequeme Haltung sitzend auf einem Stuhl ein, lehnen Sie sich an, lassen Sie den Kopf nach vorne hängen, legen Sie die Arme bequem auf den Oberschenkeln ab, schließen Sie die Augen, konzentrieren Sie sich auf das Ausatmen, lassen Sie ein paar Atemzüge kommen und gehen, danach gehen Sie gedanklich, wie in Übung 3 beschrieben, den Körper durch, beginnend bei den Zehen, Fußsohlen, Unterschenkeln, Oberschenkeln, dem Becken, der Wirbelsäule, Kopf, Gesicht, Kiefer, zurück zu den Schulterblättern, Rücken – Becken – Bauch – Brustkorb – Oberarme – Unterarme – Ellbogen – Hände usw. danach am Ende der Übung bewusst kräftig ein- und ausatmen, Arme und Hände ausschütteln, Augen öffnen und strecken.
3.1.1 Atemübungen
(Sicherheit, Dauer und Stärke des Atems)
Übung 1 – Atmung aktivieren
Rückenlage, Arme neben den Kopf locker am Boden wegstrecken, sodass die Hände neben den Ohren aufliegen – Berührung des Rückens mit dem Boden – gedanklich feststellen, wie der Körper aufliegt – langsam mit dem Ausatmen rechten Arm am Boden über den Kopf wegstrecken, sodass dieser gerade nicht mehr den Boden berührt – mit dem Einatmen wieder locker lassen – Seiten wechseln
Weitere Varianten:
Rückenlage – gleichzeitig rechten Arm und rechtes Bein wegstrecken und wieder locker lassen – Seiten wechselnAbwechselnd rechten Arm und linkes Bein wegstrecken und wieder locker lassen – Seiten wechselnDie gleiche Übung, auch am Bauch liegend, jeweils 8 bis 10 x wiederholen.Übung 2 – Unterscheidung der Teile und Funktionen beim Atmen
Rückenlage, Beine aufgestellt (hüftbreit), ein- und ausatmen, dabei gedanklich beobachten und feststellen, welche Teile des Körpers bei der Atmung in Bewegung sind. Nach ein paar Atemzügen, Ausatmen und die Luft anhalten, bis das Gefühl entsteht, dass Sie Atem holen müssen – ein- und ausatmen – wieder anhalten.
Weitere Varianten:
Atembewegung ein paarmal wiederholen, aber ohne wirklich zu atmen. Das heißt: ausatmen, Luft anhalten und Körper- beziehungsweise Brustkorbbewegung ein paarmal ausführen – danach Atem einströmen lassen und ausruhenHände auf den Bauch legen, Luft einfließen lassen – Luft anhalten und Brustkorb zusammenziehen wie bei der Ausatmung, wieder lockerlassenAbwechselnd Brust zusammenziehen – Bauch rausstrecken; dann Brust aufblähen – Bauch zusammenziehen – es entsteht eine Wippbewegung –Rückenlage, Beine und Arme ausgestreckt – die Bewegung wiederholen (einatmen – Bauch raus – Brust zusammenziehen; ausatmen – Bauch einziehen – Brust aufblähen)Varianten auch am Bauch liegendRückenlage – beim Einatmen linke Brust – und rechte Bauchhälfte stärker gegen den Boden drücken – ausruhen, dann Seiten wechselnAuf rechte Körperseite legen, rechten Arm unter den Kopf ausstrecken, sodass der Kopf darauf liegt, linken Arm über Kopf – linke Hand fasst rechtes Ohr – mit dem Einatmen Kopf zur linken Schulter anheben – mit dem Ausatmen wieder ablegen (der Arm hebt den Kopf) anschließend kurz in Rückenlage ausruhen, SeitenwechselAm Boden sitzend, Beine anwinkeln Fußsohle an Fußsohle – Arme umfassen den Brustkorb – Kopf hängen lassen – Wippbewegung nachlinks und rechts, jeweils 8–10 x wiederholenIn Rückenlage nachspüren, anschließend langsam aufstehen, feststellen, wie und ob sich die Atmung verändert hat.
Übung 3 – Atmung verändern
Rückenlage, Füße aufgestellt – rechtes Bein über das linke schlagen, mit dem Ausatmen geht das linke Knie zur rechten Seite – mit dem Einatmen wieder zur Mitte hinauf – Seiten wechseln
Weitere Varianten:
Rechtes Bein aufstellen, linkes bleibt ausgestreckt am Boden liegen – Arme zur Decke strecken und Hände ineinanderlegen (Dreieck entsteht), nun mit dem Ausatmen langsam über die linke Schulter zur Seite drehen – mit dem Einatmen wieder zur Mitte zurück – Seiten wechselnRückenlage, Füße aufgestellt – rechtes Bein über das linke – die Beine nach rechts fallen lassen und ablegen – Arme verschränkt hinter den Kopf – mit dem Ausatmen heben die Arme den Kopf gerade aus nach vorne – Seiten wechseln – Rückenlage, Beine aufgestellt – Hände hinter den Kopf, Kopf beim Ausatmen mit den Händen anheben – mit dem Einatmen den Kopf ablegenAuf den Rücken liegen bleiben – Arme neben den Körper legen und nachspüren.
Varianten 8–10 x wiederholen.
Übung 4 – Atmung vertiefen
Sitzend am Boden, Fußsohle an Fußsohle – Arme hinter Kopf, Kopf vorfallen lassen – der Rücken ist gebeugt und die Hände drücken den Kopf leicht in Richtung Boden – aus- und einatmen – gedanklich die Luft nur in die rechte Körperhälfte einfließen lassen und ausatmen – anschließend gedanklich die Luft nur in die linke Körperhälfte ein- und ausfließen lassen, zum Abschluss in beide Seiten.
8–10x wiederholen.
Übung 5 – Bauchlockerung
Stehen mit lockeren Knien, Bauch locker lassen – Hand auf den Bauch legen, Augen schließen und ruhig ein- und ausatmen – gedanklich die Luft tief in den Bauch senden.
6–7 x wiederholen.
Übung 6 – Beckenwiege
Rückenlage, Beine hüftbreit aufgestellt – mit der Einatmung Becken ein wenig zu Boden kippen (leichtes Hohlkreuz) – mit der Ausatmung unteren Rücken gegen den Boden drücken (Rundrücken)
Variante: über langen, gemütlichen Ton ausatmen.
7 x wiederholen.
Übung 7 – Atmen und Vibrieren
Rückenlage, Beine zur Decke strecken, die Zehen anziehen, sodass diese zum Körper zeigen – in dieser Position tief ein- und ausatmen (Beine beginnen zu vibrieren), anschließend Beine lockerlassen und die Übung 3 x wiederholen.
Übung 8 – Moslemgebet
Ausgangsposition: kniend den Oberkörper vorbeugen, die Stirn wird auf den Händen abgelegt, diese berühren den Boden – Bauch locker hängen lassen, der Atem kommt und geht, ca. 2 Minuten in dieser Position bleiben und sich auf die Flankenatmung konzentrieren, danach aufrichten und nachspüren.
Übung 9 – Flankenaktivierung
Mit ausgestreckten Beinen am Boden sitzen – Oberköper und Kopf nach vorne fallen lassen – mit den Händen an den Unterschenkeln festhalten (Daumen innen, 4 Finger außen) – Wenn das Zwerchfell nun bei der Einatmung nach außen unten drückt, dehnt dies die Flanken, diese werden bei der Übung aktiviert – Atem fließen lassen, 8–10 x wiederholen.
Übung 10 – Atemfliegen
Haltung im Stehen, Arme seitlich wegstrecken und Flugbewegungen wie ein Vogel ausführen, dabei Stimme mit brrrr tönen lassen.
Übung 11 – Füllen
Den Atem kurz anhalten (Bereitschaftsstellung) – ausatmen auf ein langes anhaltendes stimmloses oder stimmhaftes S, locker ohne Nachdruck, so lange, bis der Vorgang von selbst aufhört.
Übung 12 – Füllen
Bereitschaftsstellung (Atem anhalten), ausatmen in drei nacheinander folgenden durch gleichmäßige Pausen abgesetzte S-S-S. Die Zahl der Stöße allmählich steigern. Dabei prüft die Hand an den Flanken nach, dass NICHT in den Pausen kleine Einatmungszüge gemacht werden.
Übung 13 – Füllen
Möglichst lange die Bereitschaft halten (Atem anhalten), in den Flanken wird eine Gegendruckempfindung wach, die immer mehr auf Ausatmung drängt, anschließend ausatmen.
Übung 14 – Füllen
Bereitschaft (Atem anhalten), sofort sehr kräftig auszuatmen: Es entsteht ein lautes S oder F – wieder in Bereitschaft gehen, nun sehr sachte ausatmen: Es entsteht ein leises S oder F.
Übung 15 – Füllen
Bereitschaft – auf S oder F in Taktfolge ausatmen: etwa lang – kurz – lang oder leise – laut – leise: dann Wechsel von Lautstärke und Dauer und längerer Folgen.
Übung 16 – Langsam Füllen
Sobald die füllende Einatmung zum Höhepunkt gestiegen ist, entsteht in den Flanken eine Empfindung gespannter Schwellung (siehe Übung 3). Diese Einatmungsempfindung auch während des Ausatmungsvorganges erhalten und übend kräftigen.
Übung 17 – Füllen
Bereitschaft, möglichst sparsame Ausatmung durch die zur Pfeifstellung lose gespitzten Lippen zu vollziehen. Dabei wird eine brennende Kerze dicht vor den Mund gehalten, die sich unter den Hauch nicht bewegen darf.
Übung 18– Füllen II
Dieselbe Übung bei weit geöffnetem Mund, während bei den früheren Übungen auf S oder F die vom Mund gebildete Zahn-Lippen-Sperre den Ausatmungsstrom abdämmen half, fällt die Aufgabe des Zurückhaltens nun einzig dem Zwerchfell zu.
Übung 19 – Füllen III
Die Lippen in die F-Stellung bringen, sodann einatmen – lange dauernde Bereitschaft – ausseufzen. Je stärker sich die Unterlippe an die Zähne presst, desto mehr wird die Ausatmung (in Leib und Flanken deutlich spürbar) erschwert, desto stärker das Zwerchfell beansprucht.
Übung 20 – Möglichst langsam füllen
Möglichst lange Bereitschaft – möglichst langes Ausatmen. Hierzu gehört schon ein starkes Maß an Atembeherrschung.
Die Einatmung muss völlig unhörbar, ohne irgendein Kehlkopf- und Mundreibegeräusch vor sich gehen; Es wird durch Mund und Nase zugleich eingeatmet.
3.1.2 Aktivierungsübungen
Übung 1 – Schulterentspannung
Ausgangsposition: hüftbreiter Stand, lockere Knie, rechten Arm schulterhoch nach vorne anheben, Kopf und Arm nach rechts drehen, Becken bleibt – stellen Sie fest, wieweit Sie bei der Drehung kommen, und merken Sie sich den äußersten Punkt. Nehmen Sie den Arm wieder zurück nach vorne.
Beginn der Übung: Mit dem Ausatmen geht der rechte Arm nach rechts, gleichzeitig geht der Kopf nach links, beim Einatmen gehen Kopf und Arm wieder zur mittleren Ausgangsposition zurück (der linke Arme bleibt locker hängen), 7 x wiederholen; kurz Arme ausschütteln, anschließend den gleichen Arm wieder anheben – die Bewegung wiederholen, diesmal geht das Becken mit dem Kopf nach links, während der rechte Arm wieder nach rechts geht, 7 x wiederholen, Arm ausschütteln – Seitenwechsel.
Schließen Sie die Augen und stellen Sie fest, was sich verändert hat.
Übung 2 – Schulterrollen
Die Übung kann stehend oder sitzend ausgeführt werden, aber nicht mit dem Rücken angelehnt – Schultern anheben in Richtung der Ohren und mit dem Ausatmen fallen lassen.
Varianten: nach vorne und rückwärts rollen, gegengleich rollen.
8–10 x wiederholen und nachspüren
Übung 3 – Armschwingen – Lockerung des Schulterbereichs
Haltung im Stehen – Arme nach vor und rückwärts schwingen lassen – dabei den Atem kommen und gehen lassen – nicht kontrollieren.
Varianten: gegengleich, einzeln kreisen.
8–10 x wiederholen und nachspüren.
Übung 4 – Bodenkontaktübung I
Hüftbreiter Stand mit vorgebeugtem Oberkörper und lockeren Knien, die Fingerspitzen berühren den Boden, das Gewicht ist gleichmäßig auf Fußballen und Fingerspitzen verteilt, nun Fersen von Boden abheben und Beine so weit wie möglich durchstrecken, ohne dass die Finger vom Boden abgehoben werden, bis die Beine leicht vibrieren, danach wieder in die Hocke gehen und entspannen.
3 x wiederholen.
Übung 5 – Bodenkontaktübung II
In gewohnter Haltung stehen, Beine ca. 25 cm auseinander, nun das Gewicht gleichmäßig auf Ballen und Fersen verteilen – über das Ausatmen 6 x leicht in die Knie gehen und dann wieder aufrichten – nachspüren.
Übung 6 – Kreisendes Becken
Haltung im Stehen, Knie lockern, Hände in die Hüften legen – mit dem Becken Kreise ziehen, zuerst von links nach vorne rechts und hinten, Richtungswechsel.
7 x wiederholen und nachspüren.
Übung 7 – Stehende Beckenschaukel
Haltung im Stehen, entspannte Knie – das Becken beim Ausatmen nach vorne kippen (Rundrücken) und mit dem Einatmen nach hinten – Gegenrichtung (Hohlkreuz) kippen.
8 –10 x wiederholen und nachspüren.
Übung 8 – Nackenstrecken
Diese Übung kann auch stehend oder sitzend ausgeführt werden (nicht angelehnt) – Hände im Nacken verschränken und den Kopf hängen lassen, nun mit den Händen den Kopf leicht Richtung Boden drücken, der Rücken bleibt dabei gerade aufrecht, in dieser Position ca. 1 Minute verharren, anschließend langsam die Arme lockern, vom Kopf wegnehmen und hängen lassen, danach langsam den Kopf anheben und nachspüren.
Übung 9 – Nackenmassage
Sitzend, aber nicht angelehnt, Kopf nach vorne locker hängen lassen, mit den Fingern den hängenden Nacken rauf runter streifen und massieren, anschließend langsam den Kopf wieder anheben und nachspüren.
Übung 10 – Kopfrollen
Sitzend, aber nicht angelehnt, Kopf nach vorne locker hängen lassen, den Kopf leicht nach links und rechts rollen, anschließend Kreise vollziehen, danach langsam den Kopf ausschwingen lassen und anheben – nachspüren.
6–8 x wiederholen.
Übung 11 – Händelockerung
Hände locker ausschütteln und massieren.
Übung 12 – Augenübung
Sitzend oder stehend in aufrechter Haltung, der Kopf bleibt starr, die Augen schauen nach rechts, und nach links, zwinkern, nach oben und unten bewegen, nach rechts und links rollen, Augen schließen und nachspüren.
Jede Variante 6–8 x wiederholen.
Übung 13 – Gesichtslockerungsübung
Sitzend oder stehend in aufrechter Haltung, Kiefer vorstrecken und die unteren Zähne zeigen, Kiefer vor- und zurückziehen, Kiefer vor anschließend links und rechts bewegen, runzeln und rümpfen der Nase, Heben und Senken der Augenbrauen, böse schauen, Gesicht nach oben–unten–links–rechts ziehen, Gesicht zusammenziehen, anschließend das Gesicht wieder lockern, schütteln und entspannen – nachspüren.
3.2 Schnellübungen
(5 –7 x wiederholen, anschließend nachspüren)
Übung 1
Sitzend mit aufgerichtetem Rücken, die Augen sind geschlossen und Kopf hängt locker nach vorne, durch die Nase aktiv ein- und ausatmen – nachspüren! Anschließend den Atem durch die Nase kommen und gehen lassen – nachspüren.
Übung 2
In die Hocke gehen, dabei den Rücken gerade und gestreckt aufrecht halten und leicht ins Hohlkreuz gehen – den Atem kommen und gehen lassen – langsam aufstehen – nachspüren.
Übung 3
Gleiche Übung, nur diesmal locker auf SCH den Atem ausströmen lassen, dann Mund schließen – Pause – Atem einfließen lassen – Nacken aufrecht halten – nachspüren.
Übung 4
Mit dem Zwerchfell hecheln, nur durch die Nase – wie ein schnaubendes Pferd.
Übung 5
Durch Nase einatmen, anschließend betont langsam wieder durch die Nase ausatmen, das Gleiche mit zugehaltenem rechten Nasenflügel, dann Wechsel und linke Seite zuhalten – auch im Wechsel. Ein- und Ausatmen geschehen dabei geräuschvoll.
Übung 6
Richtiges Husten: Mund aufmachen, eine Hand auf den Bauch legen und kontrollieren, wie sich der Bauch bei der Atmung durch den Mund bewegt – dann bewusst husten, der Bauch geht beim Hustgeräusch hinein – Nachspüren.
Übung 7
Schniefen: hörbar durch die Nase ein- und ausschniefen – auch einen Nasenflügel zuhalten und Wechsel.
Übung 8
Aufrechte Sitzhaltung – die Hände auf den Oberschenkel ablegen und nun über SCH beim Ausatmen leicht mit geradem Oberkörper ins Hohlkreuz gehen und dann über das Einfließenlassen des Atems wieder zurück in die Sitzhaltung – Nachspüren.
Übung 9
Ausgangsposition ist der Vierfüßerstand – leicht ins Hohlkreuz gehen und dabei einatmen, Katzenbuckel machen und dabei ausatmen – dann wieder Rücken hängen lassen und einatmen – dies nun ruckartig und aktiv, als ob Sie etwas von Ihrem Rücken abstoßen wollen. Gleiche Übung aber Abstützen auf den Unterarmen (Kopf bleibt relativ ruhig)
Übung 10
Die Nasenflügel leicht in den Grübchen oberhalb des Wulstes (Übergang vom Knochen zum Knorpel) mit je einem Finger leicht zusammendrücken und geräuschvoll ein- und ausatmen, die gleiche Übung auch mit schniefen – nachspüren.
Übung 11
Sitzhaltung, nicht anlehnen, Ober- und Unterschenkel ca. im rechten Winkel (Beine hüftbreit), Hände auf den Oberschenkel ablegen – möglichst auf Sitzdreieck (Beckenknochen) – sitzen, Rücken gerade halten, nicht ins Hohlkreuz gehen.
Übung 12
Nase- und Gesichtsmassage – Hände durch Aneinanderreiben vorwärmen, dann vorsichtig mit den Fingerspitzen das Gesicht und die Nase massieren – zum Abschluss fest mit den Handflächen das gesamte Gesicht warm reiben.
Übung 13
Gesicht- Zungenmuskulatur aktivieren – Gesicht, Mund und Augen fest zusammenziehen, wie beim bösen Schauen und wieder locker lassen – Augen stark aufreißen, dann blinzeln, schließen und öffnen, Stirn hochziehen – runzeln, Ohren wackeln, Nase rümpfen, Nüstern blähen, Mund klein zusammenziehen, groß aufreißen, übertriebenes Lächeln, Lippen spitzen, Schmollmund machen, Oberlippe abwärts ziehen, Mund passiv dehnen (mit 2 Fingern die Mundwinkel auseinanderziehen), Unterkiefer abwärts, seitwärts, rückwärts und vorwärts kreisen, Grimassieren nach freier Erfindung – Nachspüren.
Übung 14
Zungenübungen – dehnend herausstrecken, Richtung Kinn strecken, Richtung rechtes und linkes Ohr, zur Nasenspitze, herausschnellen und zurückziehen, breit zurückziehen, schnalzen, locker schlagen, lallen, nach hinten einrollen.
Übung 15
Entspannung in Rückenlage – Arme links und rechts am Boden neben dem Kopf, Strecken des linken Armes und des linken Beins während der Einatmung, Seitenwechsel rechts, dann auch in Diagonale, ganzer Körper – anschließend Arme neben den Körper legen und nachspüren – auch mit tiefem Ton beim Ausatmen.
Übung 16
In die Schrägkerze gehen – Becken mit den Händen gut abstützen – Kinn weg von der Brust – Kiefer locker und Atmung nicht behindern – Vorsichtig und langsam über das Ausatmen den Rücken abrollen – wenn der Rücken abgerollt ist, die Beine noch in der Luft lassen und langsam Kreise nach links und rechts ziehen, anschließend Füße abstellen – nachspüren – dann langsam Beine strecken – Nachspüren.
Übung 17
Stützvorgang – durch eine kleine runde Mundöffnung langsam einen Teil des Atems entweichen lassen, Lippen schließen und Luft anhalten – Mund wieder leicht öffnen und einen Teil der Luft entweichen lassen – dies so lange wiederholen, bis man keine Luft mehr hat – Pause – über Schnüffeln durch die Nase wieder einatmen und die Übung wiederholen.
Übung 18
Streckung der Gelenke – Rückenlage, rechtes Bein anwinkeln und mit der linken Hand das angewinkelte Bein zum linken Oberschenkel dehnen, gleichzeitig zieht der rechte Arm nach rechts in Schulterhöhe am Boden dagegen – langsam lösen und nachspüren – Seitenwechsel.
Übung 19
Streckung stehend oder liegend (Rücken- oder Bauchlage), Arme gehen über den Kopf, den ganzen Körper in alle Richtungen gegendehnen – anschließend lockerlassen – nachspüren.
Übung 20
Nackenbrücke: Rückenlage – Beine hüftbreit aufstellen, die Arme links und rechts neben dem Körper entspannt ablegen, nun über das Ausatmen das Becken anheben (Oberschenkel, Becken und Brust bilden eine Linie) – einige Sekunden halten, anschließend langsam ablegen.
Variationen: die gleiche Übung über das Einatmen, danach über das Ausatmen das Becken etwas abwärtsbewegen – halten und über das Einfließenlassen wieder heben, ein paarmal wiederholen, dann Becken ablegen – nachspüren.
Übung 21
Rückenlage, Beine aufgestellt, Arme hinter den Kopf legen – über das Ausatmen langsam vom Becken beginnend Wirbel für Wirbel aufrollen (Brücke machen), über das Einatmen wieder langsam zurückrollen, Becken ablegen – nachspüren.
3.3 Dehnungsübungen
(1. Phase 10–30 Sek. Dehnung, 2. Phase 10–20 Sek. Nachdehnen, 3. Phase 10–20 Sek. Lockerung und nachspüren)
Übung 1
Nacken-Halsbereich: aufrecht sitzend oder stehend, Kopf zur rechten Schulter neigen – rechte Hand greift über Kopf zum linken Ohr und zieht den Kopf zur rechten Schulter – Seitenwechsel.
Übung 2
Nackenbereich: aufrecht sitzend oder stehend, Hände hinter den Kopf verschränken, Kopf nach vorne Richtung Brustbein absenken – der Rücken bleibt dabei aufrecht, mit Armen den Kopf leicht nachdrücken Richtung Boden.
Übung 3
Rückendehnung: Haltung im Sitzen, am vorderen Drittel des Sessels, die Beine sind etwas mehr als hüftbreit geöffnet, Kopf und Rücken mit Armen nach vorne hängen lassen, die Arme kommen unter den Kniekehlen durch, die Hände werden auf den Füßen abgelegt, dabei ziehen die Arme den Oberkörper mit hängendem Kopf weit nach unten – anschließend langsam aufrollen.
Übung 4
Seitendehnung: aufrecht sitzend – rechten Arm über Kopf ausstrecken, Oberkörper und rechten Arm nach links strecken – der linke Arm geht gleichzeitig vor der Brust auf die rechte Seite, es entsteht ein Gegenzug, nach ein paar Atemzügen Position auflösen und – Seitenwechsel
3.3.1 Aktives statisches Dehnen
(1. Phase 20–30 Sek.; 2. Phase – Nachspüren)
Übung 1
Brustbereich/oberer Rückenbereich: aufrecht stehend oder sitzend (nicht anlehnen), die Arme werden in Kopfhöhe zu beiden Seiten hochgestreckt, nun ziehen die Arme bei aufrechtem Oberkörper nach hinten, dabei kein Hohlkreuz machen – anschließend lockern.
Übung 2
Brustbereich/gesamter Rückenbereich: aufrechter Sitz, beide Arme in die Höhe zur Decke strecken, die Daumen zeigen dabei nach hinten – nun ziehen beide Arme vorsichtig mit der Einatmung nach hinten, mit dem Ausatmen lockerlassen.
Übung 3