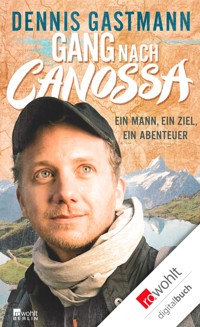9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Piratennester, verbotene Berge und versinkende Inseln – mit Dennis Gastmann auf einer einzigartigen Abenteuerreise Nach Marco Polo, Kolumbus und Vasco da Gama geht der nächste große Entdecker auf Reisen. Dennis Gastmann erkundet die letzten unentdeckten Länder dieser Welt: Akhzivland, Karakalpakstan, R'as al-Chaima – magische Orte, fern, unbekannt oder vergessen. So steuert Gastmann an Bord eines Seelenverkäufers auf Pitcairn zu, einen Felsen in der Südsee, auf dem die Nachfahren der Meuterer von der Bounty leben. Sie bitten ihn, für immer zu bleiben – es fehlt an jungen Leuten. Er wandert durch die tausendjährige Mönchsrepublik auf dem Berg Athos, in der Touristen unerwünscht sind, Frauen ein Skandal – die bärtigen heiligen Männer wollen unter sich bleiben. Gastmann taucht mit einem Rudel Haie in Palau, der weltweit ersten Haischutzzone, und sucht nach Liebe in Transnistrien, einem Mafiastaat, der Besuchern rät: «Fahren Sie lieber nach Spanien!» Er gerät in Wüstenstürme, strandet tagelang in einem Flughafenterminal und wird zum letzten Kaiser von Ladonien gekrönt ... Dennis Gastmann begibt sich auf eine Reise zu den Ausläufern unserer Zivilisation. Wie sieht es dort aus? Wie lebt man dort? Und was sagt das über den Rest unserer durchorganisierten Erde? Eine aufregende Mischung aus Douglas Adams und Herodot – und ein einzigartiges Reiseabenteuer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Dennis Gastmann
Atlas der unentdeckten Länder
Über dieses Buch
Piratennester, verbotene Berge und versinkende Inseln – mit Dennis Gastmann auf einer einzigartigen Abenteuerreise
Nach Marco Polo, Kolumbus und Vasco da Gama geht der nächste große Entdecker auf Reisen. Dennis Gastmann erkundet die letzten unentdeckten Länder dieser Welt: Akhzivland, Karakalpakstan, R’as al-Chaima – magische Orte, fern, unbekannt oder vergessen. So steuert Gastmann an Bord eines Seelenverkäufers auf Pitcairn zu, einen Felsen in der Südsee, auf dem die Nachfahren der Meuterer von der Bounty leben. Sie bitten ihn, für immer zu bleiben – es fehlt an jungen Leuten. Er wandert durch die tausendjährige Mönchsrepublik auf dem Berg Athos, in der Touristen unerwünscht sind, Frauen ein Skandal – die bärtigen heiligen Männer wollen unter sich bleiben. Gastmann taucht mit einem Rudel Haie in Palau, der weltweit ersten Haischutzzone, und sucht nach Liebe in Transnistrien, einem Mafiastaat, der Besuchern rät: «Fahren Sie lieber nach Spanien!» Er gerät in Wüstenstürme, strandet tagelang in einem Flughafenterminal und wird zum letzten Kaiser von Ladonien gekrönt ...
Dennis Gastmann begibt sich auf eine Reise zu den Ausläufern unserer Zivilisation. Wie sieht es dort aus? Wie lebt man dort? Und was sagt das über den Rest unserer durchorganisierten Erde? Eine aufregende Mischung aus Douglas Adams und Herodot – und ein einzigartiges Reiseabenteuer.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, August 2017
Copyright © 2016 by Rowohlt·Berlin Verlag GmbH, Berlin
Illustrationen Harry Jürgens
Umschlaggestaltung Frank Ortmann
Umschlagabbildung Antar Dayal, De Agostini Library, Tetra Images/Getty Images; Extezy/shutterstock.com
ISBN 978-3-644-12171-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Illustration 1
Widmung
Ritt auf dem Wal
Meuterei und Mai Tai
Der auf dem Wasser treibende Berg
Paradieskinder
Oktober und die verschwundenen Fische
Der Staat bin ich
Sucht dich der Dschinn, so salze dein Bett
Krieger und Könige
Ferien im Phantomstaat
Ungeheuer der See
Der geheime Garten
Illustration 2
Für meinen Großonkel, der sein kleines Land mit einem Lächeln regierte
Ritt auf dem Wal
Irgendwo in der Südsee
«This is a nasty piece of water», knurrte Nigel, als wir Mangareva verließen und der Wind jäh von Backbord blies, «jetzt reiten wir den Wal.» Der Abend schmeckte nach Diesel, Messer und Gabeln klirrten über das Deck, und die Claymore legte sich so verflucht auf die Seite, dass uns war, als könnten wir durch ihre Luken direkt in den Schlund der Ungetüme blicken, die in den Wogen lauerten. Allein darum bemüht, die Mahlzeit bei uns zu behalten, klammerten wir uns mit Händen und Füßen an den Esstisch. Und Nigel? Er saß da wie ein Buddha, nur mit einem Handtuch bekleidet, wischte sich Reste aus dem Bart und erzählte von dem Berber, der sich auf einer Antarktis-Expedition selbst den Blinddarm entfernte.
Manchmal frage ich mich, zu welcher Spezies der Reeder gehörte. War Nigel wirklich für ein Leben an Land geschaffen? Oder musste man ihn zu den Seewesen zählen, weil Meerwasser in seinen Pupillen schwappte? Die Furchen in seinem Gesicht – Zeichen des Alters oder Spuren der Kämpfe mit Netzen und Harpunen – verrieten viel über einen Mann, der schon jedes Gefühl erlebt hatte, das Mensch und Tier kannten. Bis auf eines.
Niemand außer Nigel wagte die Passage: Das Ziel unserer Reise lag dort, wo Götter und Dämonen ungestört bleiben wollen. Wir steuerten auf eine Insel an den fernen Ausläufern unserer Zivilisation zu, einen Felsen, der so weit von allen Erdteilen liegt, dass es absurd wäre, ihn irgendeinem Kontinent zuzuordnen. Dort, so sagen Schwärmer, ziemlich genau in der Mitte des Pazifischen Ozeans, werden die Träume der Menschheit geboren. Und dort, so sagen Spötter, werden sie auch wieder begraben. Es ist der entlegenste Ort auf dem Globus. Die Mutter aller unentdeckten Länder. Wer noch weiter reisen will, muss in eine Mondrakete steigen.
Vor den halbblinden Fenstern der Claymore, die im Seitenwind ächzte und aufjaulte wie eine sterbende Kreatur, wechselten Himmel und Wasser im Takt weniger Sekunden, so sehr wand sich der kleine Frachter in den Wellen. Auf den Horizont zu blicken soll das beste Mittel gegen Seekrankheit sein, doch was, wenn er wie ein Pendel durch das Sichtfeld schwingt?
Unter den Passagieren war keine glückliche Seele mehr. Nur Nigel lächelte ab und an, und verzog sich seine Miene sogar zu einem Lachen, dann funkelte und blitzte es im Schein der Neonröhren. Sein Boot ist für gerade ein Dutzend Gäste ausgelegt, aber hätte er sich je an Regeln gehalten, er hätte sich niemals beide Zahnreihen vergolden lassen können.
Zweiundzwanzig Frauen und Männer hatte er an Bord genommen, fast doppelt so viel, wie ihm erlaubt war, und obwohl wir uns zwängten, quetschten und drängten, verlangte er den vollen Preis – fünftausend Dollar für die Überfahrt auf einem Kahn, der sich leidlich über Wasser hielt. Dafür hätte jeder von uns einen ganzen Monat quer durch die Karibik kreuzen können, Champagnerpyramide und Lavakuchen inklusive. Wir hätten zehn Pfund zugenommen, mit betuchten Witwen, Gentlemen Hosts und anderen Scheintoten «Bingo!» gerufen, wären nach der Polonaise, sieben Planter’s Punch und einer zweifelhaften Cats-Interpretation auf dem Shuffleboard ausgerutscht und zur Krönung der Nacht in unseren geliehenen Smokings arschlings in den frisch gechlorten Kinderpool gestürzt. Es hätten vier wundervolle Wochen werden können.
Stattdessen bekamen wir eine fensterlose Kabine, die wir uns mit Fremden teilten, einen Eimer, den wir uns ebenfalls mit Fremden teilten, und pünktlich zum Morgengrauen weckte uns längst Verflossenes, das in den Waschbecken der Räume aufstieg und sich auf den Teppich ergoss. Das einzige Abendentertainment bescherte der Schiffskoch, wenn er versuchte zu servieren. Sobald die Claymore in ein Tal fiel, hastete er herbei, um einen Teller Suppe abzusetzen, bevor uns die nächste Welle erwischte. Die Kunst bestand darin, See- und Suppengang so zu synchronisieren, dass man a) nichts verschüttete und b) sich nicht den Hals brach. Manchmal allerdings erreichte er unseren Tisch nicht rechtzeitig, und Neptun schleuderte den armen Kerl mit vollen Tellern zurück in die Kombüse.
Das amüsierte besonders die drei mit den Nikons und den auberginefarbenen Fleecejacken, die eigentlich zu viert waren. Andy, der Hagerste von allen, hatte nur einen eiligen Blick auf seine Mahlzeit geworfen, sich danach genauso eilig in seine Koje verzogen und dabei nicht den Anschein erweckt, als würde man ihn heute noch wiedersehen. Die drei lustigen vier sahen aus wie britische Ornithologen.
«Wir sind britische Ornithologen», sagte Sarah, die einzige Lady zwischen Andy, Neil und Paul, und natürlich war das eine Lüge. Jeder von ihnen hätte abgestritten, dass er in Wirklichkeit einer international operierenden Spezialeinheit angehörte. Sarah war die Späherin. Tagsüber, wenn uns Delfine und fliegende Fische begleiteten, verbarg sie sich im Schatten eines Kühlaggregats auf dem Achterdeck und nahm Fregattvögel ins Visier, die hungrig über dem Gischtwasser segelten. Entweder waren diese Geschöpfe lebensmüde oder vom Glück behütet. Obwohl sie mit ihren verkürzten Beinen und den grotesken, übergroßen Schwingen niemals hätten schwimmen können, jagten sie über dem offenen Meer, Hunderte Kilometer fernab jeden Festlands, ohne von der See gefangen und verschluckt zu werden.
Neil saß in der Mannschaftsmesse, las Henry Miller und ließ die Zeit vergehen. Er war auf vielen Schiffen gereist. «Ich besitze nichts, was nicht in einen Rucksack passt», sagte er von sich selbst, und auch eine Familie kann man leider nicht auf dem Rücken tragen. So seien seine letzten vier Freundinnen «Teil seiner Projekte» gewesen, Kolleginnen mit gewissen Vorzügen, mehr nicht. Er gab vor, ein harmloser Inselbiologe zu sein, und wollte als solcher gerade das Ökosystem von Tristan da Cunha studiert haben, der Spitze eines Vulkans im Atlantik, auf der eine Minute Überseegespräch ein Monatsgehalt koste.
Tatsächlich war Neil ein Richter über Leben und Tod. Wenn er eine Insel betrat, folgten ihm Stille und Dunkelheit. Dann dauerte es wenige Tage, bis er darüber entschied, welchem Tier zuerst das Schlaflied gesungen werden sollte. Den Mäusen? Den Ratten? Den Kaninchen? Manchmal beschloss er, alle gleichzeitig liquidieren zu lassen, und es war Zeit für Paul, den Vollstrecker. Wenn die Nager deine Insel überrennen, wenn sie Nester zerwühlen und Eier stehlen, und wenn du dich nicht mehr an das letzte Quaken einer Augenbrauenente oder den Ruf eines Pazifischen Goldregenpfeifers erinnern kannst, then you better call Paul.
Bis dahin dachte ich, Missionare und Kolonialherren hätten die Biester eingeschleppt, weil kein Schiff ohne Ratten ist, auch nicht die Claymore. Doch Paul glaubte nicht an blinde Passagiere. Polynesische Seefahrer hätten sie mitgebracht und freigelassen, als sie die Inseln erkundeten.
«Weißt du, Ratten sind die perfekte Mahlzeit für den Notfall. Du setzt sie einmal aus und hast immer einen Snack.»
«Und wie erledigst du sie?», fragte ich.
«Das ist nicht so leicht. Mäuse sind schwerer totzukriegen als Ratten, weil sie kleiner sind, und Kaninchen sind schwerer zu killen als Mäuse, weil sie sich tiefer eingraben. Mal bringe ich Katzen mit, um die Ratten loszuwerden, und dann bringe ich Hunde mit, um die Katzen loszuwerden.»
«Und wie wirst du die Hunde wieder los?»
«Gar nicht, aber was ist dir lieber: Hund oder Ratte?»
Ein Hund reiste auch auf der Claymore. Allerdings kein richtiger, der bellt und beißt und Katzen frisst. Murphy, wie ihn Stella, sein Frauchen, rief, war ein nackter, schlotternder Strich von einem Lebewesen, das den Schwanz einzog und wohl an Morbus Basedow litt – es schien, als könnten seine Augäpfel jeden Moment aus ihren Höhlen ploppen. Sie saßen wie Tischtennisbälle auf dem schmalen Hundeköpfchen, das in seiner liebenswerten Komik an die Simpsons erinnerte.
Stella, die ähnlich aussah, war mit ihm schon dreimal um die Welt gereist, auch wenn Murphy wohl lieber zu Hause geblieben wäre. Der arme Kerl hatte sein halbes Leben in Transportboxen, Frachträumen und Quarantänestationen verbracht, und wenn man ihn endlich in die Freiheit entließ, auf Galapagos oder den Weihnachtsinseln, schnappten Riesenkrabben nach seinen Beinchen, und Drachen erschreckten sein Hasenherz. Stella entführte ihn sogar in ein kantonesisches Toilettenrestaurant, wo sie Geld dafür bezahlte, Nudelsuppe aus einer Kloschlüssel schlürfen zu dürfen, und natürlich hatte sie nicht versäumt, all diese bedeutenden Momente der Zeitgeschichte für die Ewigkeit festzuhalten.
«Ihr müsst wissen, dass mein Murphy kein gewöhnlicher Hund ist», piepste Stella. «Immer wenn mein Insulinspiegel sinkt, wirft er mir einen besorgten Blick zu.»
Ich sah hinunter zu Murphy. Er warf mir einen besorgten Blick zu. Genauer gesagt, warf er allen besorgte Blicke zu, seit wir den Hafen verlassen hatten. Entweder breitete sich mit der See- auch die Zuckerkrankheit an Bord aus, oder der gute Murphy war doch nur ein gewöhnlicher Windhundmischling, der sich berechtigte Sorgen um die Claymore machte, die jetzt in den Wellen rollte und dabei so knarzte, als werde sie noch vor dem Dessert auseinanderbrechen.
Der alte Seelenverkäufer war eindeutig überladen. Er hing bedenklich tief im Wasser und schien sich durchzubiegen unter all der Fracht, die er auf die Insel brachte. Über die Kisten und Fässer, die mit Seilen im Bug verzurrt waren, ragte ein gewaltiger, rostender Arm. Der ehemalige Tonnenleger war dreißig Jahre lang unter dem Namen «Konrad Meisel» gefahren, ausgerechnet über den Fluss, der sich durch Hamburg, meine Heimatstadt, windet. Danach hatte er mehrfach den Besitzer gewechselt. Er reiste als «Isibane» um das Kap der Guten Hoffnung und landete schließlich in den Händen eines Söldners aus Tauranga, Neuseeland, der ihn nach einem schottischen Langschwert benannte und nicht zu fragen schien, was er transportierte, sondern nur, wohin.
Erwähnte ich bereits, dass wir unseren Ritt mit einer Woche Verspätung angetreten hatten? Nigel zögerte, die Goldzähne tanzen zu lassen, aber dann beichtete er uns doch, welches bedauerliche Malheur ihm auf der Anreise passiert war. Nach drei Tagen Fahrt hatte das Ruder der Claymore ausgesetzt. Schlagartig. Mitten im Ozean. Und wie steuert man, wenn man nicht steuern kann? Ganz unten, tief im Bauch des Wals, soll es eine enge, nach Schweröl stinkende Zelle mit einem Stuhl, einem Kompass und einem Rad geben, das sich nur mit einiger Muskelkraft bewegen lässt. Während also der erste Offizier bei markerschütterndem Lärm versuchte, die Magnetnadel halbwegs auf Kurs zu halten, musste der Koch seinen Kopf aus einem Bullauge strecken und noch markerschütternder schreien, wenn eine Korallenbank, ein Atoll oder ein Tanker vor dem Rumpf auftauchte.
Ich sah hinunter zu Murphy. Er warf mir einen besorgten Blick zu.
«Don’t listen to this Dog-Girl, she’s mental», sagte Zoran, der nicht einmal zu flüstern versuchte, und stellte mir eine durchaus überraschende Frage: «Magst du Katzen?»
«Hast du eben ‹Katzen› gesagt?»
«Ob du Katzen magst.»
Noch bevor ich antworten konnte (gottlob, denn ich hasse Katzen), hielt mir Zoran sein Smartphone unter die Nase und zeigte mir ein Video, in dem er sich mit Löwen und Tigern auf dem englischen Rasen seines schneeweißen Châteaus räkelte. Wie sich herausstellte, war er ein slowakischer Millionär, der zwar in einem eigenen, mit Totenschädeln dekorierten Jet zu reisen pflegte und einen Privatzoo voller menschenfressender Bestien unterhielt, sich ansonsten aber eine gesunde Bescheidenheit bewahrt hatte. «Ich bin Anwalt», sagte Zoran, «und ich habe ein paar Aktien. Aber lass uns über interessantere Dinge sprechen.»
Wenn Zoran nicht gerade der häuslichen Tierliebe frönte, ließ er sich gerne mal vor abgeschossenen Frachtmaschinen in Puntland, Somalia, fotografieren. Ein Piratennest, das man besser nur bis an die Zähne bewaffnet im militärischen Konvoi bereist. Nicht ohne Stolz präsentierte er mir auch seine Urlaubserinnerungen an Dschidda, Saudi-Arabien, wo er einer öffentlichen Enthauptung beiwohnen durfte. Die Hintergründe seiner Schnappschüsse wechselten, der Vordergrund aber blieb immer derselbe: Haarloses Kraftpaket im Sportdress versucht, so wenig Freude zu zeigen, wie es einem Menschen nur möglich ist.
Zoran, dem, wie ich später erfuhr, eine gewisse Nähe zur Osteuropamafia nachgesagt wird, hatte sich vorgenommen, der größte Traveller aller Zeiten zu werden. Er war es leid, sich in einer Kolonne um die Sagrada Família schieben zu müssen oder eine Münze über tausend Köpfe in den Trevi-Brunnen zu werfen, und ich war es auch. Wir suchten das Unbekannte: verborgene Königreiche, verbotene Berge, ferne, vergessene, magische Orte. Natürlich wussten wir, dass alle Länder dieser Welt längst entdeckt worden waren. Wir wussten aber auch, wie unerreichbar manche von ihnen schienen, trotz der Geschwindigkeit, mit der das moderne Leben um den Erdball jagt. So wie die tausendjährige Mönchsrepublik Athos, in der männliche Besucher unerwünscht sind und kein weiblicher Fuß den heiligen Boden berühren darf. Und wir wussten, dass immer wieder neue Staaten entstehen – autonome Republiken wie Karakalpakstan, Mikronationen wie Ladonien oder abtrünnige Regionen wie Transnistrien, deren Schicksal im Nebel der Ungewissheit liegt.
Mit Hilfe seines Entdeckergeistes und seines beneidenswert bezahlten Agenten hatte es Zoran vor kurzem auf die Spratly Islands geschafft, einen Archipel im Südchinesischen Meer, der gleichzeitig von Brunei, China, Malaysia, Taiwan, Vietnam und den Philippinen beansprucht wird. Zweihundertsechzig Länder habe er bereits gesehen, berichtete mein finanzkräftiger Kumpan, und angeblich fehlten ihm nur noch Nordossetien, Südossetien und eben jene Insel, von der ich erzählen werde, wenn es so weit ist.
«Excuse me, Sir, but this is nonsense. Es gibt auf diesem Planeten nur einhundertdreiundneunzig Länder», mischte sich Lak ein und spielte damit auf die Mitglieder der Vereinten Nationen an. «Glaub dem Russen kein Wort.»
«Ich bin kein Russe», feuerte Zoran zurück.
«Du siehst aber wie einer aus.»
Dummerweise hatte sich Lak, ebenfalls Millionär, ebenfalls vorgenommen, der größte Traveller aller Zeiten zu werden, und deshalb war es bei Lak und Zoran, die sich noch dazu eine Kabine teilen mussten, Hass auf den ersten Handshake. Lak nannte Zoran «den Russen», und Zoran nannte Lak «den Inder», obwohl Zoran aus Bratislava und Lak aus Chicago kam. Die beiden waren sich einfach zu ähnlich. Nur dass Zoran tatsächlich wie ein Russe und Lak tatsächlich wie ein Inder aussah. Laks Vater war aus Karatschi.
Ihre Art zu reisen unterschied sich jedoch ganz erheblich. Während sich Zoran auf eine morbide Weise durchaus für die Kultur eines Landes interessierte, war es Laks einzige Maxime, mindestens fünfunddreißig Staatsgrenzen jährlich zu überschreiten – einreisen, stempeln, ausreisen. In manchen Staaten hatte er nicht mal eine Stunde verbracht.
«Und genau deshalb ist dieser Inder auch kein Traveller», fluchte Zoran.
«Ich bin Amerikaner.»
«Du bist ein Witz. Dann verrat uns doch mal, wo es dir am besten gefallen hat!»
«In Deutschland.»
«Deutschland? Wie lange warst du da? Zehn Minuten? Was ist mit São Tomé und Príncipe?»
«Langweilig.
«Wallis und Futuna?»
«Um Gottes willen. Kann es sein, dass es auf Futuna nur ein einziges Hotel gibt?»
«Das Fia-Fia in Leava. Was ist mit Nauru?»
«Meint ihr diese Insel, auf der die dicksten Menschen der Erde leben?», mischte sich Stella ein.
«Ein Hoch auf die Republik der Fettleibigen!», rief Zoran und hob sein Glas. «Nauru war der reichste Staat der Welt, als man dort noch Phosphat abgebaut hat, diesen prähistorischen Vogelmist. Jetzt ist die Scheiße verkauft und das Land im Arsch.»
«Brillant!», applaudierte Lak. «Treffender hätte ich es nicht formulieren können.»
«Also was jetzt, Gandhi, warst du schon mal auf Nauru oder nicht?»
«Da bin ich nächsten Monat, du verdammter Kanisterkopf.»
Ich sah hinunter zu Murphy. Er warf mir einen besorgten Blick zu. Genau in dieser Minute erwischte uns ein Brecher, der alles hinfortnahm: die Bananen, den Thunfisch, Stella, Zoran und zuallererst Lak, der meinte, seine Lederslipper seien für die rutschigen Böden eine ausgezeichnete Wahl. Als sich die Claymore wieder aufrichtete, krochen die meisten Passagiere in ihre Kojen, und Murphy rollte sich zwischen ein paar Töpfen mit Erdbeerpflanzen zusammen, die zur Fracht gehörten. Nigel sah noch auf der Brücke vorbei und wechselte ein Wort mit dem Maori-Kapitän, um sich dann im Doppelbett seiner Suite auszustrecken, die er nur mit drei Zentnersäcken Gemüsezwiebeln teilen musste.
Und ich? Als sich die See beruhigte, kletterte ich an Deck und war allein mit den Sternen und einem silbernen Vollmond, dessen Licht die Wasser beschien und uns sanft den Weg zu den letzten Abenteuern wies, die man unserer Tage noch erleben kann. Manch einer mochte behaupten, dass alle Reisenden auf der Claymore wahnsinnig waren, und ich würde nicht widersprechen. Doch vielleicht einte uns noch etwas anderes: Jeder, ob Russe oder Inder, Dichter oder Seemann, Hundefrau oder Vogelfreund, wünschte sich nichts mehr, als frei zu sein. Von Herzen frei wie der erste Maat, der davon träumte, eines Tages mit seiner Liebe auf einer Segelyacht zu leben. Frei wie mein Kabinennachbar, der sich scheiden ließ, seinen Job kündigte und sein Haus verkaufte, um auf dem Rücken eines Wals zu reiten. Frei wie das Meer auf einer kreisenden blauen Kugel, die der liebe Gott zwischen all die Lampions dort oben im Nachthimmel gehängt hatte.
Meuterei und Mai Tai
In der Lagune
Alles begann mit einer Meuterei. Meiner Meuterei. Ich war nach Tahiti geflogen und hatte mir ein Zimmer genommen, in dessen Garten Orchideen und Bougainvilleen in allen Facetten des Regenbogens wuchsen, jenes Buschwerk, das man bei uns unter dem Namen Wunderblume kennt. Morgens aß ich Bananenkuchen und Passionsfrucht, mittags Krebsfleisch, Yams und Maniok, und abends verwöhnte mich die Südsee mit Taro, Guaven und Crevetten, die nach Kokos und Vanille dufteten.
Die offene Hand der Polynesier würde den Teufel zu Tränen rühren. Sie reichen dir die wahnwitzigsten Teller und sehen mit der Freude eines Kindes dabei zu, wie du an ihnen scheiterst. Dann entschuldigen sie sich für die Größe der Portion und eilen in die Küche, um glucksend mit dem nächsten unüberwindlichen Gang zurückzukehren: schneebedeckte Eiskrem, die auf dem Löffel blaurot schimmert und unter der Zunge nach Sehnsucht schmeckt.
Auf Tahiti lernte ich, die Pflicht zu vergessen. Ich vergaß, zu reisen und zu schreiben, und konnte mir bald nicht mehr vorstellen, diesen Ort der Liebe jemals wieder zu verlassen. Auch die Erinnerung an meinen Plan verblasste allmählich. Eigentlich hatte ich vor, nach wenigen Tagen zu verschwinden, in eine Maschine zu steigen und auf die Gambierinseln zu fliegen – ein Archipel, der den poetischen Namen «Rand der Welt» trägt, weil er zwanzigtausend Meilen jenseits unserer Vorstellungskraft liegt. Im Hafen von Mangareva sollte die Claymore warten und mich weit nach Osten tragen, wo ich Fuß auf sagenumwobenen Grund setzen wollte: Mein Ziel war Pitcairn Island, die unentdeckte Heimat der Meuterer der Bounty. Wenn die Zeitungsberichte stimmten, dann lebten dort noch immer drei Dutzend Nachfahren der legendären Seefahrer, die ihren Kapitän über Bord jagten, davonsegelten und in der selbstgewählten Verbannung eine neue Zivilisation gründeten.
Es hieß, wer es nach Pitcairn schaffe und sich entschließe, für immer zu bleiben, dem würden die Meuterer ein Haus bauen, einen Acker bestellen und ein neues Leben schenken. Ein Leben ohne Welt und ohne Winter, irgendwo zwischen Neuseeland und Chile, so dachte meine romantische Seite. Eine andere dagegen sprach: «Hör zu, mein Freund, du bist auf Tahiti, wo reife Mangos von den Bäumen fallen, und erzählst mir von einer Pirateninsel voller Inzestgesichter, die keine Bar und keinen Puff betreiben können, aber scharf auf frisches Blut sind?» Und so hörte ich auf meine Dämonen und meuterte. Nur ein einziges Mal noch dachte ich an meinen Job und versuchte mich an einer Recherche.
«Was kann man denn hier machen?», fragte ich Puaiti, die ein korallenschimmerndes Sommerkleid trug und mir Früchte in einer halbierten, ausgehöhlten Ananas servierte. Puaiti bedeutet «kleine Blume», und so hatte sie sich an diesem Morgen eine weiße Tiaréblüte hinter das linke Ohr gesteckt und lange, frangipanigelbe Bänder ins Haar geflochten, die im Südseewind über ihren makellosen braunen Rücken spielten.
«Monsieur, Sie könnten eine Vulkan-Tour mit Safari-Bussen buchen. Vielen Touristen gefällt das. Oder Sie gehen an den Strand.»
«Vielleicht würde ich gerne in die nächste Stadt fahren.»
«Es gibt keine nächste Stadt. Es gibt eine Straße und ab und zu einen Shop. Und zweihundert Meter die Straße runter gibt es einen Strand.»
«Was ist mit Papeete?»
«Bon, wenn Sie hundert Dollar übrig haben, finden Sie sicher einen Taxifahrer, der Sie in die Hauptstadt bringt. Der Strand ist um die Ecke und kostet nichts.»
«Gibt es keinen Bus?»
«Oui bien sûr, der kostet nur zwei Dollar. Auf dem Weg zurück sagen Sie dem Fahrer, dass er Sie bei Kilometer achtzehn absetzt. Achtzehn Kilometer südlich von Papeete, das ist unsere Adresse. Aber wahrscheinlich wird er Sie nicht verstehen, und Sie landen irgendwo», seufzte sie und legte ihr Servierbrett ein wenig erschöpft auf der Veranda ab. «Oder Sie gehen an den Strand.»
Puaiti verschwand für einen Moment und breitete dann einen Prospekt vor mir aus. Es war ein Katalog der Verzichtbarkeiten. Voilà: In Papeete hätte ich ein Fresko bewundern können, das die Meuterei auf der Bounty meisterhaft in Szene setzt. Und in Arue, ein paar Kilometer weiter, steht noch immer die Villa, in der die Schriftstellerfreunde James N. Hall und Charles B. Nordhoff einen großartigen Stoff in einen fabelhaften Roman verwandelten. Stilvoll, keine Frage, dunkles Holz, zwanziger Jahre, das Meer ist nicht weit, Hemingway hätte es geliebt.
Dennoch ging ich an den Strand, und dort blieb ich auch, und hätte die Abenteuerlust nicht irgendwann gesiegt, ich würde noch heute dort liegen und wie stoned auf die Lagune starren. Je länger ich hinsah, mag es am Jetlag oder an der weißen Magie der Tropen gelegen haben, umso mehr liefen die Farben des Himmels über den Ozean und seine Riffe direkt in meine Seele. Einmal, ich lüge nicht, weckte mich das spitze Kichern dreier Mädchen, die barbusig in der Brandung badeten, und mir war, als würden sie von Zeit zu Zeit heimlich zu mir herüberschauen. Manche von ihnen trugen Blumenkränze im Haar.
Mit dieser wundervollen Szene aus einem schlechten Drehbuch schlummerte ich selig wieder ein. Was hätte ich tun sollen? Es war höhere Gewalt. Marlon Brando erging es genauso, als er Fuß auf diesen Sand setzte. Eigentlich sollte er den Seemann Fletcher Christian in der Meuterei auf der Bounty spielen. Das tat er auch, doch vor allem schwängerte er seine Filmpartnerin, kaufte ein Atoll, ließ sich das Gesäß tätowieren und gab sich so lange hemmungslos der Inselliebe hin, bis er sich auch figurlich in einen Polynesier verwandelt hatte.
Wer den Zauber von Tahiti erlebt hat, fragt nicht mehr, wie sich eine ausgemergelte, über Wochen und Monate gepeinigte Besatzung so verlieren konnte. Warum sie rebellierte, als es wieder Pökelfleisch und Peitschenhiebe gab und daumenlange rote Würmer aus dem Käse lugten. Und wieso die Männer ihren Kapitän auf hoher See in einer Nussschale aussetzten: Möge das sadistische Schwein verdursten, verhungern oder wenigstens elendig ersaufen.
Im Grunde war William Bligh, der cholerische Kapitän der Bounty, ein überforderter CEO. Einer von denen, die so lange nach oben gelobt wurden, bis sie hilflos mit den Armen rudernd von ihrem hohen Posten in den Abgrund blicken und nur noch versuchen, eigene Fehler durch die Fehler anderer zu kaschieren. Es ist kein Geheimnis, dass in Chefsesseln erstaunlich oft Psychopathen sitzen. Das war so und wird auch immer so sein. Und was unterscheidet den Psychopathen von anderen Menschen? Positiv: Er kann führen und kennt keine Angst. Negativ: Er kennt keine Empathie und kann seine Untergebenen mitleidlos ins Verderben lotsen.
Vielleicht haderte Bligh mit seinem Auftrag. Vielleicht hatte er sich das Kommando über eine Fregatte erhofft. Stattdessen vertraute ihm die britische Admiralität ein schwerfälliges schwimmendes Gewächshaus an, das im Marineregister als Kutter gelistet war. Unter dem Hauptdeck versteckte sich ein gut belüfteter Zwischenboden, in dem sechshundertneunundzwanzig Tontöpfe auf eine sensible Fracht warteten. Die Bounty sollte nach Tahiti segeln und dort Stecklinge eines wundersamen Baumes auflesen, der im Schutze seiner Blätter Brot gedeihen ließ. Die Pflanze galt als äußerst empfindlich und pflegebedürftig. Würde es gelingen, sie auf die Westindischen Inseln zu bringen und dort heimisch zu machen, so hätte man eine so reichhaltige wie preiswerte Nahrung für die Sklaven auf den Baumwollplantagen gewonnen.
Doch wie gelangt man von Portsmouth nach Papeete? Bligh hatte zwei Optionen, genau wie ich. Wir beide hätten in westlicher oder in östlicher Richtung um den Globus reisen können, wir beide entschieden uns für den weitaus kürzeren Weg, und wir beide scheiterten an ihm. Ich wollte über New York und Los Angeles fliegen, doch der Preis für das Ticket hätte mich ruiniert. Also legte ich nur halb so viel Dollar auf den Schalter und flog über Dubai, Singapur, Sydney und Wellington einer Insel aus Vulkanen entgegen, die spitz aus den Wolken ragten, um nach vierzig Stunden wie ein Zombie aus dem Aéroport international Tahiti Faa’a zu wanken. Ein Zombie mit einem Blumenkranz um den Hals.
Auf dem Weg gen Westen kämpfte Bligh einen geschlagenen Monat mit den Eisstürmen vor Kap Hoorn. Selbst der Teufel würde hier erfrieren, hat Charles Darwin einmal geschrieben. Schließlich gab Bligh auf und nahm Kurs auf das Kap der Guten Hoffnung. Weil er so gottverdammt viel Zeit verloren hatte, tat er nun alles, um wieder aufzuholen. Von Eifer zerfressen, trieb er seine Männer an, ließ sie halb verhungern, und wer nicht spurte, bekam die gefürchtete neunschwänzige Katze zu spüren. Eine Peitsche, die an ihren Enden mit Lederknoten versehen war und so tief ins Fleisch schnitt, dass es nach zwei Dutzend Schlägen in Fetzen vom Rücken hing.
Als die Bounty endlich ihr Ziel erreicht hatte, musste David Nelson, der Botaniker, feststellen, dass sich die Brotfruchtbäume in einer Ruhephase befanden und es Monate dauern würde, bis er seine Stecklinge ziehen konnte. Die Seeleute waren darüber nicht allzu traurig. Sie ergingen sich in einer endlosen Orgie aus Rum und Schokoladenmädchen, und als der Schiffsarzt an seiner Trunksucht verstarb, war es um die Disziplin der Mannschaft endgültig geschehen. Nach einem halben Jahr wollte Bligh wieder in See stechen, aber die Männer hatten andere Pläne. So endete der Kapitän mit seinen letzten Getreuen in einer sieben Meter langen und zwei Meter breiten Barkasse, ohne eine Seekarte und ohne jede Hoffnung, Game Over für den Menschenschinder.
Doch unterschätze keinen Psychopathen. Nur mit einem Kompass, einer Taschenuhr und seinen Rachegelüsten ausgerüstet, führte Bligh das Boot in die niederländische Faktorei Kupang auf Timor – sechstausend Kilometer von der Stelle entfernt, an der man ihn seinem Schicksal überlassen hatte. Über Batavia und Kapstadt kehrte er schließlich nach England zurück, die Krone erklärte ihn zum Nationalhelden und entsandte die Pandora, ein Kriegsschiff mit hundertsechzig Mann und zwei Dutzend Kanonen, um die Bounty und ihre Besatzung zu jagen.
Und was taten unsere Freunde, die Meuterer? Kaum waren sie den alten Bluthund los, nahmen sie wieder Kurs auf die Sehnsuchtsinsel, wo sich ihre Wege für immer trennten. Denjenigen, die sich entschieden, auf Tahiti zu bleiben, erging es wie den zehn kleinen Negerlein. Zwei meuchelten sich gegenseitig. Alle anderen drängten sich bald in einer eisernen Büchse auf dem Achterdeck der Pandora und lernten auf die harte Tour, was schlechtes Karma bedeutet. Auf der Rückfahrt nach Großbritannien zerschellte die Fregatte an einem Riff, und vier weitere arme Seelen sanken mit angstgeweiteten Augen auf den Grund des Ozeans. Den Überlebenden wurde der Prozess gemacht. Vier sprach man frei, drei verfaulten in einer Zelle, und ein jämmerliches letztes Trio baumelte am 29. Oktober 1792 an einer Rah im Hafen von Portsmouth. Stundenlang ließ man die Männer dort hängen.
Dieses Bild gab mir zu denken, als ich einen Mai Tai im Schatten der Kokospalmen trank und den Blumenmädchen in der Lagune winkte. Nur die echten Abenteurer kamen davon. Sie nahmen ihre polynesischen Geliebten an Bord, ließen die Insel hinter sich und verschwanden in einem Fleck auf der Weltkarte, der noch weiß und unschuldig war. Adieu, Tahiti, bonjour, liberté.
Der auf dem Wasser treibende Berg
Am Rand der Welt
Ich fand mich in der Propellermaschine einer Airline wieder, die in Französisch-Polynesien «Air Maybe» genannt wird. «Maybe», weil sie nur vielleicht ankommt, und wenn, dann immer zu spät. Es herrschte freie Platzwahl, und so war ich in einer Traube aus Armen, Beinen, Schachteln, Taschen und Koffern auf das Flugzeug zugehastet und hatte, obwohl ich es als Letzter betrat, einen Doppelsitz erbeutet.
«Monsieur, bedaure, Sie dürfen hier nicht Platz nehmen!», wies mich der Steward zurecht. «Sie bringen die Maschine aus dem Gleichgewicht.» Während ich wehmütig an die letzten Mahlzeiten auf Tahiti dachte, führte er mich neben einen tätowierten Bandanaträger, der sich Kickboxvideos auf dem Laptop ansah. Seine Arme waren so breit wie meine Oberschenkel.
Seltsamerweise schienen alle Passagiere Kickboxer, Cagefighter oder Wrestlinglegenden zu sein. Narbengesichter mit Irokesenschnitten, Goldketten, Schlangenlederstiefeln und Koksaugen. Ich fühlte mich irgendwie underdressed, und noch etwas bereitete mir Sorgen: Am Boden hatte es keinen Sicherheitscheck gegeben. Niemand wollte mein Handgepäck durchleuchten. Die Cockpittür stand während des Flugs weit offen, und der Pilot genoss seine ausgedehnten Spaziergänge an die Bar. Ich beruhigte mich damit, aus dem Fenster zu schauen und einer großen rostigen Schraube dabei zuzusehen, wie sie den Wind über dem Pazifischen Ozean quirlte. Als ich wieder aufblickte, hatten sich meine Mitreisenden Lesebrillen aufgesetzt und Pullis übergestreift. Andere bliesen Luft in ihre achtsam gefalteten Nackenkissen, die sie aus kleinen Necessaires gefischt hatten. Sie kuschelten ihre Füße in Reisesöckchen und schlossen friedlich die Lider.
Auf unserem Weg an den Rand der Welt überquerten wir anderthalbtausend Kilometer Blau, nichts als Blau, nur ein einziges Mal erschien etwas unter uns, das in anderen Farben schimmerte. Es war ein unwirkliches Dreieck aus Puderzucker, das hauchzart über dem türkis leuchtenden Uferwasser schwebte. Darüber hingen Wolken, die irgendjemand mit transparenten Fäden an die Palmkronen geknüpft hatte. Während es vorüberzog wie eine Sinnestäuschung, fragte ich mich, ob es dort unten Leben gab und, wenn ja, wie lange noch. Mit jeder Zigarette, die man an einer Kerze entzündet, stirbt ein Seemann. Und mit jedem Motor, den man startet, versinkt ein Südseetraum.
Als die Passagiere erwachten, rutschten sie unruhig hin und her. Wir waren schon erheblich länger unterwegs als angekündigt. Würde unser Treibstoff überhaupt bis zu den Gambierinseln reichen? Einige diskutierten darüber, ob es nicht besser gewesen wäre, zwischenzulanden, irgendwo, auf irgendeinem Atoll, das ich übersehen hatte. Das sei nicht ungewöhnlich bei so viel Gegenwind und Gepäck. Die Maschine schwinge sich kurz mal runter, der Steward kippe ein, zwei Kanister Flugbenzin nach, und weiter geht’s, no big thing.
Tatsächlich setzte Air Maybe nun zum Touchdown an, und offenbar hatte sich der Pilot vorgenommen, auf dem Meeresboden zu landen. Wir segelten geradewegs in Richtung Absturz, um zunächst die Haie und kurz darauf unseren Schöpfer zu besuchen. Erst im letzten Moment tauchte ein schmaler, beidseitig von Wellen umspülter Streifen in den Fluten auf, der erfreulicherweise nicht versank, als sich die Maschine krachend darauffallen ließ.
Bienvenue auf dem Aéroport Totegegie. «Tote» bedeutet Sandbank, und «Gegie» bezeichnet ein Strauchgewächs, das der Wacholderpflanze ähnelt. Wir waren auf einem Korallenriff gelandet, mitten im Pazifik, das lediglich von Muschelresten und einem exotischen Gehölz zusammengehalten wurde, aus dem man wohl besser Schnaps gebrannt hätte.
Der einzige Flughafen der Gambierinseln verfügte über ein einziges Gebäude, das zweimal die Woche aufgesperrt wurde, und leider, wie uns nach anderthalb Stunden klar wurde, nur über einen einzigen, bedauernswerten Gepäckabfertiger. Er musste die Koffer ganz allein aus dem Flieger auf das Rollfeld werfen, um sie von dort aus auf den einzigen Gepäckwagen zu wuchten. Dann fuhr er zwanzig Meter über den Airstrip hinüber zum Terminal, schmiss die Koffer wieder aufs Rollfeld, schleifte sie über den Beton und stemmte sie in ein merkwürdiges Holzregal, aus dem wir sie schließlich wieder heraushieven konnten, um sie zurück auf den Boden krachen zu lassen. Nun schleppten wir unser Gepäck einen Steg hinunter und donnerten es vor die Füße eines grobschlächtigen Polizeibeamten, der es zu unserer Verwunderung ganz vorsichtig, sachte und akkurat im Inneren einer kleinen Fähre verstaute.
Für die Überfahrt verlangte er tausend Einheiten einer Währung, an die ich für immer und ewig mein Herz verlor. Sie hat von der sogenannten Internationalen Organisation für Normung die Abkürzung «XPF» bekommen, und bis heute konnte mir niemand erklären, wo in dem Begriff «Französischer Pazifischer Franc» ein «X» vorkommen soll. Vielleicht steht es für «Xtra Large», denn wer mit den stattlichen roten, grünen und blauen Scheinen bezahlt, bekommt eine ganze Handvoll prachtvoller Silber- und Goldtaler zurück. Auf jedem Geldstück sind Schatzinseln abgebildet, Piratenschiffe, Kokospalmen, Brotfrüchte und der wilde weite Ozean. Sie sind wunderbar groß und schwer und klimpern genau so wie jene, die versteckt in der Kiste unter dem «X» liegen, mit dem mancher die vergrabenen Phantasien seiner Jugend markiert hat.
Wir konnten das Ziel schon sehen, als die Fähre den Flughafen verließ, und dennoch fuhren wir noch eine Dreiviertelstunde darauf zu. Vor uns lag ein Massiv, das mit Laub- und Nadelbäumen bewachsen war und mir vertraut vorkam wie ein Schwarzwaldhang. In seinem Schatten standen Häuschen und eine Kirche, so als hätten Wind und Wellen ein Stückchen meines eigenen Landes an den Rand der Welt getragen. Das Gebirge schien auf dem Meer zu schwimmen, während die See absolut stillstand. Es war nach seiner Erscheinung benannt: Mangareva – der auf dem Wasser treibende Berg.
Wir machten im Hafen fest, und ich blickte in zwei Augenpaare – ein gutes und ein böses. Die guten gehörten Marie, die mich an sich drückte, auf beide Wangen küsste und mir einen Blumenkranz um den Hals legte. Eine knallbunt gekleidete Mama mit einem drolligen, kugelrunden Gesicht. Die bösen Augen gehörten ihrem ältesten Sohn Gabriel, der seinen Namen einem Missionar zu verdanken hatte. «Ich weiß, was du denkst», sagte er, während ich den Notenschlüssel betrachtete, der auf seine rechten Schläfe tätowiert war. «Ich sehe aus wie Brando.»
Gabriel war kein guter Gedankenleser, aber die Ähnlichkeit verblüffte mich doch. Ich stand einer polynesischen Version von «Endstation Sehnsucht» gegenüber. Dasselbe Kinn, dieselben Falten auf der Stirn, dieselbe Melancholie. Dieser Brando allerdings verbarg sich hinter seiner Gangsterattitüde und einer Laune, die alle Orchideen am Rande unseres Weges welken ließ. Wie ich später erfuhr, hatte er keinen Führerschein, was erklären mag, warum er den Wagen durch jedes der Schlaglöcher quälte, die sich vor uns öffneten.
Auf Mangareva gibt es kein Hotel, aber immerhin drei Pensionen. Das «Jojo» im Hafen, in dem die Seeleute absteigen, ist gleichzeitig das einzige Restaurant der Insel. Spezialität: «Poisson cru» – roher Fisch in Kokosmilch. Nummer zwei, das «Bianca et Benoît», thront auf einer Anhöhe über der Bucht und wird von einem Paar geführt, das zwar ein wenig aufgedreht, aber ansonsten hinreißend ist. Ich entschied mich für Nummer drei, die Pension «Maro’i», weil ich vorher nichts über sie herausfinden konnte. Außer dass sie direkt am Wasser liegt und «Maro’i» in der Sprache der Insel «Herzlich willkommen» bedeutet.
«Ich hasse Touristen», seufzte mein neuer Freund, als wir auf das Grundstück seiner Familie einbogen und endlich zum Stehen kamen. «Deine», murrte er, deutete halbherzig auf eine Hütte und verließ die Szenerie. Ich schob eine störrische Glastür auf, verjagte eine Kolonie Sandwespen, nahm Platz auf der Veranda und lächelte in mich hinein, denn es gibt noch einen dritten Grund, warum ich ausgerechnet das «Maro’i» wählte: Die Pension ist im Westen von Mangareva zu Hause, und wo geht die Sonne unter? Im Panoramakino direkt vor meiner Tür, und ich saß in der allerersten Reihe.