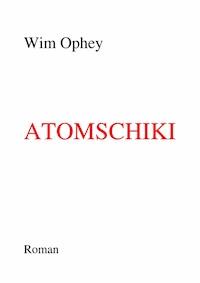
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als "Atomschiki" werden auf Russisch die Protagonisten der Nuklearindustrie bezeichnet. Sie spielen in diesem Buch, in dem es um Plutoniumschmuggel von Kasachstan nach Großbritannien geht, eine Schlüsselrolle. Zum Inhalt: Die beschauliche Welt des Berliner Aussteigers Marcel, der in einem Cottage auf einer kleinen Insel an der irischen Westküste lebt, wird jäh gestört. Auf See von einem Frachter ausgesetzt stranden auf der idyllischen Insel ein kauziger russischer Wissenschaftler und sein Begleiter nach einer langen beschwerlichen Reise , die in Kasachstan begann. In einem kleinen aber schweren Koffer transportieren sie ein Rohr gefüllt mit Plutonium, das die internationale Atommafia in London schon erwartet. Die beiden Russen zwingen Marcel und seine Gäste, Britta und Walter, ein Freundespaar aus Berlin, sie mit dem brisanten Koffer nach London zu bringen. Auf der Fahrt dorthin kommt es auf der historischen Seebrücke in Bangor (Wales) zu einem dramatischen Hubschrauberüberfall, der für die Beteiligten jedoch glimpflich verläuft. Währenddessen macht in Lagos, Nigeria, ein moslemischer Kurier beim Chef des Plutonium Kartells Druck, damit die rechtzeitige Lieferung des versprochenen Materials in London erfolgt. Das hat für ihn letale Folgen. In der Klosterstadt Sergiew Posad bei Moskau und später bei Uzungöl, einem Bergsee an der türkischen Schwarzmeerküste nahe der georgischen Grenze, treffen sich russische und englische Geheimdienstleute, die das aktuelle internationale Geschäft mit angereichertem Uran und Plutonium zur Herstellung von ("schmutzigen") Atombomben durch Schwellenländer und Terroristen für den Leser anschaulich beleuchten. Auch in Wien, bei der Internationalen Atomenergiebehörde, ist der Plutoniumschmuggel ein Thema. Dr. Thomas Torfhaus, genannt Teteh, der zwielichtige Chef der atomrechtlichen Genehmigungsbehörde, trifft sich dort zu konspirativen Gesprächen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Atomschiki
Wim Ophey
published by: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
Copyright: © 2012 Wim Ophey
ISBN 978-3-8442-2822-9
Lagos, Nigeria
Vom Mutala Mohammed- Flughafen hatte der hagere 60 jährige sich ein Taxi genommen und dem ekelig nach Schweiß riechenden Fahrer befohlen, ihn schnurstracks nach Victoria Island zu bringen. Auf der breiten, vierspurigen Straße zuckte er vor Schreck mehrfach zusammen, anfangs schloss er sogar die geröteten Augen. So ein Chaos hatte er noch nirgendwo erlebt und er war nun in Allahs Namen viel herumgekommen in dieser kaputten gottlosen Welt. Motorroller von rechts nach links und umgekehrt, quer zum Heck und quer zum Kühler, junge Männer, die wie Affen in geöffneten Türen fahrender Minibussen standen und offensichtlich Mühe hatten, sich irgendwie festzukrallen, ständige Vollbremsungen, das Aufprallen in enormen Schlaglöchern, irres Gehupe, Plärren der Autoradios, gestikulierende Fahrer. Er lockerte seine Krawatte noch weiter, so dass sie jetzt schon unter seinen Bauchnabel reichte. Auf seiner Stirn unter den schütteren gelbgrauen Haaren perlte der Schweiß und nicht nur dort. Er nestelte ein gesticktes Taschentuch aus der Jackentasche des khakifarbenen Anzuges. Nun hatten sie die Stadtautobahn erreicht und der Fahrer fing mit langgezogenen, beinahe gesungenen Vokalen wieder davon an, ihm von seiner großen hungrigen Familie zu erzählen und dass ihn die Fahrt eigentlich finanziell ruiniere. Zwischendurch spukte er die Tabakkrümel seiner Zigarette aus dem geöffneten Fenster. Doch sein Passagier hörte nicht mehr zu, der schaute gelangweilt auf die grellen Schilder und riesigen Werbeplakate, wie es sie auch in Amerika gibt. Victoria Island mit seiner modernen Skyline kam in Sicht. Dieses Stadtviertel hat mit dem typischen Lagos wenig zu tun. Mit seinen modernen klimatisierten Hochhäusern spiegelt es den Reichtum wieder, den wenige nigerianische Clans aus dem Erdöl und anderen, dubioseren Geschäften ziehen. Hier bleibt man unter sich und hier war er verabredet.
Das gelbe Taxi, ein japanisches Fabrikat, hielt vor einem Hochhaus, dessen Eingang mit rötlichem Marmor verblendet war. Aus dem Gebäude eilte ein dicker Doorman, der die Wagentür öffnete, lächerlich gekleidet in einer Art britischer Uniform mit Goldtressen. Der Hagere hustete krampfhaft, als der aus dem Auto ausstieg. Er hatte dem Taxifahrer ein anständiges Trinkgeld gegeben, aber der schien noch immer unzufrieden. Missmutig und vor sich her schimpfend händigte er dem blauschwarzen Türsteher das Gepäck, den kleinen Aluminiumtrolley seines Fahrgastes aus. In der kühlen, klimatisierten Halle fing der Hagere sofort an zu frösteln. Eine grell geschminkte Empfangsdame empfing ihn höflich säuselnd an ihrem Tisch aus Palisanderholz. Sie bat ihn, in einem der tiefen Ledersessel Platz zu nehmen, Mr. Ogunijofor sei bereits benachrichtigt. Kaum hatte er sich eine von diesen süßlichen ägyptischen Zigaretten angezündet, als Mr. Ogunijofor erschien. Der Nigerianer war sehr formell gekleidet: dunkler Maßanzug, weißes Hemd mit gestreifter Seidenkrawatte. Zwei Goldzähne blinkten, als er dem Besucher lächelnd die Hand zur Begrüßung reichte.
In seinem Büro hatte man den Eindruck in Manhattan zu sein und nicht im ostafrikanischen Lagos. Es war offensichtlich von einem Innenarchitekten aus dunklem Holz, Leder und Glas eingerichtet worden und wirkte so kühl wie die Temperatur der Klimaanlage. Durch das verspiegelte Fenster überschaute man Victoria Island. Die Sekretärin bot Getränke an und der Hagere entschied sich für eine Cola. Nervös fragte er, ob er rauchen dürfe, was ihm Ogunijofor, der in seinem Schreibtischsessel wippte, lächelnd erlaubte.
„Nun, im Namen seiner Exzellenz, Präsident Ihidero, möchte ich Sie noch einmal bei uns herzlich willkommen heißen“, begann der Nigerianer.
„Auch wir legen Wert darauf, unsere Geschäftsbeziehungen zu optimieren und Ihnen, mehr noch als in der Vergangenheit, zu Diensten zu sein.“
„Ich danke Ihnen sehr für Ihre Freundlichkeit, mich so kurzfristig hier zu empfangen“, antwortete der Hagere mit einem gekünstelten Lächeln und sog an seiner Zigarette, deren blauer Rauch sich zur Decke kräuselte. „Ich bin allerdings autorisiert, mit seiner Exzellenz Ihidero persönlich zu verhandeln.“
„Das wird sich leider nicht einrichten lassen“, mein lieber Mister..., seine Exzellenz ist mit Angelegenheiten beschäftigt, die noch größeres Gewicht besitzen, als der von Ihnen übermittelte Wunsch“, antwortete Ogunijofor kühl und drehte seinen Montblanc-Füllfederhalter auf der Tischfläche.
„Hören Sie!“, erregte sich der Hagere, drückte seine Zigarette aus und sprang vom Stuhl hoch und gestikulierte: „Es geht hier nicht nur um ein Millionengeschäft, besonders für Sie, es geht hier um Politik, um große Politik, Weltpolitik und mein Präsident hat mir aufgetragen, nur mit Ihrem Präsidenten zu verhandeln und ich bin nicht 4000 Meilen hierher in diese ekelhafte Stadt geflogen, um mit Ihnen Freundlichkeiten auszutauschen. Sie, Mr.Ogunifor, mögen ein wichtiger Mann in dieser Firma sein, aber für uns nicht wichtig genug. Wenn ich nicht mit Mr. Ihidero sprechen kann, dann fliege ich noch heute wieder zurück!“
Seine Worte hatten ihn in Rage gebracht, fast atemlos gemacht und er setzte sich, fast in den Sitz plumpsend, wieder zurück. Dann wischte er sich mit dem Taschentuch die Stirn und verfluchte innerlich dieses Geschäft und diesen dreckigen Hurensohn.
Ogunijofor schaute sein Gegenüber mit großen ernsten Augen an und als er mit der Spitze seiner Zunge über die Oberlippe fuhr, blitzten für einen Sekundenbruchteil die beiden Goldzähne. Er überlegte kurz, drückte dann auf eine Taste seiner Telefonanlage, mit der er die Sekretärin rief, die in ihrem engen Rock hineinstelzte. Der Nigerianer tuschelte ihr etwas in Ohr und sie eilte, mit dem Hintern ein wenig wackelnd, wieder hinaus.
„Ich möchte nicht, dass Sie Ihre Reise vergeblich gemacht haben und lasse im Büro seiner Exzellenz nachfragen, ob ein Gespräch mit Ihnen möglich ist“, erklärte Ogunijofor und blickte dabei beinahe gelangweilt. Wieder spielte er mit seinem teuren Füller.
Dann herrschte Schweigen. Der Hagere war nervös, zuckte rhythmisch mit seinen Füßen, zündete sich wieder einer der Zigaretten mit ovalem Mundstück an und schaute dem aufsteigenden Qualm nach.
Schließlich summte das Telefon, der Nigerianer nahm ab, hörte lautlos zu, klopfte mit der Hand leicht auf die Schreibtischplatte und legte den Hörer wieder auf. Dann blickte er auf seinen weißen Gast und sagte:
„Ich habe die Freude, Ihnen mitzuteilen, dass seine Exzellenz einige wenige Minuten erübrigen kann, Ihnen eine Audienz zu geben. Ich werde Sie hinführen“
Schweigend fuhren sie zusammen im Aufzug ein paar Stockwerke höher. Um in die Räume des Präsidenten zu gelangen, musste Ogunijofor sich identifizieren und einer Plastikkarte in einen Automaten am Eingangsportal einführen. Als sich die Tür öffnete, wurden sie von einem massigen Typen vom Sicherheitsdienst empfangen und durch eine Schleuse wie auf den Flughäfen gelotst. Der schweigsame Bursche trug ein schwarzes Hemd, auf dessen Brusttasche eine Art Sheriffstern geheftet war und einen Revolver im Halfter. Er durchleuchtete auch Orgunijofor mit einem dieser piepsenden Handgeräte und ließ beide dann durch.
Hier oben gab es keine Sekretärin. Stattdessen leitete ein junger Mann im dunklen Anzug beide in einen Warteraum. Der Mann trug ein kaum sichtbares Headset. Kaum eine Minute später forderte er den Hageren auf, ihm zu folgen. Orgunijofor wies er mit einer knappen Handbewegung an, zu warten.
In dem langen Saal lag unter dem Besprechungstisch, der mit Intarsien verziert war, ein breiter blassblauer Seidenteppich, die Wände waren mit antiken Fächern verziert, am Panoramafenster standen große weiße Alabastervasen mit grünen Bambusstangen. Und auf einer großen Kachel stand in blauer Kalligraphie Allahs Namen. Kaum hatte er versucht, sich in dem Raum zu orientieren, als sich die Mahagonitür an der Stirnseite öffnete und ein relativ kleiner dunkler Mann herein trat, der nicht mit einem Anzug , sondern mit einer Dschellaba, einem weißen islamischen Kaftan, gekleidet war.
Der Hagere schien verblüfft. Dann fasste er sich und ging langsam auf den Präsidenten zu. Aus der Nähe war zu sehen, dass der ein pockennarbiges Gesicht hatte, Katzenaugen und gelbliche Zähne.
Präsident Ihidero umfasste mit seinen beiden kühlen Händen die rechte , ein wenig schwitzende Hand des Gastes und begrüßte ihn mit hoher Stimme.
„Salam!“
„Wa alaykum as-salam.“
Nach der devoten Erwiderung des Hageren fuhr er in sonorem Tonfall fort: „Mein lieber Freund, ich habe gehört, Sie und Ihr Präsident hätten ein Problem. Warum nur , warum?“
„Exzellenz, ich danke Ihnen für die Gelegenheit…“
Er wurde von Ihidero barsch unterbrochen.
„Keine Floskeln bitte! Kommen wir zur Sache. Haben Sie die letzte Lieferung nicht erhalten?“
„Exzellenz, doch, die letzte Lieferung ist eingegangen. Aber Sie hatten uns insgesamt 500 Gramm zugesagt und 300 Gramm stehen also noch aus. Unsere Zahlung basierte jedoch auf der vereinbarten Menge.“
„Was habt Ihr damit nur vor, Ihr Verrückten?“, kicherte Ihidero und schüttelte seinen kleinen Vogelkopf. Dann wurden seine Gesichtszüge schlagartig wieder ernst. „Sagen Sie ihrem Präsidenten: die ausstehenden 300 Gramm sind schon auf der Reise. Wir erwarten Sie bald. Und wir haben aktuelle Maßnahmen ergriffen, dies sicherzustellen. Wir garantieren Ihnen die Lieferung bis zum Ende des Monats. In London. Die Einzelheiten klären Sie mit Mr. Orgunijofor.“
Kaum hatte der Hagere diese Mitteilung realisiert, wurde seine schwitzige rechte Hand erneut von den kühlen beiden Händen seiner Exzellenz Ihidero umgriffen, der sich schnellen Schrittes wieder zum Ausgang durch die Tür an der Stirnseite des Saales begab.
Der Mann im Khaki-Anzug kochte vor Wut.
„Dieser arrogante Esel! Hurensohn, so springt man nicht mit mir um!“
Draußen blaffte er den wartenden Orgunijofor an: „Ich muss noch einmal mit Ihnen sprechen. Sofort.“
Schweigend fuhren sie gemeinsam den Aufzug hinunter in sein Büro. Sie musterten sich abschätzig wie Todfeinde. Im Büro begab sich Mr. Ogunijofor wieder in seinen Schreibtischsessel, wippte lässig und spielte mit seinem Montblanc.
Die Adern an der Stirn des Hageren waren sichtbar, als er mit gepresstem Atem und vorgebeugt dem Schwarzen sagte:
„Hören Sie, ich habe dafür gesorgt, dass Ihnen, Ihnen persönlich zur Abwicklung unseres Geschäftes ein großer Betrag übergeben wurde. Den haben Sie gerne genommen. Seine Exzellenz weiß offenbar nicht davon. Nun haben Sie sich nicht an unsere Verabredung gehalten. Es geht auch nicht um 500 Gramm, wie Ihr Chef meint, sondern um einiges mehr. Hören Sie, wenn Sie das nicht umgehend in Ordnung bringen, lasse ich Sie auffliegen, mein Freund, umgehend!“
Orgunijofor hörte auf, in seinem Sessel zu wippen und den Füllfederhalter zu drehen. Er schaute den Hageren ruhig aus seinen tiefbraunen Augen an, zog die Luft durch seine Nase, rückte die Krawatte gerade und sagte: „Sir, Sie dürfen davon ausgehen, dass ich – dass wir - unsere Verpflichtungen gegenüber Ihnen und Ihren Auftraggebern erfüllen werden. Komplett erfüllen werden.“ Dann erhob er sich aus seinem Sessel und verließ grußlos den Raum.
********
Im Hotelzimmer schwang er sich auf das Bett, nahm sein Handy und erstattete in kurzen Worten Bericht. Dann schaltetet den Fernseher an, drückte die Fernbedienung und suchte das Programm von Al Jaseera. Nervös sprang er wieder auf, ging zur Minibar, wo er ein kühles Bier fand, es öffnete und gierig aus der Flasche trank. Hastig knöpfte er sein Hemd auf, warf es auf den Boden, zog die Anzughose aus und warf sie auf den Boden, ging zur Zimmertür, wo sein Jackett hing, griff in die Seitentasche , fischte das Päckchen Zigaretten und das silberne Dunhill-Feuerzeug heraus und zündete sich eine Zigarette an, die er tief inhalierte. Dann setzte er sich wieder aufs Bett, schaute zum Fernseher, sprang wieder auf, um einen Aschenbecher aufzutreiben, ging ans Fenster, schob die Gardine beiseite, blickte kurz hinunter auf die lebhafte Straße, schaltete die Air Condition eine Stufe kleiner, setzte sich wieder vor den Fernseher, zog auch das Unterhemd aus, das er aufs Bett warf und verschwand im Badezimmer.
Eine halbe Stunde später kam er nackt mit einem Handtuch aus dem Bad, blickte hinunter auf faltige gelbliche Haut und die sommersprossartigen Pigmente auf seinen Handrücken. Er rümpfte die Nase, ging zum Koffer, öffnete ihn und nahm ein Paar Jeans und einen billigen roten T-Shirt heraus, die er anzog. Camouflage. Dann rauchte er wieder eine Zigarette, ging zum Telefon am Nachttisch, wählte die Rezeption und bestellte sich ein Taxi.
In den Straßen von Lagos, wie überall in Afrika, wimmelt es von Militär in olivfarbenen Uniformen. Diese Burschen mit ihren gespiegelten Sonnenbrillen stehen die um ihre Geländewagen herum, die Maschinenpistolen in der Hand oder um die Schulter gehängt. Aber es wimmelt auch von normalen Leuten: von guttural lachenden gertenschlanken Mädchen in engen glitzernden Hosen, von dicken, gestikulierenden Mamas mit bunten Kopfbedeckungen und wallenden Gewändern, von coolen jungen Typen in Hemd und Hose oder selbst muslimischen in weißen Kaftanen, die Dir allesamt auf diesen staubigen grauen Straßen immer etwas verkaufen wollen. An den Straßenrändern kleine Verkaufsstellen, oftmals nur aus einem großen Reklame- Sonnenschirm und darunter aus einer ausgebreiteten Decke mit fein drapierten Sonnenbrillen oder Raubkopien von DVDs , hin und wieder aber auch mit Gemüse.
Der Sonnenuntergang bricht in diesen äquatorialen Gefilden unvermittelt und schlagartig ein. Und schlagartig werden die Lichter eingeschaltet. Auf die grellen bläulichen Neonleuchten fliegen die meisten Insekten. Nachdem er aus dem Taxi gestiegen war, hatte der Hagere zunächst eine Garküche am Straßenrand ausgesucht und dort für wenige Naira Rindfleischspieße, Suya, mit höllisch scharfem Chiliöl und dazu eine undefinierbare Griespampe bestellt. Aus dem Lautsprecher der kleinen Klitsche dröhnte eine Art Reggae- Musik. Er verließ den Imbiss gegen 20.30 Uhr und begab sich auf seinen zielgerichteten Bummel durch das quirlige Viertel. Die Luft fühlte sich jetzt mollig an, nicht mehr so schwül und seine Augen fixierten die hüpfenden kleinen und wogenden großen Brüste in den strammen Shirts der ihm entgegenkommenden Ladies. Mit der Zungenspitze fuhr er über seine Lippen. In den unbeleuchteten Hauslücken verschmolzen die schwarzen Gesichter der Passanten mit der Dunkelheit, nur das knallige Weiß der Zähne oder Augenäpfel leuchteten zuweilen auf. Von den vorbei hastenden frechen kleinen Burschen wurde er das eine und andere Mal angerempelt. Dann fuhr seine Hand reflexartig in die vordere rechte Hosentasche, wo er sein Geld trug. Schließlich bemerkte er eine interessante Kneipe in einem langgestreckten Bau mit Wellblechdach. Neben dem breiten Eingang mit bunten Plastikschnüren war eine große rot-gelben Reklametafel von „Gulder-Beer – The Ultimate“ angebracht. Darüber in ungelenker Schrift das Namensschild des Lokals : „Bei Tante Zeeba – Mehr als eine Bar…“
Der Hagere trat ein. Er musste sich einen Augenblick an das funzelige Licht über dem Tresen gewöhnen.
„Hi, Mister! How can I help ye?” knarrte ihn die dicke Wirtin an, noch bevor er sich in dem zwielichtigen Raum orientiert hatte. Er bestellte ein kleines Bier, erklomm den Barhocker und zündete sich eine Zigarette an. Er war nicht der einzige Gast. Drei Stühle weiter hustete ein weißhaariger Schwarzer mit großer Brille sich die Lunge aus dem Leib, während er zwischendurch versuchte zu rauchen. Aus der Musikbox wummerte ein Schlager. In der Ecke räkelten sich hinter kleinen Tischchen zwei blutjunge Ladies mit prallen Lippen, die eine hatte sich Rasta-Zöpfe geflochten. Auch sie rauchten, nippten an einem Cocktail und kicherten, als sie Blicke auf ihn warfen.
Die Wirtin, offenbar „Tante Zeeba“ trug eine Art Turban. Sie musterte ihn. Als er das bemerkte, stellte sie ihm eine Holzschale mit gesalzenen Nüssen neben das Bierglas, das er in zwei Zügen austrank. An der Wand hing ein gerahmtes Farbfoto des Staatspräsidenten, auf das sich offenbar viele Fliegen erleichtert hatten.
„Another drink, Mister?“ fragte sie ihn. Jetzt bestellte er einen Bourbon mit Eis. Als die dicke Wirtin ihm den Whisky brachte, schlüpfte durch die Perlenschnüre ein kleiner Schwarzer, etwa Ende Zwanzig. Er trug auf seinen dicken Backen ungleichmäßige Narben, wahrscheinlich von Pocken. Auch der kleine Schwarze musterte den Hageren kurz, ging dann zur Wirtin, flüsterte ihr etwas ins Ohr. Worauf sie nickte und er stracks in die Hinterräume verschwand. Die Musikbox spielte nun: „Killing me softly“.
„Do you like a little entertainment?” fragte die Wirtin ihn süßlich. Bevor er noch antwortete stand die Lady mit den prallen Lippen und den Rasta-Zöpfen neben ihm, schaute ihn mit ihren großen Augen an und flüsterte mit dunkler Stimme:
„I like you Mister. - Please order me a nice drink.”
Das Mädchen schwang sich auf den Barhocker neben ihm. Sie trug enge helle Jeans, in denen ihr großer Hintern zur Geltung kam
Ein wenig später sog er aufgeregt an einer weiteren Zigarette, das Mädchen ihren Cocktail aus einem Plastikstrohhalm. Sie blickte ihn verschmitzt an, rückte mit einer kleinen Handbewegung ihren prallgefüllten BH zurecht und sagte:
„I like you, Charly. We could have some fun in the backyards“. Sie ergriff seine Hand.
Der Hagere zögerte kaum. Er bezahlte die Drinks bei der dicken Wirtin, die ihm regungslos geschäftsmäßig das Wechselgeld herausgab. Dann hakte sich die schwarze Lady in den engen Jeans bei ihm unter und beide verschwanden hinter einer hölzernen Klapptür in die hinteren Räume.
Der Gang war eng und dunkel. Aber der Hagere spürte die Wärme der Lady for the night, die neben ihm stöckelte, er roch ihr süßliches Parfum, und einmal berührte eine der Rastazöpfe kitzelig seine Wange, sein Handrücken berührte ihre feste Brust. Das Blut schoss ihm wer weiß wo hin. Ficken.
Auf den langen Gang folgte eine Art Raum, von dem auch die Toilette zu erreichen war. Hier stand der kleine Pockennarbige und schaute ihn mit großen Augen an. Sie kamen näher und er stand noch immer da und schaute ihn mit bösem Blick an. Plötzlich löste die Lady ihre untergehakten Arme aus seinem, stöckelte zur Seite und nahm reißaus zurück in den Gastraum.
Die beiden Männer standen sich gegenüber und spürten ihren Atem.
„Allahu Akbar! Und schöne Grüße von Mister Ogunijofor“, grinste der Pockennarbige und griff in seine Hosentasche. Der Hagere war verwundert, wusste gar nicht, wie ihm geschah. Kurz sah er eine Klinge blitzen. Einen Schmerz verspürte er nicht. Doch dann fühlte er noch, wie es in seinem Bauch warm, so ganz warm wurde. Es ihm so warm herunter floss. Als habe er im Schlaf eingepullert. Er spürte die aufkeimende Scham. Mama!
Jewgeni
An diesem Tag, wie an allen Tagen im November war alles grau: Der Himmel, die Straßen und Häuser, die Mäntel und Gesichter der Menschen, die Stimmung. Jewgeni war in den Strom seiner Kommilitonen eingereiht, der sich wegen der Kälte schnell aus der Metro-Station Politechnitscheskaja zum Institut bewegte. Der kleine Hörsaal mit seinen abgewetzten, klappbaren Holztischchen war wie immer gut besetzt. Und während dort unten Professor Petroff begleitet von sonorer Stimme und quietschender Kreide Formel auf Formel auf die große Tafel schrieb, verlor sich Jewgeni in Gedanken.
Seit 1978 lebte er nun in Leningrad in einem Wohnheim auf der Schewtschenko Straße nahe des Hafens und war so unendlich stolz darauf, Student am berühmten physikalisch-technischen Ioffe Institut zu sein, dem ersten sowjetischen Institut, in dem die Kernspaltung erforscht worden war.
Gestern hatte ihn die „Deschurnaja“, die Pförtnerin mit der dicken Warze neben der Nase wieder einmal mit vorwurfsvollem Blick gefragt, wo er denn so lange unterwegs war und mit wem wohl. „Jewgeni“, hatte sie ihn angeherrscht, „es ist Zeit ins Bett zu gehen!“ Dabei war er, im Gegensatz zu vielen anderen Studenten im Heim immerhin schon 19 Jahre alt.
Das enge überheizte Zimmer teilte er mit Igor, einem dicken Bauernlümmel irgendwo aus der Ukraine. Zwar hatte jeder ein eigenes Bett und einen Schreibtisch, aber Kühlschrank und Dusche mussten sie mit den anderen 34 Bewohnern der Etage teilen. Und erst die wenigen, ständig verdreckten Klos. Die Wände waren zwar sehr schalldicht. Aber über die Heizungsrohre konnte man sogar Gespräche von nebenan belauschen. Gelegentlich hatte er das Gefühl, dass im Zimmer über ihm Tataren Volkstänze aufführten. Es kam auch schon mal vor, dass er nachts um zwei von Musik geweckt wurde, obwohl die „Komendantka“, die Chefin des Wohnheims, solche Auswüchse mit gnadenloser Härte rächte.
Die Kakerlakenhäufigkeit im Haus schwankte. Mal sah er eine ganze Woche lang keine einzige Schabe in seinem Zimmer. Dann konnte es passieren, dass die Käfer bei helllichtem Tag über den Tisch marschierten. Einmal war ihm sogar eine Maus über den Weg gelaufen. Sie war schon halbtot, ließ sich ohne Probleme fangen und wurde aus dem Fenster vor das Wohnheim geworfen. Es kam auch vor, dass Holzstühle und Kochtöpfe aus den Fenstern flogen. Jedenfalls waren Brot und Wurst im Kühlschrank vor Mäusen und Kakerlaken in Sicherheit.
Und dann der Müllschlucker im Gang. Es war unmöglich, den Müll einzuwerfen, ohne dass einem der Geruch von Pestilenz entgegenkam. Es passierte auch immer mal wieder, dass diese Bauernlümmel mit sperrigen Gegenständen den Müllschacht verstopften. Dann stapelten sich die stinkenden Abfälle auf dem Gang, weil sie niemand zu den verbeulten Tonnen vor dem Haus tragen mochte. Manchmal lag die Müllklappe neben der gähnenden Öffnung des Schachtes auf dem Boden und es flogen überall Müllfetzen umher, die aus dem Schacht geweht wurden.
Immer freute er sich auf Post. Auf die Briefe seiner Mutter, die er umgehend beantwortete. Auf einem kleinen Tisch im zugigen Eingangsbereich des Hauses war die Post zu finden. Es gab zwar ein Regal mit alphabetisch gekennzeichneten Fächern, aber niemand machte sich die Mühe, die Briefe dort einzuordnen. Nur die alten Briefe, die niemand mitgenommen hat, wurden wahllos dort hineingestopft. Hier unten gab es auch das einzige Telefon. Aber wen sollte er schon anrufen? Seine Mutter hatte keines zuhause und im Betrieb durfte sie keine privaten Anrufe führen.
Jewgeni war verliebt. Zum ersten Mal in seinem Leben verliebt. Und deshalb verlor er sich in Gedanken und Träumen, obwohl er doch sich und der Mutter versprochen hatte, ein fleißiger Student zu sein. Aber von Professor Petroffs Vorlesung hatte er wenig, nein: gar nichts mitbekommen. Jetzt musste er wieder an Larisa denken, wie sie ihn angeschaut hatte mit ihren tiefen dunklen Augen. Ob sie überhaupt wusste, was er für sie empfand? Er schob seine runde Brille zur Nasenwurzel.
********
Nach der dicken Kladde aus dem Panzerschrank hatten sie fast 24 Kilo von diesem Zeug im Komplex gelagert. In verschiedenen Räumen zwar, alle hinter dichten gelben Stahltüren, die mit großen Hebeln verriegelt waren, aber immerhin. So viel hatten sie nie gebraucht. Auch nicht vor der „Konversion“, wie sie den Ausverkauf der Nuklearwissenschaft unter Jelzin nannten. Das war eine Forschungsstätte hier und nicht ein Produktionsbetrieb wie in Tomsk. Nachgewogen hatte das keiner. Die Eingänge waren akkurat notiert worden. Materialausgänge gab es ebenso wenig wie Bestandskontrollen. Und wer sollte sich auch darum kümmern? Jeder musste selbst zusehen, wie er über die Runden kam.
Doktoringenieur Jewgeni Farenjuk schob das breite Brillengestell zur Nasenwurzel und strich sich sein Haar aus der Stirn. Wieder legte er den Kopf in seine aufgestützten Hände und stierte auf die aufgeschlagene dicke Kladde aus dem Panzerschrank. Er hatte eine Idee. Eine Idee, die ihm gar nicht gefiel. Die gar nicht zu seiner Art passte. Aber war das nicht ohnehin egal, wo jetzt alles drunter und drüber ging? Wo staatliche Forschungskomplexe aufgelöst und systematisch an die fetten Katzen verhökert wurden? Und es war ein Notfall.
Gestern hatte er seine Olja in die Klinik Nr. 1 gebracht. Sie hatte jetzt zum zweiten Male plötzliche Gleichgewichtsstörungen, taumelte beinahe und musste sich auf ihn stützen. Und er hatte sie ganz fest an den nass geschwitzten Armen gehalten. Zuhause war ihr übel gewesen, als müsse sie gleich erbrechen.
Auf dem langen Wege zur Neurologie kamen sie an der Intensivstation vorbei. Türen und Fenster standen offen, aber wenigstens waren die Fenster mit Fliegengittern versehen. Trotzdem roch es nach einer Mischung von Urin und Desinfektionsmittel. Die hellblaue Ölfarbe bröckelt von den Wänden, eines der leeren Betten war mit einem groben graubraune Bettlaken bezogen, das einen riesengroßen, offenbar nicht auswaschbaren Flecken hatte - darauf wird wohl mal jemand verblutet sein. Rissige Gummischläuche führten von einem verbeulten Dialyseapparat zu einem improvisierten Anschluss ans Waschbecken.
„Terpite! – Halten Sie’s aus!“, befahl der junge kasachische Arzt Olga, als er sie auf einem Stuhl sitzend untersuchte, ihr mit Drähten verbundene kleine Metallplättchen auf die Kopfhaut klebte und ihr offenbar aus einem kleinen schwarzen Kasten Strom zuführte. Jewgeni konnte das nicht mit ansehen und schlich sich aus dem Behandlungszimmer. Er wartete auf dem Flur. Ärzte und Schwestern in blütenweißen Kitteln und Mützen, wie die Köche sie im Westen tragen, rauschten an ihm vorbei. Manchmal unterhielten sie sich und lachten laut.
Nach fast einer Stunde qualvollen Wartens war die Diagnose zwar nicht klar, aber doch wahrscheinlich: Olga litt vermutlich unter Multipler Sklerose. Nie davon gehört. Eine Krankheit, gegen die sie hier nicht viel bewirken können, eine schleichende Krankheit über die man noch nicht viel weiß, sagte der Arzt. UNHEILBAR. Vielleicht eine Untersuchung in Moskau beim Spezialisten? An der berühmten Charité-Klinik in Berlin? Kein Problem in diesen neuen Zeiten. Aber das kostet. Und das geht nur „nebenbei“. Auch Medikamente gegen die Krankheit gibt es hier bei uns in der Provinz nicht. Jedenfalls keine, die helfen. Tja, in Amerika, in England und Frankreich, da haben sie eine Arznei. Gibt es inzwischen wohl auch in Moskau. Aber die kostet viele Dollar.
„Haben Sie Dollar? Haben Sie im Westen Verwandte? Freunde? Vielleicht kann ich da etwas vermitteln“, seufzte der Arzt und fügte hinzu: „Das kostet natürlich“.
Olga war ganz stumm geblieben, fast lethargisch, als sie die Diagnose hörte. Auf Jewgeni gestützt ging sie langsam den langen Flur entlang, vorbei an der offenen Tür der trostlosen Intensivstation und Jewgeni hörte sie schwer atmen, Schritt für Schritt. Erst als sie mit ihrem grauen Lada wieder zuhause angekommen waren, fing Olga an zu weinen. Sie ließ sich auf die Couch fallen, schluchzte, schlug die Hände vors Gesicht und Ihr Oberkörper bebte dabei. Jewgeni stand wie versteinert neben ihr. Dann streichelte er leicht ihren Kopf.
„Ich werde Dir helfen, das verspreche ich Dir, Olja“, sagte er trotzig und auch ihm stiegen Tränen in die Augen. „Es ist ja gar nicht sicher, dass Du diese Multiple, wie heißt das noch? überhaupt hast. Das lassen wir erst einmal untersuchen und wenn wir nach USA fahren müssen, nicht wahr? Stell Dir vor, Olja, wir beide fahren nach New York!“ Jewgeni stockte, als er an sich bemerkte, dass dieser Gedanke ihm so gut gefiel, dass er zu lächeln begonnen hatte. Dann aber fuhr er fort: „Und selbst wenn Du diese Krankheit tatsächlich haben solltest: Olja, liebste Olja, ich verspreche Dir, Du bekommst die beste Medizin, die es gibt! - Und wer weiß, vielleicht entdecken sie ja bald etwas, was diese ominöse Krankheit, die keiner kennt, heilen wird.“
Ja, sie befanden sich jetzt in einer akuten Notlage. Und Jewgeni erinnerte sich daran, gelernt zu haben, dass man außergewöhnliche Probleme oftmals nur mit außergewöhnlichen Methoden lösen kann. Geräuschvoll klappte er die dicke Kladde zu, stand auf und legte sie zurück in den Panzerschrank, den er sogleich verschloss.
********
In der Nacht, als er schlaflos sein Hirn zermartert hatte, war ihm wieder und wieder der obskure Satz von diesem schmierigen Karimow eingefallen, den der bei dem Kongress in Almaty so ganz nebenbei hatte fallen lassen. Das war der letzte Fachkongress in der alten kasachischen Hauptstadt, bevor dieser größenwahnsinnige Präsident seine Wolkenkuckucksheime im staubigen Altana errichtete.
„Weißt Du, Jewgeni, ich habe da einige Verbindungen, sehr lukrative Verbindungen zu Kollegen in London, die insbesondere an unserem Wissen interessiert sind, aber auch an Materialien, die wir gar nicht mehr brauchen. Sehr lukrativ sage ich Dir. Das solltest Du Dir einmal überlegen. Ihr in Kurtschatow habt doch jede Menge davon!“
Was hat dieser Karimow, dieser schmierige Hurensohn, nur damit gemeint? „Materialien“, die wir gar nicht mehr brauchen?
Es wird das Plutonium sein. Der Stoff der Träume von Wahnsinnigen. Von Geldgierigen und Terroristen. Der Stoff, von dem Dreckskerle, kapitalistische Dreckskerle und islamische Dreckskerle träumen. Typen, Businessmen und Religiöse, die bereit sind, Teile unserer Welt in die Luft zu jagen, wenn es ihnen nur nützt. Dessen war sich Jewgeni sicher. Und nach einer weiteren Stunde unruhigen Wälzens schlief er endlich ein. Morgens erinnerte er sich an Albträume.
Am nächsten Tag, als er nach einem schnellen Tee und einem kalten Blini mit Marmelade zum Frühstück - Olga und Irina schliefen noch - mit dem Bus wieder ins Institut gefahren war, suchte er in seinem Büro hektisch in alten Tagungsunterlagen nach der Telefonnummer von diesem Karimow. Ob der sich überhaupt noch in Kasachstan aufhielt?
Karimow hatte sich inzwischen nach Moskau abgesetzt. Das ergaben Jewgenis Recherchen. Er brauchte fast eine Stunde, bis er die Telefonnummer von ihm herausgefunden hatte.
„Aljo, hier ist Farenejuk, Jewgeni“
„Sluschaju, hier ist Karimow, Bajat.“
„Erinnerst Du Dich an mich? „fragte Jewgeni. „Kongress in Almaty?“
„Natürlich erinnere ich mich, lieber Kollege. Was kann ich für Dich tun?“ antwortetet Karimow nach kurzem Zögern zuckersüß.
„Du hattest einmal von Wissensaustausch mit Kollegen aus London gesprochen“, sagte Jewgeni.
Eine Sekunde lang herrschte Stille in der Leitung. Dann antwortete Karimow, offenbar sehr vorsichtig: „Ja, ich erinnere mich auch daran.“
„Können wir deswegen einmal ins Gespräch kommen?“ fragte Jewgeni.
„Können wir“, bestätigte Karimow. „Aber dazu sollten wir uns treffen. Gib mir doch Deine Adresse!“
********





























