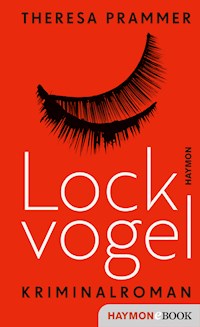9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Jede von Stefans Beziehungen scheitert. Die Frauen verlassen ihn entnervt, weil er nie spricht. Schon gar nicht über die große Leere, die seit dem Weggang seines Vaters in ihm ist. Stefan war erst acht, als nach einem Tag an der Donau seine Familie auseinanderbrach. Jetzt weiß er nicht, wie er auf die Frau zugehen soll, die er bewundert. Als seine Mutter Hannah von ihrer Geburtstagsfeier wegläuft und unauffindbar bleibt, ist das für ihn der nächste Schlag. Gibt es für Beziehungen ein Geheimnis, das er nicht kennt? Stefan beginnt nach Hannah zu suchen, der Gedanke, noch jemanden zu verlieren, ist für ihn unerträglich. Es ist auch eine Suche danach, was Menschen verbindet und zusammenhält. "Theresa Prammer kann's! 'Auf dem Wasser treiben' ist spannend, berührend und steckt voller Überraschungen." Andreas Izquierdo
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Jede von Stefans Beziehungen scheitert. Die Frauen verlassen ihn, weil er nie spricht. Schon gar nicht über die große Leere, die seit dem Weggang seines Vaters in ihm ist. Als seine Mutter Hannah ohne ein Wort verschwindet, fühlt er sich dafür verantwortlich. Stefan beginnt nach Hannah zu suchen, der Gedanke, noch jemanden zu verlieren, ist für ihn unerträglich. Gibt es für Beziehungen ein Geheimnis, das er nicht kennt?
Die Autorin
Theresa Prammer wurde 1974 in Wien geboren. Sie hatte Engagements als Schauspielerin unter anderem am Burgtheater und an der Volksoper. Seit sieben Jahren arbeitet sie außerdem als Regisseurin. 2006 gründete sie mit ihrem Mann das Sommertheater »Komödienspiele Neulengbach«. Für ihren Kriminalroman Wiener Totenlieder ist sie mit dem Leo-Perutz-Preis ausgezeichnet worden. Theresa Prammer lebt abwechselnd in Wien und in Reichenau an der Rax.
Theresa Prammer
Auf dem Wasser treiben
Roman
List
List ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweise zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-2018-2
© 2019 © der deutschsprachigen Ausgabe 2019 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Umschlaggestaltung und -illustration: Sabine Kwauka unter Verwendung von shutterstock-Motiven Autorenfoto: © Janine Guldener
E-Book: L42 AG, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Für meine Eltern.
Wasser ist ein mysteriöses Material.
Es ist ein einfaches Molekül.
Aber es verhält sich auf sehr überraschende Weise.
Dr. Adam Wexler, 2018
PROLOG
Alles begann mit einem Sturz ins Wasser.
Stefan hatte sich vom Picknickplatz weggeschlichen, da niemand auf sein »Wer geht mit mir schwimmen?« reagierte.
Seine Eltern waren mit seinen Geschwistern beschäftigt. Fred, mit zwölf Jahren der Älteste von ihnen, musste pinkeln und fluchte leise hinter einem Busch, weil er das nicht im Freien konnte.
»Come on, Freddie. You can do it. Let it flow.«
Emma, die Mittlere und das »Toastkind«, wie sie sich deshalb selbst nannte, durchsuchte alle Taschen. Sie konnte ihre Bücher nicht finden, war aber vollkommen sicher, sie eingesteckt zu haben. Ihre Mutter suchte mit, denn Emma wurde nervös, wenn sie nichts zu lesen hatte.
Ihr Vater, der aus England stammte, nannte Emma dann liebevoll »cold turkey« und lachte.
Stefan wusste nicht, wieso seine Schwester ohne Buch ein kalter Truthahn sein sollte. Aber Emma schien es zu wissen oder zumindest blöd zu finden, denn sie verdrehte die Augen und schüttelte den Kopf.
Die Familie war am Morgen überstürzt aufgebrochen, in den letzten beiden Wochen hatten Regenfälle und Sturmböen einander abgewechselt, als käme die nächste Sintflut.
An diesem Sonntag war endlich der ersehnte erste heiße Sommertag, und sie wollten jede Sekunde nutzen, denn niemand traute dem Wetter.
Und weil eben alle so beschäftigt und aufgeregt waren, achtete keiner auf Stefan. Mit seinen acht Jahren war er der Jüngste.
Manchmal hatte er den Eindruck, er könne sich in seiner Familie unsichtbar machen.
Es war wie das »Beamen« in seiner Lieblingsserie Raumschiff Enterprise. Nur eben ein bisschen anders. Er musste sich nicht in Luft auflösen. Es reichte, wenn er keinen Mucks von sich gab und sich dabei vorstellte, er wäre gar nicht da.
Es funktionierte nicht immer. Aber oft.
Als er außer Sichtweite des Picknickplatzes war, rannte er auf den Steg zu, der in die Donau führte. Wegen des vielen Regens der vergangenen Tage war das Holz aufgeweicht und mit einer glitschigen Schlammschicht überzogen. Er rutschte aus und landete auf dem Hintern. Wie ein Pfeil schoss er in den Fluss. Und ging sofort unter. Die reißende Strömung drückte ihn tiefer und ließ ihn nicht wieder hochkommen. Sein Brustkorb krampfte sich zusammen, als er statt Luft Wasser einatmete. Schlagartig explodierten Angst und Panik in ihm. Alles wirbelte. Er konnte nichts mehr erkennen. Kein Oben und kein Unten. Sein ganzer Körper flehte. Keine Hilfe. Nur noch mehr Wasser in seinen Lungen. Mehr. Und mehr. Es zerriss ihn. Und plötzlich wurde alles dunkel. Zuerst verließ ihn die Kraft. Dann wurde die Angst weniger. Bis sogar sie schließlich verebbte. In ihm wurde es ganz still. Er verschwand. Wie beim Beamen.
Als er die Hände auf dem Oberarm spürte, war es, als wäre das gar nicht mehr sein Körper. So, wie wenn man mitten in der Nacht aufwacht, weil man auf seinem Arm eingeschlafen ist und den nicht richtig spürt. Die Hände rissen und zogen ihn. Es tat kaum weh. Auf seinem Gesicht wurde es kühl.
War das Luft?
»Ich hab ihn, ihn hab ihn«, hörte er seine Mutter von ganz weit entfernt. Ihre Stimme klang schrill und gleichzeitig wie unter Wasser. »Stefan, hörst du mich? Stefan?«
Er fühlte ein Rütteln und wollte antworten, aber es ging nicht. Jemand quietschte. War das Emma?
»Mama, was ist mit ihm?«, schrie Fred.
Er wurde unter den Achseln gepackt und aus dem Wasser gezogen.
»Holt euren Vater.«
Irgendwas drückte auf seine Brust, wieder und wieder. Zuerst spürte er es kaum. Dann wurde es stärker und stärker. Und plötzlich tat es unglaublich weh. Er musste husten und spucken und ihm wurde schlecht. Das Wasser spritzte ihm aus Mund und Nase, und als er einatmete, stach seine Lunge, als wären darin Tausende Nadeln. Er blinzelte und sah in die Augen seiner Mutter. Sie weinte, streichelte ihm über das Gesicht, küsste seine Wangen.
»Wie geht es dir, mein armer Liebling?«
Er wollte etwas sagen, aber es kam nur ein Schluchzen heraus.
»Stevie, Stevie. O my god.«
Sein Vater fiel auf die Knie, drückte ihn an sich, während seine Mutter nicht aufhörte, ihm über den Rücken zu streicheln. Sogar die Hände von Emma und Fred griffen nach ihm, als müssten sie sich vergewissern, dass er wirklich da war.
Sein Vater hob ihn hoch, so behutsam, als wäre er ein sehr kostbares Paket.
In diesen Armen war Stefan in Sicherheit. Er klammerte sich wie ein Äffchen an Johns Hals, vergrub sein Gesicht im weichen Vollbart. Das hatte er früher immer so gerne getan. Diese Fülle aus Haaren wie flauschiger Draht, in die er seine Nase gesteckt hatte. Ganz genau so roch sein Vater, wie dieser Bart.
Doch jetzt war da noch ein anderer Geruch, nach diesen scharfen Pfefferminzbonbons, die so auf der Zunge brannten.
Als Stefan auf der Picknickdecke saß, eingeklemmt zwischen seinen Eltern, kam es ihm vor, als wären sie drei miteinander verbundene Legosteine.
Emma fütterte ihn mit Keksen, Fred ließ ihn nicht aus den Augen, und seine Eltern fragten alle paar Minuten, wie es ihm ging, ob er etwas brauchte, ihm etwas wehtat?
Irgendwann stand sein Vater auf und sagte: »Lasst uns zurück zum Wasser gehen.«
Stefan wollte nicht, er wollte nie wieder dorthin, geschweige denn sonst in die Nähe eines Gewässers. Er fing an zu weinen und krallte sich an der Picknickdecke fest.
Sein Vater strich ihm über den Kopf.
»Vertraust du mir, Stevie?«
Er wartete, bis Stefan nickte. Erst dann hob er ihn wieder hoch und trug ihn zum Ufer.
»Stevie, ich weiß, du hast Angst. Aber kannst du dich erinnern an die Story, wenn man vom Pferd fällt?«
Stefan schüttelte den Kopf. Er wäre jetzt lieber mit jeder Art von Pferd davongeritten, als auch nur eine Zehenspitze in den Fluss zu stecken.
Sein Vater lächelte, strich ihm die Haare aus der Stirn und flüsterte ihm ins Ohr.
»Wenn du noch mal schwimmst, mit Emma und Fred, dann wirst du dich immer daran erinnern. Und irgendwann vergisst du die schlimme Sache von vorhin. Mummy steht da und ist sofort im Wasser, wenn du sie brauchst. Okay?«
Stefan sah hinüber zu seiner Mutter. Sie sah ein bisschen so aus wie damals, als der Arzt gesagt hatte, die roten Punkte auf seiner Haut seien Scharlach.
»Emma und Freddie, ihr passt auf Stevie auf, okay?«
Emma nickte und griff gleich nach Stefans Hand, kaum hatte sein Vater ihn abgesetzt. Fred reichte ihm die andere.
Vorsichtig rutschte er an ihren Händen bis zum Ende des Stegs. Er ließ die beiden nicht mal los, als sie bereits im Wasser waren.
Zuerst brauste die Angst noch tosend in ihm, wie eine Horde wilder Fliegen. »Bss-bss-bss« dröhnte sie in seinen Ohren. Sie ließen sich zu dritt treiben. Die Strömung war sanfter geworden, Stefan fühlte sie nur ganz leicht an den Füßen.
»Wir sind ein Kreis aus Fleisch und Blut im Wasser«, rief Emma.
»Igitt«, sagte Fred. Emma quietschte vor Lachen.
»Ja, das seid ihr«, rief ihr Vater vom Ufer zurück.
Sonnenstrahlen trafen auf die Wasseroberfläche und verwandelten sie in flüssiges Licht.
Es dauerte eine Weile. Aber irgendwann wurde dieses Brausen in Stefan tatsächlich weniger. Bis es schließlich ganz verebbte und die wilden Angst-Fliegen sich in Luft auflösten.
Und als Stefan die Hände seiner Geschwister losließ und sie nebeneinander schwammen, war es noch immer in Ordnung. Das Wasser trug ihn und Emma und Fred. Irgendwie füllte es die losen Stellen zwischen ihnen aus, sogar wenn sie sich nicht festhielten. Er winkte zum Ufer, sein Vater hatte recht gehabt.
»Du hast es geschafft, Stevie. Das war sehr mutig!«
Stefan war an diesem Abend in seinem Bett vor dem Einschlafen so glücklich, dass er sicher war, dieser Tag war besser als der Besuch im Prater vor zwei Monaten. Besser als fünf Folgen Raumschiff Enterprise hintereinander. Und sogar besser als die Nacht, als sie im Garten gezeltet hatten.
Er würde morgen seinen Freunden in der Schule davon erzählen. Und alle wären schwer beeindruckt.
Doch das passierte nie.
Denn in dieser Nacht verschwand sein Vater aus der Familie. Seine Seite des Bettes war am Morgen leer, seine Schlüssel lagen am Küchentisch. Er war einfach weg. Oder wie Emma es nannte: »Er hat sich wie eine Fata Morgana in Luft aufgelöst.«
Keiner von ihnen nannte ihn je wieder Papa.
Alles, was von John Wilkinson blieb, war eine krakelige, wahrscheinlich im Dunkeln geschriebene Nachricht auf einem Notizzettel, den er auf sein Kopfkissen gelegt hatte.
I’m sorry. Bitte verzeiht mir. John
1.
Jeder Mensch besteht zu drei Viertel aus Wasser.
Im Prinzip ist also jeder von uns nichts anderes
als eine lebende Wassermelone.
Das stand auf einem Aufkleber an der Tür von Stefans Büro in der Technischen Universität. Irgendjemand hatte ihn dort angebracht, lange bevor er in dieses Büro eingezogen war. Vielleicht einer der Studenten, um das Abbild der »geistigen Elite«, mit dem jede Universität sich umgab, zu relativieren.
Als Stefan es zum ersten Mal las, musste er lachen.
Auch, weil der Hausmeister gleich darüber sein Namensschild angebracht hatte: Stefan Schneider, Dipl.-Ing. Dr. techn. – Forschungsbereich Wassergüte und Wasserressourcen.
Er ließ den Aufkleber, wo er war. Nicht nur, weil ihm der Vergleich gefiel. Die beiden Sätze führten ihm immer wieder die Vielfalt vor Augen, die er an seinem Forschungsgebiet so schätzte. Natürlich waren die Verschmutzungen und knappen Trinkwasser-Ressourcen weltweit das größte Problem. Es wurde daran geforscht, um schnellstmöglich Lösungen zu finden. Ohne sauberes Wasser kein Leben – aber da war noch mehr. Denn obwohl Wasser der Ursprung war, wusste die Wissenschaft noch immer erstaunlich wenig darüber. Woher kam es? Wieso verhielt es sich, wie es das tat?
Stefan glaubte, wenn er Wasser genau genug verstand, dann würde es ihm ganz von selbst die Antworten zeigen. Und damit auch die Lösungen.
Sein Büro war eines der letzten im dritten Stock. Er hatte es sich ausgesucht, da man in diesen Teil der Universität nur dann kam, wenn man wirklich hinwollte. Die Direktion lag im ersten Stock, die Vorlesungen fanden in den beiden anderen Gebäuden statt, und die Mensa lag im zweiten Innenhof. Allein deswegen war er verwundert, als er an diesem Nachmittag im August ein fremdes Frauenlachen hörte. Während der Semesterferien war die Uni so ausgestorben, dass man normalerweise den ganzen Tag niemanden zu Gesicht bekam.
Er sah von den Unterlagen auf seinem Schreibtisch hoch und streckte den Kopf, um über den oberen Rand des Bildschirms zu sehen. Im Eingang des Büros stand eine dunkelhaarige Frau in einem hellgrünen T-Shirt.
»Oh, hallo.«
Sie lächelte ihn an, ihre Augenbrauen schnellten in die Höhe, und sofort dachte Stefan, er hätte einen Termin übersehen. Das passierte ihm öfter, wenn er mit einem Forschungsprojekt beschäftigt war. Wie spät war es überhaupt? Er hatte den Wecker des Handys gestellt, um nicht auf die Uhrzeit achten zu müssen. Kurz nach achtzehn Uhr sollte er sich auf den Weg machen, wenn er noch Blumen für seine Mutter kaufen wollte.
»Stefan Schneider«, sagte die Frau in der Tür und nickte.
Er nickte zurück.
Manchmal, wenn er den ganzen Tag gearbeitet hatte, schien seine Sprache mit seinen Gefühlen zu kollidieren. Er war dann so in seiner inneren Welt eingekapselt, dass er sich erst wieder an einen anderen Menschen gewöhnen musste.
»Du hast dich kein bisschen verändert«, sagte sie.
Für einen Augenblick sah er sie schweigend an. Sie kam ihm bekannt vor, aber er hatte keine Ahnung, woher.
Die kurzen braunen Haare betonten ihre auffallend großen Augen hinter der Brille mit so hellgrünem Gestell wie ihr T-Shirt.
»Du hast keine Ahnung mehr, wer ich bin, oder? Es ist auch lange her. Meine Haare waren damals lang, ich war blond …« Sie nahm die Brille ab. »… und ich hab die noch nicht gebraucht. Wir haben zusammen studiert. Bevor ich …«
Sie sprach nicht weiter, trat einen Schritt in sein Büro, legte einen Finger an die Schläfe, als würde sie nachdenken, und kniff ihre Augen zu einem scharfsinnigen Blick zusammen. Und da wusste er sofort wieder, wer sie war.
Marie Kronsteiner. Sie hatte im Hörsaal oft in seiner Nähe gesessen. Ein erfreuter Laut entkam ihm, es klang wie ein Bellen.
»Marie«, sagte er rasch mit tiefer Stimme.
Sie nickte und legte den Kopf leicht schief.
»Hallo, Stefan.«
Ihr breites Lächeln erinnerte ihn sofort wieder, wie sie früher manchmal zu ihm herübergesehen hatte, wenn sie gute Noten bekamen oder ihre Arbeiten gelobt wurden. Wochenlang hatte er sich gefragt, warum sie plötzlich nicht mehr in die Vorlesungen gekommen war. Er hatte sie vermisst. Sich sogar überlegt, ob er sie anrufen sollte. Doch das waren nur hypothetische Gedanken, natürlich hatte er es dann doch nicht gemacht. Sie hatte sich verändert, war erwachsener geworden. Aber noch immer genauso attraktiv wie damals.
Er stand vom Schreibtisch auf und versuchte dabei lässig zu wirken.
Eine erwachsene, selbstsichere Version von Stefan Schneider, dem mit Auszeichnung promovierten Wissenschaftler. Und nicht mehr Stefan Schneider, der Streberstudent. Der sie fragen wollte, ob sie mit ihm ausging, und sich dann bei jedem Versuch doch immer in physikalische Themen flüchtete, weil das ein sichereres Terrain war.
»Das ist zwölf Jahre her«, sagte er und streckte ihr die Hand entgegen. Sie grinste, doch gerade als er sich fragte, ob diese Begrüßung zu förmlich war, schüttelte sie ihm die Hand.
»Du hast ein perfektes Gedächtnis. Wie damals.«
Er sah sie einen Moment zu lange an und dachte, dass sein Gedächtnis nicht der Grund war, warum er sich daran erinnerte. Marie hatte immer so unerschrocken gewirkt. Als hätte sie das Leben im Griff und wüsste, was sie wollte. Und nicht umgekehrt, wie bei ihm. Das hatte er an ihr bewundert. Sie war freundlich zu den größtenteils männlichen Studenten und trotzdem bestimmt gewesen, wenn es den Anschein hatte, dass sie nicht mit dem gleichen Respekt behandelt wurde. Etwas in der Art hatte er ihr damals sagen wollen. Nur weniger abgehoben.
»Als ich unten beim Eingang deinen Namen gelesen habe, dachte ich mir, dass du dieser berühmte Wasser-Mann an der Uni bist. Das war ja damals schon dein Steckenpferd.« Sie deutete auf sein Hemd. »Und ist es heute nur purer Zufall, oder trägst du noch immer ausschließlich Hawaiihemden wie früher?«
Er musste lächeln und spürte, wie ihm das Blut in die Wangen schoss. »Kein Zufall.«
Sie schnalzte mit der Zunge.
»Dabei dachte ich, du machst das, damit du auf den Studentenpartys aus der Menge herausstichst.«
Stefan war in seinem Leben auf gerade mal zwei Studentenpartys gewesen, und das so kurz, dass er sein halbes Bier stehen gelassen hatte. Aber das war eben so – jeder schätzte ihn geselliger, als er war. Und er entfernte sich normalerweise rasch genug, bevor man ihm draufkommen konnte. Meistens. Das war die beste Strategie.
Der neuerliche Beweis dafür war Anja, die wahrscheinlich gerade in seine Wohnung fuhr, um ihre Habseligkeiten zu holen. Ein weiterer gescheiterter Versuch einer Beziehung in der nichtlinearen Differenzialgleichung seines Lebens. Gratulation. Von wegen seiner Theorie »das Wasser im menschlichen Körper strebt nach Verbindung«. Nach drei Monaten hatte sie ihm gestern den Laufpass gegeben. Einfach so, am Telefon. Der Gedanke gab ihm einen Stich. Es hatte ihn vollkommen überrascht, was sie wiederum als »sehr lustig« kommentiert hatte. Ironisch gemeint.
»Woran arbeitest du gerade?«, fragte Marie. Sie deutete zu seinem Schreibtisch. »Darf ich?«
»Natürlich.«
Er freute sich über ihr Interesse und trat zur Seite. Kam es ihm nur so vor, oder roch sie noch immer wie damals? Nach frisch gewaschener Wäsche und einem Hauch Lavendel.
Dass er das nach all den Jahren noch wusste, sich aber nicht daran erinnern konnte, wo er vor ein paar Stunden sein Auto geparkt hatte.
Sie beugte sich über die Unterlagen.
»Die Reaktion von Wassermolekülen bei elektrischer Ladung«, las sie. »Spannend. Um was genau geht es?«
»Wasser im menschlichen Körper. Genauer gesagt, ich untersuche gerade die Art von Protonen darin, die durch die elektrische Ladung, die Herzschläge erzeugen, entstehen.«
Marie faltete ihre Hände, als würde sie beten, und grinste. Da sah er ihren Ehering. Das machte ihn trotz der langen Zeit, die vergangen war, tatsächlich ein bisschen wehmütig. Er überspielte es mit einem Lächeln.
Sie legte den Kopf in den Nacken und seufzte.
»Oh, das ist lange her … ich habe seit einer Ewigkeit niemanden mehr von Protonen und elektrisch geladenem Wasser sprechen hören. Das klingt wie Musik in meinen Ohren.«
Sie lächelte dabei die ganze Zeit, und Stefan war sich nicht sicher, ob sie sich lustig machte oder es ernst meinte.
»Und was genau untersuchst du bei diesen Protonen im menschlichen Körper?«, fragte sie.
»Sie reagieren magnetisch und streben nach inniger Verbindung.« Er verschränkte die Finger ineinander, wie er es sonst auch bei seinen Vorlesungen machte. »Es ist eine Art eigener Zustand, wie flüssig, verdampft, gefroren, nur können wir ihn nicht mit bloßem Auge erkennen, darum …«
»Moment. Willst du damit sagen, du hast herausgefunden, das Wasser im menschlichen Körper ist magnetisch?«
»Nicht das ganze Wasser. Aber die elektrisch geladenen Teilchen, die Protonen darin. Ja, genau.«
»Aber – und korrigiere mich bitte, wenn ich falschliege – wir sprechen hier von einhundert Trillionen Trillionen Wassermolekülen?«
»Stimmt. So viele befinden sich in jedem Menschen.«
Er hörte sich an wie in einer Quizshow.
Sie setzte sich auf den Stuhl hinter seinem Schreibtisch, sah wieder auf die Unterlagen und dann zu ihm.
»Weißt du, was das bedeutet, Stefan? Das heißt, es wäre der Beweis schlechthin, warum Menschen sich verbinden. Sie müssen es. Ob sie wollen oder nicht.«
»Ganz richtig, es hat den Anschein, diese Theorie könnte unter diesem Aspekt wahr sein.«
Bitte hör auf, so gestelzt zu klingen, und rede normal.
Sie schien es gar nicht zu bemerken, denn sie runzelte die Stirn, und da war auch wieder dieser scharfsinnige Blick wie früher.
»Das ist gigantisch. Stell dir vor, du nimmst einen ein Meter langen Stab und legst ihn einhundert Trillionen Trillionen Mal aneinander. Dann würde er von einer Seite des Universums bis zur anderen reichen. Und genau so eine Größenordnung an Protonen hat jeder Mensch in sich? Diese riesige Menge an winzig kleinen Magneten?«
»Ja.«
Ein »ja« war unverfänglich, ein »ja« ging immer.
Sie sah ihn verblüfft an. Nein, er hatte sich geirrt. Sie war vielleicht äußerlich erwachsener geworden, aber sonst noch ganz genauso wie früher.
»Das ist die Entdeckung.« Sie lachte auf. »Endlich habe ich eine Erklärung für jede grauenhafte Beziehung in meinem Leben. Die wollte gar nicht ich – sondern das Wasser in mir. Ich wusste es. Das ist genial.« Sie strahlte ihn an. »Ernsthaft, dafür bekommst du den Nobelpreis, Stefan.«
Er lachte auf und schüttelte den Kopf. An ihrer Reaktion war zu merken, dass sie schon lange nicht mehr mit der Materie zu tun hatte. Trotzdem nahm er alles in sich auf, ihre Begeisterung, ihre Scherze und auch ihr Staunen. Er lächelte sie an. Und jetzt sollte er etwas sagen. Etwas Charmantes.
»Was verschlägt dich hierher, Marie?« war alles, was ihm einfiel. Er hoffte, dass er sich sicherer anhörte, als er sich fühlte. Lässig versteckte er seine Hände in den Hosentaschen, weil er nicht wusste, wo er mit ihnen hinsollte.
»Oh, ich wollte mich nur kurz umsehen, und weil ich so spät noch Licht in deinem Büro gesehen habe, dachte ich, ich schau mal rein.«
»Wieso so spät?«
Stefan sah auf die Uhr über der Tür. Das konnte nicht stimmen. Die Zeiger standen kurz vor neunzehn Uhr.
»Was ist los?«, fragte Marie und folgte seinem Blick.
»Mein Wecker hat nicht geläutet. Ich muss zu einem Termin.«
Im Laufschritt holte er sein Sakko von der Stuhllehne. Marie begleitete ihn bis zum Ausgang auf den Karlsplatz. Sie sprach über die gemeinsame Studienzeit und ehemalige Kommilitonen, während Stefan fieberhaft nachdachte, wo er geparkt hatte. Dann trennten sich ihre Wege. Er überlegte, was er ihr zum Abschied sagen könnte. Etwas jenseits eines floskelhaften: »Hat mich gefreut, dich wiederzusehen.«
Doch sie kam ihm zuvor.
»Wir sehen uns morgen, Stefan. Hochoffiziell.«
Er hatte keine Ahnung, was sie meinte, aber »morgen« klang auf jeden Fall gut. Und dann lief er auch schon los in der Hoffnung, sein Gedächtnis möge anspringen wie ein Motor und ihm den Weg zum Auto weisen.
In weniger als einer halben Stunde würden fünfundfünfzig Gäste im Garten seines Elternhauses, das sie alle nur »die Villa« nannten, vergebens darauf warten, »Happy Birthday, Hannah« zu rufen, wenn er seine Mutter nicht rechtzeitig zu ihrer Überraschungsparty brachte.
2.
Hannah Schneider war froh, als sie endlich das Klingeln an der Tür ihrer Hausverwaltung hörte. Seit diesem Anruf vor einer Stunde saß sie wie auf Nadeln.
»Bitte sag, dass Martin keine Überraschungsparty für mich gibt«, sagte sie, kaum dass sie geöffnet hatte. Stefan senkte sofort den Blick. Ihr jüngster Sohn war zwar ein erfolgreicher Wissenschaftler mit diversen Auszeichnungen, aber er war schon immer ein dramatisch schlechter Lügner gewesen. Er konnte nie den Augenkontakt halten und bekam diesen überforderten Gesichtsausdruck. Hannah wusste Bescheid, bevor er ihr überhaupt den Ansatz einer Antwort lieferte.
»Oh Gott, Martin tut es wirklich«, sagte sie.
Schon die ganze Woche hatte sie sich auf einen gemütlichen Abend mit ihm, ihren Kindern und beiden Enkelkindern im Fratellis, ihrem Stammitaliener, gefreut.
»Was? Nein, natürlich nicht«, bemühte Stefan sich. »Alles Gute zum Geburtstag, Mama.«
Ihr Sohn küsste sie eilig auf die Wange.
»Also, gehen wir?«
Hannah strich sich den engen schwarzen Seidenrock glatt, um Zeit zu gewinnen. Kurz fragte sie sich, ob man seine eigene Überraschungsparty versäumen durfte? Nein, natürlich nicht. Dass sie überhaupt daran dachte, musste am Sekt liegen, mit dem sie am Nachmittag im Büro angestoßen hatten. Sie vertrug anscheinend tatsächlich keinen Alkohol mehr. Sie fuhr sich über das Gesicht, ihre sonst hochgesteckten dunkelblonden Locken flossen über die Schultern. Sie war am Morgen vor dem Büro beim Yoga gewesen, wie jeden Donnerstag. Hätte sie das mit der Party gewusst, wäre sie nicht hingegangen. Sie war so müde. Vielleicht lag es auch daran, dass sie die letzten Nächte kaum geschlafen hatte.
Nein, nicht daran denken, es gab jetzt Wichtigeres. Wo waren eigentlich ihre Schuhe? Nachdem ihre Sekretärin Frau Karinger gegangen war, hatte sie sie ausgezogen, aber sie war so zerstreut, dass sie keine Ahnung mehr hatte, wo.
»Komm bitte noch rein, Stefan. Ich muss meine Schuhe suchen.«
»Sind sie das dort?«
Stefan deutete zur Biedermeierkommode. Unter den geschwungenen Holzbeinen lugten zwei schwarze Absätze hervor. Hannah konnte sich gar nicht erinnern, wie sie dort gelandet waren. Sie musste sich konzentrieren.
Eilig fischte sie die Pumps hervor und ging im Kopf die Liste ihrer Freundinnen durch. Wenn Martin ihre engsten und von einigen deren Partner eingeladen hatte, dann wären es um die fünfzehn Personen. Oder zwanzig. Höchstens.
»Hat Martin dir gesagt, wie viele Gäste es sein werden?«, fragte sie, während sie in die Schuhe schlüpfte.
»Wir sollten jetzt los«, wich Stefan aus.
»Stefan, bitte. Wie viele Leute kommen heute Abend?«
Sie sprach absichtlich sehr langsam und deutlich, wie immer, wenn ihr etwas wirklich wichtig war. Das funktionierte meistens. Stefan seufzte und runzelte die Stirn.
»Na gut. Woher weißt du es?«
Er wirkte bekümmert. Sie sah ihn an und wurde von einer solchen Liebe erfasst, dass sie ganz automatisch ihre Hand ausstreckte und ihm über die Wange streichelte. Erst als sie seinen erstaunten Blick bemerkte, registrierte sie, was sie da tat. Als wäre er ein kleiner Junge und nicht ein einunddreißig Jahre alter Mann. Rasch zog sie ihre Hand zurück.
»Die Cateringfirma hat vor einer Stunde angerufen, weil sie nicht ins Haus gekommen sind. Sie hatten meine Nummer aus dem Internet. Ich habe gesagt, das muss ein Irrtum sein, da haben sie anscheinend ihren Fehler bemerkt und sehr schnell aufgelegt. Also, wie viele?«
»Fünfundfünfzig.«
Sie zuckte zusammen.
»Wie bitte?«
Er nickte. »Es erwarten dich fünfundfünfzig Gäste.«
»Nein!« Ihre Stimme war hochgerutscht. »Weil ich fünfundfünfzig Jahre alt werde, hat Martin fünfundfünfzig Gäste eingeladen?«
Er deutete auf ihre weiße Bluse.
»Ja. Und du hast da einen kleinen Kaffeefleck.«
Sie sah an sich herunter.
»Ich muss in die Küche.«
Stefan folgte ihr. Sie deutete auf den schwarzen Esstisch, auf dem eine halbe Sachertorte mit einer abgebrannten Geburtstagskerze stand.
»Möchtest du ein Stück?«
»Nein, danke. Wir sollten wirklich los.«
»Gib mir fünf Minuten.«
Während sie ihre Bluse reinigte, fiel ihr im Spiegel über dem Waschbecken auf, dass ihr Haaransatz an den Schläfen schon wieder grau war. Die Zeichen der Zeit hatten sie nach all den Jahren doch überraschend plötzlich eingeholt. Vielleicht hatte sie es aber bis jetzt auch einfach nicht bemerkt. Oder ausgeblendet. Sie musste daran denken, wie sie früher manchmal für die ältere Schwester ihrer Kinder gehalten worden war.
Sie war noch so jung gewesen, als Fred auf die Welt kam. Einen Augenblick blieb ihr Blick an ihrem Spiegelbild hängen. Wo war die naive, hoffnungsvolle Hannah Schneider von damals?
Stefan trat hinter sie. Er tippte auf sein Handgelenk, als wäre dort eine Uhr.
»Du siehst sehr gut aus, Mama.«
»Danke. Aber hätte Martin nicht einfach fünfundfünfzig Kerzen in eine Torte stecken können?«, murmelte sie und betrachte ihren Sohn im Spiegel.
Erst wenn sie ihn neben sich sah, fiel ihr wieder auf, wie ähnlich er seinem Vater sah. Genauso hinreißend, aber im Gegensatz zu John hatte sie bei Stefan den Eindruck, es würde ihn ärgern. Dabei war alles an seinem Gesicht eine fast schon perfekte Einheit. Die melancholischen dunklen Augen unter den dichten Brauen, die hohen Wangenknochen, das schnittige Kinn und die geschwungenen Lippen. Natürlich fand jede Mutter ihre Kinder schön, aber Stefan sah aus, als hätte John ihn gemalt. Was würde John wohl dazu sagen, wenn er …
Sie stoppte die Frage, noch bevor sie sie beendet hatte. Was war das nur in letzter Zeit? Immer wieder tauchte John in ihren Träumen auf und weckte sie mitten in der Nacht. Und selbst dann, wenn sie mit klopfendem Herzen wach lag, hatte sie den Eindruck, als würde er neben ihr am Bett sitzen.
Sie konzentrierte sich auf Stefan, der ungeduldig hinter ihr stand.
Seine blasse Haut und die leicht eingefallenen Wangen verrieten ihr, dass er zu viel arbeitete. Ob er glücklich war? Stefan hatte noch nie viel geredet. Nein, das stimmte so nicht, aber diesen Gedanken schob sie rasch beiseite.
Er hob die Augenbrauen zu einer stummen Frage. Für einen Augenblick war es fast so, als würde John hinter ihr stehen und nicht ihr Sohn.
Sie sah rasch weg, mit einer Hand stopfte sie die Bluse in den engen Rock, während sie eine Spraydose aus dem Schrank unter dem Waschbecken holte. In Sekundenschnelle waren ihre Schläfen so dunkelblond wie der Rest ihrer Haare, sie drehte sie zu einem Knoten und steckte sie fest. »Fünfundfünfzig«, sagte sie, als könnte sie es selbst nicht glauben. Es war so schnell passiert. »Ich bin zu jung, um alt zu sein, und zu alt, um jung zu sein.«
Stefan lächelte milde im Spiegelbild.
»Alter ist relativ.«
»Nur für Wissenschaftler.«
Sie verteilte Rouge auf den Wangen. Wo war der Abdeckstift? Ihre Augenschatten hatten die Farbe von Auberginen.
»Mama, wir sollten jetzt los.«
»Eine Minute.«
Stefan schien es aufzugeben, er setzte sich an den Tisch, brach ein kleines Stück Torte ab und steckte es in den Mund. Sie drehte sich um und betrachtete ihn. Er starrte gedankenverloren vor sich hin. Sein hellgrünes Hemd mit den pinkfarbenen Flamingos blitzte unter dem Sakko hervor. Hoffentlich würde sich Fred nicht darüber lustig machen. Schon die letzten Male war ihr Freds vordergründig lustiger, aber in Wahrheit abschätziger Kommentar über die Vorliebe seines Bruders für Hawaiihemden nicht entgangen. Im nächsten Moment schüttelte sie über sich selbst den Kopf.
Meine Güte, ihre Söhne waren erwachsene Männer und keine kleinen Jungen. Wieso dachte sie so etwas? Warum jetzt auf einmal? Waren das die Wechseljahre? Oder war etwa ihr Geburtstag daran schuld? Nein, stopp. Es war wirklich nicht der richtige Zeitpunkt, daran zu denken. Sie wollte sich schon wieder zum Spiegel drehen, da sah sie den Schlüssel. Er lag neben dem Teller mit der Torte. Sie musste ihn liegen gelassen haben, als sie aus dem Keller hochgekommen war.
»Wenn du und Emma und Fred mit Lydia und den Zwillingen kommen, wer sind dann eigentlich die anderen – achtundvierzig Gäste?«, lenkte sie ab, während sie den Schlüssel nahm und ihn beiläufig in der Besteckschublade verschwinden ließ.
Hatte Stefan etwas bemerkt? Sie wagte nicht, ihn anzusehen. Sonst würde sie sich garantiert verraten. Wieso war sie überhaupt dort unten gewesen? Das war dumm, so dumm.
»Keine Ahnung«, sagte Stefan. Er klang ganz normal, stellte sie erleichtert fest. Nein, es war ihm sicher nicht aufgefallen.
Sie fand den Abdeckstift und verteilte die Creme unter den Augen. Im Spiegelbild warf sie Stefan einen kurzen Blick zu. Er schien genauso wenig begeistert von der Party zu sein wie sie.
Wen Martin wohl eingeladen hatte? Auf jeden Fall musste er sich unglaubliche Mühe gegeben haben. Darum hatte er die letzten beiden Wochen also oft so angespannt gewirkt. Sie sollte sich wirklich zusammenreißen. Ein bisschen stärkere Unterstützung konnte da auch nicht mehr schaden. Sie holte eine Flasche Cognac aus einem der Küchenschränke, goss sich zwei Fingerbreit ein und prostete Stefan zu.
»Auf ein rauschendes Fest«, sagte sie und leerte das Glas auf einen Zug.
»Ich kann mich …«
Das Klingeln von Stefans Handy unterbrach seinen Satz. Er formte stumm Martins Namen, während er abhob.
»Hallo, Martin. … Wir fahren sofort los. … Oh, dein Auto springt nicht an. Ja, natürlich holen wir dich von zu Hause ab und fahren dann gemeinsam ins Fratellis.« Das war also der Vorwand, unter dem Stefan sie zur Überraschungsparty bringen sollte statt zum Italiener. »Nein, noch in der Hausverwaltung … ja, wir brechen jeden Moment auf.«
Er klang bei seiner Lüge so unecht und angestrengt, als würde er einen Text ablesen, den er nicht verstand. Es fiel ihr schwer, das Lachen zu unterdrücken. Aber Martin schien Stefans Mühen nicht zu bemerken. Sie hörte ihn voller Vorfreude aus dem Telefon glucksen wie ein Kind am Weihnachtsabend.
Ein Gefühl von Dankbarkeit überfiel sie so plötzlich, dass sie sich umdrehen musste. Tränen stiegen ihr in die Augen. Der Cognac war doch ein Fehler gewesen. Jetzt wurde sie auch noch rührselig.
»Bist du fertig?«, fragte Stefan, nachdem er aufgelegt hatte. Sie nickte, dabei war ihr plötzlich wirklich nach Weinen zumute. Warum, wusste sie selbst nicht. Sie wollte es nicht, aber die Tränen kullerten über ihre Wangen.
»Mama?«
Er trat neben sie mit einem erschrockenen, fast schon schockierten Blick. Sie schüttelte den Kopf, winkte ab und streichelte ihm reflexartig über den Oberarm.
»Alles in Ordnung, Stefan. Deine Mutter spinnt nur ein bisschen.«
Sie versuchte ein Lachen, merkte aber selbst, wie es ihr misslang. Schnell wischte sie sich die Tränen ab und übermalte die länglichen Spuren im Make-up mit dem Abdeckstift. Als könnte sie das schlechte Gewissen, das aus seinem Versteck gekrochen war und ihr die Brust zuschnürte, damit ausradieren.