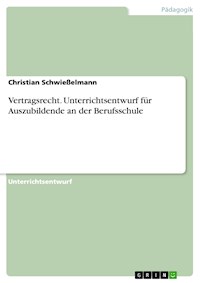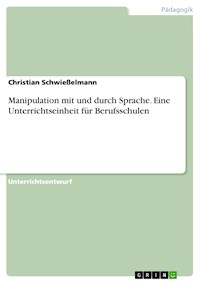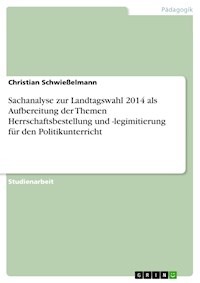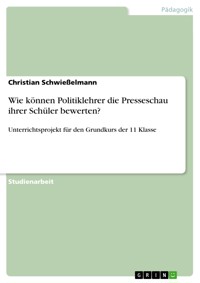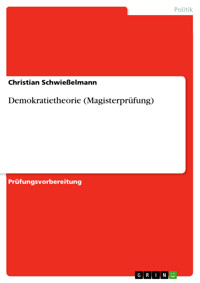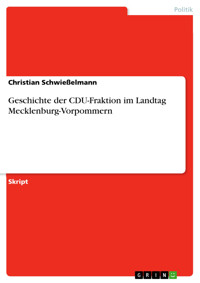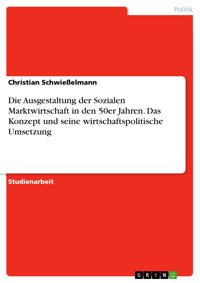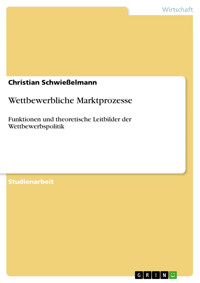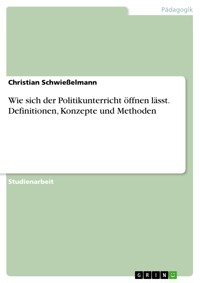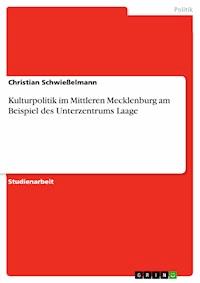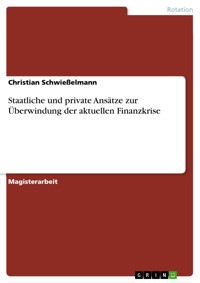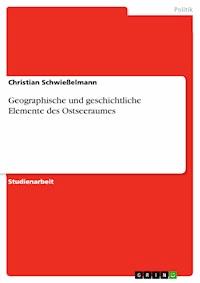Auf den Spuren Richard Wossidlos. Volkskundliche Sammlung am Beispiel der mecklenburgischen Kleinstadt Laage um die Jahrhundertwende und später E-Book
Christian Schwießelmann
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Ethnologie / Volkskunde, Note: sehr gut, Universität Rostock (Institut für Volkskunde (Wossidlo-Archiv)), Veranstaltung: Lesen des Kulturprofils einer Landschaft mit volkskundlichen Quellen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Hauptseminararbeit widmet sich in erster Linie der Entstehung der mecklenburgischen Volkskunde Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Warener Gymnasiallehrer Richard Wossidlo gilt als Nestor seines Fachs in Mecklenburg. Seine Sammeltätigkeit auf der Grundlage einer modernen, wissenschaftlichen Sammeltechnik führte zu einer ungemeinen Dichte von Volksüberlieferungen aus einer Region. Sie basierte auf der Zusammenarbeit mit Beiträgern vor Ort. Die Arbeit macht dies am Beispiel der mecklenburgischen Kleinstadt Laage deutlich. Hier waren die bedeutsamsten Beiträger und Korrespondenten Wossidlos der Pastor und Schriftsteller Carl Beyer sowie der Bürgermeister und Heimatdichter Fritz Kähler. Ihnen und ihren weniger bedeutenden Gefährten ist der Hauptteil dieser Arbeit gewidmet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2003
Ähnliche
Page 1
Page 2
Page 4
Einleitung - Sammeltechnik Richard Wossidlos 3
1. Einleitung - Sammeltechnik Richard Wossidlos oder:
Wie Mecklenburg volkskundlich erschlossen wurde
Über Leben und Werk Richard Wossidlos (1859-1939) braucht man eigentlich kein Wort mehr zu verlieren. Längst ist der „Volksprofessor“ auch außerhalb deresoterischenGrenzen des volkskundlichen Wissenschaftsbetriebes zur „Symbolgestalt für Mecklenburg“ (NEUMANN 1996, S. 20) geworden. Die Literatur über den Forscher und Sammler, der die (mecklenburgische) Volkskunde als wissenschaftliche Disziplin gewissermaßen zu inaugurieren half, steigt ins Unermeßliche; sein Nachlaß bildet den Grundstock des Wossidlo-Archivs, dem jetzigen Institut für Volkskunde in Mecklenburg-Vorpommern, das 1999 in die Universität Rostock vollintegriert wurde.1Dank der volkskundlichen Forschung der Wossidlo-Forschungsstelle, die 1954 eröffnet wurde und der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin angegliedert war (vgl. NEUMANN 1997, S. 8ff), bietet sich dem Betrachter das Werk Wossidlos selbst überschaubarer dar. Wie bei den hinterlassenen 1,5 bis 2 Mio. Zetteln, die die berühmte Zettelwand bilden und auf die der Warener Oberlehrer die gesamten mecklenburgischen Volksüberlieferungen zu bannen suchte, begannen hier die Erschließungsarbeiten zügig. Zum 100. Geburtstag Wossidlos 1959 erschien im Deutschen Jahrbuch für Volkskunde eine noch heute gültige Bibliographie (siehe BENTZIEN 1959, S. 153ff).2Ihr lassen sich die wichtigsten Quellen und Selbstauskünfte Richard Wossidlos zu seiner Sammeltätigkeit entnehmen.
Ein Jahr später, 1960, veröffentlichte Paul Beckmann ebenfalls im Jahrbuch eine kurze, würdigende Darstellung des Lebenswerkes des Sammlers, die die bisher einzige, freilich unkritisch überhöhende Biographie Wossidlos aus der Feder Karl Gratopps ergänzt. Darin geht der erste Leiter der Wossidlo-Archivs nicht nur auf die Bedingungen mecklenburgischer Volksüberlieferungen ein, sondern systematisiert Wossidlos Sammlungen nach ihrem Inhalt. Sie bestehen aus:
1Angesichts der Schwierigkeiten bei der Einführung eines Studienganges Volkskunde/Europäische Ethnologie scheint dieser Prozeß noch nicht abgeschlossen. Außerdem sind wichtige Fragen zur zukünftigen Raum- und Personalausstattung immer noch unbeantwortet. Auf die chronische Finanznot der Universitäten M-Vs braucht in diesem Zusammenhang nicht erst hingewiesen werden. Siehe dazu SCHMITT 1998 und SCHMITT 2000, S. 179ff.
2Wolfgang Steinitz als Schriftleiter des Jahrbuchs ließ es sich bei diesem Anlaß trotz rhetorischer Distanz zum Versuch, den wohl unpolitischen, konservativen Wossidlo „als Sozialisten proklamieren zu wollen“ (STEINITZ 1959, S. 5), nicht nehmen, mit der Waffe der sozialkritischen, sozialistischen Volkskunde der DDR gegen die romantisch-patriarchalisch verklärte, traditionelle westdeutsche zu polemisieren und die Wossidlo-Ehrung mit einer Tagung über antifeudale Volksdichtung organisch verbunden zu sehen.