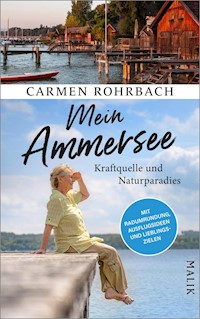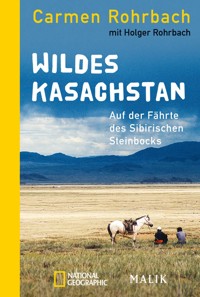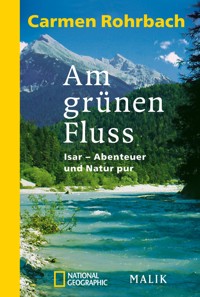14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Carmen Rohrbach durchstreift sechs Monate lang die junge Vulkaninsel am Rande des Polarkreises. Im Tal des Markarfljót zeltet sie unter der gewaltigen Eruptionswolke des berühmtberüchtigten Vulkans Eyjafjallajökull. Sie begleitet den jährlichen Schafabtrieb nahe einer Farm im Nordwesten der Insel. Auf einsamen Wanderungen im Hochland beobachtet sie die wilde Tierwelt, steigt hinauf zum geheimnisvollen Krater Askja und auf den Gipfel der Herðubreið, der Königin der Berge. Sie erkundet die Hauptstadt Reykjavík und taucht ein in das künstlerische Gemeindeleben des unberührten Küstenortes Vík am südlichsten Zipfel Islands.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Cover & Impressum
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de Mit 41 Fotos und einer Karte Der Verlag dankt für die Genehmigung zum Abdruck aus dem Werk Isafold, Reisebilder aus Island von Ina von Grumbkow, hrsg. von Marion Malinowski. Verlag Literatur Wissenschaft, Marburg 2006. Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe 1.Auflage 2011 ISBN 978-3-492-95352-8 © Piper Verlag GmbH, München 2011 Umschlaggestaltung: Birgit Kohlhaas, Egling Fotos: Carmen Rohrbach Karte: Eckehard Radehose, Miesbach
Die Wolke aus dem Vulkan
In einem Boot schaukele ich übers Meer. Von einer Welle werde ich emporgehoben, stürze hinab ins Wellental, um mit der nächsten Woge wieder in die Höhe zu steigen. Ich fürchte mich, will um Hilfe schreien, aber kein Laut dringt aus meiner Kehle– da erwache ich aus meinem Traum. Es ist die Erde, die sich bewegt, sich hebt und senkt, stößt und pufft, nach oben drängt und wieder nach unten fällt. Ein Erdbeben!
Ich liege im Zelt auf einer Bergwiese in Island, weit unter mir im Tal fließt der Gletscherfluss Markarfljót. Vor Schreck bin ich wie erstarrt. In Südamerika habe ich dieses Gefühl der Ohnmacht schon einmal durchlitten, wenn die so fest und sicher erscheinende Oberfläche unseres Planeten aufbricht in Spalten und Risse. Ein Impuls rast durch meinen Körper, gibt mir den Befehl: »Nichts wie weg! Lauf um dein Leben!« Mein Verstand zwingt die Panik nieder. Zitternd vor Aufregung öffne ich den Reißverschluss am Zelteingang und schaue hinaus. Es ist drei Uhr in der Nacht und doch nicht wirklich dunkel. Im isländischen Frühling versinkt die Sonne nachts zwar noch für wenige Stunden, aber der Himmel bleibt diffus grau. Es ist hell genug, dass ich die Umgebung erkennen kann: das gelbe vorjährige Gras, dürre Sträucher, Steine und Felsen, den ansteigenden Hang. Nichts Bedrohliches also, und auch die Erde bebt nicht mehr.
Viel zu aufgeregt, um wieder einschlafen zu können, krieche ich aus dem Zelt. Als ich mich aufrichte, erschüttert ein Dröhnen und Donnern die Luft. Es pfeift und zischt, grollt, knallt und poltert. Und dann sehe ich sie aufsteigen– die Wolke. Dunkel, graubraunschwarz, himmelwärts quillt sie empor, immer höher. Wild brodelt sie und wirkt dabei weich wie Watte. Sie steigt aus dem Vulkan Eyjafjallajökull an der gegenüberliegenden Talseite. Als ich gestern ankam, reichte der Nebel bis zum Fuß des Berges, und ich konnte die Aschewolke nicht sehen, hörte aber das Donnergetöse des Vulkanausbruchs. In der Nacht schwieg er, jetzt verschafft er sich wieder lautstark Gehör.
Blitze zucken in der Wolke. Es sieht gespenstisch aus. Die Ascheteilchen reiben aneinander, dabei laden sie sich elektrisch auf und entladen sich im Blitz. Glühende Lavabrocken werden von einer gewaltigen Kraft aus dem Erdinneren emporgeschleudert, fallen zu Stein erstarrt wieder zurück, prasseln nieder auf den felsigen Kraterrand.
Der Anblick der Aschewolke ist furchterregend, zugleich aber bin ich wie verzaubert. Sie birgt Gefahr in sich und Zerstörung und ist doch ungewöhnlich schön. Seltsam, warum kann auf uns Menschen das Schreckliche so anziehend wirken? Wir fürchten uns bei Waldbränden, Hochwasser und reißender Flut und können dennoch unseren Blick nicht abwenden, erleben ein Gefühl zwischen Grauen und Faszination.
Am oberen Rand der dunklen Wolke sehe ich einen rötlichen Schimmer, der sich ausdehnt, als würde die Wolke von innen glühen. Es ist die aufgehende Sonne, die mit ihrem warmen Licht die wabernde Vulkanasche färbt. Eingehüllt in meinen Schlafsack hocke ich vor dem Zelt, bin wie gebannt. Donnernd stößt der Vulkan neue Wolken aus. Zuerst sind sie kompakt, dann dehnen sie sich aus, als würden Blumen sich öffnen, ähneln Chrysanthemen mit ihren großen Blütenblättern. Von nachdrängenden Wolken gestoßen, steigen sie immer höher, sieben oder sogar neun Kilometer, so hoch wie der Mount Everest. Ich muss an das Märchen vom süßen Brei denken: Ein Zaubertopf kocht unaufhörlich, kocht und kocht, bis der Hirsebrei überquillt. Der Brei füllt zuerst die Küche, dann das Haus, ergießt sich in die Gasse, schließlich in das ganze Dorf und ist nicht zu stoppen. Ebenso pausenlos produziert der Eyjafjallajökull mit Donnergetöse seine Aschewolken, stößt sie aus dem Leib der Erde aus. Der Wind weht die Asche von mir fort nach Südosten.
Die Sonne steigt über den Horizont. Die Rotfärbung ist erloschen, die Wolke wirkt jetzt bedrohlich dunkel. Die Blitze sind im hellen Licht nicht mehr zu sehen und auch nicht das Glühen der emporgeschleuderten Lava.
Die Eisumschlungene
Aus dem Flugzeugfenster sehe ich unter mir das Wellengekräusel des Atlantiks. Noch ist der Himmel klar. Doch bald, lange bevor wir uns Island nähern, zieht sich ein dunkles Band durch das tiefe Blau. Hier ist sie, die berüchtigte Aschewolke, die so viel Ungemach verursacht. Im Moment weht der Wind sie in eine Richtung, die für unseren Flug ungefährlich ist.
Nach Island reise ich, weil der Name »Eisland« meine Phantasie schon als Jugendliche entzündet hat. Eisiges Land, geprägt von Gletschern und Vulkanen. Erst spät in der Menschheitsgeschichte wurde es besiedelt, allerdings nur entlang der Küste. Im Innern ist es wild und einsam. Kontraste ziehen mich an, ich mag Hitze und Kälte gleichermaßen. Wo kann ich mehr Gegensätze finden als auf Island?
Doch warum hat es so lange gedauert, bis ich meinen Jugendtraum endlich verwirklichte? Die Weichen stellten sich seit meiner Ankunft in Westdeutschland in andere Richtungen. Da war zunächst der Forschungsauftrag auf den Galapagos-Inseln, wo ich Spanisch lernte und wo sich danach Reisen nach Südamerika anboten. Dennoch verlor ich Island nie aus dem Blick, sammelte alle Informationen, die ich bekommen konnte. Irgendwann werde ich hinfahren, sagte ich mir, doch stets drängten sich mir andere Ziele in den Sinn: Mongolei, Namibia, Jemen, Patagonien, Ägypten. Eines Tages fiel mir das BuchIsafoldin die Hände, die »Eisumschlungene«. So nannte Ina von Grumbkow die Insel. Was sie über ihre Reise im Jahr1908 schrieb, war der letzte Anstoß, mich endlich auf den Weg zu begeben. Aber ich wollte nicht mit dem Schiff fahren wie die Schriftstellerin, die von Berlin über Kopenhagen, Edinburgh, die Orkney- und Faröer-Inseln nach Island reiste. Ich wähle lieber das Flugzeug. Von München mit Zwischenlandung in Kopenhagen dauert der Flug nur vier Stunden– kein Vergleich zu den zwei Wochen, die Ina von Grumbkow unterwegs war.
Sechs Tage vor meinem Flugtermin am 14.April brach der Eyjafjallajökull aus, sandte seine Aschewolke über den Atlantik und stoppte den Flugverkehr auf fast allen europäischen Flughäfen. Musste ich nun doch die Fähre nehmen? Zu meiner großen Erleichterung konnte kurzzeitig wieder geflogen werden, einen Tag später herrschte schon wieder Flugverbot. Bis zuletzt bangte ich, ob die Maschine wirklich starten dürfe. Erst als nach der Zwischenlandung in Kopenhagen das Flugzeug abhob, begann ich, an eine Landung in Island zu glauben.
Island verbirgt sich unter einer grauen Wolkenschicht. Beim Landeanflug öffnen sich Gucklöcher in den Wolken, und ich sehe einsame Täler, bedeckt mit Schnee, Eis und Felsen. Die Sätze, mit denen Ina von Grumbkow ihr Buch begann, kommen mir in den Sinn:Fern im Norden erhebt sich aus den Wogen des Atlantik, der in ungebrochener Gewalt ihre schroffen Küsten umschäumt, die Insel Island– Isafold, die Eisumschlungene.
Was mir nach der Landung sofort auffällt, ist das Licht. Es ist hell und leuchtend. Obwohl schon fast Abend, steht die Sonne hoch am Himmel. Ich hatte mir ein dunkles, düsteres Land vorgestellt.
Die Busfahrt vom internationalen Flughafen zur 45Kilometer entfernten Hauptstadt Reykjavík führt durch 7000Jahre alte Lavafelder. Sie sind überwachsen mit graugrünem Moos. Auf der einen Seite wird die erstarrte Lava vom Atlantik begrenzt, auf der anderen dehnt sie sich bis zum Horizont. Für alle Zeiten scheint der Boden mit dicken Schichten wulstigen Gesteins versiegelt. Dennoch ist es gelungen, eine breite, asphaltierte Schnellstraße anzulegen, an der sich Neubauten entlangziehen. Es ist dieser harte Kontrast zwischen wilder Natur und der von Menschen geschaffenen, modernen Welt, der so bezeichnend für Island ist. Gleich bei meiner Ankunft werde ich von diesem Gegensatz überrascht, der mich auf meiner Reise stets begleiten und immer wieder für Staunen sorgen wird.
Während wir uns Reykjavík nähern, der nördlichsten Hauptstadt der Welt, wird die Besiedlung immer dichter: Reihenhäuser, Bungalows, zweistöckige Wohnhäuser– alle aus dem bevorzugten Baustoff: Beton. In den letzten Jahrzehnten sind viele Menschen aus ländlichen Gebieten in die Hauptstadt abgewandert. Die Stadt und die umliegenden Gemeinden sind gewachsen und weitgehend miteinander verschmolzen. Von insgesamt 318000Isländern wohnen im Großraum Reykjavík weit über die Hälfte, nämlich etwa 200000Menschen.
Die Hauptstadt liegt im Westen Islands in einer Bucht der Reykjanes-Halbinsel. Die Stadt breitet sich an der flachen Küste aus, nur wenig über dem Meer. Weder Vulkane, noch Gletscher sind zu sehen, auch kein Gebirge im Hintergrund. Jahrhundertelang war die heutige Metropole eine ärmliche Siedlung gewesen mit aus Torf erbauten Gehöften, um 1900 lebten kaum 5000Menschen in Reykjavík. Inzwischen ist die Stadt zum pulsierenden Mittelpunkt der Insel geworden, dynamisch und voller Leben. Die Peripherie mit ihren Hochhäusern und Betonbauten hat wenig einladend auf mich gewirkt, das Stadtzentrum jedoch mit dem liebenswerten Charme einer Kleinstadt hat es mir gleich angetan.
Die Jugendherberge »Reykjavík Downtown«, die ich mir als Quartier gewählt habe, liegt zentral und in einer Straße, die parallel zur Küste verläuft. Nach dem Einchecken spaziere ich durch die Stadt, um erste Eindrücke zu sammeln. Zwar ist es schon spät am Abend, doch ich bin viel zu neugierig und aufgeregt, um gleich schlafen zu gehen. Zum Hafen sind es nur wenige Schritte. Fischerboote schaukeln sanft auf den Wellen, in dem engen Hafenbecken scheint kein Platz für größere Schiffe zu sein. Es herrscht abendliche Ruhe, obwohl es trotz der späten Stunde noch taghell ist. Im Stadtzentrum sind die Häuser klein, meist einstöckig. Auf den Straßen ist fast kein Verkehr, die Geschäfte sind bereits geschlossen. In wenigen Minuten erreiche ich den Tjörnin, den Stadtsee. Dort streiten sich Möwen laut kreischend ums Futter. Das große Gewässer ist Zufluchtsort für zahlreiche Wasservögel. Über vierzig verschiedene Entenarten, Gänse, Singschwäne, Möwen, Küstenseeschwalben bevölkern ihn, bauen am Ufer oder auf Inselchen ihre Nester und ziehen die Jungen auf. Am Uferhang reihen sich Holzhäuser, die zum Schutz gegen die Witterung mit buntem Wellblech ummantelt sind. Auch die Dächer haben leuchtende Farben: Gelb, Grün, Blau und Rot. Eine farbenfrohe Kulisse, die mir gefällt.
Ein mächtiger Bau erhebt sich direkt am See– das Rathaus. Die Architektin Margrét Hardardóttir hatte für ihren Entwurf den ersten Preis gewonnen, aber die postmoderne Architektur löste heftige Proteste aus. Das Gebäude sei ein Störfaktor inmitten der historischen Altstadt, hieß es. Dennoch wurde das Bauwerk aus grauem, unverputztem Beton im Jahr1992 gebaut. Es hat zwei tonnenförmige Dächer und wurde auf Stelzen in den See gesetzt. Gerade weil das imposante Rathaus nicht zu den zierlichen Wellblechhäusern am Ufer passt, entsteht durch den harten Kontrast eine interessante Spannung und Aufmerksamkeit wird erregt, und das ist es ja, was Kunst unter anderem bezweckt.
An diesem Abend spüre ich nicht das Flair einer pulsierenden Stadt, über das ich so viel gelesen habe. Kaum ein Mensch ist auf den Straßen zu sehen. Erst im Sommer beginnen die langen Nächte, in denen es scheint, als würde keiner mehr schlafen gehen. Dann verwischen die Unterschiede zwischen Tag und Nacht.
Es ist immer aufregend, in einem unbekannten Land aufzuwachen, dabei ist es vertrauter Vogelgesang, der durch das offene Fenster hereinschallt. Kann das sein? Für einen Augenblick kommen mir Zweifel, ob ich überhaupt in Island bin. Da höre ich ihn wieder, ich habe mich nicht geirrt. Auf dem Dachfirst gegenüber zwitschert ein Star. Wie kommen Stare auf diese entfernte Insel? Stare gehören nicht zu den Zugvögeln, die weite Distanzen zurücklegen. Am liebsten überwintern sie im Mittelmeergebiet. Wie sind sie also in den hohen Norden gelangt? Fast tausend Kilometer beträgt die Entfernung von Norwegen nach Island, eine Strecke, die Stare nicht freiwillig übers offene Meer fliegen würden. Wurden sie von Stürmen hierhergetrieben? Jedenfalls sind sie noch nicht lange in Island, zum ersten Mal hat man sie vor einigen Jahrzehnten beobachtet. Seitdem brüten sie in Reykjavík, lese ich im Vogelbestimmungsbuch.
Wie kann man an einem einzigen Tag einen umfassenden Eindruck von einer Stadt bekommen und möglichst viel erfahren? Am besten auf einer Fahrradtour. Ich habe mich bei »Reykjavík Bike Tours« angemeldet, und Stefán hat für mich eine Extratour zusammengestellt. Ich treffe ihn unten am Hafen, wo er schon mit Fahrrad, Helm und roter Weste auf mich wartet. Mit seiner deutschen Lebensgefährtin Ursula hat er sich auf Fahrradtouren spezialisiert und organisiert Ausflüge in und um Reykjavík.
Stefán sieht so aus, wie ich mir Isländer vorgestellt habe: groß und blond. Nach einer knappen Erläuterung, worauf beim Fahrradfahren durch die Straßen Reykjavíks zu achten sei, schwingen wir uns auf die Räder, fahren aber nur wenige Meter. Stefán deutet auf einen Kiosk, wo Hotdogs verkauft werden. Unscheinbar duckt sichBæjarins beztu, die stadtbeste Würstchenbude, zwischen die hohen Gebäude in der Nähe des alten Hafens. Mit vergnügt blitzenden Augen erzählt mir Stefán in perfektem Englisch eine lustige Anekdote: Als Clinton noch Präsident der USA war, sei er bei einem Staatsbesuch für kurze Zeit seinen Bewachern entwischt und habe hier einen Hotdog gegessen.
Zurpylsa, wie Wurst auf Isländisch heißt, kann man verschiedene Zutaten wählen: Ketchup, Remoulade, Senf, frische und geröstete Zwiebeln. Clinton wollte als Beilage nur Senf. Jeder, der seitdem seinepylsamit Senf will, bestellt: »Eine Clinton, bitte!« Die Schlange der Wartenden, darunter viele Geschäftsleute, ist lang. An der Theke hängt noch immer der Zeitungsbericht, der den Besuch des amerikanischen Präsidenten samt Foto dokumentiert. Ich bestelle eine »Clinton«. Stefán trifft die bessere Wahl:eina með öllu,»eine mit allem«.
Nach der Stärkung steigen wir wieder auf die Fahrräder. Wenige Straßen weiter erreichen wir einen Platz, den Ingólfstorg. Zwei Basaltsäulen ragen dort empor, aus denen Dampf quillt. Der Wasserdampf soll symbolisch an Ingólfur Arnarson erinnern, den ersten dauerhaften Siedler, erklärt Stefán. Im Jahr874 verließ Ingólfur mit Frau und Kindern, Gesinde, Vieh und Hausrat seine Heimat Norwegen, um Streitigkeiten mit dem norwegischen König aus dem Weg zu gehen. Als sich die Schiffe der isländischen Küste näherten, warf Ingólfur kunstvoll mit Schnitzereien verzierte Holzstelen ins Wasser, die nach dem Willen der Götter an Land treiben und den zukünftigen Wohnort anzeigen sollten. Nach dreijähriger Suche wurden die Hölzer beim heutigen Reykjavík gefunden, ohne zu zögern, beugte sich Ingólfur dem Ratschluss der Götter. Er verließ das Gebiet an der Südküste, wo er sich zwischenzeitlich niedergelassen hatte und das noch heute Ingólfshöfði-Kap heißt, und zog 300Kilometer westwärts in die von Dampfschwaden erfüllte »Rauchbucht«, auf Isländisch Reykjavík. Der Dampf, dem die Stadt ihren Namen verdankt, quillt aus heißen Quellen, deren Wärme heutzutage zum Heizen der Wohnungen genutzt wird.
»Siehst du irgendwo rauchende Schornsteine auf den Dächern?«, fragt mich Stefán. Tatsächlich, die Luft ist frei von Abgasen fossiler Brennstoffe. Autos sind die einzigen Umweltverschmutzer in der Stadt. Als Stefán berichtet, dass die Gehsteige im Winter beheizt werden, lache ich und glaube an einen Scherz. Doch es stimmt. In der Innenstadt wurden Warmwasserrohre unter den Gehwegen verlegt, auch vor Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden, um sie eisfrei zu halten. Das verhindert Stürze bei Glatteis und spart Schneeräumdienste. Nach dem Heizen der Wohnungen ist das Wasser aus dem Erdinneren immer noch warm genug, um den Schnee auf den Straßen zu schmelzen. Jahrhundertelang aber fehlten die technischen Voraussetzungen, die Erdwärme zu nutzen; erst im 20.Jahrhundert war man dazu in der Lage. Das erste Gebäude, das im Jahr 1930 so beheizt wurde, war eine Schule; inzwischen sind alle Häuser an das Warmwassernetz angeschlossen.
Wir radeln die Aðalstræti entlang, vorbei an einer an alte Zeiten erinnernden Brunnenpumpe zu einer archäologischen Fundstätte. Durch eine mit Glas abgedeckte Öffnung im Bürgersteig kann man ein paar Meter in die Tiefe blicken, wo Mauerreste aus der frühen Besiedlungszeit zu sehen sind. Möglich, dass es sogar Ingólfurs Gehöft war.
»Ohne Ingólfur und die Götter, die ihm den Ort zeigten, gäbe es Reykjavík vielleicht gar nicht. Aber dass die ärmlichen Bauerngehöfte und Fischerkaten sich zu einer Stadt entwickelten, verdanken wir ihm.« Stefán weist auf ein Denkmal. »Das ist Skúli Magnússon, der Vater Reykjavíks.«
Skúli war einst Stadtmagistrat. Mit seinen tief liegenden Augen, der gerunzelten Stirn, den schmalen, fest aufeinandergepressten Lippen blickt er ernst von seinem Sockel herab. Lange Haare umrahmen ein sorgenvolles Gesicht. In beiden Händen hält er eine Schriftrolle.
Jahrhundertelang war Island dänische Kolonie und wurde denkbar schlecht verwaltet. Beamte, die als Gouverneure zu der weit abgelegenen Insel mit ihrer armseligen Bevölkerung geschickt wurden, betrachteten ihre Berufung als Strafversetzung. Sie blieben nie lange, delegierten ihre Aufgaben an unwillige, oft korrupte Statthalter, von denen die Bevölkerung brutal ausgebeutet wurde. Skúli Magnússon war der erste Isländer, der im Jahr1749 mit dem Amt des Stadtmagistrats betraut wurde. Er hatte eine Vision, träumte von freiem Handel, wollte die Lebensbedingungen seiner Landsleute verbessern. Der dänische König unterstützte zunächst die engagierten Bemühungen des Isländers. Von besser gestellten Untertanen versprach er sich höhere Abgaben, und so übereignete er Magnússon das Gehöft Reykjavík zum Ausbau. Der neue Stadtmagistrat begann, Manufakturen für die Fell- und Wollverarbeitung zu entwickeln, denn zuvor waren die Produkte unbearbeitet nach Dänemark verschifft worden. In Island entstanden nun neue Berufe und Arbeitsplätze: Spinnereien, Webereien, Färbereien, Gerbereien, Seilereien sowie Salz- und Schwefelgewinnungsanlagen. Auch die Landwirtschaft wollte Skúli Magnússon reformieren: feuchte Wiesen entwässern, Bäume pflanzen, Getreide und Gemüse anbauen, auch Kartoffeln, die Mitte des 18.Jahrhunderts auf der Vulkaninsel noch unbekannt waren.
Das Aufblühen der isländischen Wirtschaft kam den dänischen Kaufleuten, die um ihr Handelsmonopol fürchteten, gar nicht gelegen. Sie boykottierten die von den isländischen Manufakturen hergestellten Waren und intrigierten so lange, bis Magnússon seines Amtes enthoben wurde. Doch seine Bemühungen waren nicht vergeblich gewesen. Seine Ideen lebten fort, wurden später von anderen wieder aufgegriffen.
Stefán zeigt auf ein dunkles Holzhäuschen, eingezwängt in einer Gebäudezeile an der Aðalstræti. Es wurde 1764 gebaut und ist das älteste noch erhaltene Haus. Heute beherbergt es wechselnde Ausstellungen und Verkaufsräume. »Stell dir vor«, sagt Stefán, »bis zum 18.Jahrhundert gab es in Island nur Gebäude aus schnell vergänglichem Material wie Torf, Rasenstücken und Treibholz, deshalb ist auch so wenig erhalten geblieben.« Holz war von alters her Mangelware. Ursprünglich vorhandene Wälder waren in den ersten Jahrzehnten der Besiedlung durch die norwegischen Einwanderer abgeholzt worden.
Am Tjörnin, dem Stadtsee, herrscht jetzt am Tag reges Leben. Eltern und Großeltern gehen mit ihren Kindern und Enkeln spazieren und füttern die Wasservögel mit trockenem Brot. Modisch gekleidete Jugendliche sitzen auf den Bänken, lesen oder unterhalten sich. Ich sehe auffallend viele Menschen, die aus Asien, Afrika und Südamerika stammen. Spanische Worte dringen an mein Ohr, andere sprechen Englisch oder slawische Sprachen.
»Siehst du die Fontäne im See?«, fragt Stefán. »Der amerikanische Botschafter Rowohlt hat sie gestiftet. Wir Isländer haben dieses Geschenk als Beleidigung empfunden.«
»Warum denn? Weil sie so mickrig ist?«, vermute ich.
»Groß oder klein, das spielt keine Rolle! Aber was sollen wir mit einem lächerlichen Springbrunnen, wo wir doch unsere großartigen Geysire haben!« Stefán, der selten um einen Scherz verlegen ist und mich mit seinem trockenen Humor immer wieder zum Lachen bringt, wirkt plötzlich gar nicht mehr lustig. Verglichen mit anderen Völkern ist Island eine kleine Nation, umso größer ist ihr Nationalstolz. Besonders ihre Freiheit ist den Isländern wichtig. Viele Jahrhunderte waren sie unterdrückt, zuerst von Norwegen, dann von Dänemark. Ihre Unabhängigkeit erhielten sie erst im Jahr 1944.
»Siehst du irgendwo Wachleute?«, will Stefán wissen, als wir mit unseren Rädern im sorgfältig gepflegten Garten des Parlaments anhalten. Isländer sind stolz darauf, dass sie ihre Politiker nicht schützen müssen und außer einem Pförtner kaum Sicherheitspersonal für offizielle Gebäude benötigt wird.
Wir sind an der verkehrsreichen Lækjargata angekommen, hier hat die Regierung ihren Sitz. Das weiße zweistöckige Haus wirkt unauffällig, keine Schilder oder andere Kennzeichen sind zu sehen. Nichts, rein gar nichts weist darauf hin, dass in diesem Gebäude die Regierung des Landes sitzt. Stefáns braungrüne Augen blitzen vergnügt, als er mir erzählt, dass es früher ein Gefängnis war: »Welches andere Land kann sich rühmen, seine Regierung einzubuchten?«
Die Straße, die rechts vom Regierungssitz bergauf führt, heißt Laugavegur, »Weg zu den Quellen«. Es ist noch nicht lange her, nur wenige Jahrzehnte, da gingen die Frauen zu den heißen Quellen im Laugadalur, dem »Quellental«, um dort ihre Wäsche zu waschen. Heute ist der Pfad zur Einkaufsmeile geworden. Geschäft reiht sich an Geschäft: Schmuck-, Mode-, Designer-, Woll- und Souvenirläden, Boutiquen, Cafés, Restaurants. Nichts für unsere Radtour, meint Stefán und fährt am Regierungsgebäude vorbei zu einer grünen Anhöhe, Arnarholl genannt, »Adlerhügel«. Dort erhebt sich, dargestellt als siegreicher Wikingerheld, ein Standbild von Ingólfur Arnarson, dem ersten dauerhaften Siedler an dieser Küste.
Ich freue mich, als wir in einen Fahrradweg einbiegen, der am Atlantik entlangführt. Endlich kann ich mit voller Kraft in die Pedale treten. Frischer Wind weht mir entgegen, die Luft ist klar und die Sicht weit. Im Norden, über hundert Kilometer entfernt, schimmert zart wie in einer chinesischen Tuschzeichnung der schneebedeckte, fast perfekte Kegel des Snæfellsnesjökull. Wesentlich näher im Norden liegt die Halbinsel Akranes mit dem einige Hundert Meter hohen Akrafjall. Nordöstlich ragen die steilen Hänge der Esja empor, des etwa tausend Meter hohen Hausberges von Reykjavík. Westlich reicht der Blick weit übers Meer, ein paar Inselchen reihen sich dicht vor der Küste auf. Wie malerisch doch diese Stadt gelegen ist. Ich kann mir gut vorstellen, hier zu leben.
Skulpturen säumen unseren Weg, darunter die verfremdete Darstellung eines Wikingerschiffes. Dann erreichen wir das Höfði-Haus, ein repräsentatives Gebäude aus dem Jahr 1908. Früher lag es am Stadtrand, inzwischen ist es längst vom Häusermeer umschlossen, doch die Grünflächen ringsum hat man unbebaut gelassen, und der Blick zur Meeresbucht ist frei. Wegen Baufälligkeit sollte es ursprünglich abgerissen werden, bis es in den Besitz der Stadt überging und restauriert wurde; heute dient es als Gästehaus für besondere Besucher.
»Gorbatschow und Reagan sind sich hier begegnet«, berichtet Stefán.
»Wirklich?«, frage ich überrascht.
»Hier im Höfði trafen sich die beiden zum ersten Mal, saßen sich Auge in Auge gegenüber, um über Abrüstung zu sprechen. Das war 1986, mitten im Kalten Krieg.«
»Deswegen sind sie extra nach Island gereist?«
»Genau! Welches Land wäre besser geeignet gewesen für ein Treffen zwischen Ost und West? Island gehört geografisch gesehen mit der einen Hälfte zu Amerika und mit der anderen zum eurasischen Kontinent. Die beiden Kontinentalplatten driften seit Jahrmillionen auseinander, und an der Bruchstelle ist neues Land entstanden: Island. Symbolisch gesehen war unsere Insel für beide Staatsmänner also neutraler Boden.«
»Hat Stefán dir den Elfenstein gezeigt?«, fragt Ursula nach unserer Rückkehr. Ursula, die aus Nürnberg stammt, hat sich vor sieben Jahren für ihre Wahlheimat Island und für Stefán entschieden. »Ein unglaublicher Zufall, dass wir uns getroffen haben. Irgendwie magisch.« Ursula lächelt. »Ich war im Süden bei Vík, wo es den schwarzen Strand gibt. Ich hatte mir ein Rad geliehen, bin zu einer Basaltgrotte geradelt, die vom Meer umspült wird, und dort wartete Stefán auf mich.«
»Wusste er denn, dass du kommst?«
»Nein, gar nicht, wir kannten uns ja nicht. Er stand einfach so da und blickte mir entgegen. Er arbeitete damals schon als Reiseleiter, hatte gerade eine Gruppe zur Grotte gefahren, und da kam ich. Es sollte einfach so sein.«
Mit Ursula hatte ich bereits von Deutschland aus Kontakt aufgenommen. Durch ihr BuchZwischen Licht und Dunkelwar ich auf sie aufmerksam geworden. Schon der Titel gefiel mir. Humorvoll und informativ berichtet Ursula vom »Abenteuer Alltag in Island«.
»Du hattest was von einem Elfenstein gesagt«, knüpfe ich an ihre vorige Frage an. »Es soll doch sogar eine Elfenbeauftragte geben, die beim Bau jeder neuen Straße eingeschaltet wird. Wenn sie feststellt, dass irgendwo in einem Felsen Elfen leben, baut man die Straßen in einen Bogen um diese Stellen herum, damit sie nicht gestört werden. Stimmt das denn?«
Ursula lacht. »Es kommt schon mal vor, dass Erla angerufen wird, aber den Begriff Elfenbeauftragte hat sich ein deutscher Autor ausgedacht. In derFrankfurter Rundschauhatte er einen Bericht über Erla Stefánsdóttir veröffentlicht und sie als offizielle Elfenbeauftragte vorgestellt. Seitdem wird das in Zeitschriften und Büchern wiederholt. Du bist nicht die Einzige, die darauf hereingefallen ist. Das isländische Straßenbauamt kann sich natürlich nicht bei jedem Bauvorhaben um Elfenwohnorte kümmern. Aber Erla beschäftigt sich schon lange mit demhuldufólk, dem verborgenen Volk, hat Bücher verfasst, sogar eine spezielle Elfenlandkarte für den Hafenort Hafnarfjörður erstellt, wo es besonders viele Elfenwohnungen geben soll. Seitdem vermarktet sich der Ort erfolgreich als Elfenstadt, und es gibt sogar Führungen zu den Behausungen der geheimnisvollen Wesen.«
»Also alles nur Werbung für Touristen?«
»So einfach ist das nicht. Aber lass uns erst mal zum Elfenstein gehen. Er ist ganz in der Nähe.«
Schmale Gassen führen durch ein altes Viertel mit bunten Häuschen, umgeben von verwunschenen Gärten. Ursula zeigt auf einen großen Stein mit Löchern und Einbuchtungen in seiner rauen Oberfläche.
»Das Viertel war früher ziemlich verwahrlost, die Häuser sollten abgerissen und moderne Wohnungen errichtet werden. Die Einwohner aber wollten die Elfen nicht verärgern, diese zarten Wesen mögen Lärm gar nicht. Behutsam renovierten die Leute ihre Häuser selbst, und so blieb dieser idyllische Ort erhalten«, erzählt Ursula und fügt hinzu: »Ob es die Elfen nun gibt oder nicht, durch den Glauben an sie gehen die Menschen respektvoller mit der Natur um, was ihnen dann selber zugutekommt.«
Naturgeister haben ihre Wurzeln tief in der heidnischen Religion der ersten Einwanderer. Die auf der Insel waltenden Kräfte, unberechenbare Vulkane, brodelnde Schlammquellen, fauchende Geysire, überzeugten die Menschen, dass übernatürliche Wesen am Werk sein müssten. Lange nachdem die christliche Religion die alten Götter verdrängt hatte, führten das isolierte Leben auf abgelegenen Höfen, die dunklen Winternächte und die als übermächtig empfundene Natur dazu, den alten Volksglauben an Elfen, Trolle, Geister zu bewahren. Die Vorstellung, dass es mehr gibt als die sichtbaren Dinge, war tröstlich für die Menschen. Ob aber die Isländer heute noch an das verborgene Volk glauben? Umfragen zeigen, dass zehn Prozent dies als Unsinn abtun, während ebenso viele von der Anwesenheit der Naturgeister überzeugt sind. Und die restliche Mehrheit? Ihre Antwort bleibt unbestimmt und auf liebenswerte Weise selbstironisch: »Ich will nicht behaupten, dass es sie nicht gibt.«
Schwärzer als die Nacht
Einen Teil meiner Ausrüstung, die für ein halbes Jahr berechnet ist, lasse ich im Lagerraum der Jugendherberge zurück. Mein erstes Ziel ist der Vulkan Eyjafjallajökull. Ich will ihn sehen, solange er noch aktiv ist und seine Aschewolken in den Himmel spuckt. Auf der Ringstraße fahre ich mit dem Bus zum Ort Hvolsvöllur, von dort will ich in das Tal des Gletscherflusses Markarfljót wandern. Die Ringstraße heißt so, weil sie die Insel umrundet; erst 1974 konnte der »Ring« geschlossen werden. Immer wieder sind Reparaturen nötig, wenn Gletscherflüsse Teile der Straße und Brücken wegreißen.
Ich bin der einzige Passagier im Bus. Das wird sich in den Sommermonaten ändern, wenn mehr Touristen ins Land strömen, als Einheimische hier wohnen. Für Isländer müsste es dieses gut ausgebaute Busnetz nicht geben, das Reisende auch an weit entlegene Orte bringt. Selten habe ich sie in den öffentlichen Verkehrsmitteln gesehen, dafür stehen vor ihren Häusern ein oder mehrere Geländewagen.
Auf einer autobahnähnlich ausgebauten Schnellstraße fährt der Bus nach Osten, südlich von Reykjavíks Hausberg Esja hinauf auf das Plateau Hellisheiði. Nichts als Lavawüste bis zum Horizont, kein Baum, nur niedrige Sträucher, die sich zwischen moosbedeckte Steine ducken.
Der Kontrast zwischen Zivilisation und Wildnis ist stark. Eben noch war ich in einer modernen Großstadt, wenige Kilometer später umgibt mich eine lebensfeindliche Mondlandschaft. Beide Extreme liegen in Island so nah beieinander, wie ich es noch in keinem anderen Land erlebt habe.
Auf einmal steigt Dampf aus der dunklen Lava. Unwirklich wirken diese hohen, weißen Säulen, die Szene könnte aus einem Fantasyfilm stammen. Dann sehe ich dicke Rohre, die sich kilometerweit über die Lavafelder ziehen. Aus Ventilen entweicht zischend der Überdruck. Mit dieser Erdwärme werden Reykjavík und die Farmen der Umgebung versorgt, sowie Schwimmbäder und Gewächshäuser beheizt. Auf Serpentinen geht es vom Plateau hinab zur Küste. Zwischen Baumkronen erkenne ich rote Dächer.
»Das ist Hveragerði, die Gartenstadt«, antwortet der Fahrer in gutem Englisch auf meine Frage. Vom Bus aus kann ich mir kein Bild von den Gewächshäusern machen, zu dicht ist alles mit Büschen und Bäumen bewachsen. Immerhin sollen vierzehn Hektar von Glas überdacht sein; mit dem hier geernteten Gemüse und Obst kann der Bedarf der Inselbevölkerung zu einem Großteil gedeckt werden. Stolz verkündet der Fahrer, dass in den Treibhäusern sogar Bananen wachsen. Südfrüchte und Palmen nahe am Polarkreis, das gebe es nur in Island, meint er.
Weiter fahren wir durch flaches Weideland, ab und zu sehe ich Islandpferde auf den Wiesen. Sie sind gar nicht so klein, wie es in Reiseberichten oft heißt. Jetzt im Frühjahr tragen sie noch ihr dichtes, struppiges Winterfell. Ihren robusten Körpern sieht man an, dass sie das ganze Jahr im Freien verbringen. Mir fällt die Vielfalt der Fellfarben und Mähnen auf, es gibt alle nur denkbaren Varianten.
Nach gut zwei Stunden Fahrt habe ich mein Ziel erreicht und steige in Hvolsvöllur aus. Ein paar reizlose Betonbauten reihen sich entlang der Durchgangsstraße. Es ist keine historisch gewachsene Ortschaft, erst in den letzten Jahrzehnten ist die Einwohnerzahl auf etwa 800Personen gestiegen. Ich halte mich im Ort nicht lange auf. Was ich unterwegs an Nahrungsmitteln benötige, habe ich aus der Hauptstadt mitgebracht.
Mein Weg führt mich ins Gebiet Fljótshlið, wie die bergige Landschaft am Gletscherfluss Markarfljót heißt. Zuerst wandere ich auf einer schmalen Teerstraße, die bald zu einem Schotterweg wird. Vom Hang zu meiner Linken stürzen unzählige Wasserfälle herab, dazwischen liegt hin und wieder ein Bauerngehöft. Auf meiner rechten Seite fließt der Fluss in einem breiten Bett. Die Aschewolke des Vulkans auf der gegenüberliegenden Talseite kann ich nicht sehen, der Himmel ist bedeckt, und die Wolken reichen weit hinab. Nach ungefähr zwanzig Kilometern suche ich mir am Wiesenhang eine ebene Stelle und baue mein Zelt auf.
Der Uhr nach ist es schon später Abend, aber es ist noch immer taghell. Einmal höre ich den Vulkan grollen, es klingt, als würde ein heftiges Gewitter toben. Dann schweigt er wieder, und ich schlafe beruhigt ein.
In der Nacht weckt mich das Erdbeben, das mich wie in einem Kahn schaukelt. Erschrocken krieche ich aus dem Zelt, und zum ersten Mal sehe ich die Wolke, wie sie dunkelbraun hoch hinauf in den Himmel steigt. Gefesselt von dem ungewöhnlichen Anblick, bleibe ich wach und merke kaum, wie die Stunden vergehen.
Ein flötendes Trillern mischt sich am Morgen in das Donnergrollen des Vulkans. Ein brauner Vogel auf langen Beinen stakst durch das wintergelbe Gras. An seinem halbmondförmig gebogenen Schnabel erkenne ich den Regenbrachvogel. Sie sind also schon da, die ersten Zugvögel aus Afrika. Einen weiten Weg müssen sie zurücklegen, um in Island zu brüten. Noch scheint der Brachvogel ohne Partner zu sein. Die Austernfischer dagegen, die ich später bei meiner Wanderung entlang des Flusses beobachte, treten schon paarweise auf. Es sind schwarz-weiße Vögel von Kiebitzgröße mit rotem Schnabel und roten Füßen. Ihr Name ist irreführend– ihre Leibspeise sind nicht Austern, sondern Würmer.
In zahlreichen Windungen und Schleifen zieht sich der Markarfljót durch das breite Tal. Sein von Gletschern gespeistes Wasser ist eiskalt, was ich schmerzhaft spüre, als ich einen seiner Seitenarme durchwate, um ans andere Ufer zu gelangen. Ein Farmhaus mit Stallungen liegt dort am Berghang. Der Farmer und seine Frau stehen am Zaun, blicken zum Eyjafjallajökull hinüber und mustern sorgenvoll die Wolke.
»Góðan daginn«,grüße ich.
»Sæl og blessuð«,antworten sie freundlich, was so viel bedeutet wie »Sei gegrüßt«. In Island spricht man sich ausnahmslos mit Vornamen an und duzt sich. Selbst bei berühmten Persönlichkeiten wird keine Ausnahme gemacht.
Mein Isländisch ist noch mangelhaft. Ich habe zwar in Deutschland begonnen, die Sprache zu lernen, ohne viel Erfolg. Die fremdartigen Buchstaben sind keine große Hürde, denn ð und þ werden wie das stimmhafte und stimmlose englische th ausgesprochen und æ wie ei, auch die unregelmäßige Grammatik kann man sich mit viel Fleiß aneignen. Es ist der besondere Klang der Konsonanten, der Isländisch für mich so schwierig macht. Mal werden sie gedehnt, dann wieder gehaucht, was davon abhängt, mit welchen anderen Konsonanten sie zusammenstehen. Oft verändern sie sich auch ganz. So werden die Orte Höfn wie Höpn und Keflavík wie Keplavík ausgesprochen. Vatnajökull wird zu Vatnajöküdl. Diese Ausspracheregeln kann ich mir einprägen, aber wenn Landmannalaugar zu Landmannalöüchar wird, da gehorcht mir meine Zunge einfach nicht mehr. Zudem kann keine Umschrift wirklich wiedergeben, wie es richtig klingen muss.
Ich gebe mir besonders Mühe und stottere ziemlich, als ich versuche, etwas über den Vulkanausbruch zu erfahren. Die beiden lächeln verständnisvoll über mein Bemühen.
»Bis jetzt haben wir noch Glück gehabt«, antwortet der Farmer in perfektem Englisch. »Der Wind weht günstig und treibt die Wolke nach Süden hinaus aufs Meer. Doch er wird sich bald drehen, da bin ich mir sicher.«
Die Frau geht ins Haus und verabschiedet sich:»Bless, bless!«Der Mann bleibt noch eine Weile und unterhält sich mit mir. »Die Asche wird dann bei uns niedergehen«, setzt er seinen Gedanken fort. Es erstaunt mich, dass er die Bedrohung so nüchtern einschätzt, als unabwendbare Tatsache.
»Warum die Augen vor der Wirklichkeit verschließen?«, meint er. »Wir Isländer leben seit tausend Jahren mit den Vulkanen und wissen, wie gefährlich sie sein können. Ausbrüche hat es immer gegeben, das ist nichts Neues für uns.«
»Aber was tust du, wenn die Asche auf deinen Hof fällt und das Weideland vergiftet?«
»Da ist nicht viel zu tun. Die Schafe müssen dann im Stall bleiben, das ist das größte Problem. Denn bald werden die Lämmer geboren, und die Herde vervielfacht sich. Der Platz im Stall reicht nicht für alle, dann müssen wir schlachten. Für die anderen muss Heu gekauft werden, das wird teuer. Oder wir bringen die Herde mit Lastwagen in ein Gebiet, das frei von Asche ist. Dafür aber gibt es strenge Vorschriften. Wenn die Tiere unsere Region verlassen, dürfen sie später nicht mehr zurück, damit keine Krankheiten eingeschleppt werden.«
Der Mann nimmt sich Zeit für das Gespräch, und ich erfahre, dass er schon als sechsjähriges Kind mit seinem Vater zum Fischen aufs Meer hinausgefahren ist. »Später habe ich Fischereiwirtschaft studiert. Ich liebe die See, doch dann hat meine Frau diese Farm geerbt, deshalb musste ich umsatteln. Bereut habe ich es nicht. Am besten gefällt mir, wenn die Lämmer geboren werden«, erzählt er mir, und auch, dass der Eyjafjallajökull mitten in der Nacht ausgebrochen sei. Den Namen des Vulkans könne ich mir recht einfach merken:Eybedeutet »Insel«, undfjallaist der »Berg«, also Inselberg, undjökullist ein »Gletscher«. Eyjafjallajökull heißt also Inselberggletscher.
»Um vier Uhr morgens am 14.April haben uns die Leute vom Katastrophenschutz geweckt«, berichtet er. »Wir wurden alle in der Schule im dreißig Kilometer entfernten Ort Hvolsvöllur untergebracht. Erst am Nachmittag durften wir zurück und die Schafe versorgen.«
»War der Vulkan dann nicht mehr gefährlich?«
»Na ja, Lebensgefahr bestand auch vorher wohl keine. Aber wer kann das so genau wissen? Glühende Lava ist nicht in die Täler gelangt, und auch die hochgeschleuderten Lavabrocken haben niemanden gefährdet. Es war die Flut, vor der sich alle gefürchtet haben.«
»Die Flut?«
»Der Gletscher ist teilweise geschmolzen, und plötzlich kam viel Wasser auf einmal heruntergeschossen. Der Markarfljót war wie ein wildes Tier. Das Hochwasser raste mit großer Gewalt heran, trat über die Ufer, riss alles mit sich. Eisblöcke, riesig groß, die keine Zeit hatten zu schmelzen, schwammen im Wasser. Jetzt sieht der Fluss wieder harmlos aus, aber ich sage dir, das war ein grauenvoller Anblick und dazu das Gepolter und Getöse. So stelle ich mir den Weltuntergang vor.«
»Menschen sind nicht zu Schaden gekommen?«
»Gott bewahre, nein, dank unseres Katastrophenschutzes. Wir sind gut vorbereitet.«
Ich verabschiede mich und wandere weiter nördlich des Tals durch die Berglandschaft zum »Gipfelberggletscher«, wie der Tindfjallajökull heißt. Auch dieser Berg ist ein Vulkan, was ausnahmslos alle Berge Islands Vulkane sind oder waren. Seinen letzten großen Ausbruch hatte dieser vor etwa 52000Jahren. Vor 9000Jahren gab es zwei kleine Eruptionen, nördlich und westlich des Zentralkraters, wie Vulkanologen festgestellt haben. Mit seinen 1463Metern scheint er im Vergleich zu Bergen in den Alpen oder gar im Himalaja ein Zwerg zu sein, doch da sich Island fast am Polarkreis befindet, herrschen bei tausend Höhenmetern bereits alpine Verhältnisse. Auch der Gipfel des Tindfjallajökull ist vom Gletschereis bedeckt. Der Farmer hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass durch den Ausbruch des Eyjafjallajökull alle Gletscher in seiner Nähe jetzt schwarz sind, weil eine dicke Ascheschicht das Schneeweiß bedeckt. Da ich nicht wissen konnte, wie die Berge vor der Eruption aussahen, hatte ich vermutet, die schwarzen Gletscher seien Felsgestein.
Während ich aufsteige, rumort und donnert der Eyjafjallajökull südlich von mir. Nur wenn ich mich umdrehe, kann ich seine immer gegenwärtige Aschewolke sehen. Die Landschaft wirkt eintönig, ist noch von keinem Grün geschmückt. Tiere sind in der tristen Umgebung selten, aber einige Vögel sehe ich, Arten, die mir aus Deutschland bekannt sind. Neben Regenbrachvögeln und Austernfischern beobachte ich Bachstelzen, Uferschnepfen, Bekassinen und weiter oben in der Felsregion Schneeammern. Am Aufstiegspfad liegen drei Wanderhütten, die allerdings verschlossen sind. Beim isländischen Wanderverein hätte ich mir gegen Bezahlung den Schlüssel holen können, doch zu dieser Wanderung habe ich mich spontan entschlossen. Überhaupt liebe ich es, in meinen Entscheidungen frei zu sein, nicht an einer vorher festgelegten Route und gebuchten Berghütten festhalten zu müssen.
Seit Stunden wandere ich durch eine Ödnis aus Sand und Kies. Immer wieder ragt Lavagestein hervor, auf dem sich graue Moospolster ausbreiten. Je höher ich steige, umso heftiger weht der Wind. So hatte ich mir Island vorgestellt: kalt, rau und windig.
Als ich in der Ferne eine Bewegung wahrnehme, greife ich schnell nach meinem Fernglas und erkenne zwei Männer. Es verursacht mir immer einen leichten Schrecken, in einsamer Landschaft auf Menschen zu treffen. In Island muss ich sicherlich nichts befürchten, und so weiche ich einer Begegnung nicht aus. Mit schnellen Schritten kommen die beiden näher. Wir begrüßen uns auf Isländisch, und sofort befragt mich der Ältere auf Englisch nach meinem Weg. Es klingt weder neugierig noch anmaßend, er will mich nur warnen. Von einer Gipfelbesteigung rate er dringend ab. Sie selbst hätten ihre Tour wegen des Sturmes abgebrochen, am Gipfelgrat herrsche Orkanstärke. Ich versichere, dass ich ebenfalls umkehren und in der Herberge Fljótsdalur übernachten werde.
Im Verzeichnis der isländischen Jugendherbergen hatte ich eine Beschreibung von Fljótsdalur gefunden, die mich neugierig machte: eine einsame Hütte weitab jeder Ortschaft mitten in den Bergen. Was man an Nahrungsmitteln benötigt, muss man mitbringen, da kein Geschäft in der Nähe ist. Das ehemalige Farmhaus soll über hundert Jahre alt sein und ein Grasdach haben. Noch bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts waren Häuser dieser Art nichts Ungewöhnliches auf Island. Einige hat man erhalten und restauriert, nun benutzt man sie als Herbergen, andere als Freilichtmuseum.
Schon von Weitem bin ich mir sicher, dass es sich bei dem kleinen Haus nur um die Jugendherberge handeln kann. Eng duckt es sich an den Hang, schwarz gestrichenes Wellblech schützt die Wände gegen die Witterung, dicke Grassoden bedecken das Satteldach. Es sieht lustig aus, diese Wiese auf dem Dach mit Gräsern und vielen Blumen. Im Garten überraschen mich Osterglocken und Narzissen neben dekorativ aufgereihten oder zu Kreisen geordneten Steinen. Ausgediente Wanderschuhe liegen als Erinnerung an anstrengende Touren neben dem Gartentor.
Die Tür ist unverschlossen, in der Hütte kein Mensch. Auf einer Holzleiter gelange ich unters Dach ins Matratzenlager, wo an den Giebelseiten je ein Fenster Licht spendet. Ich öffne beide Fenster, um durchzulüften, und kann mir einen Schlafplatz wählen, denn außer mir scheint so früh im Jahr keiner hier oben übernachten zu wollen. Zur Hauptsaison wird es so voll sein, dass man sich anmelden muss. Unten öffne ich die Tür neben dem Eingang und komme in die Küche, daran schließen sich ein Aufenthaltsraum und zwei Schlafräume mit Doppelstockbetten an. Gepäck und Schlafsäcke zeigen mir, dass hier Leute übernachten.
Im Gästebuch entdecke ich eine Eintragung von Birna Benediksdóttir. Sie schrieb, ihre Großmutter Þórunn Úlfarsdóttir habe einst hier gelebt. Birna bedankt sich für die Mühe, das Haus in seiner alten Form zu erhalten. Für sie werde so die Erinnerung an die Großmutter und ihre eigene Kindheit bewahrt. Andere Eintragungen im Gästebuch haben die einsame Lage dieser Herberge zum Thema. Das scheint für viele Menschen sehr ungewohnt zu sein. Nichts als Schafe gebe es hier, heißt es.
Wo sich heute eine breite Fensterfront erstreckt und den Blick direkt auf die Vulkanwolke freigibt, waren früher bestimmt nur winzige Fenster angebracht. Im Raum stehen ein langer Holztisch und hölzerne Bänke, in der Ecke ein Sofa und an den Wänden Schränke voller Bücher, fast alle auf Englisch, aber mit isländischen Themen.
Am Abend trifft der Herbergswirt Paul mit vier englischen Touristen ein, er selbst ist ebenfalls Engländer. Sie haben eine zwölfstündige Wanderung hinter sich. Erschöpft werfen sie sich in ihre Kojen. Paul befeuert inzwischen den Grill. Seit 38Jahren arbeitet er jeden Sommer in dieser Herberge, erzählt er mir. Der Erste, der die Idee hatte, das alte Farmhaus zu restaurieren und als Wanderhütte zu nutzen, war der Engländer Dick Philipps. Schon im Jahr 1961 begann er, Gäste durch die isländischen Berge zu führen.
Die Wanderer haben sich inzwischen erholt und gruppieren sich hungrig um den drei mal drei Meter großen Grill, wo Kartoffeln in Folie, Zucchini, Paprika, Zwiebeln und Koteletts schmoren und köstlich duften. Die Engländer laden mich zum Essen ein, und während wir es uns schmecken lassen, blicken wir von der Feuerstelle direkt auf den rauchenden Vulkan.
Ende der Leseprobe