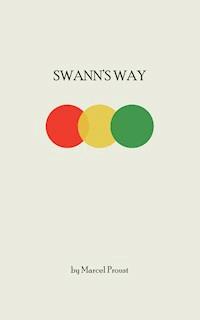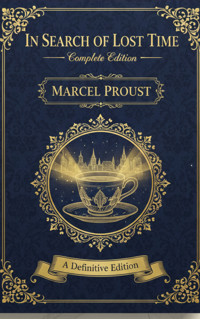24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sodom und Gomorrha beginnt mit einer spektakulären Szene, der Begegnung zweier Männer, die von der Natur füreinander geschaffen sind: Baron von Charlus und der Westenmacher Jupien. Endlich öffnet Proust seinem Romanhelden die Augen; Marcel erhält Antwort auf die bisher unverstandenen Zeichen der Homosexualität. Nach der mondäncn Welt der Guermantes tun sich nun neue Welten auf: Sodom, die Welt der männlichen, und Gomorrha, die Welt der weiblichen Homosexualität."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1278
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Marcel Proust
Sodom und Gomorrha Auf der Suche nach der verlorenen Zeit Band 4
Suhrkamp
I
Erstes Auftreten der Zwitterwesen, Nachkommen jener Einwohner Sodoms, die vom Feuer des Himmels verschont blieben.
Die Frau wird in Gomorrha, der Mann in Sodom herrschen.1
ALFRED DE VIGNY
Lange bevor ich an jenem Tag (dem Tag, an dem die Soiree bei der Fürstin von Guermantes stattfand) dem Herzog und der Herzogin den Besuch abstattete, von dem ich eben erzählt habe, hatte ich, wie man sich erinnern wird, den Zeitpunkt ihrer Rückkehr abgepaßt und, während ich auf der Lauer lag, eine Entdeckung gemacht, die im speziellen Monsieur de Charlus betrifft, an und für sich aber so wichtig ist, daß ich es bis jetzt, da ich ihr den erwünschten Platz und Umfang einräumen kann, aufgeschoben habe, von ihr zu berichten.2 Wie schon gesagt, hatte ich jenen wundervollen, so bequem zuoberst im Haus eingerichteten Aussichtspunkt mit dem Blick auf das bergige Gelände aufgegeben, das zum Hôtel de Bréquigny hinaufführt und wo der rosige Campanile auf der Remise des Marquis von Frécourt einen heiteren Dekor im italienischen Stil bildet. Als meiner Meinung nach der Herzog und die Herzogin nun gleich zurückkehren mußten, hatte ich es praktischer gefunden, mich auf der Treppe zu postieren. Ich trauerte der Höhenluft zwar etwas nach, doch zu dieser Stunde, der nach dem Mittagessen, lag weniger Grund dazu vor, denn ich hätte nicht wie am Vormittag zwischen den breiten Lagen von durchscheinendem Glimmer, die sich so reizvoll von dem roten Vorgebirge abhoben, beobachten können, wie die winzigen Staffagefiguren, zu denen aus der Entfernung die Diener des Hôtel de Bréquigny et de Tresmes zusammenschrumpften, langsam den steilen Hang hinaufstiegen, einen Flederwisch in der Hand. Anstelle der geologischen blieb mir wenigstens die botanische Betrachtung, und ich schaute durch die Läden des Treppenfensters auf den kleinen Strauch der Herzogin und die kostbare Pflanze, die mit der gleichen Beharrlichkeit im Hof ausgestellt wurden, mit der man heiratsfähige junge Leute ausführt, und ich fragte mich, ob durch eine Fügung der Vorsehung das unwahrscheinliche Insekt den dargebotenen und verschmähten Blütenstempel wohl aufsuchen werde.1 Da die Neugier mich allmählich kühner machte, begab ich mich bis zum Parterrefenster hinunter, das gleichfalls offenstand und dessen Läden nur halb geschlossen waren. Ich hörte deutlich die Aufbruchsvorbereitungen Jupiens, der mich hinter meinem Store nicht bemerken konnte, wo ich mich unbeweglich verhielt bis zu dem Augenblick, da ich mich jäh zur Seite warf, um von Monsieur de Charlus nicht bemerkt zu werden, der auf dem Weg zu Madame de Villeparisis langsam den Hof überquerte, dickbäuchig, im hellen Licht des Mittags sichtlich gealtert, ergraut. Es hatte einer Unpäßlichkeit von Madame de Villeparisis bedurft (als Folge einer Krankheit des Marquis von Fierbois, mit dem er persönlich tödlich verfeindet war), daß Monsieur de Charlus, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben, zu dieser Stunde einen Besuch machte. Aufgrund einer Eigenart der Guermantes, die, anstatt sich dem Leben der Gesellschaft anzupassen, es nach ihren persönlichen Gewohnheiten abänderten (die sie nicht für mondän und folglich für würdig hielten, daß man zu ihren Gunsten etwas so Wertloses wie eben »die Mondänität« vernachlässigte – so hatte Madame de Marsantes keinen Empfangstag, sondern nahm jeden Vormittag zwischen zehn und zwölf den Besuch ihrer Freundinnen entgegen), machte der Baron, der diese Tageszeit der Lektüre, dem Stöbern nach reizvollen kleinen Antiquitäten und ähnlichem vorbehielt, niemals einen Besuch zu einer anderen Zeit als zwischen vier und sechs Uhr nachmittags. Um sechs begab er sich in den Jockey-Club oder auf eine Spazierfahrt in den Bois. Um von Jupien nicht bemerkt zu werden, zog ich mich gleich danach noch weiter zurück; es war für ihn bald Zeit, ins Büro zu gehen, von wo er erst zum Abendessen heimkam – und selbst das nicht immer seit etwa einer Woche, da seine Nichte mit ihren Gehilfinnen aufs Land gefahren war, um dort bei einer Kundin eine Robe fertigzustellen. Als ich mir dann aber klar wurde, daß niemand mich sehen konnte, beschloß ich, meinen Posten nicht mehr zu verlassen, denn ich fürchtete, ich möchte sonst, wenn das Wunder wirklich eintreten sollte, die (über so viele Hindernisse, Entfernungen, alle entgegenstehenden Bedrohungen und Gefahren hinweg) fast unmöglich zu erhoffende Ankunft des Insekts versäumen, des Botschafters, gesandt zu der Jungfrau, die seit langem auf sein Kommen wartete.1 Ich wußte, daß dieses Warten nicht passiver als bei der männlichen Blüte war, deren Staubfäden sich von selbst wendeten, damit das Insekt auch ja den Pollen aufnehmen könne; ebenso würde die weibliche Blüte hier vor mir beim Eintreffen des Insekts kokett ihren Griffel biegen und würde ihm gleich einer heuchlerischen, doch feurigen Maid, damit es besser in sie einzudringen vermöchte, unmerklich auf halbem Weg entgegenkommen. Die Gesetze der Pflanzenwelt werden ihrerseits von immer wieder höheren Gesetzen regiert. Wenn der Besuch eines Insekts, das heißt die Zufuhr des Pollens einer anderen Pflanze, gemeinhin notwendig ist, um einer Blüte zur Befruchtung zu verhelfen, so deswegen, weil die Befruchtung der Blüte durch sie selbst wie wiederholte Heiraten innerhalb derselben Familie zu Degeneration und Unfruchtbarkeit führen würde, während die durch Insekten herbeigeführte Kreuzung den folgenden Generationen derselben Gattung eine ihren Vorfahren noch nicht zuteil gewordene Lebenskraft verleiht. Allerdings kann dieser Kraftüberschwang allzu stark werden und die Art sich damit ins Maßlose entwickeln; aber wie ein Antitoxin die Krankheit abwehrt, die Schilddrüse den Fettansatz regelt, die Niederlage den Hochmut bestraft, die Müdigkeit den Genuß, und wie der Schlaf wiederum ein Ausruhen von der Ermüdung bringt, so tritt im richtigen Moment ausnahmsweise ein Akt der Selbstbefruchtung ein und führt wie durch das Anziehen einer Schraube in einer Art von Bremshebelwirkung die Pflanze auf die Norm zurück, die sie zu weit überschritten hat. Meine Überlegungen waren in eine Richtung geraten, auf deren Schilderung ich später zurückkommen werde1, und ich hatte aus der anscheinenden List der Pflanzen bereits eine Konsequenz für einen ganzen, unbewußten Teil des literarischen Schaffens gezogen, als ich Monsieur de Charlus erblickte, der von seinem Besuch bei der Marquise zurückkehrte. Seit seinem Eintreten in das Haus waren erst ein paar Minuten vergangen. Vielleicht hatte er von seiner alten Verwandten selbst oder auch nur durch einen Diener gehört, daß es ihr bedeutend besser gehe oder daß sie bereits völlig wiederhergestellt sei – Madame de Villeparisis sei einfach kurz unpäßlich gewesen. In diesem Augenblick, da Monsieur de Charlus sich unbeobachtet wähnte und die Lider wegen der Sonne gesenkt hielt, hatte er jene Spannung in seinem Gesicht gelöst, jene künstliche Kernigkeit abgelegt, die die Erregung des Redens und die Willenskraft bei ihm aufrechterhielten. Er war blaß wie Marmor, die Nase sprang stark hervor, und seine weichen Gesichtszüge spiegelten keine von dominanten Blicken veränderte Bedeutung mehr wider, die die Schönheit ihres ursprünglichen Typus’ getrübt hätte; nur noch ein Guermantes, schien er bereits in Stein gehauen: Palamède
xv
. in der Kapelle zu Combray. Allerdings nahmen diese gemeinsamen Familienzüge in dem Gesicht von Monsieur de Charlus eine mehr vergeistigte, vor allem aber eine sanftere Feinheit an. Ich bedauerte um seinetwillen, daß er gewöhnlich die Freundlichkeit und die Güte, die ich im Augenblick, als er von Madame de Villeparisis zurückkehrte, so ungekünstelt auf seinem Gesicht ausgebreitet sah, durch so viele wilde Ausbrüche und widerwärtige Seltsamkeiten, durch Klatsch und Härte, durch Empfindlichkeiten und Überheblichkeiten verunstaltete und unter einer künstlich angenommenen Brutalität verbarg. In der Sonne blinzelnd schien er beinahe zu lächeln; im Ruhe-, sozusagen im Naturzustand, zeigte mir sein Gesicht etwas so Liebevolles, so Wehrloses, daß ich mich nicht enthalten konnte zu denken, wie entrüstet Monsieur de Charlus gewesen wäre, hätte er gewußt, daß ihn jemand sah; denn woran ich plötzlich denken mußte beim Anblick dieses Mannes, der für Männlichkeit derart eingenommen war, der sich so viel auf seine Männlichkeit einbildete, dem alle anderen grauenhaft weibisch vorkamen, das war – so sehr trug er vorübergehend die Züge, den Ausdruck, das Lächeln einer solchen – eine Frau.1
Ich wollte gerade noch einmal meine Stellung verändern, damit er mich ja nicht bemerkte. Doch ergab sich dafür weder die Zeit noch eine Notwendigkeit. Denn was mußte ich sehen! Auf diesem Hof, auf dem die beiden sich gewiß zuvor nie begegnet waren (da Monsieur de Charlus sonst nur nachmittags in das Haus kam, das heißt in den Stunden, in denen Jupien sich im Büro befand), traten sie jetzt einander gegenüber: der Baron, der mit einem Mal die halbgeschlossenen Lider weit öffnete und mit außergewöhnlicher Aufmerksamkeit den ehemaligen Westenmacher auf der Schwelle seines Ladens betrachtete, und dieser, der wie angenagelt, ja pflanzengleich angewurzelt stehenblieb, als er Monsieur de Charlus vor sich sah und den staunend bewundernden Blick über die zur Fülle neigende Gestalt des alternden Barons gleiten ließ. Doch was noch erstaunlicher war: nachdem Monsieur de Charlus seine Haltung verändert hatte, richtete sich auch die Jupiens im gleichen Augenblick, als folge sie den Gesetzen einer geheimen Kunst, harmonisch danach aus. Der Baron, der jetzt den Eindruck verbergen zu wollen schien, den er empfangen hatte, sich aber offenbar ungeachtet seiner zur Schau getragenen Gleichgültigkeit nur widerwillig entfernte, ging, kam zurück, schaute ziellos in einer Weise vor sich hin, von der er annahm, sie werde die Schönheit seiner Augen am besten zur Geltung bringen, und nahm ein eitles, lässiges, lächerliches Gehaben an. Jupien aber, der auf der Stelle die ergebene und gutmütige Miene ablegte, die ich von jeher an ihm kannte, hatte – in vollkommener Übereinstimmung mit dem Baron – den Kopf erhoben und seine Gestalt möglichst vorteilhaft zurechtgerückt, wobei er mit grotesker Überheblichkeit die Faust auf die Hüfte stemmte und sein Hinterteil herausdrückte, kurz Posen annahm, in denen jene Koketterie lag, wie sie die Orchidee für die von der Vorsehung gesandte, überraschend eintreffende Hummel hätte aufwenden können. Ich hatte nicht gewußt, daß er so unsympathisch aussehen konnte. Es war mir aber auch neu, daß er in dieser Art von Doppelpantomime, die (obwohl er zum ersten Mal Monsieur de Charlus gegenüberstand) schon seit langem einstudiert schien, seine Rolle so gut zu improvisieren verstand; ohne Vorbereitung erreicht man solche Vollkommenheit nur, wenn man im Ausland auf einen Landsmann stößt, mit dem die Verständigung dann ganz von selbst eintritt, obwohl man sich nie zuvor gesehen hat, weil das Vermittlungsinstrument das gleiche ist.
Diese Szene war übrigens nicht eigentlich komisch, sie barg in sich eine Seltsamkeit oder – wenn man will – eine Natürlichkeit, die allmählich an Schönheit gewann. Monsieur de Charlus mochte wohl eine ganz unbeteiligte Miene aufsetzen, zerstreut die Lider senken – sekundenlang hob er sie dennoch wieder und warf auf Jupien einen gespannten Blick. Jedesmal jedoch (gewiß weil er der Meinung war, eine solche Szene könne an diesem Ort nicht beliebig lange ausgesponnen werden – sei es aus Gründen, die man später verstehen wird, oder schließlich auch aus dem Gefühl für die Kurzlebigkeit aller Dinge, das den Wunsch erzeugt, jeder Streich möge auf der Stelle sitzen, und das immer wieder das Schauspiel der Liebe so rührend macht), wenn Monsieur de Charlus Jupien anblickte, richtete er es so ein, daß sein Blick ausdrücklich etwas besagte, was ihn den Blicken ganz ungleich machte, die man gemeinhin für eine Person verwendet, die man wenig oder gar nicht kennt; er starrte Jupien auf die besondere Weise eines Menschen an, der einem gleich darauf sagen wird: Verzeihen Sie meine Aufdringlichkeit, aber auf Ihrem Rücken hängt ein langer weißer Faden, oder: Ich glaube, ich täusche mich nicht, Sie sind doch auch aus Zürich, ich meine, ich bin Ihnen dort beim Antiquitätenhändler begegnet.1 So schien alle zwei Minuten die gleiche dringliche Frage in den Blicken zu liegen, die Monsieur de Charlus Jupien zuwarf, wie in den fragenden Motiven bei Beethoven, die im gleichen Abstand unendlich oft wiederholt werden, um nach einem übertriebenen Aufwand an Vorbereitung ein neues Thema, einen Wechsel der Tonart oder eine »Wiederkehr«2 herbeizuführen. Die Schönheit aber der Blicke, die Monsieur de Charlus und Jupien einander zuwarfen, schien im Gegenteil gerade daher zu rühren, daß – einstweilen wenigstens – diese Blicke offenbar nicht dem Zweck unterlagen, auf etwas hinzuführen. Diese Schönheit stellte ich bei dem Baron und Jupien zum ersten Mal fest. In aller beider Augen war ebender Himmel, freilich nicht Zürichs, sondern einer gewissen orientalischen Stadt, deren Namen ich noch nicht erraten hatte, aufgegangen.1 Was auch Monsieur de Charlus und den Westenmacher noch zurückhalten mochte, auf alle Fälle schien der Bund geschlossen, und diese zweckfreien Blicke waren offenbar nur ein rituelles Vorspiel, wie die Feste, die vor einer bereits beschlossenen Heirat stattfinden. Um näher bei der Natur zu bleiben – und die Vielzahl dieser Vergleiche ist in sich selbst um so natürlicher, als ein und derselbe Mensch, wenn man ihn ein paar Minuten lang beobachtet, sukzessive ein Mensch, ein Vogelmensch, ein Insektenmensch usw. zu sein scheint –, hätte man auch sagen können, es handle sich um zwei Vögel, ein Männchen und ein Weibchen, von denen das Männchen seine Avancen macht, das Weibchen aber – Jupien – mit keinem Zeichen auf dieses Treiben antwortet, sondern ohne Verwunderung seinen neuen Freund anschaut, mit einer achtlosen Unablässigkeit, die es bestimmt für verführerischer und, nachdem das Männchen den ersten Schritt getan hat, für das einzig Zweckmäßige hält, derweil es sich auf das Glätten seiner Flügel beschränkt. Endlich schien die Indifferenz Jupiens ihm nicht mehr zu genügen; von der Gewißheit, eine Eroberung gemacht zu haben, bis zu dem Entschluß, sich verfolgen und begehren zu lassen, war es nur ein Schritt, und so trat Jupien, entschlossen, zur Arbeit zu gehen, zum Eingangstor hinaus. Gleichwohl machte er sich, erst nachdem er zwei- oder dreimal den Kopf gewendet hatte, auf den Weg, während der Baron, der befürchtete, er könne die Spur verlieren (betont unbekümmert, vor sich hin pfeifend und nicht ohne dem Hausmeister, der, halb betrunken, in seinem Hinterzimmer Gäste bewirtete und ihn gar nicht hörte, »Auf Wiedersehen« zuzurufen), eilig hinter ihm herlief, um ihn einzuholen. Im gleichen Augenblick, da Monsieur de Charlus pfeifend wie eine dicke Hummel durch das Tor verschwand, kam eine andere, diesmal eine richtige, in den Hof geschwirrt. Wer weiß, ob es nicht die seit so langem schon von der Orchidee erwartete war, die ihr den so seltenen Pollen brachte, ohne den sie jungfräulich bleiben würde? Doch wurde ich durch Jupien davon abgelenkt, den Liebesspielen des Insekts zu folgen; denn einige Minuten darauf kehrte Jupien zurück (vielleicht um ein Paket zu holen, mit dem er später fortging und das er in seiner Erregung über das Erscheinen von Monsieur de Charlus vergessen hatte, vielleicht auch ganz einfach aus einem natürlicheren Grund), gefolgt von dem Baron. Nunmehr entschlossen, rasch voranzukommen, bat dieser den Westenmacher um Feuer, bemerkte dann aber sofort: »Ich bitte Sie um Feuer, sehe aber, daß ich meine Zigarren vergessen habe.« Die Gesetze der Gastfreundschaft waren stärker als die Regeln der Koketterie: »Kommen Sie doch herein, da können Sie alles bekommen, was Sie wünschen«, sagte der Westenmacher, dessen Miene nicht mehr Verachtung, sondern Freude verriet. Die Ladentür schloß sich hinter den beiden, ich konnte nichts mehr hören. Die Hummel hatte ich aus den Augen verloren, ich wußte nicht, ob sie das Insekt war, das die Orchidee benötigte, zweifelte aber nicht mehr daran, daß eine in der Gefangenschaft lebende Pflanze und ein sehr seltenes Insekt die ans Wunderbare grenzende Möglichkeit finden konnten, sich zu vereinigen, wo doch Monsieur de Charlus (es soll dies ein schlichter Vergleich hinsichtlich providentieller Fügungen jeglicher Spielart sein, ohne die leiseste nach Wissenschaftlichkeit schielende Anmaßung, gewisse Gesetze der Botanik zu dem in Beziehung zu setzen, was man zuweilen recht unzulänglich als Homosexualität1 bezeichnet), der seit Jahren in dieses Haus immer nur zu den Stunden kam, zu denen Jupien nicht anwesend war, nun durch den Zufall einer Unpäßlichkeit von Madame de Villeparisis dem Westenmacher und damit dem großen Glück begegnet war, das Männern vom Schlage des Barons durch eines der Wesen geschenkt wird, die sogar, wie man sehen wird, unendlich viel jünger und schöner als Jupien sein können –, durch den Menschen, der vom Schicksal im voraus ausersehen ist, damit auch diese ihren Anteil an den Wonnen der Erde erhalten: den Mann, der einzig die alten Herren liebt.
Was ich hier übrigens eben berichtet habe, sollte ich erst einige Minuten darauf begreifen, so sehr steht der Wirklichkeit die Fähigkeit zu Gebote, sich unsichtbar zu machen, bis irgendein Umstand sie dieser Fähigkeit beraubt. Auf alle Fälle ärgerte ich mich im Augenblick, daß ich die Unterhaltung des ehemaligen Westenmachers und des Barons nicht weiter mit anhören konnte. Ich zog daher den zur Vermietung stehenden Ladenraum in Betracht, der von Jupiens Werkstatt nur durch eine äußerst dünne Zwischenwand getrennt war. Ich mußte, um dorthin zu gelangen, nur wieder in unsere Wohnung hinaufsteigen, mich in die Küche begeben, die Hintertreppe bis zum Keller hinuntergehen, diesen in der ganzen Hofbreite durchmessen, um, sobald ich mich an der Stelle des Souterrains befand, wo der Kunstschreiner noch vor ein paar Monaten seine Holzvorräte gelagert hatte und wo Jupien jetzt seine Kohlen unterbringen wollte, über ein paar Stufen ins Innere des Ladens zu gelangen. Auf diese Weise würde ich den ganzen Weg unter Deckung zurücklegen, ohne gesehen zu werden. So wäre es am vorsichtigsten gewesen. Dennoch wählte ich diesen Weg nicht, sondern schlich mich im Freien, dicht an der Wand, rings um den Hof herum und versuchte dabei ungesehen zu bleiben. Wenn es mir wirklich gelang, so verdanke ich das, glaube ich, mehr dem Zufall als meiner Achtsamkeit. Für die Tatsache aber, daß ich einen so unvorsichtigen Entschluß faßte, obwohl der Weg durch den Keller so viel sicherer war, sehe ich drei Erklärungen, wofern es überhaupt eine gibt. Zunächst meine Ungeduld. Dann vielleicht eine dunkle Rückerinnerung an die Szene in Montjouvain, als ich mich vor dem Fenster von Mademoiselle Vinteuil verbarg. Tatsächlich trugen Dinge dieser Art, denen ich beiwohnte, in ihrer Inszenierung jeweils den Stempel größter Unvorsichtigkeit und Unwahrscheinlichkeit, als dürften solche Enthüllungen immer nur Lohn einer gefahrvollen, wenngleich teilweise geheimen Unternehmung sein.1 Schließlich wage ich wegen seines kindischen Charakters kaum den dritten Grund einzugestehen, der wohl, wie ich glaube, unbewußt der bestimmende war. Seitdem ich in der Absicht, die militärischen Grundsätze Saint-Loups zu studieren – und durch die Tatsachen widerlegt zu sehen –, den Burenkrieg genau verfolgt hatte, war ich auch dazu gekommen, alte Berichte über Forschungsexpeditionen und Reisen wiederzulesen. Diese Erzählungen hatten mich begeistert, und ich wandte sie nun auf das tägliche Leben an, um meinen Mut zu stärken. Wenn Anfälle mich gezwungen hatten, mehrere Tage und Nächte nacheinander nicht nur, ohne zu schlafen, zu verbringen, sondern auch, ohne mich auszustrecken, Nahrung zu mir zu nehmen oder etwas zu trinken, dann dachte ich, wenn Erschöpfung und Leiden mir derart zusetzten, daß ich kein Ende abzusehen meinte, an einen gestrandeten Reisenden, der, von giftigen Gewächsen geschwächt, schlotternd vor Fieber unter seinen vom Salzwasser durchweichten Kleidern, sich dennoch nach zwei Tagen besser fühlt und seinen Weg ins Ungewisse fortsetzt auf der Suche nach Bewohnern, die vielleicht Menschenfresser sind. Solche Beispiele stärkten mich, gaben mir die Hoffnung zurück, und ich schämte mich meiner Regung vorübergehender Mutlosigkeit. Wenn ich an die Buren dachte, die im Angesicht der englischen Armeen nicht fürchteten, sich zu exponieren, wenn es galt, ungedecktes Gelände zu durchqueren, um zu einem Dickicht zu gelangen, sagte ich mir: Es wäre ja noch schöner, wenn ich zaghafter wäre, wo doch der Kriegsschauplatz nur einfach unser eigener Hof ist und wo ich, der ich mich in letzter Zeit wegen der Dreyfus-Affäre mehrere Male furchtlos duelliert habe, einzig von den Blicken der Nachbarn durchbohrt werden kann, die sicher anderes zu tun haben, als in den Hof hinabzuschauen.1
Doch als ich mich in dem Ladenraum befand und das geringste Knacken des Fußbodens zu vermeiden bemüht war – denn ich merkte, daß selbst das kleinste Geräusch von Jupiens Laden her auf meiner Seite zu hören war –, dachte ich, wie unvorsichtig Jupien und Monsieur de Charlus sich doch verhalten hätten und wie sehr das Glück ihnen hold gewesen war.
Ich wagte mich nicht zu rühren. Der Reitknecht des Herzogs von Guermantes hatte wahrscheinlich die Abwesenheit seiner Herrschaft benutzt, um in den Ladenraum, in dem ich mich aufhielt, eine Leiter zu schaffen, die sich sonst in der Remise befand. Hätte ich sie erstiegen, wäre es mir sicher möglich gewesen, die Luke aufzustoßen und so gut zu hören2, als ob ich mich in Jupiens Werkstatt befunden hätte. Ich fürchtete aber, mich durch ein Geräusch zu verraten. Im übrigen hatte es keinen Zweck. Ich brauchte nicht einmal zu bedauern, daß ich nicht schon ein paar Minuten früher in den Laden gekommen war. Denn nach dem zu schließen, was ich zu Anfang von Jupiens Seite her vernahm und was einzig in unartikulierten Lauten bestand, vermute ich, daß nur wenige Worte gewechselt worden waren. Allerdings waren diese Töne so heftig, daß ich, wären sie nicht immer wieder eine Oktave höher von einer parallel verlaufenden Klage aufgegriffen worden, hätte meinen können, neben mir würde ein Mensch von einem anderen erwürgt, hinterher aber nähmen der Mörder und sein wiedererstandenes Opfer ein Bad, um die Spuren des Verbrechens auszulöschen.1 Ich zog daraus später den Schluß, daß es etwas ebenso Geräuschvolles gibt wie den Schmerz, nämlich die Lust, vor allem in Verbindung zwar nicht mit der Befürchtung, Kinder zu bekommen, was hier trotz des wenig überzeugenden Beispiels aus der Legenda aurea2 nicht der Fall sein konnte, sondern mit unmittelbaren Bedürfnissen der Hygiene. Endlich nach einer halben Stunde etwa (ich hatte mich inzwischen mit lautlosem Schritt dennoch auf die Leiter gewagt, um durch die Luke zu schauen, die ich jedoch nicht öffnete) kam eine Unterhaltung in Fluß. Jupien lehnte energisch das Geld ab, das der Baron ihm anbot.
Dann trat Monsieur de Charlus einen Schritt weit aus dem Laden hinaus. »Warum haben Sie Ihr Kinn so glatt ausrasiert«, hielt Jupien dem Baron in zärtlich schmollendem Tone vor. »Das ist doch etwas Schönes, so ein schöner Bart!« – »Pfui! Ich finde das greulich«, antwortete der Baron. Indessen verweilte er noch auf der Türschwelle und fragte Jupien über das Stadtviertel aus. »Wissen Sie nichts über den Maronenverkäufer an der Ecke, ich meine nicht den links, das ist eine Schreckschraube, sondern den gegenüber, so ein großer, schwarzer, kräftiger Bursche? Und der Apotheker gegenüber, er hat einen netten Radler, der die Arzneien austrägt.« Offenbar fühlte sich Jupien durch diese Fragen gekränkt, denn er richtete sich auf und antwortete mit dem Verdruß einer hintergangenen Kokotte: »Ich glaube, Sie haben ein Herz wie ein Bienenhaus.« Dieser in schmerzlichem, eisigem und affektiertem Ton geäußerte Vorwurf rührte offenbar Monsieur de Charlus, denn um den schlechten Eindruck wieder zu verwischen, den seine Neugier hervorgerufen hatte, richtete er, zu leise allerdings, als daß ich es verstehen konnte, an Jupien eine Bitte, die es zweifellos notwendig machte, daß sie ihren Aufenthalt im Laden noch etwas länger ausdehnten; dem Westenmacher genügte sie offenbar, um seinen Kummer zu bannen, denn er ließ auf dem fetten, unter dem grauen Haar geröteten Gesicht des Barons den wonnetrunkenen Blick eines Menschen ruhen, dessen Eigenliebe man mit Erfolg geschmeichelt hat, und nunmehr entschlossen, Monsieur de Charlus zu gewähren, was dieser von ihm erbeten hatte, sagte er nach Bemerkungen, die jeder Distinktion entbehrten, wie etwa: »Sie sind aber hinten gut versorgt!«, mit lächelnder, bewegter, überlegener und dankerfüllter Miene: »Na, schon gut, mein kleiner Rotzbengel!«
»Wenn ich auf die Frage nach dem Straßenbahnschaffner zurückkomme«1, hielt Monsieur de Charlus beharrlich an seinem Thema fest, »so deswegen, weil das abgesehen von allem übrigen eine gewisse Bedeutung für meine Rückfahrt haben könnte. Es geht mir tatsächlich manchmal wie dem Kalifen, der Bagdad in der Kleidung eines schlichten Kaufmanns durchwanderte2, nämlich daß ich mich herablasse, einer interessanten kleinen Person zu folgen, deren Silhouette mir gefällt.« Ich machte hier die gleiche Beobachtung wie früher schon bei Bergotte. Wenn dieser sich jemals vor einem Tribunal zu verantworten hätte, würde er nicht die Wendungen gebrauchen, die am besten geeignet wären, die Richter zu überzeugen, sondern echt bergottische, die ihm ganz natürlich aus seinem speziellen literarischen Temperament zuströmten und die er nun einmal gern benutzte. In gleicher Weise verwendete Monsieur de Charlus in seinem Gespräch mit dem Westenmacher die Redeweise, deren er sich unter Weltleuten seiner Kreise bedient hätte, ja er übertrieb sogar noch seine Manieriertheiten, sei es, daß die Schüchternheit, die er zu überwinden hatte, ihn zu exzessivem Hochmut trieb, sei es, daß sie ihn um die volle Beherrschung seiner selbst brachte (denn man ist befangener Menschen gegenüber, die nicht dem eigenen Milieu angehören) und ihn zwang, seine von Grund auf hochmütige und, wie Madame de Guermantes sagte, etwas verrückte Natur zu enthüllen, sie bloßzulegen. »Um ihre Spur nicht zu verlieren«, fuhr er fort, »springe ich wie ein kleiner Schullehrer oder ein hübscher junger Arzt in die gleiche Straßenbahn wie die bewußte interessante Person, von der wir nur im Femininum sprechen wollen, um der Sitte zu entsprechen (so wie man sagt, wenn man zu einer Fürstlichkeit spricht: Befindet Hoheit sich wohl?). Wenn sie umsteigt, löse ich vielleicht gleichzeitig mit einer Ladung Pestmikroben diese unmögliche Sache, die man als ›Umsteiger‹ bezeichnet, eine Nummer, die, obwohl man sie mir aushändigt, nicht einmal immer die Nummer eins ist! So steige ich selbst drei- oder sogar viermal in einen anderen ›Wagen‹ um. Manchmal lande ich dann um elf Uhr abends an der Gare d’Orléans1 und muß von da wieder zurück! Und wenn es sich dabei wirklich nur um den Bahnhof handelte! Denn einmal bin ich zum Beispiel, weil es mir vorher nicht gelang, eine Unterhaltung in Gang zu bringen, bis Orléans gefahren, in einem jener abscheulichen Waggons, in denen man zwischen dreieckigen Netzen in ›Knüpftechnik‹ Photographien der hervorragendsten Meisterwerke der Architektur der betreffenden Linie vor Augen hat. Es war nur ein Platz frei, und ich hatte vor mir als historisches Monument eine Ansicht der Kathedrale von Orléans, die die häßlichste von ganz Frankreich ist und deren erzwungener Anblick auf mich so ermüdend wirkte, als müsse ich ihre Türme in dem Glaskügelchen jener optischen Federhalter betrachten, von denen man Augenweh bekommt.1 Ich stieg in Les Aubrais zugleich mit der interessanten Person aus, die aber leider von ihrer Familie (auf alles war ich bei ihr gefaßt, nur darauf nicht, daß sie eine Familie hatte) am Bahnsteig erwartet wurde! Bis zur Abfahrt des Zuges, der mich wieder nach Paris brachte, blieb mir als Trost nur das Haus der Diane de Poitiers.2 Sie mag zwar meine königlichen Vorfahren begeistert haben, ich selbst jedenfalls hätte eine lebendigere Schönheit vorgezogen. Deswegen nun, als Linderungsmittel für die Langeweile solcher einsamen Heimfahrten, würde ich recht gern die Bekanntschaft eines Schlafwagenangestellten oder Omnibusschaffners machen. Seien Sie übrigens nicht zu entsetzt«, schloß der Baron, »bei alledem kommt es immer ganz auf das Genre an. Was beispielsweise die jungen Leute aus der Gesellschaft angeht, so verlangt es mich bei ihnen nicht nach physischem Besitz, aber ich bin erst zufrieden, wenn ich sie berührt habe, ich meine nicht im physischen Sinn, sondern so, daß ich ihre empfindliche Seite getroffen habe. Wenn ein junger Mann erst einmal, anstatt meine Briefe unbeantwortet zu lassen, mir unaufhörlich schreibt, mir psychisch völlig hörig geworden ist, habe ich meine Ruhe wieder oder vielmehr hätte sie, wenn ich nicht sehr bald von einem anderen in Anspruch genommen würde. Recht sonderbar, nicht wahr? Apropos, diese jungen Leute aus der Gesellschaft: Unter denen, die hier in diesem Haus verkehren, sind Ihnen wohl keine solchen bekannt?« – »Nein, mein Süßer. Ach, ja doch, ein Dunkler, sehr Großer mit Monokel, der immer lacht und sich nach mir umdreht.« – »Ich weiß nicht, wen Sie meinen.« Jupien vollendete das Porträt, Monsieur de Charlus aber konnte nicht herausfinden, um wen es sich handelte, weil er nicht wußte, daß der ehemalige Westenmacher zu den Leuten gehörte – sie sind viel zahlreicher, als man meint –, die sich an die Haarfarbe von Leuten, die sie nur flüchtig kennen, nicht erinnern können. Ich aber, der ich diese Schwäche Jupiens kannte und daraufhin dunkel durch blond ersetzte, war der Meinung, das Porträt sei genau das des Herzogs von Châtellerault. »Um noch einmal auf die jungen Leute zurückzukommen, die nicht dem Volk angehören«, fuhr der Baron fort, »so hat mir im Augenblick ein seltsamer kleiner Bursche den Kopf verdreht, ein gescheiter kleiner Bürgerlicher, der mir mit fabelhafter Unhöflichkeit gegenübertritt.1 Er hat gar kein Gefühl dafür, was für eine eminente Persönlichkeit ich bin und was für ein mikroskopischer Einzeller er selbst im Vergleich dazu ist. Aber schließlich, was macht es, dieser kleine Esel soll meinem erhabenen Bischofsgewand gegenüber nur so viel I–a schreien, wie er will.« – »Bischof !« rief Jupien aus, der von den letzten Bemerkungen des Barons kein Wort verstanden hatte, den jedoch das Wort Bischof völlig zu überwältigen schien. »Das verträgt sich aber schlecht mit der Religion«, sagte er. »Ich habe drei Päpste in meiner Familie«, antwortete Monsieur de Charlus, »und das Recht auf rotes Wappentuch von einem Titel her, der dem eines Kardinals entspricht, denn die Nichte des Kardinals, der mein Großonkel war, hat meinem Großvater einen Herzogstitel eingebracht, der ein Ersatz dafür war. Aber ich sehe, daß bei Ihnen Metaphern auf taube Ohren stoßen und französische Geschichte auf Indifferenz stößt. Im übrigen«, setzte er hinzu – weniger vielleicht als Schlußfolgerung denn als Warnung –, »die Anziehung, die auf mich junge Leute ausüben, die mich meiden – aus Furcht natürlich, denn nur der Respekt schließt ihnen die Lippen, die so gern ihrer Liebe Ausdruck geben möchten –, wäre ohne einen sehr hohen gesellschaftlichen Rang ganz undenkbar. Zudem kann ihre vorgebliche Gleichgültigkeit ganz ungewollt eine vollkommen gegenteilige Wirkung erzielen. Zieht man sie nämlich dummdreisterweise in die Länge, finde ich sie abstoßend. Um ein Beispiel aus einer Klasse zu wählen, die Ihnen vielleicht näherliegt: als mein Stadthaus renoviert wurde, habe ich, um keine Eifersucht unter den Herzoginnen zu schaffen, die sich die Ehre streitig machten, sagen zu können, ich hätte bei ihnen gewohnt, ein paar Tage ›im Hotel logiert‹, wie man sagt. Einer der Etagenboys war mir bekannt, ich machte ihn auf einen interessanten kleinen Pagen aufmerksam, der Wagentüren schloß und für meine Angebote unzugänglich blieb. Am Ende meiner Geduld angekommen, ließ ich ihm, um die Lauterkeit meiner Absichten zu beweisen, eine lächerlich hohe Summe anbieten, wenn er mich nur für eine Unterhaltung von fünf Minuten auf meinem Zimmer besuchte. Ich wartete vergebens auf ihn. Daraufhin faßte ich eine solche Abneigung gegen ihn, daß ich die Hintertreppe benutzte, nur um die Visage dieses ekligen kleinen Wichts ja nicht mehr vor die Augen zu bekommen. Später habe ich in Erfahrung gebracht, daß er keinen meiner Briefe erhalten hat, alle waren abgefangen worden, der erste vom Etagenboy, der neidisch auf ihn war, der zweite vom Tagesportier, der tugendhaft war, und der dritte vom Nachtportier, der in den jungen Pagen verliebt war und mit ihm ins Bett ging, wenn Diana sich erhob. Doch meine Abneigung blieb gleichwohl bestehen, und wenn man mir den Pagen heute wie ein Wildbret auf silberner Platte servierte, würde ich ihn mit einem Würgen der Übelkeit von mir weisen. Sehen Sie, da haben wir das Pech! Durch unser seriöses Gespräch haben wir uns um das gebracht, was ich für uns erhoffte. Doch Sie können mir große Dienste erweisen, zum Beispiel ein bißchen vermitteln; aber nein, der bloße Gedanke daran muntert mich derart auf, daß ich spüre, es ist noch immer für gar nichts zu spät.«
Seit dem Beginn dieser Szene hatte sich für meine Augen, von denen es wie Schuppen fiel, eine unerhörte Wandlung in Monsieur de Charlus vollzogen, und zwar ebenso umfassend und plötzlich, als hätte ihn ein Zauberstab berührt. Bis dahin hatte ich nichts begriffen, und aus diesem Grunde sah ich auch nichts. Das Laster (wenn man es der Bequemlichkeit halber so nennen will) eines jeden einzelnen begleitet diesen nach Art der Genien, die für die Menschen unsichtbar waren, solange diese von ihrer Anwesenheit keine Kenntnis hatten. Güte, Falschheit, Name, gesellschaftliche Beziehungen lassen sich nicht erkennen, man trägt sie verborgen mit sich herum. Odysseus sogar vermochte zunächst Athene nicht zu erkennen.1 Doch für Götter sind Götter auf der Stelle erkennbar, ebenso rasch für den Gleichgesinnten ein Gleichgesinnter und so auch für Jupien Monsieur de Charlus. Bislang hatte ich mich Monsieur de Charlus gegenüber in der Lage eines etwas zerstreuten Mannes befunden, der beharrlich einer schwangeren Frau, deren schwerer gewordenen Leib er nicht wahrnimmt und die ihm lächelnd immer wieder sagt: »Oh, ich bin im Augenblick etwas angegriffen«, die indiskrete Frage stellt: »Aber was haben Sie denn?« Wenn ihm dann jemand sagt: »Sie ist in anderen Umständen«, bemerkt er ihren starken Leib und sieht nun nichts anderes mehr. Der Verstand ist es, der uns die Augen öffnet; ein behobener Irrtum verleiht uns einen zusätzlichen Sinn.
Diejenigen Personen, die nicht gern als Beispiel für diese Regel die »Charlusse« ihrer Bekanntschaft heranziehen wollen, gegen die sie lange Zeit keinerlei Verdacht hegten bis zu dem Tag, da auf der glatten Oberfläche eines Individuums (das den anderen sonst in allem glich) in einer bis dahin unsichtbaren Tinte eingetragen jene Lettern erschienen, aus denen sich das den alten Griechen teure Wort2 zusammensetzt, brauchen – um sich zu überzeugen, daß die sie umgebende Welt sich ihnen anfangs kahl, bar der tausend Zierden zeigt, in deren Schmuck sie hingegen den Eingeweihteren erscheint – sich nur daran zu erinnern, wie oft im Leben sie schon im Begriff gewesen sind, einen Taktfehler zu begehen. Nichts auf dem unbeschriebenen Allerweltsgesicht dieses oder jenes Mannes konnte sie auf den Gedanken bringen, daß er ausgerechnet der Bruder oder der Verlobte oder der Liebhaber einer Frau sei, von der sie gerade per »diese Kuh!« zu sprechen im Zuge waren. Dann aber hält glücklicherweise ein Wort, das ihnen ein Nachbar zuraunt, auf ihren Lippen den fatalen Ausdruck zurück. Im Nu leuchten wie ein Menetekel1 die Worte auf: »Er ist der Verlobte« oder »er ist der Bruder« oder »er ist der Liebhaber« der Frau, die man also vor ihm nicht als »Kuh« bezeichnen darf. Diese einzige, neue Vorstellung aber wird eine völlige Umgruppierung nach sich ziehen, den Abzug oder den Vormarsch der Fraktion all jener Vorstellungen, die man von der übrigen Familie besaß. In Monsieur de Charlus mochte sich noch so sehr, eng mit ihm verkoppelt, ein anderes Wesen, das ihn von den übrigen Männern unterschied, wie das Pferd im Zentauren verbergen, ich hatte es niemals bemerkt. Jetzt, da das Abstrakte wirkliche Gestalt angenommen hatte, besaß das endlich erkannte Wesen auf der Stelle seine Macht nicht mehr, unsichtbar zu bleiben, und die Umwandlung von Monsieur de Charlus in eine neue Person war so vollständig, daß nicht nur die Kontraste in seinem Mienenspiel, seiner Stimme, sondern rückblickend auch der jähe Wechsel in seinen Beziehungen zu mir, alles, was mir bislang im Geiste unvereinbar erschienen war, nunmehr verständlich wurde, augenfällig wie ein Satz, der keinen Sinn hat, solange er in seinen einzelnen Lettern willkürlich zerlegt erscheint, jedoch wenn diese in richtiger Ordnung wieder aneinandergefügt worden sind, einen Gedanken ausdrückt, den man nicht wieder vergessen kann.
Zudem begriff ich jetzt, wieso ich vorhin, als ich Monsieur de Charlus von Madame de Villeparisis hatte herauskommen sehen, finden konnte, er sehe aus wie eine Frau: Er war eine!1 Er gehörte zu der Rasse jener Menschen (sie sind weniger widerspruchsvoll, als es den Anschein hat), deren Ideal männlich ist, gerade weil sie von weiblichem Temperament sind, und die im Leben nur scheinbar den anderen Männern gleichen; da, wo jeder in seinen Augen, durch die er alle Dinge der Welt betrachtet, eine bestimmte Silhouette auf seiner Iris eingezeichnet trägt, schwebt diesen nicht eine Nymphe, sondern ein Ephebe vor. Eine Rasse2, auf der ein Fluch liegt und die in Lüge und Meineid leben muß, da sie weiß, daß ihr Verlangen, das, was für jedes Geschöpf die höchste Beseligung im Dasein ausmacht, für sträflich und schmachvoll, für ganz uneingestehbar gilt; die ihren Gott verleugnen muß, weil ihre Angehörigen, selbst wenn sie Christen sind, sobald sie als Angeklagte vor den Schranken des Tribunals erscheinen, auch im Angesicht Christi und unter Anrufung des heiligen Namens sich dessen als einer Verleumdung erwehren müssen, was ihr Leben ausmacht; Söhne ohne Mutter, denn auch die müssen sie ihr Leben lang belügen, selbst in der Stunde noch, da sie ihr die Augen zudrücken; Freunde ohne Freundschaft trotz der Gefühle, die ihr oft anerkannter Zauber anderen einzuflößen vermag und die ihr oft gutes Herz selbst verspüren könnte; aber kann man als Freundschaft Beziehungen bezeichnen, die sich nur dank einer Lüge aufrechterhalten lassen und aus denen man sie nach der ersten Regung von Vertrauen oder Aufrichtigkeit, zu der sie sich etwa versucht fühlten, mit Abscheu wieder entlassen wird, wofern sie nicht mit einem unparteiischen, ja sogar ihnen sympathisch gegenüberstehenden Geist zu tun haben, der aber dann, durch eine konventionelle Psychologie ihnen gegenüber geblendet, gerade aus dem eingestandenen Laster bei ihnen jene Art der Zuneigung ableiten muß, die ihm die allerfremdeste ist, ebenso wie gewisse Richter bei Homosexuellen einen Mord und bei Juden einen Verrat leichter vermuten und verzeihen, aus Gründen, die sie aus der Erbsünde und schicksalhaften rassischen Bedingtheiten ableiten?1 Endlich auch – wenigstens nach der ersten Theorie, die ich damals hierüber entwarf und die ich, wie man sehen wird, in der Folge korrigieren mußte, an der sie aber gerade das besonders gekränkt haben würde, wenn nicht dieser Widerspruch ihren Blicken durch die Illusion entzogen worden wäre, durch die sie sehen und leben – Liebende, denen fast völlig die Möglichkeit der Liebe verschlossen ist, auf die zu hoffen ihnen die Kraft verleiht, so viele Wagnisse und Einsamkeiten zu ertragen, da sie nämlich in einen Mann verliebt sind, der nichts von einer Frau haben, nicht homosexuell sein darf und sie infolgedessen ja gar nicht lieben kann, so daß ihr Verlangen auf immer ungestillt bliebe, wenn nicht Geld ihnen richtige Männer verschaffte und ihre Phantasie ihnen schließlich dennoch ermöglichte, die Homosexuellen, mit denen sie sich eingelassen haben, für echte Männer zu halten. Keine Ehre, außer einer prekären; keine Freiheit, außer einer vorläufigen, bis zur Aufdeckung ihres Verbrechens; keine Stellung, außer einer unsicheren, wie im Falle des Dichters2, der eben noch in allen Salons gefeiert und in allen Theatern Londons mit Beifall bedacht, am Tage darauf aus jedem noch so bescheidenen Logis verjagt, schließlich nicht mehr wußte, wo er sein Haupt betten sollte, den Mühlstein drehte wie Samson und sich sagte:
Les deux sexes mourront chacun de son côté3;
Und getrennt voneinander werden die beiden
Geschlechter zugrunde gehen;
ausgeschlossen sogar, außer in den Tagen schwerer Schicksalsschläge, wo sich die meisten um das Opfer scharen wie die Juden um Dreyfus1, aus der Sympathie – manchmal sogar aus der Gesellschaft – von ihresgleichen, die voller Abscheu in ihnen sehen, was sie sind, gemalt in einem Spiegel, der ihnen nicht mehr schmeichelt, sondern alle bei ihnen selbst bewußt übersehenen Makel hervorhebt und sie begreifen lehrt, daß das, was sie ihre Liebe nannten (und dem sie, mit dem Wortsinn spielend, aus sozialem Empfinden alles einverleibt hatten, was Poesie, Malerei, Musik, Rittertum oder Askese jemals der Liebe hinzufügten), nicht einem selbstgewählten Schönheitsideal, sondern unheilbarer Krankheit entspringt; wie die Juden wiederum (abgesehen von einigen, die nur mit den Angehörigen ihrer eigenen Rasse verkehren wollen und stets rituelle Ausdrücke sowie altbekannte Witze auf der Zunge haben) auf der Flucht voreinander, doch hinter jenen her, die ihnen am meisten entgegengesetzt sind, die nichts von ihnen wissen wollen, bereit, deren Abfuhren zu verzeihen und sich zu berauschen an deren Freundlichkeiten; doch auch versammelt mit ihresgleichen durch das Scherbengericht, das über sie verhängt wird, durch die Schmach, in die sie hinabgesunken, gezeichnet am Ende nach einer Verfolgung, die der der Juden gleicht, mit den physischen und psychischen Merkmalen einer Rasse; manchmal schön, oft Abscheu erregend, entspannt lediglich (trotz allen Spottes, mit dem derjenige, der sich mit der gegnerischen Rasse eher vermischt, sich ihr besser angepaßt hat und nach außen hin weniger homosexuell wirkt, den anderen überhäuft, der es mehr geblieben ist) im Umgang mit ihresgleichen, was ihrem Dasein sogar Halt verleihen kann, so daß sie es zwar leugnen, eine Rasse zu sein (deren Name als die größte Beleidigung gilt), aber denjenigen, denen es gelingt zu verbergen, daß sie dazugehören, gern die Maske abreißen, weniger um diesen zu schaden, was ihnen allerdings nicht unlieb ist, als um sich selbst zu entschuldigen, auch mit Beispielen für Homosexualität aus der Geschichte, wie ein Arzt solche für Blinddarmentzündung anführt; Sokrates, heißt es gern, sei einer der Ihren gewesen, wie die Juden sagen, Jesus sei Jude gewesen, ohne zu bedenken, daß es keine abnorm Veranlagten gab, als Homosexualität die Norm war, und keine Christenfeinde vor Christus, daß allein die Schmach das Verbrechen ausmacht, denn sie hat einzig jene übriggelassen, die sich jeder Belehrung, jedem Beispiel, jeder Züchtigung widersetzten, aufgrund einer derart speziellen angeborenen Veranlagung, daß diese anderen Menschen (obwohl sie mit hohen moralischen Qualitäten gepaart sein kann) mehr zuwider ist als gewisse Laster, die solchen Qualitäten entgegenstehen, wie Diebstahl, Grausamkeit oder Unredlichkeit, die für die meisten Menschen leichter verständlich und deshalb eher entschuldbar sind; ein Freimaurertum, das viel weiter verbreitet, viel wirksamer ist und weniger vermutet wird als jenes der Logen, denn es beruht auf einer Gleichheit der Neigungen, der Bedürfnisse, der Gewohnheiten, der Gefahren, der Lehrjahre, der ersten Erfahrungen, des Wissens, des Umgangs, des Vokabulars, und in ihm erkennen sich auf der Stelle sogar jene Mitglieder, die sich nicht zu kennen wünschen, an natürlichen oder konventionellen, unwillkürlichen oder gewollten Zeichen, die dem Bettler den großen Herrn, dem er den Wagenschlag schließt, dem Vater den Verlobten seiner Tochter, demjenigen, der Heilung, Beichte oder Rechtshilfe gesucht hatte, den Arzt, den Priester oder den Anwalt, den er konsultiert hatte, als einen seinesgleichen offenbaren; allesamt genötigt, ihr Geheimnis zu wahren, doch Teilhaber an einem Geheimnis der anderen, von dem die übrige Menschheit nichts ahnt, das ihnen aber die unwahrscheinlichsten Abenteuerromane wahr erscheinen läßt; denn in diesem romanhaften, anachronistischen Leben ist der Botschafter der Freund des Sträflings; der Fürst geht, wenn er das Palais der Herzogin verläßt, mit einer gewissen Ungezwungenheit, wie sie aristokratische Erziehung verleiht und über die ein ängstlicher Kleinbürger nicht verfügen würde, zu einer Unterredung mit dem Apachen; ein geächteter Teil der menschlichen Gemeinschaft, doch ein bedeutender Teil, da vermutet, wo er nicht ist, gegenwärtig, unverschämt und ungestraft, wo er unerkannt bleibt; mit einer überall verbreiteten Anhängerschaft, im Volk, in der Armee, in der Kirche, im Zuchthaus, auf dem Thron; ein Leben schließlich, zumindest für zahlreiche, in zärtlichem und gefährlichem Umgang mit Männern der anderen Rasse, die sie provozieren, mit denen sie zum Spiel von ihrem Laster sprechen, als ob es nicht das ihre sei, ein Spiel, das durch die Verblendung oder die Falschheit der anderen leicht gemacht wird, ein Spiel, das jahrelang andauern kann bis zu dem Tag des Skandals, an dem diese Bändiger selbst verschlungen werden; bis dahin aber gezwungen, ihr Leben zu verbergen, ihre Blicke dort wegzuwenden, wo sie verharren möchten, dort zu verharren, wovon sie sich wegwenden möchten, in ihrem Vokabular das Geschlecht mancher Adjektive zu ändern – ein gesellschaftlich bedingter Zwang, der leicht wiegt neben dem inneren Zwang, den ihr Laster oder das, was man unpassenderweise so nennt, ihnen nicht mit Rücksicht auf andere, sondern auf sie selbst auferlegt, und dies so, daß es ihnen nicht als Laster erscheint. Manche aber, die praktischer denken, es eiliger haben, die sich die Zeit nicht nehmen, der Ware nachzulaufen, und auf die Vereinfachung des Lebens sowie die Zeitersparnis nicht verzichten wollen, die sich aus der Kooperation ergibt, haben sich zwei Gesellschaften zugelegt, deren eine ausschließlich aus ihresgleichen besteht.
Das fällt besonders ins Auge bei denen, die arm und ohne Verbindung aus der Provinz kommen, ohne etwas anderes als den Ehrgeiz, eines Tages ein berühmter Arzt oder Anwalt zu sein, deren Geist noch aller Meinungen und deren Körper noch aller Manieren entbehrt, die aber beides aufs schnellste herausputzen möchten, so wie sie für ihr kleines Zimmer im Quartier latin die Möbel am liebsten nach dem Muster dessen kauften, was sie anderen abgeschaut haben und ihnen nachmachen möchten, jenen nämlich, die bereits in der nützlichen oder ehrenwerten Profession fest im Sattel sitzen, in die sie eintreten und in der sie berühmt werden wollen; bei diesen ist ihre spezielle Neigung, die sie unbewußt ererbt haben, wie die Veranlagung zum Zeichnen, zur Musik oder zur Blindheit, vielleicht die einzige, eingewurzelte und despotische Originalität – eine Originalität, die an gewissen Abenden ihnen auferlegt, diese oder jene für ihre Laufbahn nützliche Veranstaltung mit Leuten zu versäumen, deren Art zu sprechen, zu denken, sich zu kleiden und das Haar zu tragen, sie in allen sonstigen Belangen angenommen haben. In ihrem Stadtviertel, in dem sie sonst nur mit ihren Studiengenossen, ihren Lehrern oder irgendeinem arrivierten und sie protegierenden Landsmann verkehren, haben sie schnell andere junge Leute entdeckt, die eine gleiche Neigung in ihre Nähe rückt, so wie in einer Kleinstadt der Mittelschullehrer und der Notar sich finden, weil beide für Kammermusik oder die Elfenbeinskulpturen des Mittelalters schwärmen; mit Bezug auf den Gegenstand ihrer Zerstreuung von dem gleichen Nützlichkeitsinstinkt und dem gleichen professionellen Geist geleitet, der sie in ihrer Karriere bestimmt, finden sie sie wieder bei Zusammenkünften, zu denen ein Außenstehender ebensowenig zugelassen ist wie zu solchen, bei denen sich die Liebhaber von alten Tabatieren, japanischen Holzschnitten, seltenen Blumen treffen und wo infolge der Freude am Dazulernen, der Nützlichkeit des Tausches und der Furcht vor Wettbewerb gleichzeitig, wie an einer Briefmarkenbörse, das enge Einverständnis der Spezialisten, aber auch die wilde Rivalität der Sammler herrscht. Niemand übrigens in dem Café, in dem sie ihren Stammtisch haben, weiß, um was für eine Versammlung es sich dabei handelt, ob man es mit der Zusammenkunft einer Anglergesellschaft, einer solchen von Redaktionssekretären oder der aus dem Departement Indre Gebürtigen zu tun hat, so korrekt ist ihre Haltung, so reserviert und kühl ihre Miene, und so wenig wagen sie – außer ganz schüchtern vielleicht – die jungen Leute der vornehmen Kreise anzusehen, die angehenden Salonlöwen, die sich ein paar Meter entfernt ausführlich über ihre Geliebten auslassen und von denen – wie diejenigen, die sie bewundern, ohne daß sie wagen, den Blick zu ihnen zu erheben, erst zwanzig Jahre später erfahren, wenn die einen schon dicht vor ihrem Eintritt in eine Akademie stehen und die anderen alte Clubleute sind – der Verführerischste, jetzt ein dicker und ergrauender Charlus, in Wirklichkeit ihnen gleichgeartet war, aber anderswo, in einer anderen Welt, unter anderen äußeren Zeichen und ihnen unbekannten Symbolen, deren Verschiedenheit von den ihren sie irregeleitet hat. Doch sind die Gruppierungen mehr oder weniger radikal; und wie sich die Union des Gauches von der Fédération socialiste und diese oder jene Gesellschaft zur Pflege der Musik Mendelssohns von der Schola Cantorum1 unterscheidet, gibt es an gewissen Abenden an einem anderen Tisch Extremisten, die ein Armband unter ihrer Manschette hervorsehen lassen, manchmal auch ein Kollier aus dem Schlitz ihres Kragens, durch ihre zudringlichen Blicke, ihr Glucksen, ihr Gelächter, die Zärtlichkeiten, die sie untereinander austauschen, eine Schar von Schülern schleunigst in die Flucht schlagen und mit einer Höflichkeit, hinter der Empörung lauert, von einem Kellner bedient werden, der, wie an den Abenden, wo er den Dreyfus-Anhängern aufzuwarten hat, am liebsten die Polizei holen würde, wenn es nicht dennoch vorteilhaft wäre, die Trinkgelder einzustecken.
Solchen Berufsverbänden stellt man im Geist die Neigung der Einzelgänger gegenüber, einerseits ohne allzu große Kunstgriffe, denn man tut nur, was diese Einzelgänger selbst tun, die glauben, daß nichts sich so sehr von dem organisierten Laster unterscheidet wie das, was sie selbst für unverstandene Liebe halten, und doch nicht ohne Kunstgriffe, denn diese verschiedenen Klassen entsprechen ebenso wie verschiedenen physiologischen Typen auch verschiedenen Phasen einer pathologischen oder lediglich sozialen Entwicklung. Und selten genug kommt es tatsächlich vor, daß diese Einzelgänger eines Tages schließlich doch in derartigen Organisationen aufgehen, zuweilen aus bloßer Müdigkeit oder Bequemlichkeit (so wie auch die, die am meisten dagegen waren, schließlich doch Telephon bei sich legen lassen, die Iénas empfangen oder bei Potin einkaufen1 ). Sie werden übrigens im allgemeinen nicht sehr freundlich aufgenommen, denn in ihrem verhältnismäßig sittenreinen Leben hat der Mangel an Erfahrung und die Sättigung durch bloße Träumerei, auf die sie angewiesen waren, stärker die besonderen Merkmale der Effeminiertheit ausgebildet, die diejenigen zu verwischen bemüht sind, die sich im Laster zusammengefunden haben. Man muß auch zugeben, daß bei manchen dieser Neuhinzugekommenen die Frau nicht nur innerlich mit dem Mann vereint ist, sondern in grauenerregender Weise äußerlich sichtbar wird, wenn sie, von hysterischen Konvulsionen geschüttelt, mit schrillem Lachen Knie und Hände zusammenkrampfen und einem normalen Menschen nicht ähnlicher sind als jene Affen mit ihren Greiffüßen und dem melancholischen und umringten Blick, die einen Smoking anlegen und eine schwarze Krawatte tragen; so daß der Umgang mit diesen Neueintretenden im Urteil von doch weit unkeuscheren Leuten als kompromittierend und ihre Zulassung als problematisch gilt; man nimmt sie indessen dennoch auf, und sie profitieren dann von jenen Erleichterungen, durch die Handel und große Unternehmen das Leben der einzelnen Menschen verwandelt haben, indem sie ihnen Waren, die bis dahin zu kostspielig zu erwerben oder sogar schwierig aufzutreiben waren, zugänglich machen und sie nun mit einem überreichen Angebot dessen überschwemmen, was sie allein auch in der größten Menschenmenge nicht zu entdecken vermochten. Doch selbst bei all diesen unzähligen Lustventilen bleibt der soziale Zwang zu stark für einige, die sich besonders aus dem Kreis jener rekrutieren, bei denen keinerlei geistiger Zwang gewirkt hat und die ihre Art von Liebe für noch seltener ansehen, als sie ist. Wir wollen im Augenblick diejenigen beiseite lassen, bei denen der exzeptionelle Charakter ihrer Neigungen bewirkt, daß sie sich den Frauen überlegen glauben und sie verachten, aus der Homosexualität aber das Privileg der großen Genies und glorreichen Epochen machen, und die, wenn sie sich bemühen, für ihre Neigungen auch andere zu gewinnen, es weniger unter denen versuchen, die ihnen dafür veranlagt scheinen, als vielmehr – so wie es der Morphinist hinsichtlich des Morphiums tut – unter denen, die ihnen würdig erscheinen, aus Eifer des Apostolats, so wie andere den Zionismus, die Verweigerung des Militärdienstes, den Saint-Simonismus, das Vegetariertum oder die Anarchie predigen. Bei einigen sieht man, wenn man sie morgens im Bett überrascht, einen wundervollen Frauenkopf, so allgemein ist der Gesichtsausdruck, und so sehr symbolisiert er das ganze Geschlecht; das Haar sogar bezeugt es; seine Wellen haben etwas derart Weibliches, frei fließend legt es sich derart natürlich in Locken an die Wange, daß man staunend bewundert, wie die junge Frau, das junge Mädchen, Galatea1, noch kaum erwacht, im Unbewußten dieses männlichen Körpers, in den sie eingeschlossen ist, auf eine so erfindungsreiche Art, von allein, ohne es irgend jemandem abgeschaut zu haben, sich der geringsten Möglichkeit bedient, aus ihrem Gefängnis zu schlüpfen und zu finden, was sie zum Leben notwendig braucht. Gewiß sagt sich der junge Mann mit diesem bezaubernden Kopf nicht: Ich bin eine Frau. Wenn er aber – aus vielen Gründen, die es dafür geben kann – mit einer Frau lebt, kann er ihr gegenüber zwar leugnen, daß er selbst eine ist, ihr schwören, daß er niemals Beziehungen mit Männern gehabt hat. Doch soll sie sich ihn nur ansehen, so wie wir ihn eben gezeigt haben, im Bett liegend, im Pyjama, mit nackten Armen und nacktem Hals unter dem schwarzen Haar. Der Pyjama ist die Nachtjacke einer Frau geworden, der Kopf der einer hübschen Spanierin. Die Geliebte entsetzt sich vor den Bekenntnissen, die da vor ihren Blicken ans Licht dringen und die wahrer als Worte, ja als Taten sind und die die Taten, wenn sie es nicht schon getan haben, schließlich nur bestätigen können, denn jedes Wesen folgt seinem Drang zur Lust;2 und wenn dieses Wesen nicht allzu lasterhaft ist, so sucht es diese Lust bei dem entgegengesetzten Geschlecht. Für den Homosexuellen aber beginnt das Laster nicht, wenn er Verbindungen mit Frauen knüpft (denn allzu viele Gründe können solche nahelegen), sondern wenn er seine Lust bei Frauen sucht. Der junge Mann, den wir soeben darzustellen versucht haben, war so offensichtlich eine Frau, daß die Frauen, die ihn mit Verlangen anschauten (wofern sie nicht selbst einem ganz besonderen Geschmack huldigten), Opfer der gleichen Enttäuschung werden mußten wie diejenigen, die in den Komödien Shakespeares von einem verkleideten jungen Mädchen getäuscht werden, das sich als Jüngling ausgibt.1 Die Täuschung ist die gleiche, der Homosexuelle weiß es sogar, er ahnt die Desillusion, die nach der Demaskierung die Frau erleben wird, und fühlt, zu welchem Quell versponnener Poesie dieser Irrtum über sein Geschlecht werden kann. Im übrigen wird er vergeblich seiner Geliebten, die Ansprüche an ihn stellt (wenn sie nicht ihrerseits eine Bürgerin Gomorrhas ist), das Eingeständnis vorenthalten: Ich bin eine Frau; mit welcher List, welcher Beweglichkeit, welcher eigensinnigen Zähigkeit gleich der einer Kletterpflanze sucht doch in ihm die unbewußte, aber sichtbare Frau nach einem männlichen Organ! Man braucht nur das lockige Haar auf dem weißen Kopfkissen anzuschauen, um zu verstehen, daß dieser junge Mann am Abend, wenn er seinen Eltern, ihnen und sich selbst zum Trotz, entschlüpft, es gewiß nicht tun wird, um zu Frauen zu gehen. Seine Geliebte kann ihn züchtigen, einschließen, am nächsten Tag wird das Zwitterwesen das Mittel gefunden haben, sich einem Mann anzuschließen, so wie die Winde ihre Ranken dorthin sendet, wo eine Harke oder ein Rechen winkt.2 Warum sollten wir, wenn wir in dem Gesicht dieses Mannes zarte Züge bewundern, die uns rühren, eine Anmut, eine natürliche Liebenswürdigkeit, wie Männer sie nicht besitzen, tief betrübt sein zu erfahren, daß dieser junge Mensch die Gesellschaft von Boxern sucht? Das sind die verschiedenen Aspekte einer gleichen Wirklichkeit. Und der uns am meisten abstößt, ist sogar der rührendste, rührender als alle liebenswürdigen Züge, denn er stellt ein bewundernswertes unbewußtes Bestreben der Natur dar: Das Eingeständnis des Geschlechts durch sich selbst trotz aller Schwindeleien des Geschlechts zeigt sich in dem uneingestandenen Versuch, sich zu dem hinzuflüchten, was ein Grundirrtum der Gesellschaft diesem Wesen so ferngerückt hat. Was die einen anbetrifft, diejenigen offenbar, die als Kinder die Schüchternsten gewesen sind, kümmern sie sich kaum um die materielle Form der Lust, deren sie teilhaftig werden, wenn sie sie nur mit einem männlichen Gesicht in Zusammenhang bringen können. Andere hingegen, die offenbar leidenschaftlichere Sinne haben, verlangen für ihre Lust gebieterischer bestimmte Lokalisierungen. Diese letzteren würden durch ein Geständnis die Durchschnittsmenschheit schockieren. Sie leben vielleicht weniger ausschließlich unter der Herrschaft des Saturn-Satelliten1, denn für sie kommen Frauen immerhin eher in Betracht als für erstere, für die sie nicht existieren würden, wenn es nicht die Sphäre der Unterhaltung, der Koketterie, die Liebe vom Verstand her gäbe. Die zweiten aber suchen die Frauen, die selbst Frauen lieben, denn diese können ihnen einen jungen Mann verschaffen, ja, die Lust am Umgang mit ihm steigern; mehr noch, sie können bei diesen Frauen selbst die Lust finden, die sie sonst nur mit einem Mann erleben. Daher kommt es, daß die Eifersucht bei denjenigen, die die ersteren lieben, nur durch die Lust entfacht wird, die diese bei einem Mann finden könnten und die ihnen als einzige als Verrat erscheint, da sie an der Frauenliebe nicht teilhaben, sie nur aus Gewohnheit ausüben und um sich die Möglichkeit einer Heirat offenzuhalten, sich dabei aber so wenig das Vergnügen vorzustellen vermögen, das man daran haben kann, daß sie nicht darunter leiden können, wenn derjenige, den sie lieben, sich ihm hingibt; während die zweiten oft Eifersucht durch ihre Liebschaften mit Frauen erregen. Denn in den Beziehungen, die sie mit diesen haben, spielen sie für die Frau, die Frauen liebt, die Rolle einer anderen Frau, und die Frau bietet ihnen gleichzeitig ungefähr das, was solche Männer bei dem Mann finden, so daß der eifersüchtige Freund darunter leidet, den Geliebten an die geschmiedet zu wissen, die für ihn fast ein Mann ist, während er gleichzeitig das Gefühl hat, daß er ihm entgleitet, weil er für jene Frauen etwas ist, was er selber nicht kennt, eine Art von Frau. Wir wollen auch gar nicht von den jungen Toren sprechen, die aus einer Art von Kinderei, um ihre Freunde zu necken oder ihre Eltern zu schockieren, einen merkwürdigen Eifer entfalten, Kleidungsstücke zu wählen, die an Frauenkleider erinnern, ihre Lippen rot färben und ihre Augen schwärzen; lassen wir sie beiseite, denn das sind die, die später, nachdem sie nur allzu grausam die Folgen ihrer Affektiertheit haben spüren müssen, ein ganzes Leben auf das vergebliche Bemühen verwenden, durch eine puritanisch strenge Haltung das Unrecht wiedergutzumachen, das sie sich selbst zugefügt haben, als sie vom gleichen Teufel geritten wurden, der junge Frauen des Faubourg Saint-Germain dazu verführt, auf eine skandalöse Art und Weise zu leben, mit allem Brauch zu brechen, ihrer Familie Spott und Schande zu bereiten bis zu dem Tag, an dem sie anfangen, beharrlich und erfolglos den Abhang wieder zu erklimmen, den hinabzugleiten sie so amüsant fanden oder vielmehr einfach nicht unterlassen konnten. Stellen wir endlich für eine spätere Betrachtung diejenigen zurück, die einen Pakt mit Gomorrha geschlossen haben. Wir werden von ihnen sprechen, wenn Monsieur de Charlus ihre Bekanntschaft machen wird. Wir wollen alle, die der einen oder anderen Spielart, die zu gegebener Zeit noch auftreten werden, unberücksichtigt lassen und hier, um diese erste Darlegung abzuschließen, nur noch mit einem Wort auf eine Gattung zurückkommen, von der wir eben zu sprechen angefangen hatten, nämlich die der Einzelgänger. Da sie ihr Laster für etwas Exzeptionelleres halten, als es eigentlich ist, haben sie angefangen, ganz für sich zu leben von dem Tag an, da sie es entdeckten, nachdem sie es schon lange in sich getragen hatten, ohne es zu kennen, doch bloß länger als andere. Denn niemand weiß zunächst, daß er homosexuell oder Dichter, ein Snob oder ein Bösewicht ist. So mancher Schüler, der Liebesgedichte auswendig lernte oder obszöne Bilder betrachtete und sich dabei dicht an einen Kameraden drängte, bildete sich ein, mit ihm nur eins zu sein im gemeinsamen Drang nach der Frau. Wie sollte er meinen, daß er nicht allen anderen gleich ist, wenn er doch die Substanz dessen, was er empfindet, bei der Lektüre von Madame de La Fayette, Racine, Baudelaire, Walter Scott wiedererkennt zu einer Zeit, da er sich noch zu wenig zu beobachten versteht, um das zu bemerken, was er an Selbsterdachtem hinzugefügt hat, und, daß zwar das Gefühl das gleiche, doch das Objekt verschieden, nämlich, was er ersehnt, Rob Roy und nicht Diana Vernon ist?1 Bei vielen bewirkt eine defensive Vorsicht des Instinkts, die der Hellsichtigkeit des Verstandes vorausgeht, daß der Spiegel und die Wände ihres Zimmers unter Farbendrucken verschwinden, die Bilder von Schauspielerinnen sind; sie machen Verse wie:
Je n’aime que Chloé au monde,
Elle est divine, elle est blonde,
Et d’amour mon cœur s’inonde.
Nur Chloé lieb’ ich auf der Welt,
Die Göttliche, die mir gefällt,
Die mir die Brust in Liebe schwellt.
Muß man deshalb schon am Anfang solcher Lebensläufe eine Neigung erkennen, die man später nicht wiederfinden wird, so wie die blonden Locken der Kinder, die nachträglich dunkel werden? Wer weiß, ob die Frauenphotographien nicht Ausdruck beginnender Heuchelei sind, ein Beginn des Grauens auch vor anderen Homosexuellen! Doch die Einzelgänger sind gerade diejenigen, denen Heuchelei schmerzlich ist. Vielleicht ist das Beispiel der Juden, einer andersgearteten Kolonie, nicht einmal deutlich genug, um zu erklären, wie wenig Macht die Erziehung über sie hat und mit welcher Kunst sie es fertigbringen, immer wieder vielleicht zwar nicht gerade zu etwas so schlicht Schrecklichem wie dem Selbstmord (wohin die Wahnsinnigen trotz aller Vorsichtsmaßregeln, die man ergreift, zurückkehren, so daß sie, aus dem Fluß gerettet, in den sie sich gestürzt haben, sich gleich darauf vergiften, sich einen Revolver verschaffen usw.), aber doch zu einem Leben zurückzukehren, dessen notwendige Vergnügen für Männer anderer Rasse unverständlich, unvorstellbar, ja hassenswert sind und dessen häufige Gefährdung und dauernde Schmach bei ihnen Entsetzen hervorrufen würde. Vielleicht muß man, um sie zu schildern, nicht gerade an undomestizierbare Tiere denken wie die angeblich gezähmten jungen Löwen, die dennoch Löwen bleiben, aber doch wenigstens an die Schwarzen, die dem komfortablen Dasein der Weißen, das sie zur Verzweiflung treibt, die Gefahren des Lebens in der Wildnis und seine unbegreiflichen Freuden vorziehen. Wenn der Tag gekommen ist, an dem sie entdecken, daß sie außerstande sind, gleichzeitig die anderen und sich selbst zu belügen, brechen sie auf und ziehen sich ganz aufs Land zurück, fliehen ihresgleichen (die sie für wenig zahlreich halten) aus Grauen vor dem Monströsen oder Furcht vor Versuchung, die übrige Menschheit aber aus Scham. Nie zu wirklicher Reife gelangt, der Schwermut verfallen, machen sie von Zeit zu Zeit an einem mondlosen Sonntagabend einen Spaziergang bis zu einem Kreuzweg, wohin einer ihrer Kindheitsfreunde, der ein benachbartes Schloß bewohnt, ebenfalls gekommen ist, ohne daß sich die beiden durch ein Wort verständigt


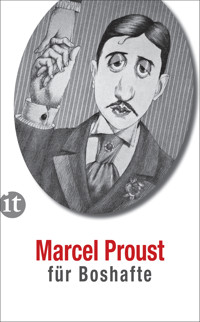


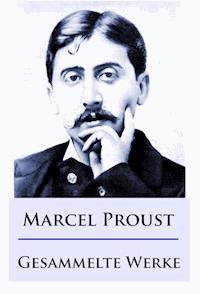


![In Search of Lost Time [volumes 1 to 7] - Marcel Proust - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/7bfeaa53b3db8b804e58de22616f49ec/w200_u90.jpg)