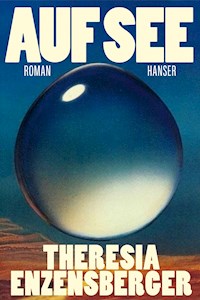
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der neue Roman von Theresia Enzensberger. "Eine brillante Zukunftsvision, so unterhaltsam wie klug konstruiert und schnörkellos geschrieben." Corinne Orlowski, WDR3 Lesestoff Yada wächst als Bürgerin einer schwimmenden Stadt in der Ostsee auf. Ihr Vater, ein libertärer Tech-Unternehmer, hat die Seestatt als Rettung vor dem Chaos entworfen, in dem die übrige Welt versinkt. In den Jahren seit ihrer Gründung ist der Glanz vergangen, Algen und Moos überwuchern die einst spiegelnden Flächen. Yadas Vater fürchtet, sie könne das Schicksal ihrer Mutter ereilen, die vor ihrem Tod an einer rätselhaften Krankheit litt. Und Yada macht eines Tages eine Entdeckung, die alles ins Wanken bringt. Klug, packend und visionär erzählt Theresia Enzensbergers großer Roman von den utopischen Versprechen neuer Gemeinschaften und dem Glück im Angesicht des Untergangs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Der neue Roman von Theresia Enzensberger. Auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2022Yada wächst als Bürgerin einer schwimmenden Stadt in der Ostsee auf. Ihr Vater, ein libertärer Tech-Unternehmer, hat die Seestatt als Rettung vor dem Chaos entworfen, in dem die übrige Welt versinkt. In den Jahren seit ihrer Gründung ist der Glanz vergangen, Algen und Moos überwuchern die einst spiegelnden Flächen. Yadas Vater fürchtet, sie könne das Schicksal ihrer Mutter ereilen, die vor ihrem Tod an einer rätselhaften Krankheit litt. Und Yada macht eines Tages eine Entdeckung, die alles ins Wanken bringt. Klug, packend und visionär erzählt Theresia Enzensbergers großer Roman von den utopischen Versprechen neuer Gemeinschaften und dem Glück im Angesicht des Untergangs.
Theresia Enzensberger
Auf See
Roman
Hanser
»I had a dream, which was not all a dream.
The bright sun was extinguish’d, and the stars
Did wander darkling in the eternal space,
Rayless, and pathless, and the icy earth
Swung blind and blackening in the moonless air;
Morn came and went — and came, and brought no day,
And men forgot their passions in the dread
Of this their desolation; and all hearts
Were chill’d into a selfish prayer for light:
And they did live by watchfires — and the thrones,
The palaces of crowned kings — the huts,
The habitations of all things which dwell,
Were burnt for beacons; cities were consum’d,
And men were gather’d round their blazing homes
To look once more into each other’s face;
Happy were those who dwelt within the eye
Of the volcanos, and their mountain-torch:
A fearful hope was all the world contain’d;
Forests were set on fire — but hour by hour
They fell and faded — and the crackling trunks
Extinguish’d with a crash — and all was black.«
Lord Byron, Darkness
Future Simple
Yada
Die See war ruhig und schwarz. Mein Vater mochte es nicht, wenn ich an Deck ging, aber die erste Morgenstunde gehörte mir. Ich sollte meditieren, stattdessen setzte ich mich auf das Dach meines Schlafquartiers in eine Mulde, schaute über die Seestatt hinaus aufs Meer und dachte über die Zukunft oder, besser gesagt, über die Wahrscheinlichkeit ihres Ausbleibens nach. Ich betrachtete die Algen, die in der Mulde wuchsen und sich an den Fugen entlang ausbreiteten. Winziges, sternförmiges Grün auf der gräulichen Oberfläche, ein unmerkliches, aber mächtiges Streben nach außen, nach oben. In der Ferne arbeitete der immer gleiche Rhythmus der Windräder, die wie starre Palmen am Horizont standen. In jeder Himmelsrichtung erhoben sie sich über dem Meer. Dazwischen unsere Siedlung, hermetische Waben, wellenförmiges Fiberglas, das einmal weiß geglänzt hatte und durch dessen schmutziges Grau sich jetzt feine Risse zogen. An manchen Stellen hatte die Reparatur größerer Sprünge helle, gummiartige Flecken hinterlassen. Die Außenbereiche, die anfangs noch begrünt worden waren, lagen verwaist, braun und grau gescheckt. Die Leinen und Netze der Algenfarmen auf der Westseite waren kaum noch zu sehen, Blaualgen wucherten direkt unter der Wasseroberfläche und formten ein monströses, ausuferndes Gebilde, einen giftigen Schatten, von dem ich nicht wusste, ob er nun mahnte, drohte oder einfach nur wartete.
Mein Vater sagte immer, die Algenfarm könne uns als Erinnerung dienen; jedes Projekt könne scheitern, das sei noch lange kein Grund zum Aufhören, im Gegenteil, ein Scheitern sei immer auch ein Neuanfang. Seit ich denken konnte, sprach mein Vater so, in großen Deklarationen, die er wie Mantras wiederholte. Als wir vor zehn Jahren hierhergezogen waren, hatte ich mein Bestes getan, mich anzupassen. Ich hatte mich bemüht, die Insel als meine Heimat zu verstehen, aber Projekte eignen sich nicht besonders gut als Zuhause. Am Anfang war wenigstens noch etwas los gewesen, die Seestatt war damals ein parametrischer Bienenstock, voll von Leuten mit Ideen, die ständig irgendetwas verbesserten, reparierten und anpassten. Die Insel kam mir vor wie ein großer Abenteuerspielplatz, die weißen Flächen unserer Behausungen glänzten in der Sonne, und wenn die Leute Fragen hatten, wusste mein Vater, was zu tun war. Ich war gerade mal sieben Jahre alt, deswegen verstand ich nicht genau, was hier eigentlich passierte. Ich wusste nur, dass mein Vater, dieser aufrechte und anständige Mann, uns noch rechtzeitig gerettet hatte, ehe das deutsche Festland im Chaos versunken war.
Sicher waren wir hier, mit unserem Intranet, unserem Wellenbrecher, der uns vor Eindringlingen schützte, und den Windfarmen, die verlässlich Strom für uns produzierten. Trotzdem waren nach und nach fast alle verschwunden. Die meisten Wissenschaftler und Programmierer waren im Laufe der Jahre weggezogen, und sogar mein Vater war inzwischen ständig auf Reisen, nach Südamerika, in die Karibik, nach Asien. Seit ein paar Jahren litt er an einer mysteriösen Krankheit und fand immer neue Heiler und Kliniken am anderen Ende der Welt, die ihm Genesung versprachen. Wenn er zurückkam, war er ein paar Wochen lang fröhlich und voller Pläne, dann verfiel er wieder in seine übliche Verdrossenheit, und schließlich schmiedete er neue Reisepläne. Bat ich ihn, mich mitzunehmen, erinnerte er mich daran, wie gefährlich das Reisen war.
Vor ein paar Tagen, an meinem siebzehnten Geburtstag, hatte ich mir aus Trotz und Langeweile Zugang zu seinem Computer verschafft. Ich hatte nicht damit gerechnet, etwas Interessantes zu finden, schon gar nicht etwas, das mit der Seestatt zu tun hatte — er hatte mir ja immer in den Ohren gelegen mit den Feinheiten des Projekts, mit seinen Möglichkeiten und Herausforderungen. Außerdem waren Transparenz und Ordnung Maximen, die sich nicht gut mit Geheimnissen vertrugen. Letztendlich war es auch gar kein Geheimnis, das ich im Dateiordner mit dem unscheinbaren Titel »Misc« gefunden hatte, lediglich tausende Seiten voll von Zeichnungen, Plänen und Konzepten. Es waren Zukunftspläne aus der Vergangenheit, die weit über das hinausgingen, was ich über die Ambitionen der Gründer wusste. Einen geschlossenen Kreislauf hatten sie schaffen wollen, von der Versorgung mit selbstgewonnenen Nahrungsmitteln bis hin zur produktiven Verwertung von Abfällen. Ihr Zeitplan hatte vorgesehen, schon nach fünf Jahren die notwendigen technologischen Fortschritte gemacht zu haben, um autark auf hoher See leben zu können, unabhängig von der jeweiligen Festlandregierung. Je mehr ich las, desto weniger wusste ich, was ich darüber denken sollte. Es machte mich wütend. Statt diesen großen Visionen zu folgen, dümpelten wir immer noch vor der Küste herum, ernährten uns durch teure Lieferungen vom Festland und warteten auf Tag X.
Den Ordner hatte ich an diesem Tag schnell geschlossen und mir die Dokumente auf eine altmodische Festplatte geladen. Seitdem lagen sie sicher versteckt in meiner Tamponschachtel, dem einzigen Ort, an dem weder mein Vater noch mein Therapeut jemals nachschauen würden. Das Putzpersonal war eigentlich dazu verpflichtet, alle ungewöhnlichen Funde zu melden, aber ich hatte schon in der Vergangenheit bemerkt, dass sich die Menschen vom Mitarbeiterschiff nicht besonders intensiv für unsere Belange interessierten. Wahrscheinlich war das nicht unklug. Als ich ungefähr elf Jahre alt war, hatte ich mich mit einem Mädchen in meinem Alter angefreundet. Anca war die Tochter einer Reinigungskraft vom Mitarbeiterschiff, ihre Mutter nahm sie öfters zur Arbeit mit und ließ sie mit mir auf Deck spielen. Obwohl wir keine Sprache gemein hatten, wurden mir die Momente zwischen Unterricht und Revision, in denen wir bäuchlings auf den Floßenden lagen und ins Wasser starrten oder Algen von den Seiten pflückten, die wichtigsten des Tages. Als mein Vater von unserer Freundschaft erfuhr, reagierte er mit kühler, wortkarger Wut. Es dauerte unerträglich lange, bis er wieder mit mir sprach. Anca und ihre Mutter sah ich nie wieder.
Nach dieser kurzen Freundschaft empfand ich meine Isolation, bis dahin eine unumstößliche, völlig selbstverständliche Tatsache meines Lebens, auf einmal als schmerzhafte Strafe. Ich fing an, meinen Vater zu fragen, warum es auf der Seestatt keine Kinder in meinem Alter, ja, außer mir überhaupt keine Kinder gab. Er antwortete ausweichend, sprach davon, wie besonders ich sei, und schenkte mir schließlich eine Europäische Sumpfschildkröte. Weil ich ihm zeigen wollte, dass ich eine echte Naturwissenschaftlerin war, nannte ich sie Emy, nach ihrem lateinischen Gattungsnamen, und redete nur heimlich mit ihr. Emy hätte mein neu erlangtes Wissen über die Pläne meines Vaters bestimmt für sich behalten, allerdings war sie vor ein paar Jahren ihrem Terrarium entkrochen und in unseren Schwebenetzen verendet. Jemand anderem von meiner Entdeckung zu erzählen, konnte ich nicht riskieren.
Die Ideen, die sich durch das Sichten der Dokumente in mir ausbreiteten, der Tatendrang, mit dem ich unsere Seestatt von Grund auf ändern wollte, die Kritik, die ich zwangsläufig an allem hätte äußern müssen, hätten meinem Vater nur als endgültige Beweise meiner überbordenden Fantasie gegolten. Seit ich denken konnte, hatte er mich vor meinen irrationalen Tendenzen gewarnt, dem Erbe meiner Mutter, die vor langer Zeit gestorben war. Meine Erinnerungen an sie waren spärlich. Ohnehin wurden sie überlagert von den wenigen Informationen, die ich mir in den letzten neun Jahren zusammengesucht hatte. Meine Mutter war eine berühmte Künstlerin gewesen; so viel wusste ich. Manche hatten sie sogar für ein Orakel gehalten. Ihr Tod, etwa ein Jahr nach unserer Ankunft hier, war mir immer noch ein Rätsel. Verschiedene Geschichten hatten zu mir gefunden, meist im Flüsterton oder in knappen, formelhaften Sätzen: Sie sei an einer rätselhaften Krankheit gestorben, sie habe sich selbst das Leben genommen, sie sei in eine politisch riskante Situation geraten. Keine dieser Versionen war besonders überraschend, das Festland war für normale Menschen schon lange nicht mehr sicher, aber ich hätte mir doch etwas mehr Eindeutigkeit gewünscht. Die einzig wiederkehrende Konstante war die geistige Erkrankung meiner Mutter. Unter der Oberfläche, fürchtete mein Vater, lauere auch bei mir eine gefährliche Verletzlichkeit, ein Übermaß an Empathie, eine sprunghafte Unvernunft, für die ich zwar nichts konnte, die aber dennoch mit allen Mitteln bekämpft werden mussten. Dazu erhielt ich eine sorgfältig abgestimmte Mixtur von Medikamenten, wöchentliche Therapiestunden und regelmäßige Biomarker-Tests. Außerdem beschränkte sich mein Unterricht auf Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften, denn alles Musische, so fürchtete mein Vater, könne mich zu sehr überreizen. Kunst, Literatur und Musik begegneten mir lediglich in unserem Intranet, wenn jemand unvorsichtig gewesen war. Von dort besorgte ich mir heimlich Romane, wunderbare virtuelle Realitäten, die ich schnell auf meiner Festplatte speicherte, ehe sie wieder aus unserem Netz gelöscht wurden. Mein Gewissen beruhigte ich, indem ich mich anstrengte, alles zu lernen, was man mir im Unterricht beizubringen versuchte. Dass ich gut darin war, merkte ich an den Reaktionen meines Vaters und meiner Lehrer, die meistens voller Lob waren. Nur einmal, als ich mich zu sehr in die Quantenmechanik vertieft hatte und meinem Vater meine Theorien auseinanderzusetzen versuchte, wurde er böse. Anstelle des Physikers, mit dem ich wöchentlich per Videoschalte sprach, tauchte von da an ein neuer Lehrer auf dem Bildschirm auf, den ich schon bald dafür hasste, dass er mir nichts außerhalb der Grundlagen beibringen wollte.
Am Horizont hatten die schwarzen Wolken einen dünnen, weißen Streifen Himmel freigegeben. Von unten hörte ich die Geräusche des Morgens. Es war Zeit, mich in die mahlende Routine zu begeben, von der meine Tage umrissen waren.
Helena
Helena öffnete die Tür zu ihrer Wohnung, oder besser, zu der Wohnung, in der sie im Moment schlief. Im Gehen zog sie ihre Klamotten aus, warf sie auf den Boden und ließ die Dusche warmlaufen. Die Zahnpasta war leer, also schmierte sie den dicken Knödel, der sich um den Verschluss gebildet hatte, auf eine Zahnbürste. Nach einer halben Minute fiel ihr auf, wie langweilig sie Zähneputzen fand. Sie ließ die Bürste ins Becken fallen und stieg unter die Dusche. Das laufende Wasser war gut, es klang wie das Rauschen der Fernseher früher, unscharf und nervtötend genug, um die Welt in ihren Ausprägungen zu übertönen. Der Abfluss war voller Haare, eine warme, schleimige Brühe stieg ihr bis zu den Knöcheln, dann bis an die Waden. Sie schloss die Augen. Erst als sie anfing, unter dem heißen Strahl zu schwitzen, und ihre Haut sich wie poröses Gummi anfühlte, drehte sie den Hahn zu. Sie stakste durch das Wasser, das sich über den Badezimmerboden ergossen hatte, trat in den Flur, angelte sich ein Hemd und eine Hose aus dem Kleiderberg vor der Küchentür und zog beides über den nassen Körper.
Sie erinnerte sich vage an einen Interviewtermin, und weil sie Hunger hatte und unsicher war, was der Kühlschrank dieser Wohnung hier bereithielt, beschloss sie, die Verabredung wahrzunehmen. Zwanzig Minuten später saß sie im Ottmann, ihrem derzeitigen Lieblingslokal, in das sie den Journalisten bestellt hatte und das sich durch nichts besonders auszeichnete, außer vielleicht durch die absurde Größe der servierten Portionen. Zufrieden kaute sie auf ihren Käsespätzle herum, während der Journalist, dessen Namen sie sich nicht gemerkt hatte, ihr von ihrem aufregenden Leben erzählte. Dass er nicht ihre volle Aufmerksamkeit hatte, schien ihn nicht zu stören. In ihrem Alter, sagte er, sei ein derart anhaltender Erfolg als Künstlerin alles andere als selbstverständlich. Die fünfunddreißigjährige Helena sah ihn kurz und scharf an und fragte dann, ob er auch etwas von ihr wissen wolle.
»Aber natürlich. Ja — fangen wir an?«
Er öffnete und schloss mehrere Reißverschlüsse seiner schwarzen, kastenförmigen Tasche, bis er sein Handy fand und es so vorsichtig auf den Tisch legte, als sei es eine seltene, zerbrechliche Muschel. Als er den Aufnahmeknopf gedrückt hatte, sah er erwartungsvoll auf.
»Also. Fangen wir an?«, fragte er wieder.
Helena kaute.
»Wie sind Sie denn auf das Thema Sekten gekommen?«
»Keine Ahnung«, sagte Helena. »Sich für etwas zu interessieren, ist ja kein Entschluss. Man interessiert sich einfach. Eigentlich ist das Interesse ziemlich irrational, zumindest ist es nah an der Emotion. Irgendwo zwischen Ratio und Emotion. Wenn meine Gedanken Gefühle hätten, dann würden sie sich wahrscheinlich wie Interesse anfühlen.«
Der Journalist lachte, als hätte sie einen ungehörigen Witz gemacht. »Na, da habe ich ja direkt eine hochphilosophische Antwort bekommen. Dann sagen Sie mir doch, was genau Sie an Sekten interessiert hat?«
»Lieber nicht.«
Jetzt ärgerte sich der Journalist, versuchte aber, sich nichts anmerken zu lassen. »Gut, vielleicht wenden wir uns dann den praktischen Fragen zu. Für Ihre Arbeit Das Kollektiv haben Sie eine Sekte gegründet, die ihren Anfang im Internet nahm. Wie haben Sie Ihre Mitglieder rekrutiert?«
»Eigentlich gar nicht. Ich habe einen Text geschrieben und eine halbgeschlossene Gruppe gegründet, die Leute kamen ganz von alleine. Die meisten Menschen glauben sowieso schon an den Weltuntergang, kann man ihnen ja auch nicht verdenken. Ich habe nicht mal ein anständiges Heilsversprechen angeboten, nur Austausch und Gemeinschaft. Und mich selbst als Guru, natürlich.« Helena winkte dem Kellner und bestellte einen Schnaps. »Ihre erste Arbeit war die berühmte Video-Performance, mit der Sie vor ein paar Jahren viel Aufsehen erregt haben. Ein wichtiger Teil Ihres neuen Werks, Das Kollektiv, sind naturalistische Portraits der Menschen, die sich Ihrer Sekte angeschlossen haben. Wieso haben Sie sich diesmal für das Medium der Malerei entschieden?«
»Das Video war überhaupt keine Performance, es war nur ein Video; nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt. Hat mir halt niemand geglaubt. Und dann kam diese ganze Orakelscheiße, ich weiß auch nicht, die Leute spinnen einfach. Ich wollte mir nur anschauen, wovon eigentlich alle die ganze Zeit reden, Desintegration der EU, brennende Wälder, bewaffnete Konflikte, deswegen bin ich herumgefahren und habe gefilmt, nicht um irgendeinen satirischen Kommentar auf den Zynismus der Reiseblogger zu produzieren, oder was ihr euch damals sonst so alles ausgedacht habt.« Der Journalist nickte, lächelte aber so wissend wie alle anderen Journalisten, denen sie jemals versucht hatte, das klarzumachen. Helena fand den gemeinschaftlichen Wahn, mit dem die Leute darauf beharrten, dass sie das Gegenteil von dem meinte, was sie sagte, zwar irritierend, aber sie hatte sich daran gewöhnt. Sie wusste selbst nicht genau, woher dieser schwache Moment eben gekommen war; eigentlich hatte sie es schon lange aufgegeben, irgendetwas klarstellen zu wollen.
»Egal. Was war noch mal die Frage? Richtig, die Malerei. Naja, ich muss doch irgendwie Geld verdienen. Ich werde nicht anfangen Cappuccinos zu machen, ich bin verdammt noch mal brillant.« Jetzt sah er wieder verstört aus. Viel besser.
In einer Ecke entdeckte Helena Kamilla. Ihr Outfit war wie immer auf maximalen Effekt ausgelegt, sie trug einen bauschenden Tüllrock und thronte wie ein enormer Pouf zwischen zwei jungen Männern auf einer Bank. Helena winkte heftig, die drei kamen herüber, umringten sie mit herbeigeholten Stühlen und bestellten eine Runde Schnaps. Kamilla drapierte ihren Rock um sich herum, dann stellte sie sich dem Journalisten als Helenas längste und beste Freundin vor, was genau genommen sogar der Wahrheit entsprach. Der Journalist nickte begeistert vor sich hin, seine Geschichte hatte eine ganz neue Wendung genommen. Helena schüttelte den beiden Neuzugängen die Hand, vergaß aber im selben Moment ihre Namen. Einer arbeitete im Immobiliengeschäft und pries die Vorzüge des Standorts Berlin mit so viel dämlicher Inbrunst an, dass sie sich mit ungewollter Intensität dem anderen zuwandte. Der war hübsch und blass, Kategorie stiller Junge. Die Unterhaltung gestaltete sich etwas mühselig. Er sah sie so an, wie die meisten Menschen sie ansahen: mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Begierde. Sie konnte sich dieses Phänomen nicht ganz erklären; sie war nicht besonders schön, wobei Schönheitsideale zwischen all den Essstörungen, Trotzhaltungen und Normaloptimierungen der Welt ohnehin nur noch schwer auszumachen waren. Jedenfalls sah sie beim Blick in den Spiegel nicht mehr als ein herbes Gesicht und einen stechenden Blick. Immerhin wusste sie, dass es nicht der Ruhm gewesen war, der sie in ein Objekt der allgemeinen Begierde verwandelt hatte. Die Leute hatten schon immer so auf sie reagiert, Frauen wie Männer. Die Augen des stillen Jungen leuchteten.
Der Journalist versuchte noch ein paar Mal, ihr seine Fragen zu stellen, dann gab er auf und verstaute sein Handy wieder vorsichtig in seiner Kastentasche. Als Nächstes probierte er, sich mit Kamilla und dem Immobilienmenschen zu unterhalten, aber die beiden waren in eine unzugängliche Diskussion verstrickt, und so bestellte er die Rechnung, winkte in die Runde und verließ das Lokal. Helena war weiterhin mit dem stillen Jungen beschäftigt, der ihren Ausführungen über ihre Arbeit andächtig lauschte. Mit halbem Ohr hörte sie, wie Kamilla dem Immobilienmenschen erklärte, die EU sei ein Instrument zur Reinwaschung kolonialer Verbrechen der verbliebenen Mitgliedsstaaten, was der als rechte EU-Kritik missverstand und anfing, mit empörter Selbstgerechtigkeit zu bestreiten. Helena hatte keine Lust, zu vermitteln, aber die Situation am Tisch wurde immer angespannter, also schlug sie vor, auf eine Party zu gehen. Natürlich wusste der Immobilienmensch etwas.
Draußen roch es sumpfig, die Luft war heiß und feucht, und in der Ferne hörten sie Sirenen. Der Immobilienmensch hatte ein Auto bestellt. Helena setzte sich nach hinten, ließ das Fenster herunter und schaute schweigend in die schwarz-gelbe Nacht hinaus, während die anderen weiter aufeinander einredeten. Sie kamen an ausgebrannten Wohnblöcken vorbei; Helena hatte Gerüchte gehört, denen zufolge die Besitzer der Gebäude sie selbst anzündeten, um teure Räumungsklagen zu vermeiden. Die Straßen waren leer, nur auf dem Grasstreifen sah sie ein paar dunkle Umrisse, schlafende Menschen, Kartons, verstreute Habseligkeiten. Die Party fand in einem leerstehenden Bürogebäude statt, das voll erleuchtet war, weshalb man in jedem der winzigen Fensterquadrate Halogenlampen und weiße Rasterdecken erkennen konnte.
Die schwere Tür des Autos öffnete sich, und Helena stolperte hinaus in die Nacht.
Yada
6:50:Wake Up
7:00—7:15: Hygiene
7:20—8:15: Meditation
8:20—8:50: Frühstück
9:00—11:50: Biologie
12:00—12:50: Yoga/Therapie/Arztbesuch
13:00—13:50: Mittagessen
14:00—14:50: Business Strategy, Leadership Skills
15:00—15:50: Softwaretechnik
16:00—16:50: Physik
17:00—17:50: Mathematik und Informatik
18:00—18:50: Meditation
19:00—20:30: Abendessen
21:00:Lights Out
Ich stand auf, klopfte mir das feine Grün der Algen von der Hose und sprang vom Dach. Auf dem Weg zum Frühstück fröstelte ich auf einmal, die Salzkristalle auf den Holzstegen glitzerten wie gefrorener Schnee. Obwohl die Population der Seestatt in den letzten Jahren geschrumpft war, reichte es zu den Stoßzeiten noch, um die Essensstation regelrecht lebhaft erscheinen zu lassen. Die zwei Stationen der Insel bestanden aus jeweils drei Waben; Lager, Küche und Kantine, zum Wasser hin ein Dock. Es waren die größten zusammenhängenden Strukturen hier, aber nur eine der beiden war noch in Betrieb.
Am Haupteingang sah ich meinen Therapeuten stehen. Rudolph war in ein Gespräch verwickelt und lachte wie die Karikatur eines älteren Mannes, den Kopf in den Nacken gelegt. Bevor er mich sehen konnte, wechselte ich die Richtung, ging an der weißgrauen Wand der Station entlang und schlüpfte beim hinteren Eingang ins Dunkel. Es reichte, alle paar Tage mit ihm sprechen zu müssen.
Langsam gewöhnten sich meine Augen an das gedämpfte Licht. Die automatisierte Essensausgabe hatte irgendwann den Geist aufgegeben, weshalb jetzt zwei Klapptische an ihrer Stelle standen. Sie waren mit großen Schüsseln beladen und wirkten in diesem Raum, in dem alle Möbel kunstvoll aus dem Boden und den hohen, gewölbten Wänden herauswuchsen, völlig fehl am Platz. Ich ging ungern zum Frühstück hierher, die Leute flüsterten, die Atmosphäre war steif und lähmend. Die Monotonie wurde nur beim Mittagessen ein wenig gebrochen, der einzigen Mahlzeit des Tages, die auch die Mitarbeiterinnen hier aßen. Diese demokratische Geste wurde davon unterlaufen, dass sich Inselvolk und Mitarbeiter nur selten an dieselben Tische setzten. Die unsichtbare Grenze, die auch ich seit der Geschichte mit Anca nicht mehr übertreten hatte, ließ sich nicht nur damit erklären, dass ein großer Teil der Mitarbeiter wenig Deutsch sprach. Ich mochte das Stimmengewirr aus Polnisch, Russisch und Arabisch, das sich zur Mittagszeit über die Station legte.
Ich bekämpfte meinen Unwillen und nahm mir von dem grünen Brei, der alle Vitamine und Nährstoffe beinhaltete und den wir Soylent nannten. Die Sonderlieferungen vom Festland tauchten meist nicht in der Essensstation auf, sie wurden direkt an die wenigen Seestattbewohner geliefert, die sie bestellt und bezahlt hatten. Mein Vater saß wahrscheinlich gerade in seinem Zimmer und aß Erdbeeren und Kiwis. Dass ich zum Frühstück und Mittagessen in die Station geschickt wurde, war eine weitere demokratische Geste, ein Symbol. Wenn der grüne Brei gut genug für seine Tochter war, war er auch gut genug für alle anderen. Abends aß ich mit ihm in seinem Quartier.
An einem der hinteren Tische saß Viktor und winkte. Der Raum war klamm. Die von vielen Körpern an einem Ort generierte Wärme stieg auf und tropfte als Kondenswasser von der großen Kuppeldecke. Ich nahm mein Tablett und setzte mich zu Viktor. Obwohl er mein Biologielehrer war, fühlte ich mich ihm nahe, er war einer der wenigen Menschen, denen ich nicht nur per Videoschalte begegnete. Jedes Mal wenn ich ihn sah, musste ich mich ermahnen, ihm nicht von den Dokumenten zu erzählen, über denen ich seit Wochen brütete. Viktor war aber sowieso mit anderen Dingen beschäftigt. Für heute war die Reparatur einer Hydraulikanlage beim Wellenbrecher vorgesehen, und Viktor machte sich Sorgen über den Sturm, der für den Abend vorhergesagt war. Viktor machte sich sowieso immer über alles Sorgen.
»Ja, das wird bestimmt ganz schrecklich, stundenlange Stromausfälle, ertrinkende Sicherheitsleute, security breach, Lockdown und Sirenen. Wahrscheinlich geht die ganze Insel unter.«
»Meinst du wirklich?«
»Quatsch, das ist eine Routinemaßnahme. Mach dir keine Sorgen. Wird schon gut gehen.«
Viktor sah mich mit banger Miene an und versuchte möglichst unauffällig, auf eine Stelle hinter seinem Ohr zu klopfen. Ich wusste, dass er abergläubisch war; wenn er kein Holz finden konnte, was meistens der Fall war, musste eben sein Kopf dran glauben. Diese etwas alberne Geste war nur eine von vielen Methoden, mit denen er seine Ängste in Schach hielt. Er war zwanghaft ordentlich, seine dunklen Haare immer kurz geschoren, sein Kittel unerklärlich sauber. An die verschiedenen Ausformungen seiner Ticks hatte ich mich schon lange gewöhnt. Viel bedenklicher fand ich, dass ihm in den letzten Wochen auch noch sein Humor abhandengekommen war.
Viktor war einer der loyalsten Mitstreiter meines Vaters. Es gab außer ihm zwar noch eine kleine Clique von Leuten, die dessen Lehren anhing, ihre Verehrung war aber so innig, dass ich sie nicht ernst nehmen konnte. Die meisten von ihnen waren erst in den letzten Jahren auf die Seestatt gekommen. Die Gruppe setzte sich zusammen aus Sicherheitsleuten, die mein Vater großzügig mit Waffen versorgte; jungen Unternehmern, die in ihm ein Genie sahen; einem Arzt, der auf dem Festland nicht mehr praktizieren konnte; und meinem Therapeuten Rudolph.
Viktor war ein anderes Kaliber. Er hatte viel aufgegeben, um hier zu sein und das Inselprojekt mit voranzutreiben. Vor dem Zusammenbruch hatte er in einem der international renommiertesten Institute für Mikrobiologie gearbeitet, er hatte Angebote aus aller Welt ausgeschlagen, um mit meinem Vater zu arbeiten. Seine Frau hatte nicht mitgewollt auf die Seestatt. Aber Viktor glaubte an das Projekt, er glaubte daran, dass die Insel der einzig sichere Ort sein würde, und so zerbrach seine Ehe nach seinem Umzug nicht an der Distanz, sondern an Glaubensfragen, bei denen zu viel auf dem Spiel stand.
Ein Tropfen fiel von der Decke auf den Teller, auf dem Viktor nervös die Reste zusammenschob. Ich stellte mir vor, wie es für ihn war, jeden Tag diesen Kontrast auszuhalten, zwischen den großen Zukunftsplänen der Vergangenheit und dem, was aus der Seestatt geworden war. Fragen konnte ich ihn nicht. Dass ich heimlich in das Büro meines Vaters gegangen war und seinen Computer durchsucht hatte, kam Hochverrat gleich, und Viktor hätte sich verpflichtet gefühlt, ihm davon zu berichten.
Helena
Die Ausstellung Das Kollektiv umfasst dreizehn Arbeiten, mit denen sich die Künstlerin Helena Harold den Möglichkeiten der Portraitmalerei in großformatigen Versuchen nähert. Der Titel, eine Anspielung auf Ayn Rands Anhänger, verweist auf das inhärente Paradoxon neoliberaler Gemeinschaftsbildung, auf das organisch gewachsene Sektierertum angeblich individualistischer Gemeinschaften. Gleichzeitig lässt uns die Künstlerin wissen, dass das ausgestellte Kollektiv aus dem Raum des Digitalen gleichsam erstanden ist. Das Ensemble dehnt sich physisch wie immateriell in den Raum aus, dabei verdichten sich Möglichkeiten der Transformation verschiedener Sinneseindrücke und Realitäten. In einer stets fluiden Interaktion zwischen der Welt des Dinglichen und der des Vorgestellten erschafft Helena Harold Momente absoluter Konzentration.
Die meisten der hier gezeigten Arbeiten konstituieren Übungen in der Destabilisierung normativer Assoziationen der traditionellen Portraitmalerei und Figuration. Indem sie die Bilder, die unseren Alltag saturieren, in Farbe sublimiert und diffundiert, fordert uns Harold auf, zu examinieren, ob es je wirklich möglich ist, Realität darzustellen.
Helena legte das Papier weg. Sie wünschte, ihre Galerie würde aufhören, ihr diese Sachen zu schicken. Mit großer Hartnäckigkeit wurde Helena von Zetteln verfolgt. Ausdrucke von Kritiken, Einladungen, Briefe, Besprechungen wurden unter der Tür durchgeschoben, von Freunden zugestellt, im Treppenhaus abgelegt. Helena hatte keinen Computer und auch kein Handy, sie schlief selten in ihrer eigenen Wohnung. Es half nur nichts, egal, wo sie sich gerade aufhielt, überall tauchten diese Papiere auf. Sie dachte an den Journalisten, mit dem sie gestern im Ottmann gesprochen hatte. Auch seine Interviewanfrage war vermutlich monatelang herumgeirrt, bevor sie schließlich auf einem der Zettel ihren Weg zu Helena gefunden hatte.
Mit ihrer Abschottung hatte sie schon vor Jahren begonnen, direkt nach dem plötzlichen und absolut versehentlichen Erfolg ihres Videos. Millionen von Menschen hatten es angeklickt. Eine kleine, aber mächtige Fraktion hatte beschlossen, in dem Video ein Kunstwerk und in ihr eine Künstlerin zu sehen. Ein viel größerer Teil der Zuschauer aber war zu der Überzeugung gelangt, Helena sei ein modernes Orakel.
Irgendwo an der albanischen Grenze hatte sie in einem Moment erschöpfter Albernheit zwölf Prophezeiungen gemacht — hauptsächlich politische Ereignisse, wobei auch ein schwerer Sturm und die Ergebnisse eines Fußballspiels dabei gewesen waren. Sie hatte sehr genaue Daten angegeben, eine Tatsache, die sie seither bereute. Dadurch war es nämlich unmöglich geworden, den Leuten glaubhaft zu machen, dass das Eintreten ihrer Vorhersagen REINER ZUFALL war. Sie tat ihr Bestes, verwies immer wieder auf die hohe Wahrscheinlichkeit der angekündigten Ereignisse und darauf, dass sie bei manchen Dingen völlig falschgelegen hatte, aber es hatte keinen Sinn. Sie war und blieb das moderne Orakel.
Helena verfiel damals in eine Depression, die noch lähmender war als alle vorangegangenen. Wochenlang benutzte sie keine Kommunikationsmittel, und als sie sich wieder einigermaßen in der Lage dazu fühlte, mit der Außenwelt zu korrespondieren, war sie so erschrocken über die große Resonanz (7782 neue E-Mails, 1489 neue Nachrichten, 476 verpasste Anrufe, 99+ Notifications), dass sie reflexhaft ihr Handy in den Restmüll fallen ließ und ihren Laptop auf den Hausflur stellte. Sie nahm sich nicht mal die Zeit, ihre Konten zu löschen. Manchmal, sehr selten, dachte sie in den folgenden Jahren daran, dass das alles immer noch weiterlief, dass täglich neue Nachrichten bei ihr eingingen und sie diese niemals lesen würde. Sie mochte den Gedanken.
Leider hieß das nicht, dass man sie in Ruhe ließ. Ständig wurde sie auf der Straße angesprochen, ganz normal aussehende Leute machten ungefragt Fotos von ihr, und Kunstsammler verlangten nach neuen Arbeiten. Sie konnte nicht verstehen, warum ihr Ruhm einfach nicht abflaute. Schließlich fand sie zufällig heraus, dass sie als technologiefeindliches Orakel aus Versehen zur Influencerin mutiert war. Ihre Verehrer und Verehrerinnen, junge Menschen zwischen fünfzehn und dreißig, bewunderten ihre Unabhängigkeit von der digitalen Welt, dokumentierten alles, was von ihrem Leben sichtbar wurde, und stellten es online. Am wenigsten einleuchten wollte Helena, dass ihre Fangemeinde sich für die Kleider interessierte, die sie sich morgens wahllos überwarf. Anscheinend hatte sie bestimmten Marken zu sehr hohen Umsätzen verholfen. Bars, in denen sie sich mit ihren Freunden betrank, wurden über Nacht so beliebt, dass man kaum noch hineinkam, Restaurants, in denen sie aß, konnten bald nur noch mit Reservierung betreten werden. Auch ihre Exzesse wurden bewundert, die Tatsache, dass sie endlos trinken und essen konnte, nie Sport trieb und das alles einem Körper antat, der jenseits des Jugendlichen war, galt als Alleinstellungsmerkmal.
Yada
Fahlblaues Licht dringt durch meine Lider. Ich löse den Griff meiner Hand vom Laken. Ich blinzle. Schlieren über meinen Augen. Das Laken ist steif, da ist getrocknetes Blut, braun auf weiß. Auf meiner Brust sitzt etwas. Ich öffne die klammen, verklebten Fäuste, sehe rote Striemen, handtellergroß. Anstelle der Erinnerung kommt die Angst, sie stemmt sich gegen den Stupor des Schlafs. Ich kontrolliere meinen Körper. Ich entdecke schwarze Poren, dort wo sich Blut ergossen hat, dunkelviolette Flecken auf meinen Knien, mit grauen und grünen Rändern. Als ich einschlief, war ich noch unverletzt. Ich schreie still, rufe mir ins Gedächtnis, aber da ist nichts, nur Nachtschwärze.
Erinnerung, begreife ich, ist keine Frage der Anstrengung.
Die Befürchtungen meines Vaters über meine geistige Gesundheit hatten mich immer begleitet. Ich wusste, ich sollte Angst haben vor den Dingen, die in mir schlummerten. Aber die Sorge meines Vaters war zu einer Konstante geworden, die in ihrer Beständigkeit beruhigend war, die Prophezeiung war so oft ausgesprochen worden, dass sie alle Kraft verloren hatte. Ich starrte an die gewölbte Decke meines Zimmers, auf den schwarzen Riss, dessen Verästelungen ich seit Jahren mit den Augen abtastete. An diesem Morgen ließ ich zum ersten Mal den Gedanken zu, dass mein Vater recht haben könnte; vielleicht keimte die Krankheit meiner Mutter wirklich in mir und war jetzt ausgebrochen. Ich wusste zwar nicht, was das für eine Krankheit sein sollte, aber sich mitten in der Nacht im Schlaf derart zu verletzen und sich beim Aufwachen nicht einmal daran zu erinnern, das war nicht normal. Immer wieder befühlte ich meine Knie, die mit blaugrünen Hämatomen übersät waren. Ich betrachtete meine Hände, strich über die blutigen Striemen. Kurz streifte mich der Gedanke, dass ich mich vielleicht nicht selbst verletzt hatte, dann schob ich ihn beiseite.
Die Videoüberwachung auf der Seestatt war lückenhaft; nur außerhalb der Quartiere, an einigen wenigen Standorten, wurde aufgezeichnet. Die Daten wurden zentral gespeichert, und wenn der Algorithmus nicht Alarm schlug, nach ein paar Wochen wieder gelöscht. Was immer ich heute Nacht getan hatte, es schien nicht drastisch genug gewesen zu sein, um das Computersystem zu alarmieren. Immerhin. Aber selbst wenn ich nicht vor die Tür getreten war, die Aufzeichnungen der Kamera vor meinem Quartier waren mein einziger Anhaltspunkt. An das Videomaterial zu kommen, würde nicht einfach werden. Ich würde warten müssen, bis mein Vater auf seine nächste Reise ging, und von seinem Computer aus darauf zugreifen. Erzählen konnte ich niemandem von meinem seltsamen Nachtverhalten, ich wollte nicht riskieren, dass mein Vater davon erfuhr. Seine Paranoia machte ihn unberechenbar, sie wurde geschürt von seiner Sorge um mich.
Den ganzen Tag über kämpfte ich mit bleierner Müdigkeit, die von tiefsitzender körperlicher Alarmbereitschaft durchdrungen war. Meine Instinkte widersprachen einander. Ich musste all meine Konzentration aufbringen, um mir eine glaubhafte Erklärung für die Wunden an meinen Händen auszudenken. Viktor erzählte ich, dass ich nach dem Abendessen versucht hatte, ein prekär befestigtes Tenderboot anzuleinen. Es war schwer zu sagen, ob er mir glaubte, jedenfalls fragte er nicht weiter nach. Überhaupt schien er zerstreuter als sonst, irgendwie niedergeschlagen. Als ich ihn nach den biologischen Ursachen des Schlafwandelns fragte, nahm er die Frage einfach hin. »Vermutlich eine Störung des Aufwachmechanismus«, antwortete er mir kurz und routiniert, »mit ziemlicher Sicherheit genetisch veranlagt.« Wenn sich das, was in der Nacht passiert war, durch Schlafwandeln erklären ließ, konnte ich es sicher nicht von meinem Vater haben. Der sah seinen regelmäßigen, kurzen und festen Schlaf als Ausweis seiner besonderen Disziplin. Da war es wieder, das Erbe meiner Mutter.
Viktor schwieg, starrte ins Leere und sah selbst nicht besonders wach aus. Ich sah ihn unter dem Tisch mit den Fingern zählen. Er tat mir leid, also fragte ich ihn, was in ihm vorging. Ein Wortschwall, der sich offensichtlich in ihm aufgestaut hatte, löste sich mit verzweifelter Geschwindigkeit. Mein Vater hatte in einem Anfall von Aktionismus beschlossen, das ursprünglich entworfene System zur Nahrungsversorgung wiederherzustellen, das darauf basierte, Fisch und Gemüse in einem geschlossenen Kreislauf zu züchten — Aquaponik hieß es in den Gründerplänen. Viktor war mit der Durchführung beauftragt worden, hatte aber eingewandt, dass man dazu das gesamte Ökosystem revitalisieren, also bei den Algenfarmen und der Reinigung von Regenwasser anfangen müsste. Daraufhin hatte mein Vater einen seiner seltenen Wutanfälle bekommen und Viktor vorgeworfen, das gesamte Seestatt-Projekt sabotieren zu wollen. Ich wusste, was das bedeutete. Mein Vater war über die Jahre immer vorsichtiger geworden, und Auseinandersetzungen dieser Art hatten meist damit geendet, dass er den vermeintlichen Verräter der Seestatt verwies. Ich glaubte eigentlich nicht, dass ihm das Projekt der eigenen Nahrungsmittelproduktion so wichtig war. Er mochte keine Einschränkungen beim Essen, deswegen bekam er ja seine Sonderlieferungen. Auf dem Festland waren nach dem Zusammenbruch ein paar wenige, streng kontrollierte Farmsiedlungen entstanden, die ihre Produkte auf dem Schwarzmarkt vertrieben. Was mein Vater zum Tausch anbot, wusste ich nicht.
Bei dem Gedanken, Viktor nie wiederzusehen wurde mir schlecht. Ich konnte ihn nicht auch noch verlieren. Ich sah hinunter auf meine Hände, auf die breiten, roten Striemen, die schon verkrustet waren, und nahm mir vor, Viktor nichts mehr zu fragen. Nicht über das Schlafwandeln, nicht über Aquaponik, nicht über die Algenfarmen.





























