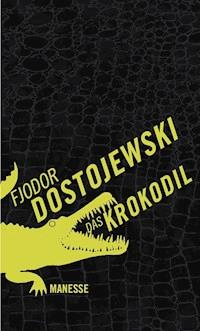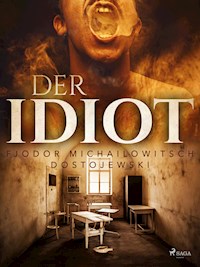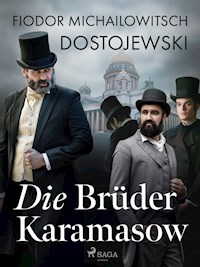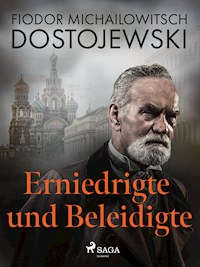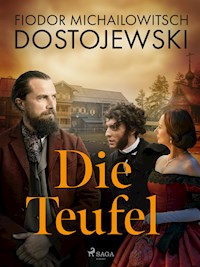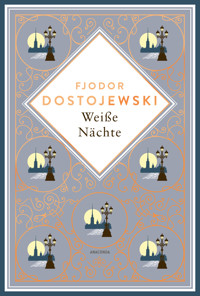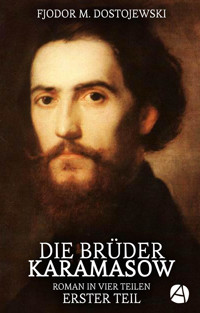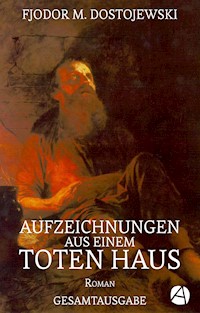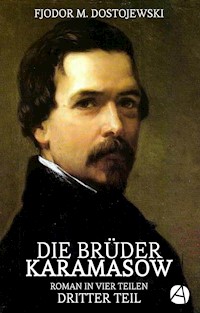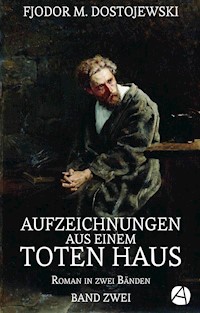
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
“Aufzeichnungen aus einem toten Haus” ist ein 1861 veröffentlichter halbautobiografischer Roman des russischen Schriftstellers Fjodor Dostojewski, der das Leben von Sträflingen in einem sibirischen Gefangenenlager schildert. Das Buch ist eine lose Sammlung von Fakten und Ereignissen, die eher nach “Themen” als nach einer durchgehenden Geschichte geordnet sind. Dostojewski selbst verbrachte vier Jahre im Exil in einem solchen Lager, nachdem er wegen seiner Beteiligung am Petraschewski-Kreis verurteilt worden war. Diese Erfahrung ermöglichte es ihm, die Bedingungen des Gefängnislebens und die Charaktere der Häftlinge mit großer Authentizität zu beschreiben. “Aufzeichnungen aus einem toten Haus” ist voller anschaulicher Details über brutale Strafen, schockierende Bedingungen, Fehden und Verrat und die psychologischen Auswirkungen des Freiheitsverlusts, beschreibt aber auch Momente der Komik und der Freundlichkeit. Es gibt groteske Badehaus- und Krankenhausszenen, die direkt aus Dantes Inferno zu stammen scheinen, neben waghalsigen Fluchtversuchen, zum Scheitern verurteilten Widerstandshandlungen und einer theatralischen Weihnachtsfeier, die die gesamte Gemeinschaft zusammenführt, um ihre düstere Realität vorübergehend außer Kraft zu setzen. Dies ist der zweite von zwei Bänden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
FJODOR M. DOSTOJEWSKI
AUFZEICHNUNGEN AUS EINEM TOTEN HAUS
BAND ZWEI
Übersetzt von
ALEXANDER ELIASBERG
AUFZEICHNUNGEN AUS EINEM TOTEN HAUS wurde im russischen Original zuerst veröffentlicht in der Zeitschrift Wremja, Sankt Petersburg 1862.
Diese Ausgabe wurde aufbereitet und herausgegeben von
© apebook Verlag, Essen (Germany)
www.apebook.de
1. Auflage 2023
V 1.0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
Band Zwei
ISBN 978-3-96130-567-4
Buchgestaltung: SKRIPTART, www.skriptart.de
Books made in Germany with
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Follow apebook!
***
BUCHTIPPS
Entdecke unsere historischen Romanreihen.
Der erste Band jeder Reihe ist kostenlos!
DIE GEHEIMNISSE VON PARIS. BAND 1
MIT FEUER UND SCHWERT. BAND 1
QUO VADIS? BAND 1
BLEAK HOUSE. BAND 1
Klicke auf die Cover oder die Textlinks oben!
Am Ende des Buches findest du weitere Buchtipps und kostenlose eBooks.
Und falls unsere Bücher mal nicht bei dem Online-Händler deiner Wahl verfügbar sein sollten: Auf unserer Website sind natürlich alle eBooks aus unserem Verlag (auch die kostenlosen) in den gängigen Formaten EPUB (Tolino etc.) und MOBI (Kindle) erhältlich!
* *
*
Inhaltsverzeichnis
Aufzeichnungen aus einem toten Haus. Band Zwei
Impressum
Einleitung
Band Zwei
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Eine kleine Bitte
Buchtipps für dich
Kostenlose eBooks
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
Links
Zu guter Letzt
Einleitung
In den entfernten Gebieten Sibiriens, mitten unter Steppen, Bergen oder unwegsamen Wäldern, findet man ab und zu kleine Städte mit ein- höchstens zweitausend Einwohnern, aus Holz erbaut und unansehnlich, mit zwei Kirchen – die eine in der Stadt und die andere auf dem Friedhofe, – Städte, die eher einem größeren Kirchdorf in der Nähe Moskaus als einer wirklichen Stadt gleichen. Sie sind gewöhnlich mit einer genügenden Anzahl von Isprawniks, Assessoren und sonstigen subalternen Beamten versehen. Im allgemeinen ist der Dienst in Sibirien, trotz der Kälte, für die Beamten außerordentlich behaglich. Es leben da einfache, nicht liberale Menschen, und herrschen alte, festgefügte, von Jahrhunderten geheiligte Sitten. Die Beamten, die mit Recht die Rolle eines sibirischen Adels spielen, sind entweder eingeborene, eingefleischte Sibirier oder sind aus dem europäischen Rußland, zum größten Teil aus den Hauptstädten, zugezogen, von den Reisevorschüssen, die niemals verrechnet werden, den doppelten Vorspanngeldern und rosigen Hoffnungen auf die Zukunft verlockt. Diejenigen von ihnen, die des Lebens Rätsel zu lösen verstehen, bleiben für immer in Sibirien und fassen dort mit Genuß Wurzeln. Diese bringen später reiche und süße Früchte. Aber die anderen, die leichtsinnigen, die des Lebens Rätsel nicht zu lösen verstehen, haben von Sibirien bald genug und fragen sich mit Qual: »Warum sind wir eigentlich hergekommen?« Sie absolvieren mit Ungeduld die gesetzliche dreijährige Dienstzeit, nach deren Verlauf sie sich sogleich um eine Versetzung bemühen, und kehren heim, auf Sibirien schimpfend und es verspottend. Sie sind im Unrecht: nicht nur in Ansehung des Dienstes, sondern auch in verschiedenen anderen Hinsichten kann man in Sibirien wohl ein glückliches Leben führen. Das Klima ist vorzüglich; es gibt viele außerordentlich reiche und gastfreundliche Kaufleute und auch viele vermögende Fremdstämmige. Die jungen Mädchen blühen wie die Rosen und sind im höchsten Grade tugendhaft. Das Wildbret fliegt in den Straßen herum und stößt von selbst auf den Jäger. Champagner wird in unnatürlichen Mengen getrunken. Die Ernte ist stellenweise fünfzehnfach . . . Es ist überhaupt ein gesegnetes Land. Man muß nur verstehen, seinen Nutzen daraus zu ziehen. Und in Sibirien versteht man sich darauf.
In einem solcher lustigen selbstzufriedenen Städtchen mit der liebenswürdigsten Bevölkerung, die eine unauslöschliche Erinnerung in meinem Herzen zurückließ, lernte ich einen gewissen Alexander Petrowitsch Gorjantschikow kennen, einen Ansiedler, der im europäischen Rußland als adeliger Gutsbesitzer geboren, wegen der Ermordung seiner Frau zu Zwangsarbeit zweiter Klasse nach Sibirien verbannt worden war und nach Abbüßung der gesetzlichen zehnjährigen Strafzeit ein stilles und bescheidenes Leben als Ansiedler im Städtchen K. fristete. Eigentlich war er nach einer in der Nähe dieser Stadt gelegenen Dorfgemeinde zuständig, wohnte aber in der Stadt, wo er die Möglichkeit hatte, durch Unterricht von Kindern seinen Lebensunterhalt zu verdienen. In den sibirischen Städten trifft man oft als Lehrer solche ehemalige Verbannte; man hat hier keinerlei Vorurteile gegen sie. Sie unterrichten vorwiegend in der französischen Sprache, die im Leben so dringend notwendig ist und von der man, ohne sie, in den entlegenen Gegenden Sibiriens keine Ahnung gehabt hätte. Ich traf Alexander Petrowitsch zum erstenmal im Hause eines alten verdienten und gastfreundlichen Beamten, Iwan Iwanytsch Gwosdikow, welcher fünf Töchter verschiedenen Alters hatte, die zu den schönsten Hoffnungen berechtigten. Alexander Petrowitsch gab ihnen Unterricht, viermal in der Woche zu dreißig Kopeken in Silber für die Stunde. Sein Äußeres weckte mein Interesse. Er war ein außerordentlich blasser und hagerer Mann, noch nicht alt, von etwa fünfunddreißig Jahren, klein und schwächlich. Er kleidete sich immer sehr sauber und nach europäischer Art. Wenn man mit ihm ein Gespräch begann, so sah er einen außerordentlich durchdringend und aufmerksam an und hörte mit strenger Höflichkeit zu, als sinne er über jedes Wort nach, als sähe er in jeder an ihn gerichteten Frage eine Aufgabe, oder als wolle man ihm irgendein Geheimnis entlocken. Schließlich antwortete er klar und kurz, aber jedes Wort dermaßen abwägend, daß man sich plötzlich aus irgendeinem Grunde geniert fühlte und schließlich froh war, wenn das Gespräch ein Ende nahm. Ich erkundigte mich über ihn schon damals bei Iwan Iwanytsch und erfuhr, daß Gorjantschikow ein tadelloses und sittliches Leben führte; sonst würde Iwan Iwanytsch seine Töchter nicht von ihm unterrichten lassen; er sei aber furchtbar menschenscheu, gehe allen aus dem Wege, sei außerordentlich gebildet, lese viel, spreche aber sehr wenig, und es sei außerordentlich schwer, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Andere behaupteten, er sei entschieden verrückt, obwohl sie es im Grunde genommen für keinen so großen Fehler hielten; viele der angesehenen Bewohner der Stadt seien bereit, Alexander Petrowitsch auf die freundlichste Weise zu behandeln, er könne sogar nützlich sein und verstünde Bittgesuche aufzusetzen usw. Man nahm an, daß er anständige Verwandte in Rußland habe, die vielleicht nicht zu den unbedeutendsten Menschen gehörten, aber man wußte, daß er seit seiner Verbannung alle Beziehungen zu denselben abgebrochen hatte, kurz, daß er sich selbst schädigte. Außerdem kannten bei uns alle seine Geschichte und wußten, daß er seine Frau im ersten Jahr des Ehelebens aus Eifersucht ermordet und sich dann selbst angezeigt hatte (was das Strafmaß bedeutend gemildert hatte). Solche Verbrechen werden aber stets als Unglücksfälle angesehen und erregen Mitleid. Trotz alledem ging aber der Sonderling allen hartnäckig aus dem Wege und erschien unter Menschen nur, um Stunden zu geben.
Anfangs schenkte ich ihm keine besondere Beachtung, aber er fing mich allmählich zu interessieren an, ich weiß selbst nicht warum. Es war in ihm etwas Rätselhaftes. Mit ihm richtig ins Gespräch zu kommen, war absolut unmöglich. Natürlich gab er auf alle meine Fragen immer Antwort und sogar mit solcher Miene, als hielte er es für seine allererste Pflicht; aber nach seinen Antworten war es mir irgendwie schwer, ihn weiter auszufragen; auch drückte sein Gesicht nach einem solchen Gespräch immer Qual und Ermüdung aus. Ich erinnere mich noch, wie ich einmal an einem schönen Sommerabend mit ihm von Iwan Iwanytsch ging. Plötzlich fiel mir ein, ihn für eine Weile zu mir einzuladen, um eine Zigarette zu rauchen. Ich kann gar nicht beschreiben, was für ein Schrecken sich da auf seinem Gesichte zeigte; er verlor ganz die Fassung, fing an, irgendwelche unzusammenhängende Worte zu stammeln, warf mir plötzlich einen gehässigen Blick zu und rannte in die entgegengesetzte Richtung davon. Ich war sogar erstaunt. Von nun an sah er mich bei jeder neuen Begegnung erschrocken an. Ich beruhigte mich aber nicht; etwas an ihm zog mich an, und etwa vier Wochen später ging ich so ganz ohne jeden Anlaß selbst zu Gorjantschikow. Natürlich war es dumm und taktlos von mir. Er wohnte am äußersten Ende der Stadt bei einer alten Kleinbürgerin, die eine schwindsüchtige Tochter hatte; diese hatte aber ein uneheliches Kind, ein etwa zehnjähriges, hübsches und heiteres Mädelchen. Alexander Petrowitsch saß, als ich kam, mit der Kleinen und unterrichtete sie im Lesen. Als er mich erblickte, geriet er in solche Verwirrung, als hätte ich ihn bei einem Verbrechen ertappt. Er verlor alle Fassung, sprang vom Stuhle auf und sah mich starr an. Endlich nahmen wir Platz; er verfolgte aufmerksam jeden meiner Blicke, als witterte er in jedem von ihnen einen besonderen geheimnisvollen Sinn. Ich merkte, daß er mißtrauisch war bis zum Wahnsinn. Er sah mich mit Haß an und schien mich fragen zu wollen, ob ich nicht bald weggehen würde. Ich brachte das Gespräch auf unser Städtchen und auf die laufenden Neuigkeiten; er schwieg und lächelte gehässig; es zeigte sich, daß er die allergewöhnlichsten, allen bekannten städtischen Neuigkeiten nicht nur nicht kannte, sondern sich für sie nicht einmal interessierte. Dann sprach ich vom Land, in dem wir wohnten, und von seinen Bedürfnissen; er hörte mir schweigend zu und sah mir so merkwürdig in die Augen, daß ich mich plötzlich dieses Gesprächs schämte. Übrigens gelang es mir fast, ihn durch die neuen Bücher und Zeitschriften, die ich bei mir hatte, in Versuchung zu bringen; sie waren soeben mit der Post angekommen, und ich bot sie ihm noch unaufgeschnitten an. Er warf auf sie einen gierigen Blick, gab aber sofort seine Absicht auf und wies mein Angebot zurück, mit der Ausrede, daß er keine Zeit habe. Endlich verabschiedete ich mich von ihm und fühlte, als ich ihn verlassen hatte, wie mir ein schwerer Stein vom Herzen gefallen war. Ich schämte mich, und es erschien mir außerordentlich dumm, einem Menschen nachzulaufen, der es sich zur Hauptaufgabe gemacht hatte, sich so weit wie möglich von der gesamten Welt zu verstecken. Aber es war einmal geschehen. Ich erinnere mich, daß ich bei ihm fast gar keine Bücher gesehen habe; folglich stimmte es nicht, wenn man sagte, daß er viel lese. Als ich aber ein paarmal zu einer sehr späten Nachtstunde an seinen Fenstern vorüberfuhr, sah ich in ihnen Licht. Was mochte er treiben, wenn er so bis zur Morgendämmerung aufblieb? Vielleicht schrieb er? Und wenn ja, was mochte er schreiben?
Die Umstände hielten mich an die drei Monate von unserem Städtchen fern. Als ich im Winter zurückkehrte, erfuhr ich, daß Alexander Petrowitsch im Herbste gestorben war, und zwar in voller Einsamkeit, ohne auch nur einmal einen Arzt gerufen zu haben. Im Städtchen hatte man ihn fast gänzlich vergessen. Seine Wohnung stand leer. Ich machte unverzüglich die Bekanntschaft der Wirtin des Verstorbenen, in der Absicht, von ihr zu erfahren, womit sich ihr Mieter eigentlich beschäftigt oder ob er nicht etwas geschrieben habe. Für ein Zwanzigkopekenstück brachte sie mir einen ganzen Korb Papiere, die der Verstorbene hinterlassen hatte. Die Alte gestand mir, daß sie zwei Hefte bereits aufgebraucht hatte. Sie war ein mürrisches und wortkarges Frauenzimmer, aus dem man schwer etwas herausbringen konnte. Über ihren Mieter vermochte sie mir nichts Neues zu erzählen. Nach ihren Worten hatte er fast nie etwas getan und monatelang weder ein Buch aufgeschlagen, noch eine Feder zur Hand genommen; dafür sei er nächtelang in seinem Zimmer auf und ab gegangen und habe über etwas nachgedacht, zuweilen sogar mit sich selbst gesprochen: er hätte ihre Enkeltochter Katja sehr lieb gewonnen und sei immer freundlich zu ihr gewesen, besonders nachdem er erfahren hatte, daß sie Katja heiße; am Katherinentag sei er stets in die Kirche gegangen und habe eine Totenmesse lesen lassen. Gäste hätte er nicht leiden können; das Haus habe er nur verlassen, um Stunden zu geben; er hätte sogar sie, die Alte, selbst scheel angesehen, wenn sie einmal in der Woche zu ihm gekommen sei, um sein Zimmer ein wenig aufzuräumen, und habe zu ihr in den ganzen drei Jahren fast kein einziges Wort gesprochen. Ich fragte Katja, ob sie sich ihres Lehrers erinnere. Sie sah mich schweigend an, wandte sich dann zur Wand und fing zu weinen an. Also hat es dieser Mensch doch vermocht, in jemand Liebe zu erwecken.
Ich nahm seine Papiere mit und wühlte in ihnen einen ganzen Tag. Drei Viertel davon waren leere unbedeutende Fetzen oder Schreibübungen seiner Schüler. Aber es fand sich auch ein Heft dabei, recht umfangreich, eng vollgeschrieben und unvollendet, vielleicht vom Verfasser selbst aufgegeben und vergessen. Es war eine, wenn auch zusammenhanglose Beschreibung des zehnjährigen Zuchthauslebens, das Alexander Petrowitsch abgebüßt hatte. Stellenweise war diese Beschreibung durch einen anderen Bericht unterbrochen, durch seltsame, schreckliche Erinnerungen, hastig und krampfhaft, wie unter einem Zwange hingeworfen. Ich las diese Bruchstücke einigemal durch und gewann fast die Überzeugung, daß sie im Wahnsinn geschrieben worden seien. Aber die Zuchthausaufzeichnungen, – »Szenen aus einem toten Hause«, – wie der Autor sie selbst an einer Stelle seines Manuskripts nannte, – erschienen mir nicht ganz uninteressant. Eine gänzlich neue, bisher unbekannte Welt, die Seltsamkeit mancher Tatsachen, einige besondere Bemerkungen über verlorene Menschen – all das fesselte mich, und ich las vieles mit Interesse. Natürlich kann ich mich auch irren. Aber ich wähle zur Probe erst zwei oder drei Kapitel aus; mag das Publikum selbst urteilen . . .
Band Zwei
I
Das Hospital
Bald nach den Feiertagen erkrankte ich und kam ins Militärspital. Es stand abseits, eine halbe Werst von der Festung entfernt. Es war ein langgestrecktes, gelbgestrichenes Gebäude. Im Sommer, wenn alle Baulichkeiten renoviert wurden, verwendete man darauf eine außerordentliche Menge Ocker. Auf dem riesengroßen Hofe befanden sich die Wirtschaftsgebäude, Häuser für das ärztliche Personal und sonstige notwendige Baulichkeiten. Im Hauptbau lagen ausschließlich die Krankensäle. Es gab ihrer viele, aber nur zwei von ihnen waren für die Sträflinge bestimmt. Sie waren immer außerordentlich überfüllt, besonders aber im Sommer, so daß man oft die Betten zusammenrücken mußte. Unsere Krankensäle waren von »Unglücklichen« aller Art angefüllt. Es waren Leute aus unserem Zuchthause dabei, auch solche, die als Angeklagte vor dem Kriegsgericht standen und in verschiedenen Arrestlokalen saßen, Verurteilte und auch Nichtverurteilte; es gab auch welche aus der Korrektionskompagnie, einer seltsamen Einrichtung, in welche Soldaten, die sich etwas zuschulden kommen ließen, und auch solche, auf die kein besonderer Verlaß war, zwecks Besserung ihrer Aufführung gesteckt wurden und die sie gewöhnlich nach zwei oder mehr Jahren als solche Schurken verließen, wie man sie selten findet. Wenn ein Arrestant bei uns erkrankte, so meldete er es gewöhnlich am Morgen dem Unteroffizier. Der Kranke wurde dann sofort in ein Buch eingetragen und mit diesem Buch in Begleitung eines Wachsoldaten ins Bataillonslazarett geschickt. Der dortige Arzt untersuchte zunächst alle Kranken aus sämtlichen in der Festung untergebrachten Militärkommandos und schickte diejenigen, die er für wirklich krank hielt, ins Hospital. So wurde auch ich ins Buch eingetragen und begab mich gegen zwei Uhr, als alle Unsrigen aus dem Zuchthause zur Nachmittagsarbeit gegangen waren, ins Hospital. Ein kranker Arrestant pflegte möglichst viel Geld und Brot mitzunehmen, da er am ersten Tage im Hospital noch keine Ration zu erwarten hatte; ferner ein winziges Pfeifchen, einen Tabaksbeutel und einen Feuerstein nebst Stahl. Die letztgenannten Gegenstände pflegte man sorgfältig in den Stiefeln zu verstecken. Ich betrat das Hospital nicht ohne eine gewisse Neugier auf diese neue, mir noch unbekannte Variation unseres Arrestantendaseins.
Der Tag war warm, trüb und traurig, – einer jener Tage, an denen solche Anstalten wie ein Hospital ein besonders nüchternes, unfreundliches und griesgrämiges Aussehen haben. Ich betrat mit dem Wachsoldaten das Aufnahmezimmer, wo zwei kupferne Wannen standen und schon zwei kranke Angeklagte mit ihren Wachsoldaten warteten. Der Feldscher kam, musterte uns mit einem faulen und hochmütigen Ausdruck und begab sich noch fauler zum diensthabenden Arzt mit der Meldung. Dieser kam bald, untersuchte uns, behandelte uns sehr freundlich und gab einem jeden von uns einen »Krankenbogen«, auf dem der Name des Betreffenden verzeichnet war. Die fernere Beschreibung der Krankheit, die Verordnung der Arzneien und Beköstigung oblag aber einem der Assistenzärzte, die die Arrestantensäle unter sich hatten. Ich hatte auch schon früher gehört, daß die Arrestanten diese Ärzte gar nicht genug loben konnten. »Sie sind besser als leibliche Väter!« antworteten sie mir auf meine Fragen, bevor ich mich ins Spital begab. Indessen hatten wir uns umgekleidet. Die Kleider und die Wäschestücke, in denen wir gekommen waren, wurden uns abgenommen, und man bekleidete uns mit der Hospitalwäsche und gab uns außerdem lange Strümpfe, Pantoffeln, Nachtmützen und dicke tuchene Schlafröcke von brauner Farbe, die mit einem Zeug, das halb an Leinwand und halb an ein Pflaster erinnerte, gefüttert waren. Kurz, mein Schlafrock war außergewöhnlich schmutzig, aber ich lernte ihn erst an Ort und Stelle richtig schätzen. Dann führte man uns in die Arrestantensäle, die am Ende eines außerordentlich langen, hohen und sauberen Korridors lagen. Die äußere Reinlichkeit war überall sehr befriedigend; alles, was einem zuerst ins Auge fiel, glänzte förmlich. Es ist übrigens möglich, daß es mir nur nach dem Aufenthalte in unserem Zuchthaus so vorkam. Die beiden Angeklagten kamen in den Saal links und ich in den Saal rechts. Vor der mit einer eisernen Querstange verschlossenen Türe stand ein Wachtposten mit einem Gewehr und neben ihm ein Mann zur Ablösung. Der zweite Unteroffizier (von der Hospitalwache) befahl ihm, mich einzulassen, und ich kam in einen langen, schmalen Raum, an dessen beiden Längswänden etwa zweiundzwanzig Betten standen, von denen drei oder vier noch unbesetzt waren. Die Betten waren aus Holz und grün gestrichen, – solche Betten sind bei uns in Rußland jedermann bekannt und können infolge einer geheimnisvollen Schicksalsfügung unmöglich wanzenfrei sein. Ich bekam das Bett in der Ecke an der Fensterseite.
Wie ich schon sagte, befanden sich hier auch Arrestanten aus unserem Zuchthause. Einige von ihnen kannten mich schon oder hatten mich wenigstens früher gesehen. Weit mehr gab es hier Leute im Anklagezustande und aus der Korrektionskompagnie. Schwerkranke, d. h. solche, die das Bett nicht verlassen konnten, gab es nicht viel. Die übrigen, die leicht Kranken und die Genesenden, saßen auf den Betten oder gingen im Zimmer auf und ab, wo es zwischen den beiden Bettreihen einen zu solchen Spaziergängen völlig ausreichenden freien Raum gab. Im Saale herrschte ein erstickender Hospitalgeruch. Die Luft war von verschiedenen unangenehmen Ausdünstungen und vom Geruch der Arzneien geschwängert, obwohl in der Ecke fast den ganzen Tag ein Ofen brannte. Mein Bett war mit einem gestreiften Überzug bedeckt. Ich nahm ihn ab. Unter dem Überzug fand ich eine mit Leinwand gefütterte tuchene Bettdecke und dicke Wäsche von zweifelhafter Sauberkeit. Neben dem Bette stand ein Tischchen mit einem Krug und einer Zinntasse. Diese Gegenstände wurden des Anstandes halber mit dem kleinen Handtuch, das ich bekam, zugedeckt. Unten im Tischchen befand sich noch ein Fach; darin hielten diejenigen, die Tee zu trinken pflegten, ihre Teekannen; hier standen auch Gefäße mit Kwas und ähnliche Dinge; Teetrinker gab es aber unter den Kranken nicht viel. Die Pfeifen und die Tabaksbeutel, die fast alle, die Schwindsüchtigen nicht ausgeschlossen, besaßen, wurden aber unter den Betten verwahrt. Der Arzt und die anderen Vorgesetzten untersuchten die Betten fast nie, und wenn sie jemand mit einer Pfeife antrafen, so taten sie so, als sähen sie sie nicht, übrigens waren auch die Kranken fast immer vorsichtig und rauchten ihre Pfeifen am Ofen. Nur in der Nacht rauchte man einfach auf dem Bette liegend; aber in der Nacht kam niemand in die Krankensäle, höchstens zuweilen der die Hospitalwache befehligende Offizier.
Bisher hatte ich noch in keinem Krankenhause gelegen; darum war die ganze Umgebung für mich außerordentlich neu. Ich merkte, daß ich eine gewisse Neugier erweckte; man hatte von mir schon gehört und musterte mich höchst ungeniert, sogar mit dem Ausdruck einer gewissen Überlegenheit, mit dem man in einer Schule einen Neueingetretenen oder in einem Amtslokal einen Bittsteller anzusehen pflegt. Rechts neben mir lag ein im Anklagezustand befindlicher Schreiber, der uneheliche Sohn eines Hauptmannes a. D. Er stand wegen Falschmünzerei vor Gericht und lag schon fast ein Jahr da, obwohl er anscheinend gar nicht krank war; aber er versicherte die Ärzte, daß er das Aneurysma habe. Er hatte damit sein Ziel erreicht: er entging dem Zuchthause und der Körperstrafe und wurde nach einem Jahr nach T–k geschickt, um dort in einem Krankenhause untergebracht zu werden. Er war ein kräftiger, stämmiger Bursche von etwa achtundzwanzig Jahren, ein großer Schwindler und Kenner der gesetzlichen Vorschriften, gar nicht dumm, außerordentlich ungeniert, seiner selbst sicher und von einem krankhaften Ehrgeiz; er hatte sich selbst ernsthaft eingeredet, daß er der ehrlichste und rechtschaffenste Mensch in der Welt und dabei völlig unschuldig sei, und behielt diese Überzeugung für immer. Er sprach mich als erster an, fragte mich neugierig aus und erzählte mir recht ausführlich von den äußeren Einrichtungen des Hospitals. Vor allen Dingen erklärte er mir natürlich, daß er ein Hauptmannssohn sei. Er wollte furchtbar gern als ein Edelmann oder wenigstens als ein Mensch adliger Abstammung erscheinen. Gleich nach ihm ging auf mich ein Kranker aus der Korrektionskompagnie zu und begann, mir zu versichern, daß er viele von den früher verbannten Adligen gekannt habe, die er mit Vor- und Vatersnamen nannte. Er war ein schon ergrauter Soldat; in seinem Gesicht stand geschrieben, daß er log. Er hieß Tschekunow. Er machte mir offenbar deshalb den Hof, weil er mich im Besitze von Geld vermutete. Als er bei mir ein Paket mit Tee und Zucker bemerkte, bot er mir gleich seine Dienste an: er wollte mir eine Teekanne holen und den Tee aufbrühen. Eine Teekanne hatte mir aber schon M–cki aus dem Zuchthause durch einen der Arrestanten, die im Hospital zu arbeiten hatten, zu schicken versprochen. Aber Tschekunow besorgte mir die ganze Sache. Er verschaffte irgendeinen kleinen Kessel und sogar eine Tasse, kochte Wasser und brühte den Tee auf, diente mir mit einem Worte mit ungewöhnlichem Eifer, womit er einen der Kranken zu einigen giftigen Bemerkungen über mich verleitete. Dieser Kranke, ein Schwindsüchtiger namens Ustjanzew, lag mir gegenüber; er gehörte zu den im Anklagezustande befindlichen Soldaten und war derselbe, der aus Angst vor der Strafe eine Schale mit Branntwein, den er stark mit Tabak angesetzt, ausgetrunken und sich dadurch die Schwindsucht zugezogen hatte; ihn habe ich schon früher einmal erwähnt. Bisher hatte er schweigend und schwer atmend dagelegen, mich mit ernster Miene gemustert und das Benehmen Tschekunows mit Entrüstung verfolgt. Ein ungewöhnlich ernster, galliger Ausdruck verlieh seiner Entrüstung etwas Komisches. Schließlich hielt er es nicht mehr aus.
»Dieser Knecht! Da hat er einen vornehmen Herrn gefunden!« versetzte er mit einigen Unterbrechungen, vor Erregung atemlos. Er hatte nur noch wenige Tage zu leben.
Tschekunow wandte sich empört zu ihm um.
»Wer ist hier ein Knecht?« sprach er mit einem verächtlichen Blick auf Ustjanzew.
»Du bist der Knecht!« antwortete jener mit solcher Sicherheit, als hätte er volles Recht, Tschekunow Rügen zu erteilen und wäre sogar zu diesem Zweck angestellt.
»Ich bin ein Knecht?«
»Ja, du. Hört ihr es, Leute, er glaubt es nicht! Er wundert sich noch!«
»Was geht es dich an! Du siehst doch, der Herr kann sich allein nicht behelfen, wie wenn er keine Hände hätte. Er ist natürlich nicht gewohnt, ohne einen Diener zu sein! Warum soll ich ihm nicht den Dienst erweisen, du borstschnauziger Hanswurst!«
»Wer ist borstschnauzig?«
»Du.«
»Ich bin borstschnauzig?«
»Ja, du!«
»Und du bist wohl hübsch? Hast selbst ein Gesicht wie ein Krähenei, wenn ich borstschnauzig bin.«
»Gewiß bist du borstschnauzig! Wenn dich Gott einmal geschlagen hat, so liege ruhig da und stirb! Aber er muß sich auch einmischen! Was mischt du dich ein?«
»Was ich mich einmische? Ich werde mich lieber vor einem Stiefel als vor einem Bastschuh verbeugen. Mein Vater hat sich vor keinem Bastschuh verbeugt und hat es auch mir verboten. Ich . . . ich . . .«
Er wollte noch fortfahren, bekam aber einen schrecklichen Hustenanfall, der einige Minuten dauerte und bei dem er Blut spuckte. Bald trat ihm kalter Schweiß der Erschöpfung auf die schmale Stirn. Der Hustenanfall hinderte ihn, sonst hätte er noch lange gesprochen; man sah es seinen Augen an, wie gern er noch schimpfen wollte; in seiner Ohnmacht winkte er aber nur mit der Hand . . . So achtete Tschekunow auf ihn bald nicht mehr.
Ich fühlte, daß die Bosheit des Schwindsüchtigen mehr gegen mich als gegen Tschekunow gerichtet war. Der Wunsch Tschekunows, mir nützlich zu sein und damit eine Kopeke zu verdienen, hätte wohl in niemand einen Zorn oder Verachtung gegen ihn geweckt. Ein jeder wußte, daß er es einfach des Geldes wegen tat. In dieser Beziehung ist das einfache Volk nicht so heikel und versteht seine Unterschiede zu machen. Den Unwillen Ustjanzews hatte eigentlich meine Person erweckt; ihm mißfiel mein Tee, auch daß ich mich selbst in Ketten noch als ein Herr gab, als könnte ich mich ohne einen Diener nicht behelfen, obwohl ich nach einem solchen gar nicht verlangt hatte. Ich wollte ja wirklich immer alles selbst machen und gab mir besondere Mühe, den Eindruck zu vermeiden, daß ich ein verzärtelter Herr mit sauberen Händen sei. Darin lag sogar ein gewisser Ehrgeiz meinerseits, – wenn ich darüber schon sprechen soll. Ich kann unmöglich begreifen, warum es immer so kam, – aber ich konnte niemals die Leute, die sich mir als Diener aufdrängten, zurückweisen; diese gewannen schließlich solche Gewalt über mich, daß eigentlich sie meine Herren waren, ich aber ihr Diener; von außen betrachtet sah es aber immer so aus, als wäre ich wirklich ein verwöhnter Herr und könne mich ohne Dienstboten nicht behelfen. Dies war mir natürlich sehr ärgerlich. Aber Ustjanzew war ein schwindsüchtiger, reizbarer Mensch. Die übrigen Kranken sahen mich gleichgültig, sogar mit einem gewissen Hochmut an. Ich erinnere mich, daß ein besonderer Umstand sie alle beschäftigte; ich erfuhr aus den Gesprächen der Sträflinge, daß am gleichen Abend zu uns einer der Angeklagten gebracht werden sollte, der in diesem Augenblick die Spießrutenstrafe bekam. Die Arrestanten erwarteten diesen Neuling mit gewisser Neugier. Man sagte übrigens, daß die Strafe eine leichte sei: bloß fünfhundert Hiebe.
Allmählich lernte ich meine Umgebung kennen. Soweit ich bemerken konnte, litten hier die meisten an Skorbut und Augenkrankheiten, die in dieser Gegend allgemein verbreitet waren. Solche gab es hier mehrere. Die anderen wirklich Kranken hatten Fieber, allerlei Geschwüre und Brustleiden. Hier war es anders als in den anderen Krankensälen: alle Kranken, selbst die Venerischen, lagen beieinander. Ich sprach eben von den »wirklich« Kranken, denn es gab hier auch solche, die ohne jede Krankheit hergekommen waren, einfach um auszuruhen. Die Ärzte nahmen solche gern aus Mitleid auf, besonders wenn es viel unbesetzte Betten gab. Das Leben in den Arrestlokalen und in den Zuchthäusern war im Vergleich mit dem im Hospital dermaßen schlecht, daß viele Arrestanten hier trotz der stickigen Luft und der verschlossenen Türe mit Vergnügen lagen. Es gab sogar besondere Liebhaber für das Liegen und für das Hospitalleben; diese gehörten übrigens zum größten Teil der Korrektionskompagnie an. Ich musterte mit Neugier meine neuen Genossen, aber meine besondere Neugier erregte, wie ich mich erinnere, ein gleichfalls schwindsüchtiger Arrestant aus unserem Zuchthause, der in den letzten Zügen, nur durch ein Bett von Ustjanzew getrennt, also gleichfalls mir fast gegenüber lag. Er hieß Michailow; erst vor zwei Wochen hatte ich ihn im Zuchthause gesehen. Er war schon seit langem krank und hätte sich längst in ärztliche Behandlung begeben sollen; aber er überwand sich mit einer trotzigen, völlig überflüssigen Geduld, beherrschte sich und kam erst in den Feiertagen ins Hospital, um nach drei Wochen seiner entsetzlich vorgeschrittenen Schwindsucht zu erliegen; der Mann war gleichsam bei lebendigem Leibe verbrannt. Mich frappierte sein schrecklich verändertes Gesicht, das mir schon bei meinem Eintritt ins Zuchthaus als eines der ersten aufgefallen war. Neben ihm lag ein Soldat aus der Korrektionskompagnie, ein schon bejahrter Mensch, der sich durch eine schreckliche, ekelerregende Unsauberkeit auszeichnete . . . Aber ich will hier gar nicht alle Kranken aufzählen . . . Diesen Alten erwähnte ich eben nur aus dem Grunde, weil er auf mich damals gleichfalls einigen Eindruck gemacht und mir in einem Augenblick einen ziemlich vollständigen Begriff von gewissen Eigentümlichkeiten des Arrestantensaals verschafft hatte. Dieser Alte hatte damals, wie ich mich erinnere, einen heftigen Schnupfen. Er nieste die ganze Zeit, nieste eine ganze Woche lang sogar im Schlafe, salvenweise, in fünf und sechs Anfällen hintereinander, wobei er jedesmal sagte: »Mein Gott, ist das eine Strafe!« Damals saß er auf seinem Bette und stopfte sich gierig aus einem kleinen Papierpaket Schnupftabak in die Nase, um auf diese Weise seine Nase möglichst gründlich zu säubern. Er nieste in sein eigenes baumwollenes kariertes Schnupftuch, das wohl hundertmal gewaschen und äußerst verschossen war; dabei verzog er eigentümlich seine kleine Nase, in der sich zahllose kleine Runzeln bildeten, und zeigte die Überreste seiner alten schwarzgewordenen Zähne zugleich mit dem roten, speicheltriefenden Zahnfleisch. Nachdem er sich tüchtig ausgeniest hatte, entfaltete er sofort das Schnupftuch, betrachtete aufmerksam den darin aufgefangenen Schleim und strich diesen sofort auf seinen dunkelbraunen Kommiß-Schlafrock, so daß der ganze Schleim auf den Rock kam, während das Schnupftuch nur feucht blieb. So trieb er es die ganze Woche, Dieses knauserige, sorgfältige Schonen des eigenen Schnupftuches zuschaden des Kommiß-Schlafrockes erregte bei den andern Kranken gar keinen Protest, obwohl jemand von ihnen gleich nach ihm diesen selben Schlafrock bekommen mußte. Aber unser einfaches Volk ist erstaunlich wenig heikel und empfindlich. Ich fühlte mich sofort angeekelt und begann unwillkürlich mit Abscheu und Neugier den Schlafrock, den ich soeben angelegt hatte, zu betrachten. Da merkte ich, daß er mir schon längst durch seinen starken Geruch aufgefallen war; er war an meinem Leibe wärmer geworden und roch immer stärker nach Arzneien, Pflastern und, wie mir schien, nach Eiter, was auch kein Wunder war, da er seit Jahren ständig von Kranken getragen wurde. Vielleicht wurde das leinene Unterfutter am Rücken manchmal gewaschen; aber ich weiß es nicht sicher. Jedenfalls war dieses Unterfutter jetzt von allen möglichen unangenehmen Säften, Mundwassern und Absonderungen von durchschnittenen Geschwüren nach dem Spanischfliegenpflaster durchtränkt. Außerdem kamen in die Krankensäle oft Arrestanten, die eben erst die Spießrutenstrafe erhalten hatten, mit verwundeten Rücken; diese wurden mit Umschlägen behandelt, und darum konnte der Schlafrock, der direkt auf dem nassen Hemd getragen wurde, unmöglich sauber bleiben: alles blieb an ihm haften. Während der Jahre, die ich im Zuchthause blieb, zog ich daher so einen Schlafrock, sooft ich ins Hospital kam (ich kam aber oft hin), nur mit Widerwillen und Angst an. Besonders mißfielen mir die zuweilen in diesen Schlafröcken vorkommenden großen und auffallend fetten Läuse. Die Arrestanten richteten sie mit Genuß hin, und wenn unter dem dicken, ungelenken Arrestantennagel das zum Tode verurteilte Tier platzte, konnte man vom Gesicht des Jägers den Grad des dabei empfangenen Genusses ablesen. Ebensowenig mochten sie die Wanzen und machten sich zuweilen an manchem langen, langweiligen Winterabend in großer Gesellschaft auf, sie auszurotten. Obwohl im Krankensaale, abgesehen vom stickigen Geruch, äußerlich alles nach Möglichkeit sauber schien, war die innere, sozusagen unsichtbare Reinlichkeit durchaus nicht hervorragend. Die Kranken waren daran gewöhnt und glaubten sogar, daß es so sein müsse; auch die ganze Ordnung war wenig dazu angetan, den Reinlichkeitssinn zu stärken. Aber von der Ordnung werde ich später sprechen . . .