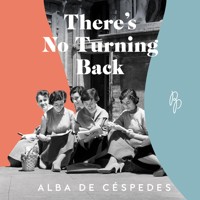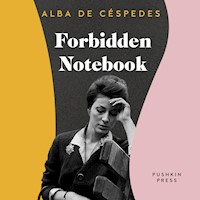13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das hochpolitische Schicksal einer Frau im von Faschismus und Patriarchat beherrschten Italien
Rom, 1939. Alessandra wächst in bescheidenen Verhältnissen auf. Ihre Mutter – ein außergewöhnliches Klaviertalent – wird vom Ehemann ständig in ihre Schranken verwiesen, und so wird Alessandra früh eingebläut, welche Rolle für Frauen vorgesehen ist. Nach dem plötzlichen Tod der Mutter wird sie vom Vater in ein Dorf in den Abruzzen geschickt, wo sie lernen soll, sich zu fügen. Doch Alessandra ist ein freier Geist, sie politisiert sich und fordert nichts weniger als die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Als sie zurück in Rom den antifaschistischen Philosophen Francesco kennenlernt, scheint sie endlich am richtigen Ort angelangt zu sein. Doch es wird ihr viel zu spät klar, was ihr für die ersehnte Freiheit abverlangt werden wird.
Dieser radikal »aus ihrer Sicht« erzählte Roman ist die Geschichte einer großen Liebe und eines Verbrechens. In einem von Faschismus und dem Patriarchat beherrschten Italien entspinnt sich das intime und hochpolitische Schicksal einer Frau, die das Unmögliche möglich macht: Resignation in Rebellion zu verwandeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 865
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
Alba de Céspedes
Aus ihrer Sicht
Roman
Aus dem Italienischen von Karin Krieger
Mit einem Nachwort von Barbara Vinken
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Titel der Originalausgabe: Alba de Céspedes, Dalla parte di leiDie Übersetzung dieses Buches ist dank einer Förderung des italienischen Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und Internationale Kooperation entstanden.Questo libro è stato tradotto grazie ad un contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano.
eBook Insel Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der 2. Auflage der deutschen Erstausgabe, 2023.
Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2023© der Originalausgaben: © 1949 Arnoldo Mondadori S. p. A., Milano© 2015 Mondadori Libri S. p. A., Milano© 2021 Mondadori Libri S. p. A., Milano
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Designbüro Lübbeke, Naumann, Thoben, Köln
Umschlagabbildung: Lex Hands, Foto: Williams & Hirakawa/AUGUST, New York
eISBN 978-3-458-77634-5
www.suhrkamp.de
Motto
From childhood’s hour I have not been
As others were; I have not seen
As others saw; I could not bring
My passions from a common spring.
From the same source I have not taken
My sorrow; I could not awaken
My heart to joy at the same tone;
And all I loved, I loved alone.
POE*
* Edgar Allan Poe, »Alone« (1829) [A.d.Ü.]
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Motto
Ich begegnete Francesco Minelli
Zwei Tage nach dem Unglück
Bei meiner Rückkehr
Vorwort zur Neuausgabe von 1994
›
Aus ihrer Sicht
‹
– Seelenmord, Tyrannenmord
Das Joch der Ehe, italienisch patriarchalisch
Sublim die Liebe, fremd
Fußnoten
Informationen zum Buch
Aus ihrer Sicht
Ich begegnete Francesco Minelli
Ich begegnete Francesco Minelli zum ersten Mal am 20.Oktober 1941 in Rom. Damals schrieb ich gerade an der Abschlussarbeit für mein Studium, und mein Vater war durch den grauen Star seit einem Jahr fast blind. Wir lebten in einem der neuen Wohnblocks am Lungotevere Flaminio, wohin wir nach dem Tod meiner Mutter gezogen waren. Ich konnte mich als Einzelkind betrachten: Zwar war vor meiner Geburt ein Bruder zur Welt gekommen, der sich als Wunderkind erwiesen hatte, aber er war im Alter von drei Jahren ertrunken. Von ihm gab es viele Fotografien in der Wohnung, auf denen ein weißes Hemdchen, das ihm von den runden Schultern gerutscht war, seine Nacktheit kaum verbarg. Er war auch bäuchlings auf einem Bärenfell abgelichtet, aber meiner Mutter gefiel besonders ein Bildchen, auf dem er vor dem Klavier stand und seine Hand nach den Tasten ausstreckte. Ihrer Meinung nach wäre er ein so großer Komponist wie Mozart geworden. Er hieß Alessandro, und als ich wenige Monate nach seinem Tod geboren wurde, nannte man mich zum Gedenken an ihn Alessandra, wohl in der Hoffnung, dass sich einige seiner unvergesslichen Vorzüge auch bei mir zeigen würden. Dieser enge Bezug zu dem kleinen toten Bruder war in meiner frühen Kindheit eine schwere Last. Ich konnte mich nie ganz davon befreien. Wenn man mit mir schimpfte, so um mich darauf hinzuweisen, dass ich trotz meines Namens die in mich gesetzten Hoffnungen enttäuscht hatte, und man vergaß auch nicht hinzuzufügen, dass Alessandro es niemals gewagt hätte, sich so aufzuführen, wie ich es tat. Sogar wenn ich in der Schule eine gute Note schrieb, wenn ich fleißig und zuverlässig war, verwehrte man mir die Hälfte der Lorbeeren, da ja Alessandro aus mir sprach. Durch diese Aufhebung meiner Person wuchs ich menschenscheu und schweigsam heran, und später musste ich einsehen, dass der Glauben, den unsere Eltern nach und nach in meine Fähigkeiten setzten, in Wahrheit nur ein Verblassen der Erinnerung an Alessandro war.
Ich schrieb der spirituellen Anwesenheit meines Bruders, zu dem meine Mutter über ein Medium namens Ottavia an einem dreibeinigen Tischchen Verbindung aufnahm, eine unheilvolle Macht zu. Ich war fest davon überzeugt, dass er sich in mir eingenistet hatte, um mich – im Gegensatz zu dem, was meine Eltern sagten – zu schlechtem Betragen, schlimmen Gedanken und ungesunden Begierden zu verleiten.
Da ich es für sinnlos hielt, sie zu bekämpfen, gab ich ihnen nach. Alessandro war für mich das, was für andere Mädchen meines Alters der Teufel oder der böse Geist war. ›Na bitte‹, dachte ich, ›er bestimmt hier, was passiert.‹ Ich glaubte, er könne von mir genauso Besitz ergreifen wie von dem Tischchen.
Meine Eltern ließen mich oft allein zu Hause, in der Obhut unseres alten Dienstmädchens Sista. Mein Vater war im Büro, und auch meine Mutter blieb täglich viele Stunden fort. Sie war Klavierlehrerin, hätte es aber, wie ich später erkannte, weit bringen können, wenn sie ihr beachtliches Talent künstlerisch hätte einsetzen können, anstatt es den Ansprüchen und dem Geschmack reicher Leute unterzuordnen, deren Kinder sie unterrichten musste. Bevor sie aus dem Haus ging, suchte sie einige Beschäftigungen für mich, damit ich mir während ihrer Abwesenheit die Zeit vertreiben konnte. Sie wusste, dass ich laute, heftige Spiele nicht mochte, also setzte sie mich in einen kleinen Korbsessel und legte Stoffreste, Muscheln, Perlen, die ich zu einem Armband oder einer Kette auffädeln konnte, und ein paar Bücher auf einen kleinen Tisch neben mich. Schon früh hatte ich unter ihrer liebevollen Anleitung recht gut Lesen und Schreiben gelernt, doch zu meinem Ärger hatte man auch diese Frühreife Alessandros Einfluss zugeschrieben. Tatsächlich dachte und sprach ich so, als wäre ich doppelt so alt, wie ich war. Meine Mutter wunderte das nicht weiter, weil sie mir im Stillen Alessandros Alter gab. Deshalb versorgte sie mich mit Büchern, die für ältere Mädchen bestimmt waren. Heute weiß ich, dass es sehr gute Bücher waren, was von ihrer soliden Bildung zeugte.
Sie verließ also das Haus, nachdem sie mich wie vor einer langen Trennung ungestüm geküsst hatte, und ich blieb allein. Aus der Küche kam Tellergeklapper, dann strich Sistas dürrer Schatten im Flur vorbei. Immer wenn es dämmerte, zog sie sich ins Dunkel ihrer Kammer zurück, und ich hörte sie den Rosenkranz beten. In der Gewissheit, nun nicht mehr gestört zu werden, legte ich Bücher, Muscheln und Perlenarmbänder beiseite und begann die Wohnung zu erforschen.
Ich durfte kein Licht machen, da wir in größter Sparsamkeit lebten. Mit vorgestreckten Armen tappte ich wie eine Schlafwandlerin durch das Halbdunkel. Die alten, wuchtigen Möbel schienen um diese Zeit aus ihrer friedlichen Reglosigkeit zu erwachen und zu geheimnisvollen Gestalten zu werden. Mit fiebriger Neugier öffnete ich Türen, stöberte in Schubladen und kauerte mich, wenn das Licht sich ganz aus den düsteren Zimmern zurückgezogen hatte, schließlich in einen Winkel, von einer schrecklichen Angst erfüllt, die ich zugleich auch genoss.
Im Sommer setzte ich mich auf den Balkon, der auf einen Gemeinschaftshof ging, oder ich stellte mich auf eine Fußbank am Fenster. Ich schaute nie auf die Straße, sondern von meinem Lieblingsplatz aus auf einen kleinen, mit Glyzinien bepflanzten Innenhof, der unser Haus von einem Nonnenkloster trennte. Oft stießen Schwalben in den Schatten des Hofs hinunter, und bei ihrem ersten Ruf sprang ich auf, als gälte er mir, und lief ans Fenster. Gedankenverloren sah ich von dort aus den Schwalben zu, den unsteten Wolkenbildern und dem Leben der verborgenen Frauen-Gemeinschaft, das sich in den erleuchteten Fenstern erahnen ließ. Wie Schattenspiele huschten die Nonnen hinter den weißen Sichtblenden vorbei, die die Klosterfenster abschirmten. Die schrillen Schreie der Schwalben trieben meine Phantasie wie Peitschenhiebe an. In meiner dunklen Fensternische sog ich begierig alles ringsumher auf. Diesen unbeschreiblichen Gemütszustand nannte ich »Alessandro«.
Später suchte ich Zuflucht bei Sista, die im Schein der rotglühenden Kohlen am Küchenherd saß. Meine Mutter kam nach Hause und machte Licht. Das alte Dienstmädchen und ich tauchten aus dem Schatten auf, benommen von der Dunkelheit und dem Schweigen. Die stummen Gespräche mit den Schwalben hatten mich so sehr ermüdet, dass mir die Augen zufielen. Meine Mutter nahm mich in die Arme, um ihre Abwesenheit wiedergutzumachen, und erzählte mir von Donna Chiara und Donna Dorotea, den jungen Töchtern einer Fürstin, denen sie seit Jahren ohne jeden Erfolg Musikstunden gab.
Mein Vater kam, wie bei den Männern aus Süditalien üblich, ziemlich spät nach Hause. Man hörte, wie sich der Schlüssel im Schloss drehte – ein langer, dünner Schlüssel, der immer aus seiner Westentasche lugte –, und dann das Klicken des Lichtschalters. Wir waren in der Küche, meine Mutter half Sista bei der Zubereitung des Abendessens, aber sobald sie das klappernde Schloss hörte, lief sie, noch bevor mein Vater die Wohnung betrat, schnell ihr Haar ordnend ins Esszimmer und setzte sich mit mir auf das harte Sofa. Sie griff nach einem Buch und tat so, als wäre sie in die Lektüre vertieft. Dann fragte sie mit sonorer Stimme, die freudige Überraschung bekunden sollte: »Bist du das, Ariberto?« Als ich klein war, spielte meine Mutter allabendlich diese Komödie, die mir lange Zeit unbegreiflich war. Ich verstand nicht, warum sie fieberhaft ein Buch aufschlug, wenn sie dann gar nicht darin las. Trotzdem war ich jeden Abend fasziniert von diesem Ruf, der klangvoll durch die Wohnung hallte und dem hässlichen Namen meines Vaters eine romantische Note gab.
Mein Vater war ein hochgewachsener, stämmiger Mann mit Bürstenhaarschnitt. Als mir im Erwachsenenalter ein paar Fotos aus seiner Jugendzeit in die Hände fielen, wurde mir klar, warum er wohl so erfolgreich bei den Frauen gewesen war. Er hatte tiefgründige, schwarze Augen, sinnliche Lippen und war oft schwarz gekleidet, vielleicht, weil er in einem Ministerium angestellt war. Er sprach wenig. Meistens begnügte er sich mit einem missbilligenden Kopfschütteln, während meine Mutter lebhaft redete. Sie erzählte Dinge, die sie auf der Straße gesehen oder gehört hatte, würzte ihre Geschichten mit geistreichen Bemerkungen und schmückte sie phantasievoll aus. Mein Vater schaute sie an und schüttelte den Kopf.
Sie stritten sich häufig, aber ohne großes Theater oder lautstarke Wortgefechte. Sie redeten eher leise, wobei sie sich wohlgezielt bissige Sätze an den Kopf warfen. Ich sah ihnen bestürzt zu, obwohl ich ihre mit Andeutungen gespickten Reden gar nicht verstand. Wäre nicht die Wut in ihren Blicken gewesen, hätte ich nicht einmal bemerkt, dass sie sich stritten.
In solchen Momenten holte mich Sista, die stets an der Tür lauschte, heraus, brachte mich in die Küche und nötigte mich, mit ihr den Rosenkranz und die Litaneien zu beten. Manchmal erzählte sie mir zur Ablenkung die Geschichte der Madonna von Lourdes, die dem Hirtenmädchen Bernadette erscheint, oder der Madonna von Loreto, deren Haus von den Engeln durch die Lüfte getragen wird.
Meine Eltern hatten sich inzwischen ins Schlafzimmer zurückgezogen. Um das alte Dienstmädchen und mich ballte sich die Stille. Ich fürchtete, im Türrahmen könne einer der Geister erscheinen, die das Medium Ottavia freitags heraufbeschwor und die ich mir in meiner kindlichen Phantasie als schneeweiße, klappernde Gerippe vorstellte. »Sista, ich habe Angst«, sagte ich, und Sista antwortete: »Wovor denn?« Doch ihre Stimme klang unsicher, und sie schaute oft zum Schlafzimmer hin, so als fürchtete auch sie sich.
Meine Eltern redeten leise, weshalb ich meist kein einziges Wort aufschnappen konnte. Aber dass die Zeichen auf Sturm standen, verriet die zwiespältige Stille, die sich im dunklen Flur und in den vier Zimmern der Wohnung ausbreitete. Sie drang unter der geschlossenen Tür hervor und zog in jeden Winkel, tückisch wie ausströmendes Gas. Sista ließ ihr Strickzeug in den Schoß sinken, ihre Hände zitterten. Am Ende brachte sie mich voller Ungeduld und Sorge in mein Zimmer, wie um mich zu retten, zog mich hastig aus und steckte mich ins Bett. Ich fügte mich stumm und ließ, von der Stille aus dem elterlichen Schlafzimmer besiegt, stumm zu, dass sie das Licht löschte.
Oft schlich meine Mutter nach so einem qualvollen Abend nachts auf Zehenspitzen herein, beugte sich über mein Bett und drückte mich krampfhaft an sich. Sie machte kein Licht. In der Dunkelheit erahnte ich ihr weißes Nachthemd. Ich klammerte mich an ihren Hals, küsste sie. Nur einen Moment, dann glitt sie davon, und ich schloss erschöpft die Augen.
Meine Mutter hieß Eleonora. Von ihr habe ich mein helles Haar geerbt. Sie war so blond, dass ihr Haar im Gegenlicht vor dem Fenster schneeweiß wirkte und ich sie manchmal so verblüfft anschaute, als hätte ich eine Vision ihres künftigen Alters vor mir. Ihre Augen waren blau, ihre Haut zart. Diese Eigenschaften hatte sie von ihrer österreichischen Mutter, einer bekannten Schauspielerin, die die Bühnenlaufbahn aufgegeben hatte, um meinen Großvater, einen italienischen Artillerieoffizier, zu heiraten. Und so hatte meine Mutter ihren Namen in Anlehnung an Ibsens Puppenhaus erhalten, ein Stück, in dem meine Großmutter an vielen glorreichen Abenden aufgetreten war. Zwei-, dreimal im Jahr, an einem der seltenen freien Nachmittage, die meine Mutter sich gönnte, durfte ich mich zu ihr setzen, wenn sie die große Fotoschachtel öffnete, um mir Bilder von meiner Großmutter zu zeigen. In ihren Bühnenkostümen sah sie immer sehr elegant aus, mit auffälligen Federhüten oder mit Perlenschnüren im offenen Haar. Ich konnte kaum glauben, dass dies wirklich meine Großmutter war, also eine Verwandte, die uns zu Hause hätte besuchen und durch das Vestibül hätte spazieren können, wo ständig das Hämmern des Schusters erklang, der gleichzeitig der Portier war. Ich kannte die Namen der Stücke und der Heldinnen, die sie gespielt hatte, auswendig. Meine Mutter wollte mich an das Theater heranführen. Deshalb erzählte sie mir die Handlung der Tragödien, las mir die wichtigsten Szenen vor und freute sich, dass mir die Namen der handelnden Personen bald genauso vertraut waren wie die unserer Verwandten. Es waren herrliche Stunden. Sista saß in einer Ecke, die Hände unter der Schürze, und verfolgte diese Erzählungen, wie um die Wahrhaftigkeit dieser wunderbaren Geschichten mit ihrer Anwesenheit zu bekräftigen.
In der Schachtel lagen auch Fotos der Verwandten meines Vaters, einer Familie kleiner Landbesitzer aus den Abruzzen, kaum mehr als Bauern. Vollbusige Frauen, in ein schwarzes Mieder gezwängt, das gescheitelte Haar in zwei schweren Schlaufen zu beiden Seiten des groben Gesichts. Es gab auch eine Fotografie meines Großvaters väterlicherseits, dunkles Jackett, Krawattenschleife. »Das sind rechtschaffene Leute«, sagte meine Mutter, »Leute vom Lande.« Von ihnen erhielten wir häufig Säcke mit Mehl und Körbe mit köstlichen gefüllten Feigen. Aber keine meiner Tanten hieß Ophelia, Desdemona oder Julia, und ich war nicht naschhaft genug, um den Liebestragödien Shakespeares eine Mandeltorte vorzuziehen. Die Verwandtschaft aus den Abruzzen wurde also in stillschweigender Übereinkunft mit meiner Mutter eher abschätzig betrachtet. Wir öffneten die mit umsäumtem Sackleinen bedeckten Körbe gleichgültig und trotz unserer Armut sogar fast nachsichtig. Nur Sista wusste ihren Inhalt zu schätzen und hütete ihn sorgsam.
Sista war meiner Mutter ängstlich und bedingungslos ergeben. Bisher an den Dienst in ärmlichen Haushalten und bei Frauen gewöhnt, die sich ungehobelt und vulgär ausdrückten und deren Interessen sich auf Speisekammer und Küche beschränkten, war sie von ihrer neuen Herrin sofort begeistert gewesen. Wenn mein Vater nicht da war, folgte sie ihr im Haus überallhin und holte die verlorene Zeit später mit nächtlicher Arbeit auf. Spielte meine Mutter Klavier, ließ Sista alles stehen und liegen, steckte ihre Schürze an einer Seite hoch und lief in den Salon. Sie lauschte den Tonleitern, Etüden und Fingerübungen genauso aufmerksam wie den Sonaten.
Sie saß gern still im Dunkeln. In meiner Kindheit funkelten in der Finsternis stets ihre sardischen Augen. Sie sprach wenig, ich glaube, ich habe sie fast nie in zusammenhängenden Sätzen reden hören. Vielleicht war es der unwiderstehliche Charme meiner Mutter, der sie an uns band, denn die offenbarte ihr eine Welt, die sie nicht einmal in ihrer Jugend kennengelernt hatte. Und so blieb sie trotz ihrer Frömmelei in unseren Diensten, auch wenn meine Mutter nie zur Messe ging und mich nicht streng katholisch erzog. Ich glaube, Sista hielt sich für sündig, weil sie bei uns lebte, und vielleicht beichtete sie ihren Verbleib in unserer Familie, gelobte, ihn zu beenden, und fand sich stattdessen immer stärker in diese Gewohnheitssünde verstrickt. Wenn meine Mutter nicht da war, empfand Sista die Wohnung wohl als leblos. Die einsamen Nachmittagsstunden zogen sich quälend in die Länge, und verspätete sich die Hausherrin auch nur ein bisschen, zerstreut, wie sie war, fürchtete Sista sofort, sie sei von einer Straßenbahn oder einem Auto überfahren worden. Dann stellte sie sich deren reglosen Körper auf dem Straßenpflaster vor, das Gesicht blass, das Haar lackrot vom Blut. Ich wusste, dass Sista ein Hundewinseln in der Kehle steckte, während sie stumm und starr dasaß, die Hände auf den Perlen des Rosenkranzes oder über dem Kohlenbecken. Aber ein unbestimmtes Schamgefühl hielt sie davon ab, direkt am Fenster auf meine Mutter zu warten. Auch ich wurde in solchen Momenten von einer irrationalen, schrecklichen Angst gepackt und schmiegte mich an Sista. Vielleicht stellte sie sich vor, dass sie wieder bei dicken Herrinnen – hervorragenden Hausfrauen – würde dienen müssen, während man mich in die Abruzzen zu meiner Großmutter schicken würde. Das Licht nahm allmählich ab, dann schlug die Dunkelheit wie eine Welle über uns zusammen, es war trostlos. Schließlich kam meine Mutter nach Hause und rief an der Wohnungstür fröhlich: »Da bin ich!«, als beantwortete sie einen verzweifelten Ruf von uns.
Sista diente auch meinen Vater treu. Sie bediente und respektierte ihn: Er war ein Mann und der Herr im Haus. Es fiel ihr leicht, sich an ihn zu wenden, wenn sie eine Frage hatte, da sie ihn, demütig und unterlegen, in seiner Rolle anerkannte. Seine schäbigen Liebesaffären, über die sie, wie ich später erfuhr, durch zahllose Indizien im Bilde war, störten sie nicht, weil sie in ihrem Dorf und später in der Stadt viele verheiratete Männer gesehen hatte, die sich so verhielten wie er.
Ich verstand anfangs nicht, warum meine Eltern geheiratet hatten, und habe auch nie erfahren, wie sie sich kennenlernten. Mein Vater war ein typischer Ehemann aus dem Mittelstand, ein durchschnittlicher Familienvater und Angestellter, der in seiner Freizeit Lichtschalter repariert oder an ausgeklügelten Geräten bastelt, um Gas zu sparen. Seine Äußerungen waren immer gleich, einsilbig und abfällig. Für gewöhnlich kritisierte er mit dürftigen Argumenten Regierung und Bürokratie, oder er beklagte sich mit abgedroschenen Redewendungen über belanglose Scherereien im Büro. Auch sein Aussehen verriet wenig Geist. Er war groß und korpulent, die breiten Schultern verrieten körperliche Überlegenheit. Seine schwarzen Augen hatten den weichen Schimmer von Septemberfeigen. Nur seine Hände – an der Rechten trug er einen goldenen Ring in Form einer Schlange – waren ungewöhnlich schön, von der edlen Form und Farbe eines uralten Geschlechts. Seine glatte, zarte Haut schien zu glühen. Diese verborgene Hitze ließ mich ahnen, weshalb meine Mutter sich zu ihm hingezogen gefühlt hatte. Das Schlafzimmer meiner Eltern lag neben meinem, und manchmal kniete ich abends auf dem Bett und presste mein Ohr an die Wand. Ich war geradezu krank vor Eifersucht, und das Gefühl, das mich zu diesem nichtswürdigen Verhalten trieb, hieß für mich »Alessandro«.
Einmal – ich war noch keine zehn Jahre alt – kam ich ins Esszimmer und überraschte die beiden in einer Umarmung. Sie standen mit dem Rücken zu mir am Fenster. Eine Hand meines Vaters lag auf der Hüfte meiner Mutter und tätschelte sie genüsslich. Sie trug ein leichtes Kleid und spürte sicherlich die trockene Hitze seiner Haut, die ihr aber nicht unangenehm war, das war offensichtlich. Plötzlich küsste er sie auf den Halsansatz. Seine Lippen glühten gewiss genauso wie seine Hände. Meine Mutter hatte einen weißen, zarten Hals, auf dem leicht ein roter Fleck zurückbleiben konnte, wie ein Brandmal, und ich rechnete damit, dass sie mit ihrer typischen Impulsivität protestieren würde, doch sie schmiegte sich an ihn, träge, entspannt, hingegeben. Ich wollte weglaufen und stieß gegen einen Stuhl. Bei dem Geräusch drehten meine Eltern sich um und sahen mich erstaunt an. Mein Gesicht war wutverzerrt. »Sandi, was hast du denn?«, fragte mich meine Mutter. Doch sie kam nicht zu mir, umarmte mich nicht, und wir liefen auch nicht zusammen weg. Im Gegenteil, sie kicherte. »Bist du etwa eifersüchtig?«, fragte sie. Ich antwortete nicht. Ich starrte sie an und litt entsetzlich.
Ich ging in mein Zimmer zurück und vergrub mich in einen dumpfen Groll. Mein lächelnder Vater stand mir noch vor Augen, in verschmitzter Komplizenschaft mit meiner Mutter. Zum ersten Mal empfand ich ihn als hinterhältigen Eindringling in unsere friedliche Frauenwelt. Bis dahin hatte ich ihn für ein andersartiges Wesen in unserer Obhut gehalten, um dessen leibliches Wohl wir uns zu kümmern hatten. Tatsächlich schien ihn auch nur das zu interessieren. Oft aßen wir die Reste der letzten Mahlzeit, während für ihn ein Steak gebraten wurde, und seine Kleidung wurde häufig gebügelt, während unsere nur zum Lüften auf den Balkon gehängt wurde, damit sich die stärksten Falten glätteten. Aus alldem hatte ich geschlossen, dass er in einer anderen Welt als der unseren lebte und dort gerade die Dinge wichtig waren, die ich durch das Vorbild meiner Mutter zu verachten gelernt hatte.
Damals begann ich an Selbsttötung zu denken, weil ich glaubte, meine Mutter habe unseren geheimen Bund verraten. Von nun an reizte mich dieser Gedanke immer, wenn ich fürchtete, eine schwierige Situation nicht zu meistern, oder auch einfach in einer Nacht voller Ungewissheit und Angst.
Meine nur spärliche religiöse Erziehung hat mich stets davon abgehalten, Unglück ergeben hinzunehmen und es als nur vorübergehend zu betrachten. Stattdessen half mir in schweren Tagen der Gedanke an Selbsttötung, die mir als letzter Ausweg immer gegenwärtig war. Dadurch wirkte ich auch im größten Kummer fröhlich und unbeschwert. Als Kind spielte ich mit dem Gedanken, mich in meinem Zimmer am Fenstergitter zu erhängen. Manchmal dachte ich aber auch, ich müsste nur in die Nacht hinaus gehen und immer weiter wandern, bis ich, am Ende meiner Kräfte, leblos zusammenbrechen würde. Doch dieses Vorhaben war für mich undurchführbar, weil mein Vater die Wohnungstür jeden Abend vor dem Zubettgehen dreifach abschloss.
Der Schlaf dämpfte meine Verzweiflung und meine Pläne. Damals bat ich Sista häufig, mit mir in die Kirche zu gehen. Mit solchen plötzlichen Impulsen ähnelte ich meiner Mutter. Auch sie besuchte manchmal an drei oder vier Tagen hintereinander bei Sonnenuntergang die Kirche, kniete nieder und sang, ganz hingerissen von der Musik. Aber ich bat Gott um die Gnade, mich sterben zu lassen. Für mich war das kein Sakrileg. In dem großen Mietshaus, in dem wir wohnten, wurde Gott für die unsäglichsten Dinge bemüht. Einmal gab es, Jahre später, das Gerücht, der Liebhaber der Frau aus dem zweiten Stock liege mit einer Lungenentzündung im Sterben. Man erzählte sich, die Frau habe in der nahe gelegenen Kirche ein Not-Triduum »Seiner Absicht gemäß« bestellt. Diese Absicht war allen längst bekannt: Der Liebhaber sollte am Leben bleiben und wieder zu Kräften kommen, damit sie ihren Mann weiterhin mit ihm betrügen konnte. Zu diesem Triduum erschienen sämtliche Nachbarinnen aus unserem Haus. In der ersten Bank kniete, das Gesicht in den Händen verborgen, die Frau aus dem zweiten Stock. Die anderen scharten sich nicht um sie, weil sie deren Schamgefühl, Ehrbarkeit und Geheimnis respektieren wollten. Sie nahmen am Hochamt teil, als wären sie zufällig vorbeigekommen, hier eine am Weihwasserbecken, dort eine an einem Seitenaltar. Aber alle wandten sie sich mit der gleichen Inbrunst an Gott, geradezu empört, weil er die arme Frau noch immer leiden ließ.
Gegen Abend verließ ich also an Sistas Hand ernst und bußfertig das Haus, als hätte ich keinen verabscheuungswürdigen Wunsch im Sinn, sondern ein heiliges Gelübde. Wir gingen durch die grauen Straßen unseres Viertels zur Kirche, die schlank und weiß zwischen den Wohnblocks am Tiberufer aufragte. Bis dorthin durften wir unsere Spaziergänge ausdehnen, so als markierte der Fluss die äußerste Grenze unseres Reviers und zugleich unserer Freiheit.
In der schönen Jahreszeit waren die Platanen am Tiber voller Spatzen. Wenn sie sich bei Sonnenuntergang den besten Ast zum Schlafen suchten, summten die alten Bäume wie Bienenstöcke und wurden von Geflatter durchgeschüttelt. Gern hätte ich den Anblick der Bäume noch länger genossen, aber stattdessen verschwand ich in der düsteren Höhlung der Kirche. Drinnen hingen der ranzige Geruch menschlicher Körper und öliger Weihrauchduft in der Luft, während das Dunkel aufzog, zu dem Sista und ich während der Abwesenheit meiner Mutter verdammt waren. Ich kannte mit Müh und Not die ersten Gebete unserer Religion, aber das rötliche Dämmerlicht, die Gesänge und der dumpfe Geruch entfachten meinen Glauben sofort und ließen ihn hell auflodern.
Ich schaute auf meine Hände im flackernden Kerzenlicht, musterte sie in der Hoffnung, an ihnen das Blut der Stigmata zu entdecken. Ich spürte, dass mein Gesicht spitzer wurde, so wie das einer Statue der heiligen Teresa, die meine Mutter sehr mochte. Langsam wurde ich schwerelos, erhob mich in die reine Luft des Himmels, und zwischen meinen Fingern funkelten die Sterne. Zusammen mit der Orgelmusik durchströmte mich ein süßer, wilder Fluss von Worten, dieselben, die meine Großmutter auf der Bühne rezitiert hatte, die schönsten Worte, die ich kannte, und mit ihnen wandte ich mich an Gott. Er antwortete mir in derselben Sprache, und so erkannte ich ihn fortan in Worten der Liebe eher als auf den Bildern der Altäre.
Alle Leute in der Kirche wirkten tiefernst und traurig. Weder das Beten noch das Singen stimmte sie froh. Ich liebte sie, wollte, dass sie glücklich waren, und wusste, dass man sie nur lehren müsste, mit den Worten der Liebe zu beten. Ich hätte sie retten können, aber ich traute mich nicht. Der Gedanke an Sista hielt mich zurück, die nur Alessandra in mir sah, ein kleines Mädchen. Alle hielten mich nur für ein kleines Mädchen. Doch nach der Messe, als die letzten Orgelklänge uns ans Tiberufer wehten, erkannten mich die Schwalben und begrüßten mich so freudig, wie sie Gott grüßten.
Wir wohnten in der Via Paolo Emilio in einem großen, Ende des 19.Jahrhunderts erbauten Mietshaus. Das Vestibül war eng und dunkel. Dort sammelte sich viel Staub an, weil der Portier sich, wie gesagt, als Schuster abmühte und seine Frau faul war.
Nur durch das hohe Oberlicht fiel etwas Licht auf die graue, spiralförmige Treppe. Trotz des verschwiegenen und fast schon anrüchigen Erscheinungsbildes von Eingang und Treppenflur wohnten in dem großen Haus Leute aus der unteren Mittelschicht. Die Männer sah man tagsüber nur selten. Sie waren fast alle Angestellte, von ständigen Entbehrungen niedergedrückt, gingen frühmorgens aus dem Haus und kamen zu festen Zeiten mit einer Zeitung in der Jackentasche oder unter dem Arm wieder heim.
Daher schien das Haus nur von Frauen bewohnt zu sein. Im Grunde besaßen sie die unangefochtene Herrschaft über die dunkle Treppe, auf der sie täglich unzählige Male unterwegs waren, mit einer leeren Einkaufstasche oder mit einer vollen, mit einer in Zeitungspapier gewickelten Milchflasche, mit den Kindern, wenn sie sie, mit Brottasche und Proviantdose versehen, zur Schule brachten oder wenn sie sie abholten, in dem blauen Schulkittel, der unter dem zu kurzen Mäntelchen hervorschaute. Sie gingen die Treppe hoch ohne einen Blick für ihre Umgebung, denn sie kannten die Schmierereien an den Wänden auswendig, und das Holzgeländer war vom vielen Anfassen wie poliert. Nur die Mädchen hüpften leichtfüßig hinunter, wenn es sie ins Freie zog. Ihre Schritte klangen auf den Stufen hell wie Hagelkörner an einer Fensterscheibe. An die Jungen im Haus erinnere ich mich kaum. Zuerst waren sie kleine Rüpel, die sich den ganzen Tag auf der Straße herumtrieben und im Gemeindegarten Fußball spielten, dann wurden sie schon in frühester Jugend vom Geschäft ihres Vaters aufgesogen. Und von ihrem Vater übernahmen sie in kürzester Zeit Aussehen, Tagesablauf und Gewohnheiten.
Doch das von außen verwahrlost und trist wirkende Haus war durch seinen großen Innenhof voller Leben. Vor den Hoffenstern verrieten schmale Balkone mit rostigen Geländern durch ihre Ausstattung viel über die Verhältnisse und das Alter der Mieter. Manche stapelten dort alte Möbel, andere bewahrten dort Hühnerkäfige oder Spielzeug auf. Unser Balkon war voller Pflanzen.
Auf der Hofseite bewegten sich die Frauen unbefangen, mit einer Ungeniertheit, wie sie auch Internatsbewohner oder Gefängnisinsassen verbindet. Aber diese rührte weniger daher, dass sie alle unter einem Dach lebten, als vielmehr daher, dass sie voneinander wussten, welches mühselige Leben sie führten. Angesichts gemeinsamer Schwierigkeiten, Entsagungen und Gewohnheiten verband sie, ohne dass sie sich dessen bewusst waren, eine freundliche Nachsicht. Weit weg von den Blicken der Männer und ohne die Notwendigkeit, eine lästige Komödie aufzuführen, zeigten sie sich so, wie sie wirklich waren. Wie die Glocke in einem Nonnenkloster war das erste Klappern der Fensterläden das Startsignal für den Tag. Jede von ihnen sah mit Anbruch eines neuen Morgens resigniert der Last neuer Strapazen entgegen. Sie trösteten sich mit dem Gedanken, dass ihre täglichen Handgriffe auf ähnliche Weise auch ein Stockwerk tiefer von einer anderen Frau in einem anderen verblichenen Morgenmantel vollführt wurden. Keine hätte die Hände in den Schoß gelegt, aus Angst, den Lauf eines präzisen Räderwerks zu stoppen. Sie ahnten in allem, was ihr Hausfrauendasein ausmachte, unbewusst sogar so etwas wie eine schlichte Poesie. Eine Leine, die von einem Balkon zum anderen gespannt wurde, um die Wäsche besser trocknen zu können, war wie eine freundlich ausgestreckte Hand. Kleine Körbe hüpften von Stockwerk zu Stockwerk und halfen mit einem geliehenen Küchengerät oder einer fehlenden Zutat aus. Trotzdem sprachen die Frauen vormittags nicht viel miteinander. Manchmal lehnte sich eine in einer Verschnaufpause über das Geländer und sagte mit Blick zum Himmel: »Schönes Wetter heute.« Nachmittags war der Hof leer und still. Hinter den Fenstern ahnte man aufgeräumte Zimmer und Küchen. Eine alte Frau saß auf dem Balkon und nähte, Dienstmädchen enthülsten Erbsen oder schälten Kartoffeln, die sie in einen Topf neben sich auf dem Boden warfen. Dann, gegen Abend, gingen auch sie für weitere Arbeiten ins Haus, und das war die Zeit, in der ich den Hof für mich allein hatte, so als wäre er mein angestammter Besitz.
Im Sommer saßen nach dem Abendessen auch die Männer oft auf dem Balkon, in Hemdsärmeln oder sogar im Schlafanzug. In der Dunkelheit zuckte die Glut ihrer Zigaretten auf wie rote Glühwürmchen. Doch die Frauen wünschten sich kaum einen guten Abend, und ihre Stimmen hatten nun einen anderen Klang. Manchmal wechselten sie ein paar Worte über Kinderkrankheiten. Gelangweilt gingen alle bald wieder in ihre Wohnung und schlossen die Fensterläden, und zwischen den Balkonen tat sich eine große, schwarze Leere auf.
Meine Mutter zeigte sich nur selten auf der Hofseite und nur, um die Blumen zu gießen. Ihre Zurückhaltung ärgerte die Nachbarinnen zwar, nötigte ihnen aber auch Bewunderung ab. So genoss unsere Familie trotz unserer großen Armut wegen der einnehmenden Schönheit und des eleganten Auftretens meiner Mutter, die stets unbeschwert und heiter gestimmt war, ein besonderes Ansehen.
Dabei mangelte es in unserem Haus nicht an charmanten, unbefangenen Frauen. Manche waren sogar gebildet, sie hatten vor ihrer Heirat als Lehrerin oder Büroangestellte gearbeitet. Aber meine Mutter wechselte nicht mehr als einen flüchtigen Gruß, eine kurze Bemerkung über das Wetter oder über den Einkauf mit ihnen. Die einzige Ausnahme war Lydia, eine Frau aus dem Stockwerk über uns.
Meine Mutter nahm mich häufig mit hinauf zu dieser Frau, damit ich mit deren Tochter Fulvia spielen konnte. Wir Mädchen blieben allein in dem mit Spielzeug vollgestopften Kinderzimmer oder auf einem kleinen Balkon, der auch als Abstellkammer diente. Die beiden Frauen machten es sich auf dem Bett bequem und unterhielten sich leise und so angeregt, dass sie, wenn wir sie unterbrachen, um für unser Spiel um ein Halstuch, ein Blatt Papier oder einen Stift zu bitten, uns sofort jeden erdenklichen Wunsch erfüllten, damit wir sie ja in Ruhe ließen. Anfangs verstand ich nicht, warum meine Mutter mit einer Frau befreundet war, mit der sie überhaupt nichts gemein hatte. Doch schon bald erlag ich meinerseits dem Einfluss der Tochter, die meine beste Freundin wurde. Sie wirkte älter als ich, war aber einige Monate jünger. Sie war hübsch, hatte braunes Haar und markante, lebhafte Gesichtszüge. Mit ihren zwölf, dreizehn Jahren war sie körperlich schon so weit entwickelt, dass die Männer ihr nachschauten, wenn wir in Sistas Begleitung ausgingen. Sie ähnelte ihrer Mutter, einer attraktiven, rundlichen, munteren Frau mit einer Vorliebe für glänzende Seidenkleider, deren Dekolleté die Mulde am Ansatz ihres üppigen Busens unverhüllt ließ.
Mutter und Tochter waren fast immer allein, denn Signor Celanti war Handlungsreisender. Wenn er nach Hause kam, war es, als beherbergten sie einen Fremden, und sie machten kein Hehl daraus, dass er mit seiner Anwesenheit ihren gewohnten Lebensrhythmus störte. Sie aßen in aller Eile, gingen früh zu Bett, antworteten kurz angebunden am Telefon, und während Lydia immerfort Migräne vorschützte, beharrte Fulvia auf lästigen, nervtötenden Kinderspielen. Ihre Wohnung, in der sonst häufig Nachbarinnen ein und aus gingen, verwaiste, sobald Lydia verkündete: »Domenico ist wieder da.« Am Ende war die Wohnung, vielleicht ohne dass die beiden es direkt wollten, so ungemütlich, unordentlich und trist, dass Signor Celanti mit seinem Köfferchen schnell wieder aufbrach, nicht ohne die Vorzüge eines Lebens im Hotel und die Küche in den Städten des Nordens gepriesen zu haben.
Nach seiner Abreise kehrten Lydia und Fulvia sofort zu ihrer gewohnten Lebensweise zurück. Die Mutter nahm ihre endlosen Telefongespräche wieder auf, und wenn sie nachmittags ausging, wehte ein starker Nelkenduft wie ein Seidenschal die ganze Treppe hinunter.
Sie ging zum Hauptmann. Über diesen Hauptmann tuschelte sie immerfort mit meiner Mutter. Fulvia und ich wussten das nur zu gut. Sie nannte ihn ausschließlich bei seinem Dienstgrad: »der Hauptmann sagt … der Hauptmann möchte …«, als würde sie seinen vollen Namen nicht kennen. Aber das kam mir damals nicht merkwürdig vor. Andere Frauen im Haus hatten einen »Ingenieur« oder einen »Anwalt«, und auch über die war nichts Genaueres bekannt.
Lydia erzählte von Rendezvous, von langen Spaziergängen, von Briefen, die sie mit Hilfe eines eingeweihten Dienstmädchens empfing. Meine Mutter hörte ihr zu und bangte mit ihr. Als ich etwas älter war, fiel mir auf, dass die Besuche bei ihrer Freundin für gewöhnlich auf die Abende folgten, an denen sie sich mit meinem Vater im Schlafzimmer einschloss und sich Stille in der Wohnung ausbreitete.
Die beiden Frauen hatten sich kennengelernt, weil meine Mutter Fulvia Klavierstunden geben sollte. Lydia hatte bei uns geklopft und wollte – wie in diesen Häusern üblich, wo man als unangemeldeter Gast stets befürchten muss, auf unaufgeräumte Zimmer und nachlässig gekleidete Menschen zu treffen – keinesfalls hereinkommen, sondern ihr Anliegen an der Tür vortragen. Ihr Besuch hatte uns erstaunt. Noch nie war jemand zu uns gekommen, nicht einmal wegen der allgemein üblichen Angewohnheit, sich Salz oder ein paar Basilikumblätter zu borgen. Meine Mutter bat sie in den Salon, einen düsteren Raum, der nie gelüftet wurde. Später gestand Lydia, dass sie nur gekommen war, um meine Mutter einmal aus der Nähe zu sehen, weil über sie, die zurückhaltende Schönheit, viele Gerüchte kursierten. Ihr Vorhaben war sofort von Erfolg gekrönt. Lydia war das blühende Leben, duftete nach Puder und wirkte so gesund wie eine frisch gegossene Pflanze. Meine Mutter war blass und hatte eine eher flache Brust. Sie fühlte sich von Lydias üppigem Busen angezogen, der ein animalisches Eigenleben unabhängig von seiner Besitzerin zu führen schien. Nach wenigen Klavierstunden, die Fulvia nur nahm, um die gängigen Schlager klimpern zu können, freundeten die zwei Frauen sich an. Meine Mutter ging wie zu den anderen Schülerinnen weiterhin zu einer festgesetzten Zeit hinauf. Aber kaum war sie in der Wohnung, rief Lydia sie in ihr Zimmer: »Komm hierher, Eleonora!«, plauderte sofort los, spulte ihre Geschichten ab und bot ihr Zigaretten an. So verbrachten sie viele Stunden zusammen.
Wie alle meine Gefühle war auch meine Eifersucht auf Lydia heftig. Von Sista angestachelt, nahm ich mir eines Abends sogar heraus, meine Mutter nach Hause zu zitieren. Es war das erste Mal, dass ich die Treppe über unser Stockwerk hinaus nach oben stieg. Ich fühlte mich wie in einer neuen Welt, zauderte. Sista stachelte mich von unten an: »Na, mach schon!«, und ich klingelte. »Sagen Sie meiner Mutter, dass es schon sehr spät ist«, sagte ich streng und mit finsterer Miene. Lydia lächelte. »Komm doch rein«, lud sie mich ein, und da ich zögerte, wiederholte sie: »Komm rein, das kannst du ihr selbst sagen.«
Ich war noch nicht oft in fremden Wohnungen gewesen, daher war ich neugierig, wie die zwei lebten, wie ihre Zimmer, ihre Betten aussahen und was sie sich auf die Kommode stellten. Lydia schloss die Tür, und ich stand begeistert vor ein paar Bildern mit mythologischen Motiven, Nymphen, die auf einer Wiese tanzten. »Ich möchte dir Fulvia vorstellen, ihr könntet euch anfreunden.« Es war Sommer. Fulvia stand in einem langen, durchsichtigen Kleid ihrer Mutter halbnackt in ihrem Zimmer. Sie trug das Haar hochgesteckt und hatte sich die Lippen geschminkt. »Ich bin Gloria Swanson«, sagte sie, und weil ich nicht verstand, weihte sie mich in ihr Spiel ein: »Komm«, sagte sie und löste meine Zöpfe. »Ich verkleide dich als Lillian Gish.«
Schnell schloss Fulvia sich mir an, wie Lydia sich meiner Mutter angeschlossen hatte. Vermutlich reizte die beiden unsere Naivität und der vielleicht unbewusste Wunsch, unsere Ordnung zu stören. Angestachelt durch das Erstaunen, das sie bei uns hervorriefen, offenbarten sie uns das geheime Leben des großen Hauses, in dem wir schon seit Jahren wohnten. Dieselben Frauen, denen wir tagtäglich begegneten, die wir viele Male auf der Treppe gestreift hatten, erschienen uns durch die Geschichten von Lydia und Fulvia nun in einem romantischen Licht, ganz wie die Figuren, die meine Großmutter auf der Bühne verkörpert hatte. Uns wurde der Grund für die Stille klar, die jeden Nachmittag bleischwer auf dem menschenleeren Hof lag. Ihrer undankbaren Aufgaben entledigt und so, als wollten sie sich gegen das ihnen auferlegte stumpfe Leben auflehnen, entflohen die Frauen jeden Nachmittag den dunklen Zimmern, den grauen Küchen und dem Hof, wo mit Einbruch der Dunkelheit unweigerlich das Ende eines weiteren Tages sinnloser Jugend wartete. Wie standhafte Wächterinnen über die aufgeräumten, stillen Wohnungen blieben die alten Frauen mit einer Näharbeit zurück und verrieten die jungen nicht, nein, sie halfen ihnen, als gehörten sie alle einem Geheimbund an. Eine stumme, langjährige Verachtung der Lebensweise der Männer und ihres tyrannischen, egoistischen Systems verband sie, ein unterdrückter Groll, der von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Wenn die Männer morgens aufstanden, war ihr Kaffee fertig und ihr Anzug gebügelt, und sie gingen in den klaren Tag hinaus, ohne einen Gedanken an Haus und Kinder zu verschwenden. Sie hinterließen muffige Schlafzimmer, ungemachte Betten und schmutzige Kaffeetassen. Wie Schuljungen kamen sie in kleinen Gruppen stets zur selben Zeit nach Hause, nachdem sie sich in der Straßenbahn oder auf dem Ponte Cavour getroffen hatten und bei angeregten Gesprächen zusammen weitergegangen waren. Noch an der Tür erkundigten sie sich: »Ist das Essen fertig?«, zogen sich das Jackett aus, was ihre schäbigen Hosenträger zum Vorschein brachte, und sorgten mit Bemerkungen wie »Die Pasta ist zerkocht, der Reis ist matschig« für schlechte Laune. Nach dem Essen setzten sie sich in den einzigen vorhandenen Sessel im kühlsten Zimmer der Wohnung und lasen Zeitung. Die Lektüre veranlasste sie jedes Mal zu düsteren Voraussagen: das Brot werde teurer, die Löhne würden gekürzt. Und jedes Mal schlussfolgerten sie: »Es muss gespart werden.« Nie fanden sie etwas Positives in der Zeitung. Schon bald gingen sie erneut aus dem Haus. Die Tür klappte hinter ihnen zu, und etwa zur selben Zeit hörte man auch in den anderen Stockwerken das Klappen der Türen. Sie kamen zurück, wenn das Haus dunkel war, die Kinder schliefen und der Tag vorbei und geschafft war. Wieder zogen sie sich das Jackett aus, setzten sich nun ans Radio und hörten sich politische Debatten an. Nie hatten sie ein Wort für ihre Frau übrig, kein »Wie geht es dir? Bist du müde? Du hast ein hübsches Kleid an«. Sie erzählten nichts, waren einsilbig, nicht zu Scherzen aufgelegt und lächelten selten. Wenn sie mit ihrer Frau sprachen, sagten sie: »Ihr macht … ihr sagt …«, und scherten so Kinder, Schwiegermutter, Dienstmädchen und ihre Frauen über einen Kamm, alles faules, kostspieliges und undankbares Volk.
Dabei hatten sie ihre Braut, wie in den kleinbürgerlichen Kreisen im Süden üblich, lange umworben. Als junge Männer hatten sie stundenlang gewartet, nur um die Geliebte am Fenster zu erspähen oder ihr zu folgen, wenn sie mit ihrer Mutter spazieren ging. Und sie hatten leidenschaftliche Briefe geschrieben. Die jungen Mädchen waren nicht selten gezwungen gewesen, sich bis zur Hochzeit viele Jahre zu gedulden, weil erst eine feste Anstellung gefunden und das Geld für die Möbel zusammengespart werden musste. In der Zwischenzeit hatten sie in der Hoffnung auf Liebe und Glück zuversichtlich an ihrer Aussteuer gestickt. Erhalten hatten sie dann aber dieses zermürbende Leben mit Küche und Haushalt, mit dem Anschwellen und Abschwellen ihres Körpers, der die Kinder zur Welt brachte. Wegen der Täuschung, der sie zum Opfer gefallen waren, wuchs unter dem Anschein von Resignation allmählich ein tiefer Groll in ihnen.
Trotzdem standen sie den beschwerlichen Alltag weiterhin durch, ohne sich zu beklagen. Sie erinnerten ihren Mann nicht daran, was für unbekümmerte Mädchen sie einmal gewesen waren oder was für ein Leben in Glück und Harmonie er ihnen versprochen hatte. Anfangs hatten sie die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Nächtelang hatten sie geweint, während der Ehemann neben ihnen schlief. Sie hatten es mit Koketterie, Tricks und vorgetäuschten Ohnmachten probiert. Die fortschrittlichsten von ihnen versuchten, ihren Partner für Musik und Literatur zu begeistern, gingen mit ihm in die Parks, durch die sie als verliebtes Paar gemeinsam geschlendert waren, und hofften, er würde verstehen und sich ändern. Aber sie hatten nur die Erinnerung an diese schönen Orte zerstört, denn dort, wo die ersten bangen Worte gesagt und voller Begehren und Neugier die ersten Küsse getauscht worden waren, hatten sich die Eheleute nichts mehr zu sagen als banale Belanglosigkeiten. In den ersten Ehejahren hatten viele dieser Frauen einen Nervenzusammenbruch und Weinkrämpfe erlitten. Eine von ihnen, so erzählte Lydia, hatte versucht, sich mit Veronal zu vergiften. Andere hatten sich schließlich damit abgefunden, nunmehr unwiderruflich alt, reizlos und unattraktiv zu sein. Doch das waren die noch nicht lange Verheirateten oder Frauen, die unter dem Zwang eines züchtigen katholischen Glaubens standen. Die meisten anderen warteten nur noch darauf, dass ihr Mann am Nachmittag sagte: »Ich gehe jetzt«, und die Tür ins Schloss fiel. Die Frauen, die schon größere Töchter hatten, warteten darauf, dass auch diese ausgingen, zusammen mit ihren gleichaltrigen Freundinnen. Dann schickten sie die Kleinen – nicht ohne ihnen sorgfältig einen Imbiss eingepackt zu haben – mit dem Dienstmädchen in den Park. Die Männer dachten alle an ihr eigenes Vergnügen, ihre eigenen Interessen. Keiner fragte die Frauen: »Und was machst du?« Man ließ sie in ihrer unerträglichen Tretmühle zwischen Bergen von Flickarbeit und Körben voller Bügelwäsche sitzen.
Im Winter, erzählte Fulvia, war ihr Leben noch härter. Träge vor Kälte, schauten die Frauen an einem Kohlenbecken oder in der Küche zu, wie der Regen an den Fensterscheiben herunterrann, und kurierten ihre kranken Kinder. Im Winter gewannen sie diesem isolierten häuslichen Leben sogar eine wenn auch bittere Zufriedenheit ab. Abends fielen sie erschöpft in einen dumpfen, erinnerungslosen Schlaf.
Aber wenn der Frühling kam und die Bäume entlang der trostlosen Straßen von Prati rote Knospen ansetzten, verströmten Mimosen und Geißblatt, hinter Gittern zusammengepfercht, einen starken Duft, der auch auf den alten Hof vordrang. Die Frauen öffneten die Fenster, um die Rufe der Schwalben zu hören, die, wie um sie einzuladen, hektisch hin und her flogen. Dann hielten sie es nicht mehr aus, streiften Zweifel und Gewissensbisse ab wie verhasste Fesseln, sagten, wenn sie im Flur am Herz-Jesu-Bild vorbeikamen, »Jesus, vergib mir«, und zogen sich in ihr Zimmer zurück. Wenig später kamen sie wie verwandelt heraus. Sie hatten alle eine Vorliebe für Kleider mit Blumen auf schwarzem Grund und für große Hüte, durch die ihr Gesicht im Schatten lag. Sie benutzten Puder, Parfüm und Lippenstift und trugen transparente Handschuhe. So zurechtgemacht, erschienen sie vor den alten Frauen, die am Fenster saßen. Diese würdigten sie kaum eines Blickes, erkannten aber das Parfüm und die resolute Stimme, die sagte: »Ich gehe aus.« Und selbst wenn es sich um die eigene Schwiegertochter handelte, sagten sie nichts. Ein Zusammenhalt, stärker als Familienbande, vereinte sie.
Fulvia erzählte, die Liebhaber – ich erspähte manchmal einen vom Fenster aus – warteten an der nächsten Straßenecke. Eine unnötige Vorsichtsmaßnahme, da sie im ganzen Viertel bekannt waren. Häufig waren es jüngere Männer aus nur wenig besseren Verhältnissen. In meiner Vorstellung hätte ein Liebhaber sehr gut aussehen, einen romantischen Blick haben und gut gekleidet sein sollen. Doch erstaunt stellte ich fest, dass die meisten keine dieser Eigenschaften besaßen.
Verwirrt von diesen Geschichten, die Lydia und Fulvia uns erzählten, und von der mysteriösen Anwesenheit der Männer, die unser Haus von Weitem belagerten, gingen meine Mutter und ich, in Gedanken und in Träumereien versunken, still die Treppe hinunter. Wir kehrten in unsere düstere Wohnung zurück, zu den dunklen Möbeln, den Büchern und dem Klavier. Ich ging sofort schlafen, meine Mutter löschte das Licht und setzte sich zu mir ans Bett. Wenn mein Vater sie in einem solchen Moment rief, antwortete sie schroff und bissig. Währenddessen erwachte Alessandro in mir und sorgte mit heiklen Fragen für einen Sturm neuer, geheimster Gefühle. Ich sah die weißen Briefe vor mir, von denen Fulvia mir erzählt hatte, Liebesbriefe, die durch die Hände der Dienstmädchen und des alten Portiers wanderten. Am liebsten hätte ich sie alle gelesen, sie alle gestohlen.
Meine Mutter saß eine Weile schweigend an meinem Bett. Schließlich erhob sie sich, ohne mir einen Kuss zu geben. Ich sah ihre zarte Gestalt zur Tür hinausgehen. Kurz darauf kam Sista und riss mich aus dem Halbschlaf: »Du warst bei denen da. Sprich ein Reuegebet und ein Ave-Maria.«
Dann geschah zweierlei: Meine Mutter machte die Bekanntschaft der Familie Pierce, und die ersten Séancen mit Ottavia, dem Medium, fanden statt.
Familie Pierce kam ursprünglich aus England und war in jenem Jahr aus Florenz nach Rom gezogen. Die Mutter, eine Amerikanerin, war steinreich und verschwendete ihr Geld im Gegensatz zu vielen ihrer Landsleute nicht mit der Veranstaltung von Bällen oder mondänen Partys, sondern kaufte Kunstwerke und unterstützte junge Künstler. Sie wohnte in einer von dicht stehenden Bäumen und hohen Palmen umgebenen Villa auf dem Gianicolo. Der Ausblick von dort war zauberhaft: Die Kuppeln der Stadt waren im Fensterausschnitt wie Familienfotos eingerahmt, und der Tiber schlängelte sich unter den Brücken hindurch wie ein Band durch ein Spitzengewebe. Damals machte meine Mutter den Gianicolo häufig zum Ziel unserer Sonntagsspaziergänge, damit mein Vater und ich aus der Ferne den Park der Villa bewundern konnten. Manchmal wagten wir uns auch bis zu einem Seitentor vor. Dann ließ sie mich auf eine kleine Mauer klettern und zeigte mir drei große Fenster im ersten Stock. Sie gehörten zum Musiksalon. Dort standen der Konzertflügel, den Mrs.Pierce aus Amerika hatte kommen lassen, die Harfe, die sie spielte, und ein hochmodernes Grammophon mit selbsttätig wechselnden Schallplatten.
Die Villa im alten Stil war wunderschön. Die üppige Vegetation machte den Park undurchdringlich. Große, elegante Hunde liefen vorbei, und meine Mutter versicherte mir, dass es auf den Wiesen auch weiße Pfauen gab, die ich aber nie zu Gesicht bekam. Wir waren beide fasziniert von diesem Anwesen. Mein Vater teilte unsere Begeisterung nicht, vielleicht wegen seiner instinktiven Abneigung eines Menschen aus bescheidenen Verhältnissen gegen alle, die in Reichtum leben. Er trieb uns zur Eile an, weil er es kaum erwarten konnte, in einer nahe gelegenen Trattoria eine Limonade zu trinken.
Jeden Sonntagabend ging er mit uns ins Café. Ich bin immer verrückt nach Eis gewesen. Doch wenn ich den Park der Villa Pierce gesehen hatte, war ich mit meinen Gedanken woanders, stocherte mit dem Löffel in meiner Portion herum und ließ das Eis zu einer gelblichen Pfütze zerrinnen. Meiner Mutter ging es ähnlich, und dass wir uns so leicht beeindrucken ließen, reizte meinen Vater maßlos. Zu Unrecht sah er darin eine Geringschätzung unserer Lebensumstände und seiner Person, die unfähig war, viel Geld zu verdienen.
Dabei schenkten weder meine Mutter noch ich unserem Lebensstandard je viel Beachtung. Sie trug jahrelang dieselben Kleider, und obwohl sie sie von Zeit zu Zeit mit einer Spange oder einem Schleifenband auffrischte – oder vielleicht gerade deswegen –, kamen sie allmählich so aus der Mode, dass sie von einer demonstrativen Extravaganz zu zeugen schienen. Sie besaß keinen Pelz, nur einen dürftigen, schwarzen Mantel, in dem sie allen Unbilden des Winters trotzte. Ihr schönes, langes Haar, das sie in einem Knoten im Nacken trug, nahm sich unter den schlichten Hütchen, die selbst eine alte Frau verschmäht hätte, kläglich aus. Unsere Mahlzeiten waren bescheiden, unsere Vergnügungen beschränkten sich auf die erwähnten Sonntagsspaziergänge. Wir zwei betrachteten die Villa nur deshalb so lange, weil uns die großen Bäume faszinierten, die sie wie Menschen in Grüppchen oder paarweise umstanden, und wir hielten es für ein großes Privileg der Familie Pierce, sich ständig an ihrem Anblick erfreuen zu können. Es war übrigens nicht das einzige. Für meine Mutter bestand das Glück dieser Familie auch darin, dank ihres Geldes ihren geistigen Neigungen folgen zu können, ohne sie den Alltagssorgen unterordnen zu müssen.
In solche Gedanken versunken saßen wir an einem kleinen Eisentisch auf einem Gehweg voller ähnlicher Tische, an denen Leute wie wir saßen, Mutter, Vater, Kinder. Ringsumher ragten große, graue Wohnblocks mit Fenstern dicht an dicht auf, und aus diesen Fenstern starrten die Bewohner missgünstig auf unser Eis, bis es aufgegessen war. Die Straßenbahn fuhr dicht vorbei, und jedes Mal übertönte ein scharfes Quietschen unsere zähflüssige Unterhaltung. Ich musste erneut an das große Gittertor denken, hinter dem die mit Efeu und Moos bewachsenen Bäume standen, an die saftigen Wiesen, auf denen die weißen Pfauen herumspazierten, die ich nicht gesehen hatte, und an die drei hohen Fenster mit dem geschlossenen Giebelfeld, hinter denen einsam im Halbdunkel der Flügel und die Harfe standen.
Die große Anziehungskraft, die dieser Flügel auf meine Mutter ausübte, war nicht nur seinem ausgezeichneten Klang geschuldet, sondern auch dem Umstand, dass auf ihm keine Tonleitern, Etüden und langweilige Sonatinen geübt werden mussten. Sie durfte frei auf ihm spielen, als wäre sie zu Hause. Denn man hatte sie aus einem eher seltsamen Grund in die Villa Pierce eingeladen. Bei ihrem ersten Besuch hatte die Hausherrin sie nicht flüchtig empfangen, ihr schnell die neue Schülerin vorgestellt und sie nach wenigen Minuten allein gelassen, wie die anderen Damen es taten, nein, sie hatte sie zum Tee eingeladen und ihr von ihrer Kunstsammlung, ihren Reisen und schließlich von ihrer Familie erzählt. Diese bestehe aus dem Vater, einem Industriellen, der in seiner Freizeit brasilianische Schmetterlinge sammele, einer in London verheirateten Tochter und den zwei jüngeren Kindern Hervey und Arletta, die bei ihr wohnten, wobei der ältere Sohn, wie sie beiläufig erwähnte, krank und oft auf Reisen sei.
Um Arletta solle meine Mutter sich kümmern, aber nicht, um ihr das Klavierspielen beizubringen, sondern um ihr Interesse für die Musik zu wecken, so wie andere Lehrer sie in Malerei und Dichtung einführten. Denn dieses Mädchen, gestand ihre Mutter mit gedämpfter Stimme, habe keinerlei Sinn für die Kunst. Das sei, führte sie weiter aus, für die anderen Familienmitglieder bedauerlich, die fast ausschließlich künstlerische Ambitionen hätten. Auch deshalb halte Hervey sich oft außerhalb von Rom auf. Erst vor Kurzem sei er wieder abgereist und werde etwa ein Jahr wegbleiben. Arlettas Wesen sei zunehmend so fehl am Platz, dass man es im täglichen Leben des Hauses nicht ignorieren könne. Sie höre lieber Schlager als Kammermusik und lese lieber Groschenromane als die Klassiker der Literatur. Daher müsse man ihren Geschmack nach und nach ausbilden. Das Mädchen sei noch sehr jung, gutwillig und folglich vielleicht heilbar.
Wenig später kam Arletta herein, und da sie womöglich ahnte, was zuvor über sie geredet worden war, spürte meine Mutter, wie sie sagte, eine gewisse Verlegenheit, als sie ihr die Hand gab. Sie habe sie sich anders vorgestellt, erzählte sie mir, lebhaft, furchtlos, zu Streitgesprächen und Ironie aufgelegt. Stattdessen war sie ein eher pummeliges, hausbackenes Mädchen in meinem Alter. Arletta erbot sich sofort, sie zum Musiksalon zu führen, und an der Art, wie sie die hohe, goldene Klinke herunterdrückte, erkannte meine Mutter, wie viel Ehrfurcht dieser Raum dem Mädchen einflößte.
Der Salon lag im Dämmerlicht. Vor den Fenstern rankte ein Geflecht aus Zweigen, und die Nachmittagssonne schien durch die frischen Blätter der Bäume, die bis an die Fenstersimse heranreichten, und tauchte den Raum in ein trübes Unterseegrün, in die Verschwommenheit eines Aquariums. Wie eine Insel ragten in einer Ecke die dunklen Umrisse des Flügels auf, und im diffusen Sonnenlicht schimmerte das Mattgold der Harfe. Abgesehen von einigen Empirestühlen mit einer Lyraverzierung in der Lehne und zwei Sofas mit deutlichen Sitzmulden gab es keine Möbel. Vor einem Fenster warfen vier hohe Notenständer transparente, skelettartige Schatten an die weiße Wand. Aus Angst, die Stille und die Ordnung zu stören, gingen meine Mutter und Arletta auf Zehenspitzen. Mitten im Raum blieb das Mädchen plötzlich stehen. Mit ihren weißen Armen und dem weißen Kleid wirkte sie im gedämpften Licht wie eine große Qualle.
»Signora«, sagte sie, »ich habe Angst. Mein Bruder will nicht, dass ich den Salon betrete.« Sie schien wirklich eingeschüchtert zu sein. »In seinen Augen bin ich unempfänglich, ja sogar schädlich für die Musik«, fügte sie hinzu. »Ich kann nichts dafür, ich verstehe sie nicht. Hervey hat Recht. Er unternimmt lange Reisen, nur um einen bestimmten Pianisten zu hören, und wenn er in Rom ist, wohnt er praktisch hier im Salon, allein mit seinen Schallplatten und der Geige. Er will nicht, dass ich hereinkomme, weil er fürchtet, etwas von mir könnte im Raum zurückbleiben und ihn stören, auch wenn ich gar nicht da bin. Das ist sehr schlimm für mich, Signora. Als hätte ich eine verborgene, ansteckende Krankheit. Sie müssen mich heilen. Vielleicht können wir mit leichten Stücken anfangen, mit solchen für Kinder. Ich muss gesund werden«, erklärte sie energisch. Dann sagte sie leise: »Weil ich meinen Bruder Hervey über alles liebe.«
Meine Mutter nahm Arletta bei den Händen und dankte ihr für ihre Aufrichtigkeit. Dann öffnete sie die Fenster, damit die mysteriöse Atmosphäre verflog, die im Salon entstanden war, und ein Tannenzweig schnellte herein wie ein Tier, das lange auf der Lauer gelegen hatte. Trotzdem blieb der große Raum unergründlich und geheimnisvoll. Die Musikinstrumente ähnelten Menschen mit Gefühlen und Gedanken. »Das ist Hervey«, sagte Arletta und schaute sich ängstlich um. Und auch meine Mutter begann sich unbehaglich zu fühlen.
»Nicht einmal meine Mutter traut sich, hier zu spielen, wenn er nicht da ist«, sagte Arletta und wies auf einen mit weißer Atlasseide bezogenen Stuhl neben der Harfe. »Wenn sie musiziert, legt sich Hervey auf das Sofa und hört ihr mit geschlossenen Augen zu.«
»Und du?«
»Ich bleibe in meinem Zimmer oder gehe im Park spazieren. Weit weg, damit er mich vom Fenster aus nicht sieht.«
Meine Mutter erlaubte sich eine kritische Bemerkung über dieses merkwürdige Verhalten, aber Arletta verteidigte ihren Bruder vehement.
»Nein, nein, Signora, Hervey ist ein Künstler. Er spielt Geige und improvisiert am Klavier. Meine Mutter findet das wunderschön. Nein«, wiederholte sie, »es ist wirklich meine Schuld.« Und traurig fügte sie hinzu: »Auch Lady Randall, also meine Schwester Shirley in London, spielt hervorragend Klavier.«
Um diese neuen Klavierstunden geben zu können, musste meine Mutter andere abgeben, da sie sich zweimal in der Woche fast einen ganzen Nachmittag in der Villa Pierce aufhielt. Mein Vater hatte ihr davon abgeraten, ohne sich für die besonderen Umstände dieser Lektionen zu interessieren. Er fürchtete, wenn sie ihre langjährigen Schülerinnen erst einmal verloren habe, könne es schwer werden, Ersatz für sie zu finden, falls diese Einnahmequelle durch einen Wegzug der Familie Pierce plötzlich versiegen würde.
Aber sie hatte sich geradezu starrköpfig bereits entschieden. An den Tagen, an denen sie zu Arletta ging, war sie schon morgens aufgekratzt und unruhig wie vor einem Fest. So wie ich veranlagt war und meine Mutter liebte, hätte ich eifersüchtig auf die neue Schülerin sein müssen, doch meine Mutter war nach ihrer Rückkehr immer viel beschwingter als sonst. Nach einigen Stunden in der Villa Pierce war sie wie von einer neuen Begeisterung erfüllt. Ihr leichter, lebhafter Schritt riss unsere düsteren Zimmer aus ihrer Schläfrigkeit.
Oft brachte sie uns Süßigkeiten mit, die sie dort oben geschenkt bekommen hatte. Das ärgerte meinen Vater, und auch ich aß sie nicht gern. Vielleicht fürchtete er, seiner Frau könnte, da sie nun einen anderen Lebensstil kennenlernte, das Leben, das sie die restliche Woche über führte, nicht mehr genügen. Bis dahin hatte sie überwiegend Schülerinnen aus eher kleinen Verhältnissen gehabt, die nur lernten, um ihrerseits Lehrerinnen zu werden und sich so ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Daher zog meine Mutter keine persönliche Befriedigung aus ihrer Arbeit und begegnete in den Häusern, in denen sie unterrichtete, auch nie bemerkenswerten oder interessanten Menschen. Nur um meinen Vater beim Geldverdienen für unsere Familie zu unterstützen, ging sie bei jedem Wetter aus dem Haus, drängelte sich in die volle Straßenbahn, stieg Treppen hinauf und hinab, die unseren ähnelten, und besuchte kleine, schmutzige Wohnungen, deren Geruch verriet, was es zum Essen gegeben hatte. Deshalb freute ich mich, dass die Nachmittage in der Villa Pierce ihr so gut gefielen, und ging gern Sista zur Hand, um meine Mutter bei der Hausarbeit zu entlasten. Ich lernte sogar flicken, was ich liebte, weil ich dabei still an meinem Lieblingsfenster sitzen und meinen Gedanken nachhängen konnte.
Gedanken, die kräftig durcheinandergewirbelt wurden, als ich durch das Medium Ottavia die Bekanntschaft mysteriöser, schauriger Gestalten machte, die denselben Himmel bevölkerten, an dem ich bei Sonnenuntergang die Schwalben fliegen sah.
Ottavia ging schon eine ganze Weile bei den Celantis ein und aus. Fulvia hatte mir oft von ihr erzählt, wenn man uns im Zimmer oder auf dem Balkon zum Plaudern allein gelassen hatte. Einmal hatte ich sie kurz auf der Treppe gesehen, eine stämmige, grauhaarige Frau mittleren Alters mit einer Männerfrisur. Sie hatte stets eine große Tasche bei sich – mit Heiligenbildchen, Amuletten an roten Bändern, Glückshörnern aus Koralle und Kräutersäckchen gegen den bösen Blick – und wurde von einem fünfzehnjährigen Jungen begleitet, den sie als ihren Neffen vorstellte und der selbst im tiefsten Winter kahlgeschoren war. Sie hinkte auf dem linken Fuß, aber offenbar ohne dass es sie anstrengte oder verdross. Jeder Schritt war ein herrisches Aufstampfen, ein Schlusspunkt. Enea, so hieß der Junge, folgte ihr mit einigem Abstand, und soweit ich mich erinnere, war er immer schwarz gekleidet und trug auch schwarze Strümpfe und schwarze Handschuhe, so dass er wie ein junger Priester wirkte. Er hatte eine glänzende, olivbraune Haut, und seine dunklen, sanften Augen mit den dichten Brauen ähnelten denen meines Vaters.
Den Celantis zufolge geisterte Ottavia schon seit vielen Jahren durch unser dunkles Haus. Sie kündigte sich mit einem speziellen Klopfzeichen an den Wohnungstüren an, drei leichten, präzisen Schlägen, um sich zu vergewissern, dass die Männer nicht zu Hause waren. Andernfalls gab sie vor, sich im Stockwerk geirrt zu haben. Sie kam freitags, dem günstigsten Tag für die Séancen. Dann zog stets schon am Morgen ein schwerer Weihrauchduft durch das Treppenhaus. Die Wohnungstüren waren nur angelehnt, und die Dienstmädchen huschten von Wohnung zu Wohnung, um ein weißes Tuch oder einen kleinen Tisch auszuleihen. Kurz, ein kaum verhohlener Eifer prägte diesen Tag.
An diesen Vormittagen kehrten nämlich alle Toten wieder in ihre einstigen Wohnungen zurück. »Das ist Onkel Quintino«, sagte Fulvia ruhig, wenn sie ein Geräusch aus dem Nebenzimmer hörte. Die Frauen standen früher auf als sonst und gaben ihr Bestes bei der Hausarbeit, vielleicht, um die Toten daran zu erinnern, was für ein bitteres Gut das Leben war. Sie wandten sich dem Stammplatz zu, auf dem jene jahrelang gesessen hatten, und warfen ihnen mit harschen, ironischen Worten ihren Tod vor wie einen Verrat, wie eine listige Flucht. Manchmal seufzten sie beim Anblick des leeren Stuhls, auf dem die Mutter oder die Großmutter stets gesessen hatte, dann wischten sie auf der Lehne mit großer Behutsamkeit Staub, so als zupften sie ein Halstuch zurecht. An diesen Tagen wurden sie von dem leeren Stuhl aus von starren, mutlosen Augen beobachtet. Obwohl ich von den spiritistischen Sitzungen ausgeschlossen war, ahnte auch ich eine unsichtbare Präsenz um mich her. Schon ein Knistern ließ mich herumfahren, schweißgebadet und mit klopfendem Herzen. »Alessandro«, flüsterte ich ängstlich. Ich spürte, dass er sich nicht wie die anderen damit begnügte, ein stummer Schatten zu sein: Er wollte durch mich auch an unserem Leben teilhaben.