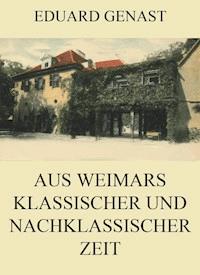
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eduard Franz Genast war ein deutscher Sänger, Schauspieler, Komponist, Theaterdirektor und Regisseur. Dieser Band beinhaltet seine autobiographischen Erinnerungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aus Weimars klassischer und nachklassischer Zeit
Eduard Genast
Inhalt:
Franz Eduard Genast – Lexikalische Biografie
Aus Weimars klassischer und nachklassischer Zeit
Erster Teil - Aus Weimars klassischer Zeit
Zweiter Teil - Aus Weimars nachklassischer Zeit
Aus Weimars klassischer und nachklassischer Zeit, E. Genast
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849615284
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Franz Eduard Genast – Lexikalische Biografie
Aus Weimars klassischer und nachklassischer Zeit
Erster Teil - Aus Weimars klassischer Zeit
Erstes Kapitel.
Meine Kindheit. – Eine Mozart-Erinnerung. – Begegnung mit Schiller. – Das Elternhaus. – Schillers Tod und Begräbnis.
Ich bin zu Weimar im Jahre 1797 geboren und der einzige Sohn des Schauspielers Anton Genast, der zwanzig Jahre unter Goethes Leitung als Regisseur bei dem Weimarischen Hoftheater wirkte.
Er war 1765 zu Drachenberg in Schlesien geboren, wo sein Vater beim Fürsten von Hatzfeldt das Amt eines Haushofmeisters bekleidete und nicht Genast, sondern Kynast hieß. Er hatte eine Menge Geschwister und wurde als der befähigtste unter den Söhnen gegen seinen Willen in die Jesuitenschule nach Krakau geschickt und dem geistlichen Stande gewidmet. In seinem zwanzigsten Jahre kehrte er, reich an wissenschaftlichen und Sprachkenntnissen, in seine Heimat zurück. Dort sollte er, nach dem Willen seines Vaters, als Kaplan eintreten; all sein Widerstreben und seine Bitten halfen ihm nichts, und so faßte er sich ein Herz und ging, mit wenigen Talern in der Tasche, seinen Eltern durch. Er wollte Schauspieler werden, und sein nächstes Ziel war Breslau; dort wurde er aber abgewiesen, und so wandte er sich nach Bunzlau, wo eine reisende Komödiantentruppe ihr Wesen trieb und wo er nach einigen Proberollen mit wöchentlich einem Taler Gage engagiert wurde. Auf dem geschriebenen Theaterzettel erschien sein Name dort zum ersten Male als Genast. Über ein Jahr trieb er sich nun bei solchen Gesellschaften herum, sang und spielte in allen möglichen Fächern, bis ihn im Jahre 1786 sein guter Stern nach Prag zu Wahr führte, der dort Direktor des deutschen Schauspiels war. Auch eine italienische Oper unter Guardasoni war dort; sie soll eine der besten der damaligen Zeit gewesen sein. Da mein Vater der italienischen Sprache mächtig war, so machte er auch bald Bekanntschaften unter den italienischen Sängern. Mit Bassi, für den der Don Juan geschrieben ist, wurde er sogar befreundet, und durch ihn lernte er den unsterblichen Mozart kennen. Es muß ein flottes künstlerisches Zusammenleben gewesen sein. Ich lasse hier ein Pröbchen davon meinen Vater selbst erzählen.
»Von Don Juan war bereits eine Theaterprobe gewesen, aber noch war keine Ouverture fertig, auch bei der Vorprobe fehlte sie noch, und Guardasoni machte dem Komponisten ernstliche Vorwürfe, daß nun wahrscheinlich die Oper ohne Ouverture gegeben werden müsse. Mozart aber, ganz unbekümmert darüber, nahm noch am Tage vor der Hauptprobe ein Souper bei einem geistlichen Herrn ein, zu welchem auch Bassi, Guardasoni, Wahr und ich geladen waren. Die Gesellschaft war sehr vergnügt; der geistliche Herr, ein Lebemann, regalierte uns mit trefflichen Speisen und mit noch trefflichern ungarischen Weinen, denen Mozart tüchtig zusprach. Die immer lebhaftere Unterhaltung ging teils in italienischer, teils in lateinischer Sprache vor sich. Bis auf den geistlichen Herrn waren uns allen die Zungen etwas schwer geworden, und erst nach ein Uhr trennte sich die Gesellschaft. Wahr und ich übernahmen es, Mozart nach Hause zu bringen, und auf dem Weg dahin sang er fortwährend Phrasen aus Don Juan, aber immer kam er wieder auf Finch' han dal vino calda la testa, das Champagnerlied, zurück. Die scharfe Oktoberluft und das Singen hatten ihn, als wir in seiner Wohnung ankamen, völlig seiner Sinne beraubt. Im vollen Anzuge warf er sich aufs Bett und schlief sofort ein. Da uns die Beine auch schwer geworden waren und wir den weiten Weg nach Hause scheuten, setzten wir uns auf ein altes Federsofa, und Morpheus nahm uns ebenfalls in seine Arme. Aus unserem süßen Schlummer wurden wir plötzlich durch kräftige Töne geweckt und sahen bei unserem Erwachen voll Erstaunen Mozart bei einer düstern Lampe an seinem Pulte sitzen und arbeiten. Keiner von uns wagte ein Wort zu sagen, und mit wahrer Verehrung hörten wir die unsterblichen Gedanken sich entwickeln. Ohne ferner ein Auge zu schließen, hörten wir zu und verhielten uns ganz still. Nach 9 Uhr sprang er mit den Worten auf: »Na! da steht's ja!« Ein Gleiches taten auch wir, und mit Erstaunen rief er: »Ja, was Teuxel! wie kommt denn ihr daher?« Mit Begeisterung küßten wir ihm seine schönen weißen Hände. Er trennte die Partitur und bat uns, sie sofort den vier Kopisten im Bureau zu übergeben. »Nun wollen wir a bissel schlafen,« sagte er. Abends lagen, teilweise noch naß, die ausgeschriebenen Stimmen auf den Pulten. Ich hatte keine der früheren Proben versäumt, und um so größer war die Wirkung, welche die Ouverture auf mich machte. Bassi war unübertrefflich als Don Juan! In Prag herrschte zu jener Zeit ein kompetentes Urteil in allem, was Musik betraf, darin war man allen deutschen Städten voraus, und so mußte denn dies Meisterwerk schon ein enormes Glück machen. Zwanzigmal wurde die Oper hintereinander bei gedrängt vollem Hause gegeben.«
Mein Vater besaß eine sehr hübsche Tenorstimme, darum beschäftigte ihn Wahr hauptsächlich im deutschen Singspiel als Tenorbuffo, wozu er das meiste Talent mitbrachte. Für dies stach erhielt er auch im Jahre 1791 einen Antrag nach Weimar, vorher aber kehrte er noch einmal in seine Heimat zurück, um eine Versöhnung mit Vater und Mutter herbeizuführen.
Kaum war mein Vater in Weimar angekommen, so wollte er auch schon wieder fort, denn großes Entsetzen flößte ihm die kleine Stadt ein, wo Rinder-, Schaf- und Schweineherden ungehindert durch die Straßen wandelten. Auch das vornehme Kopfnicken, womit Goethe ihn empfangen, behagte ihm nicht, aber er machte bald viele angenehme Bekanntschaften, die ihn fesselten, vor allen die eines einfachen, lieblichen und bildschönen Bürgermädchens, meiner Mutter. Ich sehe noch im Geist die großen, veilchenblauen Augen, die ich so oft mit kindlicher Liebe geküßt, das schwarze Haar und die schlanke Gestalt. Meines Vaters weitern Lebenslauf und seine Wirksamkeit als Regisseur beim Weimarischen Hoftheater werde ich dem Leser später mitteilen.
Ich hatte nur eine um drei Jahre ältere Schwester; sie war mein Spielkamerad und tat es mir in allen Künsten, wie Ringen, Laufen, Springen, Steinschleudern usw. weidlich zuvor; eigentlich hätte sie die Hosen und ich den Weiberrock tragen müssen, denn sie war ein kleiner Teufel.
Die wichtigste meiner Kindererinnerungen fällt in das Jahr 1803.
Die jetzige Schillerstraße hatte früher ein ganz anderes Ansehen. Auf der Südseite lag der Stadtgraben, an den sich unmittelbar zwei Reihen hochstämmiger Linden schlossen, die sich vom inneren Frauentor bis an das Palais, den Witwensitz der Herzogin Anna Amalia, erstreckten. Neben der Allee, die man Esplanade nannte, war die stahrstraße, die sich an die Stadtmauer lehnte und hinter welcher sich kleine Gärten befanden, die zu den Häusern der Windischen Gasse gehörten. In der Front der Stadtmauer standen damals nach der Südseite zwei bis drei Häuser, von denen Schiller eins ankaufte. Das erwähnte Palais, an welches sich ein sehr hübscher Park schloß, der durch einen Bach und eine Reihe Pappeln von der Straße getrennt war, lag in einer Vertiefung, die früher wohl auch zum Stadtgraben gehört haben mag.
Eines Tages ging ich mit meinem Vater nach dem Theater, welches dem Palaisgarten gegenüber lag. Er hatte dort einige Geschäfte zu besorgen und hieß mich warten, bis er zurückkäme. Während ich allein blieb, lehnte ich mich an das einfache hölzerne Geländer, welches zwischen den Pappeln angebracht war, und sah hinab in den großen, schönen Garten; da saßen zwei Damen auf einer Gartenbank und strickten. Die eine hatte so schöne große Augen wie meine Mutter, nur daß sie ganz himmelblau waren, die andere hatte ein spitzes Gesicht und schien mir etwas bucklig zu sein. Nicht lange dauerte es, so rief mich der Vater, ich sprang zu ihm und fragte: »Vater, wer sind denn die Damen, die da sitzen? Der Vater schielte seitwärts hin und erwiderte: »Das ist die Herzogin Amalia und ihre Hofdame, die Göchhausen.«
Wir gingen nun der Esplanade zu. Auf ihr begegnete uns ein großer Mann mit langen Armen und langem Rock, hagerem Gesicht, gebogener Nase, bloßem Kopf; mir fiel er sehr auf, besonders im Gegensatz zu meinem Vater, der klein und dick war, ein volles Gesicht und eine Stumpfnase hatte. Der Mann begrüßte ihn freundlich und fing mit ihm ein Gespräch über das Theater an; währenddem strich er mir durch meine Flachshaare, streichelte mir das Gesicht, nahm mich endlich sogar auf den Arm und tänzelte, mich immer dabei liebkosend, mit mir die Allee dahin. Als er uns verließ, fragte ich: »Vater, wer war denn der lange Mann?« »Das war Schiller, mein Sohn!« sagte der Vater eindringlich bedeutsam zu mir. Ja, was wußte ich dummer Junge damals von Schiller; aber doch sah ich dem Mann lange nach, und obgleich ich ihm nie wieder begegnete, ist doch sein Bild treu in meinem Gedächtnis geblieben.
Wir hatten ein Häuschen, das am Abhang des Sperlingsberges lag und dessen Räume in jeder Beziehung niedlich waren. Die Beletage bestand aus einer Stube und Kammer; ebensoviel Piecen enthielt auch das Parterre nebst einer Küche, ein kleiner Hof das Federvieh, Holz- und andern Stall, worin sich die unvermeidliche Ziege befand, die jede Weimarische Bürgerin haben mußte, wollte sie für eine wirtschaftliche Hausfrau gelten. Für Futter brauchte nicht gesorgt zu werden, denn in diesem netten Stadtviertel wuchs Gras genug auf den Straßen. Die Krone von diesem kleinen Rittergut war ein Garten, der wenigstens zwanzig Schritte im Quadrat hatte und in dem sich außer einigen Gemüsebeeten ein Apfel-, ein Birn-, ein Kirsch- und zwei Pflaumenbäume befanden. Lange bevor das Obst reif wurde, bewies ich meine Fertigkeit im Klettern, dann erscholl wohl aus dem Hinterfenster einer Nachbarin: »Verfluchter Junge, willst de gleich vom Bome! se sinn ja noch nich reif!« Alles kam mir noch riesengroß vor, als ich in meinem achten Jahre dies Eldorado verlassen mußte, und wäre wahrscheinlich in meiner Phantasie auch so geblieben, da ich seit jener Zeit die Schwelle dieses Hauses nie wieder betreten hatte, hätte nicht meine Frau, nachdem ich im Jahr 1829 nach Weimar zurückgekehrt, kurz nach unserer Ankunft den Wunsch geäußert, die Stätte zu sehen, wo ich geboren worden war.
Der Zimmermann, der vor 25 Jahren das Haus von meinem Vater gekauft hatte, wohnte noch mit seiner Frau darin. Freundlich wurden wir von dem alten Ehepaar empfangen, als ich ihnen unsern Wunsch mitgeteilt. Mit ganz eigenen Gefühlen betrat ich gebückten Hauptes, damit mein Kopf nicht mit dem Rahmen der Tür in unangenehme Berührung käme, die ehemalige Wohnstube. Ja, da stand er noch, der alte Kachelofen, hinter den ich und meine Schwester uns gekauert hatten, wenn uns die Magd oder eine alte Muhme grausige Spukgeschichten erzählten. Daneben war die kleine Kammer, wo ich das Licht der Welt erblickt hatte. Ich hatte oft gegen meine Frau mit einem gewissen Selbstgefühl von unserm wohnlich geräumigen Besitztum gesprochen, und jetzt war alles so klein und ärmlich, daß ich in namenlose Verlegenheit geriet; noch hoffte ich auf den Garten, aber auch der machte mich zum Aufschneider, als ich hineintrat. Voll Ärger sagte ich: »Ach! der ist ja viel größer gewesen!« Der Zimmermann versicherte aber, daß nicht ein Stückchen davon weggekommen sei, und auch die Nachbarsleute, von denen ein altes Gesicht nach dem andern aus den Hinterfenstern heraussah – denn es war ja ein förmliches Ereignis, daß das kleine wilde »Edewardchen« mit seiner großen schönen Frau den Nachbar besuchte – bestätigten die Aussage. »Ja, ja, mein liebes Madamchen!« rief eine alte Frau, »wir haben das kleene Edewardchen oft genug da herumspringe sehn; was konnte der klettern und was vor scheene Purzelböme konnte er schlage.« Das war vermutlich die Dame, die öfter geschrien hatte: »Verfluchter Junge, willste gleich vom Bome!« Ich war ganz ergrimmt gegen mich, als wir uns den Nachbarsleuten empfohlen und dem alten Ehepaar die Hand gedrückt hatten, und voll Schamgefühl über meine Großtuerei meiner Frau gegenüber; aber sie drückte meinen Arm an sich und sagte: »Du glaubst nicht, welche süßen Gefühle mich in diesem Augenblicke beleben, und wie mich deine kindliche Phantasie teils belustigt, teils gerührt hat. Es ist gar zu schön, die Stätte kennen zu lernen, wo uns das Liebste geboren worden ist.«
Im Jahre 1805 verkaufte mein Vater die eben beschriebene Besitzung und wir bezogen ein neues Haus am Graben.
Am 9. Mai dieses Jahres kam mein Vater sehr spät in der Nacht nach Hause. Er trat weinend zum Bett meiner Mutter und sagte: »Schiller ist tot!« Nachdem er uns geküßt und mit der Mutter noch einiges gesprochen, legte auch er sich zu Bett, aber ich hörte ihn noch lange stöhnen und seufzen.
Hier ist es wohl am Orte, eines Umstandes zu gedenken, welcher irrtümlich zum Nachteil der Anordner von Schillers Begräbnis und der damaligen Bewohner Weimars schon so oft ausgebeutet worden ist. Zunächst verweise ich den Leser auf die kleine Broschüre: »Schillers Beerdigung«, von Dr. Julius Schwabe aus den Papieren seines Vaters Karl Leberecht Schwabe herausgegeben (Leipzig 1852). Sie enthält eine getreue Darlegung des Tatbestandes und stimmt ganz mit dem überein, was mir mein Vater darüber mitgeteilt, nur daß nicht bloß, wie dort ausgesprochen ist, Gelehrte und herzogliche Beamte den Sarg des großen Toten trugen und bestatteten, sondern auch die Mitglieder des Hoftheaters: die beiden Regisseure Genast und Becker, mit denen Schiller fast in täglichem Verkehr gestanden, die Schauspieler Malkolmi, Graff, Haide, Unzelmann, Oels und Wolff, die ihm mit inniger Liebe ergeben waren, weil er ihnen stets ein wohlwollender Lehrer und Leiter bei ihren Aufgaben gewesen, folgten seiner Bahre und nahmen teil an dem Trauerzug. Dem älteren Schwabe kommt das Verdienst zu, daß Schillers Begräbnis nicht so einfach wurde, wie es die Witwe selbst gewünscht und wie sie den damaligen Oberkonsistorialrat Günther damit beauftragt hatte; er ging mit Genehmigung der Frau von Schiller zu Günther und sagte ihm: »Ich bin von Frau von Schiller an Sie gewiesen und bitte Sie dringend, zu gestatten, daß nicht Handwerker, sondern Männer, welche Schillers Genius zu würdigen wissen und es lebhaft empfinden, was die ganze gebildete Welt an ihm verloren hat, ihm die letzte irdische Ehre erweisen und ihn zu Grabe tragen dürfen.« Schwabe erhielt die trockene Antwort von Günther: »Ja, lieber Freund, das geht nun nicht mehr, es ist schon alles angeordnet; alles soll in der Stille geschehen, auch sind bereits die Träger bestellt.« Nach langem Bitten und erst als Schwabe das Versprechen gegeben, die Träger zu bezahlen, wenn sie auch nicht den Sarg trügen, wurden diese abbestellt und von dem geistlichen Herrn Schwabe die Erlaubnis zu seinem Vorhaben erteilt. Nachts um 12 Uhr fand die Beerdigung statt. Vor dem Sarge gingen die Schüler der ersten Klasse mit Laternen; diesen folgten die oben genannten Herren vom Theater, außer Graff und Haide, die den Sarg mit trugen. Die ferneren Träger waren Karl und Wilhelm Schwabe, Professor Voß, Gebrüder Träuter, St. Schütze, Klauer, Helbig, Irrgang, Brehme, Kannegießer, Oettelt, Lungershausen, Jagemann, Westermeyer, Weißer und Stark, alle teils Staatsbeamte, teils Maler, Bildhauer und Literaten. Hinter dem Sarge ging ein großer Mann in einen Mantel gehüllt, der fast das Gesicht bedeckte, der Sage nach Goethe; dem war aber nicht so, denn dieser war krank und wußte nichts von Schillers Tod, noch weniger von dessen Beerdigung. Schillers Schwager, Herr von Wolzogen, war von Naumburg zu diesem Akt der Trauer herübergekommen.
Ein Schrei der Entrüstung erscholl in der ganzen literarischen Welt über den Vandalismus, daß Schillers Leiche von Schneidern getragen worden wäre, und besonders schrie Herr von Archenholtz Zeter über Weimar. Es war dem guten Manne nicht bekannt, daß die Toten, die im Leben einen hohen Rang eingenommen, von den Innungen, welche man allerdings dafür bezahlte, zu ihrer letzten Ruhestätte gebracht wurden; dies war der damalige Brauch, und niemand konnte sich ohne spezielle Erlaubnis der Behörde dem entziehen. Wenn aber auch der Sarg von Schneidern getragen worden wäre, so wäre Schillers Leiche dadurch doch nicht entehrt gewesen, selbst nicht was die Würdigung seiner Größe betrifft, denn mancher dieser Handwerker war vielleicht vertrauter mit Schillers Werken als viele der Schreier.
Rochlitz sagt in seinem Werke »Für Freunde der Tonkunst« über seinen Aufenthalt in Weimar: voller Erstaunen hätte er einfache, schlichte Handwerker ganze Stellen aus Wallenstein ohne Anstoß rezitieren hören; und noch jetzt findet man unter dieser Klasse mehr Verehrer Schillers als unter der sogenannten gebildeten Welt.
Auch Goethes Sarg wurde von vierundzwanzig Weimarschen Bürgern, die allen Gewerken angehörten, getragen und in der Fürstengruft beigesetzt.
Zweites Kapitel.
Das Jahr 1806. – Die Schlacht bei Jena. – Die Jagd am Ettersberg. – Talma.
In Weimar war eine Menge preußisches Militär eingezogen, so daß Stadt und Umgegend davon wimmelten. Am 13. Oktober 1806 hörte man unbestimmte Nachrichten von einer Schlacht bei Saalfeld. Es hieß, der König von Preußen und seine Gemahlin wären in der Stadt; gegen Mittag wurde Generalmarsch geschlagen; die Regimenter der Stadt und Umgegend brachen auf und nahmen den Weg nach Jena, die Durchmärsche wollten gar kein Ende nehmen. Wir Jungen liefen von einem Ort zum andern, wo es was zu sehen gab. Endlich hieß es: »Der Generalstab bricht auf!« und natürlich waren wir die ersten vor dem Hause des Kommandierenden. Viele Pferde standen davor und eine Menge Offiziere kam heraus, zuletzt der Kommandierende selbst, ein ganz alter Mann, der mit Hilfe zweier Begleiter und mittels eines Faßbänkchens aufs Pferd hinausgehoben werden mußte. Die ganze Kavalkade nahm den Weg nach Jena. Bis auf die Reserve war nun alles fort, und auch diese rückte später nach.
Es war am 14. Oktober; ich ging früh mit der Mutter aus, um Einkäufe zu machen, da der Vater befohlen hatte, so viel Lebensmittel als irgend möglich herbeizuschaffen. Da hörten wir ein dumpfes Donnern. »Mutter!« rief ich, »was ist denn das?« »Das ist Kanonendonner, mein Söhnchen,« sagte ein Bürger, der vor seiner Tür stand. Die Schlacht hatte begonnen, und ich bat die Mutter, doch schnell zu gehen, damit wir bald nach Hause kämen. In banger Besorgnis wurde der Vormittag verbracht, zumal da das Schießen hier und da näher zu kommen schien. Die ganze Nachbarschaft war an den Fenstern und jeder Vorübergehende wurde angerufen und befragt; einer sagte: »Die Preußen siegen«, ein anderer schrie: »Die Preußen sind geschlagen! Die Franzosen sollen schon das Mühltal haben; Jena brennt an allen Ecken!« Endlich ging mein Vater aus, um nähere Nachrichten einzuholen; dieselben lauteten schlimm genug; es bestätigte sich, daß die Franzosen bereits in dem Besitz der Höhen des Mühltals wären. Er war mehreren Wagen mit Verwundeten begegnet, die in der schnell zum Spital eingerichteten Stadtkirche untergebracht wurden. Alles sprach nur von Jena; von der grimmigeren Schlacht bei Auerstädt wußte man gar nichts, und doch war es hier, wo die Weimarschen Schützen sich mit solcher Bravour geschlagen hatten, daß Napoleon gesagt haben soll: »Wenn ihm sechs Regimenter solch tapferer Soldaten gegenüber gestanden hätten, wäre ihm der Sieg sauer gemacht worden.« So war es leider nur ein Bataillon, aber es tat seine Schuldigkeit, denn die meisten französischen Offiziere sind auf diesem Kampfplatz gefallen.
Nach Tische wurde der Kanonendonner immer heftiger und kam näher. Ich wich nicht von unseren Fenstern, die, nach dem Graben gelegen, den Überblick über die breiteste Straße, welche nach Erfurt führte, gewährten. Gegen vier Uhr kamen schon mehrere Bagagewagen und auch einzelne Flüchtige in vollem Galopp daher; unter ihnen zwei Kürassiere, die einen verwundeten Franzosen zwischen ihren Pferden schleppten. Vor unserm Hause hielten sie still, und der Arme fiel wie tot auf das Pflaster; da sprangen sie ab und zogen ihn bis auf das Hemd aus. Mein Vater rief ihnen ganz empört zu: »Pfui! seid ihr preußische Soldaten?« Die Kerle aber lachten, schwangen sich auf die Pferde und jagten mit ihrem Raube davon. Mein Vater eilte auf die Straße, ich mit einem Glase Branntwein, das mir die Mutter gegeben hatte, hinterdrein. Der Franzose hatte sich während der Zeit aufgerafft und lehnte an der Mauer. Die Nachbarn schafften Kleider herbei und wollten ihn in die Stadtkirche bringen; dem widersetzte sich aber mein Vater wegen der allzugroßen Schwäche des Verwundeten, und da niemand von den Nachbarn den Franzosen aufnehmen wollte, ließ ihn mein Vater in unser Haus bringen, schickte mich nach dem Feldscheer, den ich auch glücklicherweise fand, und so wurde der Arme in einem warmen Hinterstübchen verbunden und zu Bett gebracht.
Ich lief wieder in die Vorderstube an das Fenster, vor welchem sich die Szene furchtbar verändert hatte. Nicht mehr einzelne Flüchtlinge, sondern ein Gewühl aller Waffengattungen, Munitions- und Bagagewagen, auf denen Verwundete lagen, raste vorüber; Marketenderinnen und Musketiere jagten auf Pferden vorbei, die wahrscheinlich von den Geschützen abgeschnitten waren; jedes Pferd hatte zwei Menschen zu tragen, und wer keinen solchen Platz hatte gewinnen können, der hing an den Strängen, um nur schneller fortzukommen; dabei erfüllte Geschrei und Wehklagen fortwährend die Luft. Es war die wildeste, sinnloseste Fucht. Nachdem der ganze Troß vorüber war, wurde es in unserer Straße auf kurze Zeit totenstill.
Etwa zwanzig Schritte von unserm Hause entfernt lag der alte Stadtgraben, der nach der Ilm führte und bis dahin von einem schützenden Geländer begrenzt war. Von unserm geöffneten Fenster aus konnten wir das ganze Terrain übersehen. Da kamen etwa zwanzig Mann sächsischer Dragoner mit einem jungen Offizier an der Spitze die Straße herauf geritten; ich sehe die roten Kollets, weißen Bandeliere und dreieckigen Hüte noch vor mir. An dem Stadtgraben hielten sie auf Kommando still und der junge Anführer rief: »Wer seinem Fürsten und Vaterland treu ist, der halte stand!« Die alten bärtigen Kerle standen; wieder einige Minuten vergingen, da kamen französische Chasseurs, ihren Obristen an der Spitze, ebenfalls die Straße heraus. Mit Zittern sah ich die stolzen Reiter herangesprengt kommen; wie sie etwa noch hundert Schritt von den Dragonern entfernt waren, machten diese links um und jagten davon; nur das junge Offizierchen ließ den Feind ganz nahe herankommen, feuerte seine beiden Pistolen gegen denselben ab und sprengte dann erst den andern nach. Der Obrist hielt einige Chasseurs, die ihm nachwollten, mit vorgehaltenem Degen zurück und lächelte dem jungen Bürschchen recht wohlgefällig nach.
Als es anfing dunkel zu werden, hörten wir Trommeln und Pickelflöten immer näher kommen, und endlich stellte sich in unserer Straße ein Corps auf, welches mir wahres Grauen einflößte: wilde, bärtige Kerle mit langen, schmutzigen Leinwandkitteln und Hosen, dreieckigen Hüten mit einem Löffel darauf. Der Vater erkannte sie als die sogenannten Löffelgardisten und meinte: »Wenn denen freier Spielraum gegeben wird, so sei uns Gott gnädig!« Diese Worte waren das Signal für mich und meine Schwester, daß wir laut zu weinen anfingen, und auch die Mutter vergoß in ihrer Angst Tränen. Der Vater beruhigte uns jedoch und sagte: »Unsere Herzogin Louise ist ja hier geblieben und diese hochherzige Frau wird gewiß alles anwenden, um von Napoleon Schonung der Stadt und ihrer Einwohner zu erlangen.« Das greuliche Corps der Löffelmänner blieb stehen, bis es völlig dunkel wurde; nun schrien sie nach Licht. Einige Nachbarn kamen dieser Forderung nach und stellten Lichter in die Fenster, uns aber verbot der Vater, überhaupt Licht anzuzünden. Endlich gingen die schauerlichen Kerle auseinander und zerstreuten sich truppweis in den nächsten Querstraßen; einige gingen auch auf die Häuser neben uns zu; andere schlugen in einem uns gegenüberliegenden Bäckerhaus mit ihren Gewehrkolben Laden und Fenster ein und stiegen hinein. In größtem Schrecken schrie meine Mutter auf: »Ach, Vater, sie plündern!« Ich verstand die Bedeutung dieses Wortes nicht, sollte aber nur zu bald darüber aufgeklärt werden, denn eben ging das Jammergeschrei und Hilferufen in der ganzen Straße los; der Lärm und das Türeinschlagen nahmen mit jedem Augenblicke zu.
Unser Haus war auf die alte Stadtmauer gebaut, hatte nur drei Fenster Front und war unter einem Dach mit dem des Nachbars; dessen Eingang mündete auf die Straße, unserer hingegen in eine kleine Sackgasse, so daß unser Haus kaum als getrennt von dem des Nachbars zu unterscheiden war; das schützte uns vorläufig.
Plötzlich beleuchtete ein greller Schein die unteren Häuser an der Ilm und durch die Straßen erscholl der Ruf: »Feuer!« Mein Vater lief mit mir auf den Boden des Hauses, um zu sehen, wo es brannte. Nach den brennenden, fliegenden Kohlen, die sich nach allen Richtungen verteilten und das Dach der Kirche, worin die armen Verwundeten lagen, mit einem wahren Feuerregen überschütteten, glaubte mein Vater, daß die Schmiede zunächst dem Schloß brennen müsse.
Wir gingen wieder hinab und setzten uns an einen Tisch auf dem kleinen Vorplatz, der an der Treppe lag und von wo aus der Schein des Lichtes nicht nach außen fallen konnte. Trotz ihrer Angst hatte die Mutter den armen Kranken nicht vergessen und gab ihm von Zeit zu Zeit etwas ein, um das Wundfieber zu stillen. Nach und nach wurde es ruhiger auf den Straßen; das Jammergeschrei und Hilferufen hatte aufgehört und nur das Feuer nahm zu.
Bis jetzt war kein Soldat bei uns eingedrungen; wir glaubten uns schon sicher und saßen eben wieder auf unserem Vorplätzchen still beisammen, als ein furchtbarer Schlag an unsere Haustür geschah. Mein Vater stand auf und rief: »Qui vive?« – »Bon ami!« war die Antwort und mein Vater öffnete. Meine Mutter stand zitternd am Tisch; meine Schwester und ich verbargen uns in eine Ecke, als wir in den Eintretenden zwei Löffelmänner erkannten. Der Vater führte sie, als er die Türe wieder verschlossen hatte, herauf, setzte sich mit ihnen an den Tisch und die Mutter mußte das wenige Essen, das wir noch hatten, nebst Branntwein herbeischaffen. Sie aßen und tranken, während der Vater mit ihnen sprach und ihnen wahrscheinlich die Geschichte von unserm Verwundeten erzählte, denn sie standen plötzlich auf und ließen sich in dessen Stube führen; als sie zurückkamen, drückten sie Vater und Mutter die Hand und gingen; der Vater wollte ihnen in seiner Freude noch Geld mitgeben, sie nahmen es aber nicht an.
Bei Tagesanbruch wurde abermals an die Haustür gedonnert; der Vater ging hinunter, machte auf und wurde von einigen zwanzig Mann von diesen Löffelgardisten, welche hereinstürmten, gleich an die Wand geworfen. Er war aber ein beherzter Mann, raffte sich schnell auf, sprang die Treppe hinauf und stellte sich schützend vor die Mutter und uns Kinder; dann sprach er den Leuten zu und wies auf die Tür, wo der Verwundete lag; die Kerle aber lachten, stürmten an uns vorüber und verteilten sich in die oberen und unteren Räume.
In dieser grenzenlosen Not rasselte es abermals zur Treppe herauf; aber diesmal zu unserer Hilfe, es war rechtmäßige Einquartierung: ein Wachtmeister mit zwei Chasseurs, die mit den plündernden Kerls kurzen Prozeß machten und sie zum Hause hinausjagten. So waren wir der Plünderung glücklich entgangen.
Der Vater führte nun auch unsere Chasseurs in die Stube des Kranken. Da war der Jubel unbeschreiblich, als sie in ihm einen Kameraden erkannten; auch der Kranke schien sehr erfreut, aber das Wundfieber hatte ihn so gewaltig erfaßt, daß er der Ruhe bedurfte. Nun ging das Händedrücken zwischen dem Vater und den Soldaten wieder los, und der Wachtmeister, der aus dem Elsaß war und deutsch sprach, sagte: »Sie sind ein braver Mann!« Alle Reste von Fleisch, Butter, Brot und Branntwein wurden aufgetragen und das Verhältnis zwischen uns und unsern Gästen wurde bald ein ganz gemütliches.
Nach dem Frühstück wagten sich Mutter und Schwester unter dem Schutze eines Chasseurs hinaus, um womöglich einige Einkäufe für den Mittag zu machen, und auch der Wachtmeister ging kurze Zeit darauf aus und nahm mich mit; wäre die Mutter zu Hause gewesen, so hätte sie dies gewiß nicht zugegeben.
Wie hatte sich die Stadt seit gestern verändert! Die zerschlagenen Türen und Fenster, die zerbrochenen Möbel, die zerhauenen Betten, die zertrümmerten Kochgeschirre, das Stroh, welches auf der Straße umherlag, – es war schrecklich anzusehen. Ich entsetzte mich auch gehörig darüber, aber mein Wachtmeister ging gänzlich teilnahmlos an dieser Zerstörung vorüber, weil er wahrscheinlich ähnliches gewohnt war.
Nach mehrstündiger Abwesenheit kehrte ich mit meinem Wachtmeister wieder heim, und meine Mutter, die große Angst um mich ausgestanden hatte, empfing mich mit einem wahren Freudenschrei; sie hatte wohl gar gefürchtet, die Franzosen hätten ihr Eduardchen mitgenommen.
Bei Tische ging es munter her. Der Vater erzählte, wie er gehört habe, hätte die Herzogin Louise eine lange Unterredung mit Napoleon gehabt, nach welcher das Plündern bei Todesstrafe verboten worden sei.
Unser Wachtmeister blieb noch einige Tage bei uns, da er eine leichte Wunde im Kampf davongetragen hatte, dann rückte er seinem Regimente nach. Dasselbe tat auch unser Kranker, sobald er wieder vollkommen hergestellt war. – –
Das Jahr 1808 brachte eine große Zeit für Weimar: in Erfurt tagten Napoleon, der Kaiser Alexander und die deutschen Fürsten. Sämtliche hohen Häupter waren nach Weimar gekommen, um einer großen Jagd, die Karl August veranstaltet hatte, beizuwohnen. Napoleon aber soll sich dabei als ein sehr schlechter Schütze bewiesen haben.
Die französische Schauspielergesellschaft, die Napoleon an diesem Tage von Erfurt nach Weimar beordert hatte, gab abends im Hoftheater den »Tod Julius Cäsars«.
Das Orchester war mit einer Estrade überbaut, auf welcher die beiden Kaiser auf Thronsesseln saßen; im Parkett hatte man die Könige und Großherzoge plaziert, im Parterre die anderen Fürsten; den ersten Rang nahmen nur Damen ein. In der herrschaftlichen Mittelloge hatten die Königinnen von Westfalen und Sachsen, unsere Herzogin Louise, die anderen Fürstinnen und Prinzessinnen ihre Plätze und außerdem die diensttuenden Marschälle und Kammerherren, sonst war niemanden der Zutritt dahin gestattet. Denjenigen Staats- und Hofbeamten, welche im Rang eines wirklichen Rats standen, war der letzte Platz, die Galerie, angewiesen. Im Proszenium standen auf jeder Seite zwei Gardisten mit ausgestoßenem Gewehr.
Ich hatte wieder Vorteil aus meines Vaters Stellung gezogen; denn da derselbe die Bühne nach Anordnung des französischen Regisseurs einrichten mußte, so war es mir ein Leichtes gewesen, mich auf dem Theater einzuschmuggeln. Der französische Regisseur, im gestickten Hofkleide, den Degen an der Seite, war ein freundlicher alter Herr, der in der ersten Kulisse saß und mich zu wiederholten Malen zwischen seine Knie nahm, so daß ich die Bühne und die beiden Kaiser prächtig sehen konnte. Daß mich die letzteren weit mehr interessierten, als was da oben vorging, da ich von den französischen Schauspielern ja keinen verstand, war natürlich; nur einer darunter machte trotzdem einen tiefen Eindruck auf mich. Seine Stimme war so voll und stark, er sprach so ausdrucksvoll und bewegte sich dabei so schön und natürlich, daß er hervorstach, da die anderen meist schrien, sehr gespreizt gingen und mit den Armen fortwährend in der Luft herumfuhren.
Beim Nachhausegehen sagte ich: »Ach, das war schön, Papa! Aber nicht die Komödie, denn von den Schauspielern hat mir nur einer gefallen, der, welcher den, der so viel meckerte, niedergestochen hat.« – »Das war auch der Talma, mein Junge,« erwiderte der Vater.
Am andern Tage wurde eine Hasenjagd auf dem Schlachtfelde von Jena auf Befehl Napoleons veranstaltet. Alle anwesenden Fürsten nahmen teil, nur unser Herzog ließ sich wegen Unwohlseins entschuldigen. Diese Perfidie mag seinem echtdeutschen Herzen doch wohl übers Maß gegangen sein.
Drittes Kapitel.
Mein Debut. – Kinderkomödien vor Goethe. – Maskenzeug. – Konditorlehrjahre. – Napoleons Flucht.
Ich hatte bereits in verschiedenen Stücken, wo Kinderstalisten vorkamen, mitgewirkt, am liebsten tat ich es aber in den »Hussiten vor Naumburg«, denn außer dem Spielgroschen, den ich bekam, gehörte zur Handlung des Stücks auch die Verteilung sehr schöner Milchbrötchen, und wer einige Frechheit besaß, konnte deren auch zwei erlangen. Bei mir war eben kein Mangel dieser Eigenschaft vorhanden, und außerdem drückte auch der Requisiteur, welcher als grimmiger Hussit die Milchbrote auf der Szene zu verteilen hatte, ein Auge zu, da der Papa des frechen Jungen Regisseur war.
In meinem elften Jahr wurde ich zum ersten Male mit einer Rolle betraut, mit dem Kellnerjungen im »Porträt der Mutter«, der im Namen seines Vaters den Rekau zu mahnen hat. Ich tat das mit so ungeheurer Keckheit, daß das Publikum lachte und applaudierte; auch der Papa schmunzelte und schien nicht ganz unzufrieden mit seinem Söhnchen zu sein. Das machte mich natürlich immer kühner, und als ungezogener Schuljunge in »Das Dorf im Gebirge« kannte meine Ausgelassenheit keine Grenzen. Der Papa hatte mir schon auf der Probe mehrere Male zugerufen: »Schlingel, übertreibe nicht!« Ja, da war aber alles umsonst, an meinem Künstlereifer ging jede Warnung spurlos vorüber. Als die Vorstellung aus war, eilte ich im Gefühl meiner Vollkommenheit nach der Garderobe meines Vaters; auf dem Wege dahin begegnete mir die berühmte Wolff und sagte: »Junge, du warst unausstehlich!« Mit einem verachtenden Blick ging ich an ihr vorbei, denkend, mein Vater sei ein gerechterer Mann, und trat in seine Garderobe; mit einem gewittervollen Gesicht jedoch empfing er mich und sagte: »Du hast deine Sache so gut gemacht, daß ich dich selbst applaudieren muß,« und dabei gab er mir eine tüchtige Ohrfeige. Die freundliche Ansprache der Wolff und meines Vaters Donnerkeil, der auf mein armes Gesicht gefallen war, hätten eigentlich meinen Theaterenthusiasmus etwas abkühlen sollen, aber ganz das Gegenteil trat ein, und da ich von nun an nur wenig Gelegenheit hatte, mein Talent öffentlich zu zeigen, so wurde ein bedeckter Altan in unserm Hause zu einer Bühne eingerichtet, und meine Spielkameraden, zu denen vorzugsweise Christian Lobe (später Professor in Leipzig) gehörte, klebten und malten mit mir so lange, bis wir etwas, was Dekorationen ähnlich sah, zu stande gebracht hatten. Nun war keine Oper und namentlich kein Ritterstück mehr vor uns sicher. Außerdem ging ich noch jeden Abend ins Theater; kurz, ich lebte und webte in der Kunst.
Goethe liebte Kinderkomödien. Er hatte schon im Jahre 1805 sich eine solche zu seinem eigenen Amusement vorspielen lassen, und zwar: »Die beiden Billets«, worin meine Schwester den Jörgen, Heinrich Becker, ein Sohn des Regisseurs Becker, den Schnaps, und Corona Becker, Tochter der unvergeßlichen Neumann, das Röschen spielte. Er ergötzte sich schon bei der Probe, die er selbst abhielt, an dem Ernst der Kinder, mit welchem sie die Sache behandelten. Die Vorstellung, zu der eine kleine Gesellschaft von seiten Goethes eingeladen worden war, fand bei vollständiger Beleuchtung des Theaters statt. Den Kindern ward reicher Beifall gespendet, am Schlusse wurden sie gerufen und Goethe sagte: »Man reiche ihnen als Lohn ein Glas Punsch!« – Im Jahr 1810 ließ er sich ebenfalls eine Kinderkomödie vorspielen: »Blind geladen« von Kotzebue, worin ich und mein Freund Christian Lobe auch mitwirkten; letzterer gab den Rittmeister und ich den Hauptmann. Bei der Probe ging alles trefflich von statten. Lobe und ich schossen aufeinander wie Helden. Bei der Vorstellung aber hatte Lobe im Eifer des Spiels vergessen, den Hahn zu spannen. Mein tödliches Geschoß war schon auf ihn abgefeuert, aber er drückte vergebens. Ich konnte mir denken, wo der Knoten steckte, sprang auf ihn zu, spannte den Hahn und lief wieder zurück an meinen Platz; denn das Stürzen ohne Schuß wäre mir gräßlich gewesen. Es knallte und ich überschlug mich wie ein Seiltänzer. Ein Bravo ertönte aus Goethes Loge, was meiner Geistesgegenwart so gut als meiner Plastik gelten konnte.
Zum Geburtstag der Herzogin Louise hatte Goethe einen großen Maskenzug bei Hofe arrangiert. Der Prologus, Minister von F..., konnte doch unmöglich auf dem platten Boden des Parketts stehen, es mußte also eine Erhöhung herbeigeschafft werden; einen Stuhl hinzustellen, um ihn zu besteigen, wäre zu prosaisch gewesen, darum wurde aus dem Theater ein gemalter Marmorwürfel requiriert und ich zum Träger desselben von Goethe erkoren. Goethe war der Kommandierende des Ganzen, und mein Vater sein treuer Adjutant. Ich sehe beide noch vor mir; Goethe als Tempelherr sah prachtvoll aus; mein Vater ging als Sarmate, sein Anzug war der Theatergarderobe entnommen und stach gewaltig ab gegen die reichen Kostüme des Adels. Alles strahlte in glänzenden Gewändern, mit Perlen und Diamanten übersäet, nur unsere Herzogin Louise saß in ihrem einfachen schwarzseidenen Kleid mit weißer Spitzenhaube und Kragen auf ihrem Thronstuhl und sah sich die Sache mit an. Erst ging der Zug einmal an ihr vorüber, dann stellte er sich auf. Der Prologus bestieg den Marmorblock, und der rhetorische Teil begann. Der Zug setzte sich langsam wieder in Bewegung und schritt in voriger Ordnung abermals vor der Herzogin vorbei, nur daß diesmal jede Maskengruppe vor der hohen Geburtstägerin stehen blieb, bis die Verse, welche die Bedeutung jeder Gruppe erklärten, gesprochen waren. An Schüchternheit litt ich durchaus nicht, und sobald der Ball eröffnet wurde, war ich einer der ersten, welcher sich mit in die Reihen mischte.
Als ich mein vierzehntes Jahr erreicht hatte, wurde ich konfirmiert. Ich glaubte nach diesem feierlichen Akte ein gemachter Mann zu sein und nun meine künstlerische Laufbahn ganz nach Neigung verfolgen zu können. Wie wurde ich aber durch eine Unterredung mit meinem Vater aus allen meinen Himmeln gerissen!
Er fragte mich eines Tages, was ich werden wolle. »Nun,« antwortete ich keck, »natürlich Schauspieler!« – »Warum nicht gar!« erwiderte er. »Du hast keine Spur von Talent und sprichst abscheulich durch die Nase.« »Aber ich will Schauspieler werden,« rief ich trotzig. »Siehst du, Junge,« sagte der Papa, »ich breche dir alle Knochen im Leibe entzwei, wenn du den dummen Gedanken nicht aufgibst!«
Ich fragte schluchzend, was ich denn lernen solle. »Ein Metier sollst du lernen,« herrschte mich der Vater an; »entweder Uhrmacher oder Goldschmied; du kannst auch Kaufmann werden. Ich sage dir, mein Sohn, ein schlechter Schauspieler ist schlimmer daran als ein Steinklopfer.«
Der Vorschlag mit dem Kaufmann war nicht so übel, von wegen der Rosinen und Mandeln; ich dachte nach. Da fiel mir ein Spielkamerad ein, der in der Hofkonditorei dies edle Metier erlernte; da gab es ja noch bessere Sachen als Rosinen und Mandeln, und keck sagte ich: »Konditor will ich werden!« Der Entschluß wurde vom Vater mit dem Bemerken angenommen, daß ich es mir nochmals reiflich überlegen sollte, denn wäre ich erst einmal dabei, so müßte ich ohne Gnade auslernen, sonst bliebe es bei dem Knochen zerbrechen. Mein Entschluß blieb wirklich fest, denn die Aussicht auf all die Süßigkeiten war ja gar zu lockend, und so wurde ich denn Lehrjunge in der Schloßkonditorei.
Da der Chef des ganzen Hofhaltes, der geheime Hofrat Kirms, ein intimer Freund meines Vaters war, ging es mir sehr gut; das ganze Personal, Knechte, Mägde, Gehilfen, hatten Nachsicht sowohl mit meiner anfänglichen Ungeschicklichkeit, als auch mit meinen tollen Streichen. Im übrigen war ich auch fleißig und aufmerksam, und die anstrengende Arbeit machte aus dem kleinen Knirps in Jahr und Tag einen langen, kräftigen Bengel.
Obgleich mir mein Geschäft ganz wohl gefiel, war doch das Theater mein stetes Ideal, und jeden Abend war ich dort zu finden. Ich war nun in dem Alter, wo der Knabe zum Jüngling wird, und aus dem heiseren Diskant entwickelte sich eine ganz leidliche Baritonstimme. Da erschallten denn zur Arbeit alle möglichen Opernarien. Beim Eismachen, das eine sehr langwierige und ebenso langweilige Arbeit ist, wurde öfter auch ein Stück von Schiller vorgenommen, und während ich die Büchse drehte, rezitierte ich dazu: »Ich zählte zwanzig Jahre, Königin!« oder: »Durch diese hohle Gasse muß er kommen!« War der Befehl gegeben, Champagnereis zu machen. so wurde natürlich »Treibt der Champagner alles im Kreise« gesungen und mit der Tat bekräftigt, indem ich einige Gläser dieses Nektars hinunterschlürfte. – –
Die Zeit war herangekommen, wo der kleine französische Korporal dem russischen Riesen zu Leibe ging. Wir bekamen ungeheuer viel Durchmärsche und Einquartierung. Die Kriegsereignisse wurden eifrigst verfolgt. Nicht ohne Schrecken hörten wir von dem immer weiteren Vordringen der französischen und dem Zurückweichen der russischen Armee. Da kam eines Tages, noch ehe die Katastrophe in Moskau und die schauerliche Flucht der Franzosen bei uns bekannt war, ein einfacher Schlitten, worin zwei Männer dicht in Pelze eingehüllt saßen, vor die Post gefahren, die dem Schloß und den Fenstern der Konditorei damals gerade gegenüber lag. Den Schlitten begleiteten mehrere sächsische Dragoner, und nachdem die Pferde gewechselt waren, ging die Reise im schnellsten Jagen weiter. »Aha,« sagte ich, »da wird ein Gefangener transportiert.« Wie erstaunten wir aber, als man uns kurze Zeit darauf erzählte, daß es Napoleon gewesen sei.
Da fuhr er hin, der Sieger von Jena, der vor vier Jahren auf dem Schlachtfeld daselbst, zum Hohn aller deutschen Stämme, eine Hasenjagd anbefohlen hatte; er selbst jetzt ein armer gehetzter Flüchtling.
So kam das Jahr 1813 heran. Im Anfang desselben wurde ich in meinem Geschäft losgesprochen, d.h. ich hatte ausgelernt. Es war nun aus dem Lehrjungen ein selbständiger Konditor geworden, mit dem Prädikat eines Gehilfen, nicht Gesellen; diese gab es nicht bei dem edlen Metier der Konditorei. Vorläufig blieb ich dabei und erhielt monatlich vier Taler Besoldung.
Der Jubel über die Niederlage der Franzosen wurde sehr abgeschwächt, als die Nachricht kam, daß Napoleon sich wieder gewaltig rüste und daß an einen Frieden gar nicht zu denken sei. Auch sollten wir bald erfahren, daß diese Kunde richtig gewesen war. In Weimar entfaltete sich abermals ein aufregendes, kriegerisches Leben, und Napoleon selbst sahen wir noch einmal an der Spitze einer Armee. Das Souhamsche Korps, ungefähr 10060 Mmn, rückte in die Stadt ein; am 27. April kam Napoleon selbst und fuhr sogleich ins Schloß, wo ihm der Herzog und die Herzogin bis zur untersten Treppe entgegen kamen. Kaum hörte ich diese Nachricht, so lief ich rasch nach einer Nische, die neben der großen Haupttreppe war und von wo aus ich mir den großen Helden recht in der Nähe betrachten konnte. Achtspännig kam er daher gefahren; sein Mameluk Rustan saß auf dem Bock, und als der Wagen hielt, sprang er herab, riß den Schlag auf und half Napoleon heraus, ihm Zobelpelz und Mütze abnehmend und dafür den dreieckigen Hut reichend. Diesen setzte der Kaiser aber nicht auf, sondern er begrüßte erst die Herzogin mit einem Kuß auf die Stirn, bot ihr dann den Arm mit einem bezaubernden Lächeln und führte sie die Treppe hinaus. Von dem Herzog nahm er gar keine Notiz. Nach zwei Stunden ungefähr kam er mit dem Herzog herab; beide stiegen zu Pferde und ritten über die Sternbrücke der Straße nach Naumburg zu; eine Menge Generale in reich gestickter Uniform folgte ihm. Er, der Allgewaltige, trug seine einfache Jägeruniform, worauf nur das Ritterkreuz der Ehrenlegion zu sehen war, während sein Gefolge in Sternen und Orden strahlte. Da zog er hin, der Mann mit dem gelben Marmorgesicht, von dem das bezaubernde Lächeln jetzt ganz verschwunden war; nur zwei dunkle Sterne blitzten aus den steinernen Zügen hervor. Da ritt er hin, der Heros, vor dem die ganze Welt gezittert hatte und noch zitterte. Es war uns allen wie ein Traum, daß derselbe Mann vor noch nicht sechs Monden vor eben diesem Schloß als Flüchtling, nur von wenigen Soldaten begleitet, vorbeigejagt war und jetzt an der Spitze von 120000 Mann stand, die er wie aus einem Nichts hervorgezaubert hatte.
Drei Tage dauerten die Durchmärsche und Einquartierungen. Wie war der Freiheitsjubel verstummt, der noch vor kurzem in den Straßen Weimars erklungen war! Jetzt sah man nur trübe und ängstliche Gesichter, und wie steigerte sich diese Niedergeschlagenheit, als die Nachricht kam, daß bei Lützen eine Schlacht stattgefunden, in der die Franzosen Sieger geblieben wären!
Viertes Kapitel.
Gesangsunterricht. – Gastspiel in Halle. – Die Schlacht bei Leipzig. – Übergabe von Paris. – Erstes Auftreten.
Meine Stimme hatte sich immer mehr entwickelt, und obgleich mein Vater durchaus nichts vom Theater wissen wollte, gab er doch endlich zu, daß ich bei dem Musikdirektor Karl Eberwein Gesangsunterricht nahm. Er lehrte mich reine Intonation und regelrechten Anschlag des Tons. Meine Töne unter dem tiefen Baß-g hatten sehr wenig Klang, aber ich kaprizierte mich, ein tiefer Bassist zu werden, denn der berühmte Stromeier war einer, und der war mein Ideal. Ich versuchte auf alle mögliche Weise das tiefe d hervorzubringen, welches bei der Arie des Osmin: »Ha, wie will ich triumphieren!« so nötig ist. Endlich glaubte ich am Ziel meines Wunsches zu sein, und mit einer Art Selbstgefühl ging ich zu meinem Lehrer, um ihm besagte Arie vorzusingen. Dieser schmunzelte bei dem tiefen d, was ich im Anfang für Beifall nahm, aber mein Wahn wurde mir gleich darauf durch die Worte: »Mein Lieber! das ist ja kein Ton mehr, sondern nur ein Brummen!« benommen; trotzdem setzte ich mein Studium fort, aber vergeblich; ich wollte wohl, aber die Natur wollte nicht, und so blieb es denn bei dem Brummen.
Ende Juni trat die Weimarische Schauspielergesellschaft ihre Sommerreise nach Halle an. Die Zeitverhältnisse geboten Vorsicht, daher ging diesmal nur das Schauspiel dahin und die Oper blieb in Weimar, um den bedeutenden Kostenaufwand zu sparen. Da aber die meisten vom Schauspiel auch sangen, so wurden wenigstens kleine Singspiele gegeben. Zu meiner großen Freude durfte ich diesmal Eltern und Schwester begleiten. Letztere war schon seit fünf Jahren beim Theater; sie hatte eine schöne Sopranstimme mit so viel natürlicher Geläufigkeit, daß sie Rollen, wie die Königin der Nacht, mit glücklichem Erfolge sang; außerdem spielte sie im Schauspiel Soubretten und Liebhaberinnen.
Auf der Fährt nach Halle gab es eine lustige Episode. »Die Henne«, ein einsam gelegenes Wirtshaus, war eine historische Merkwürdigkeit, weil in früheren Jahren einmal die Wirtin dieses Hotels, als auch die herzoglich Weimarischen Hofschauspieler dort vorüberfuhren, ihrer Magd zugeschrien: »Marie, duck de Wäsche wäet, de Bande kummt!« Auch diesmal stand die Vorsichtige, die allerdings unterdessen alt und dick geworden war, mit eingestemmten Armen vor ihrer Tür, und von den Männerlippen ertönte aus allen Wagen: »Marie, duck de Wäsche wäet, de Bande kummt!« Sie gebrauchte als Antwort eine Phrase, nach der sie uns sogleich die Kehrseite zuwendete.
Zwei Monate verbrachte die Gesellschaft in Halle. Die Stimmung der Einwohner war gegen voriges Jahr, wo ich meine Eltern auf vierzehn Tage in Halle besucht hatte, allerdings eine sehr gedrückte. Obgleich man es an der alten Gastfreundschaft nicht fehlen ließ, vermißte man doch in all dem Treiben eine ungezwungene Heiterkeit, denn mancher Hallenser Jüngling hatte sich aus den Armen seiner Mutter gerissen, war heimlich den Späheraugen der westfälischen Regierung entwichen, das Schwert zu ergreifen, um für seinen angestammten König und das Vaterland zu fechten. Erst als die Nachricht vom Abschluß eines Waffenstillstands kam, der einen baldigen Frieden erwarten ließ, nach dem sich Europa allgemein sehnte, erst dann herrschte wieder Frohsinn unter Jung und Alt.
Ende August kehrte die Gesellschaft nach Weimar zurück. Von der Niederlage der Franzosen bei Kulm hörten wir schon mit großem Jubel; wie sich aber derselbe nach der Völkerschlacht bei Leipzig steigerte, als uns die Nachricht kam, daß die Franzosen total geschlagen wären, wird noch heute jedes deutsche Herz ermessen können.
Nicht gleich gab es Frieden und Ruhe, noch folgten Kämpfe, Alarmnachrichten, Durchmärsche und Einquartierungen, aber der entscheidende Sieg war doch nun erfochten. Da es mir nicht vergönnt war, für das Vaterland zu fechten, so setzte ich mitten in diesen Unruhen und dem wilden Leben meine theatralischen Studien fort, und gerade die Kriegsereignisse waren es, die die günstige Wendung meines Schicksehals beschleunigten.
Professor Jagemann, ein höchst talentvoller Maler und Bruder der berühmten Schauspielerin, der bei den freiwilligen reitenden Jägern stand, war von Karl August als Kurier abgeschickt, um der Herzogin Louise die Nachricht der Einnahme von Paris zu überbringen. Den 11. April ganz früh langte er in Weimar an; nach wenigen Stunden war die Bekanntmachung von der Übergabe von Paris an allen Straßenecken zu lesen. Ein unbeschreiblicher Jubel erscholl in der Stadt und Freudenschüsse wurden auf allen Straßen und aus allen Fenstern abgefeuert. Einige Tage darauf ging Jagemann wieder nach Paris zurück, und unser trefflicher Bassist Stromeier, der in ganz besonderer Gunst bei Karl August stand, durfte ihn begleiten.
Nun trat für mich ein günstiger Zeitpunkt ein, weil das Theater ohne ersten Bassisten war; mein Vater wollte zwar noch gar nichts von einem Versuche wissen, aber Goethe bestand auf einer Probe. Diese fiel nach seiner Meinung günstig aus, und so betrat ich unter seiner speziellen Leitung am 23. April 1814 als Osmin die Bühne.
Fünftes Kapitel.
Mitteilungen meines Vaters. I.
Goethe als Direktor (1791–1799): Gastspiel in Lauchstädt. – Christiane Neumann. – Goethe als Lehrer. – Eckhof und Schröder. – Gastspiel Ifflands. – Neu-Aufführungen unter Goethe: »Don Carlos«, »Wallenstein« usw.
Bevor ich weiter in meiner Lebensbeschreibung fortfahre, komme ich zunächst auf die Zeit zurück, in der Goethe die Leitung des Weimarischen Hoftheaters übernahm und mein Vater vom Jahre 1793–1817 unter ihm als Regisseur fungierte. Es ist viel Unrichtiges, selbst Unwahres über die Goethesche Schule geschrieben worden. Aus dem Nachstehenden kann der Leser ersehen, ob das Goethesche Prinzip und dessen Ausführungen falsch waren. Ich habe treu, was mir mein Vater mündlich und schriftlich darüber mitgeteilt, hier niedergeschrieben und führe ihn dabei selbsterzählend ein:
Goethe hatte im Jahre 1791 das neu errichtete Hoftheater in Weimar übernommen; die erste Vorstellung unter seiner Leitung waren Ifflands »Jäger«, mit einem von ihm selbst verfaßten Prolog. Von den Mitgliedern der Belluomoschen Gesellschaft waren geblieben: Dameralius, Demmer und Frau, Malcolmi mit drei Töchtern, von denen die jüngste, Amalie, die treffliche Wolff wurde, und Christiane Neumann mit ihrer Mutter. Neu hinzugetreten waren: Amor und Frau, Becker, Benda, Einer, Fischer (der Regisseur wurde; und Frau, Krüger, Fräulein Rudorf und ich. Aus Norden, Süden, Westen und Osten waren wir zusammengekommen. Da die neu engagierten Mitglieder in der ersten Vorstellung teilweise auch untergeordnete Rollen übernehmen mußten und doch für erste Fächer in Schauspiel und Oper engagiert waren, so ließ Goethe auf den Zettel setzen: »Da die Gesellschaft meistenteils neu zusammengetreten ist, so sind die Anfangsrollen nicht als Debüts zu betrachten, sondern es wird jedem einzelnen noch Gelegenheit gegeben werden, sich dem Publikum zu empfehlen.« Diesem Versprechen kam Goethe mit großer Gewissenhaftigkeit nach, und weil jedem Schauspieler zwei Debütrollen zugesagt waren, so mußte man sich in der ersten Zeit an ältere Stücke und Singspiele, in welchen die Neuhinzugetretenen einstudiert waren, halten. Iffland, Kotzebue, Jünger und Spieß, Mozart, Dittersdorf und Paesiello beherrschten das Repertoire.
In den Kontrakt, den bereits Belluomo mit der Merseburger Regierung abgeschlossen hatte, daß die Weimarsche Gesellschaft während der Sommermonate in Lauchstädt Vorstellungen geben sollte, trat jetzt die Weimarsche Hoftheaterdirektion ein, und demnach ging die Gesellschaft am 10. Juni schon nach Lauchstädt, einem kleinen Badeorte in der Nähe von Merseburg, Halle und Naumburg, der vom sächsischen Adel und Leipziger Patrizierfamilien stark besucht wurde.





























