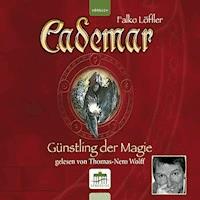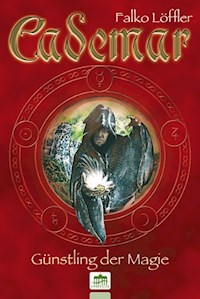5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Falko Löffler ist Autor und Übersetzer und hat an vielen Büchern gearbeitet. Er schreibt auch Kurzgeschichten - schon immer und sehr gern. Science Fiction, Fantasy, Horror - oder einfach wilde Ideen, die in Geschichtenform gegossen werden. In diesem Buch stecken Geschichten aus 30 Jahren, die in von irdischen Gegebenheiten bis in ferne Welten reichen. Viele Geschichten werden mit kleinen Nachworten biografisch eingerahmt. Dieses Buch ist eine erweiterte Neuauflage der Sammlung, die 2013 erschienen ist, und hat fast den doppelten Umfang der Originalausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Falko Löffler
Ausgewählt!
Fantastische Geschichten
Über dieses Buch
Kurzgeschichten von Falko Löffler aus 30 Jahren. Fantastik aller Spielarten und Tonlagen. Und ein Stapel von skurrilen Kürzestgeschichten, die nach Vorgaben geschrieben wurden.
Über den Autor
Falko Löffler wurde 1974 in Lauterbach/Hessen geboren. Er hat Literatur- und Medienwissenschaft in Marburg studiert, war einige Jahre bei einem Videospielehersteller in Frankfurt als Autor und Leveldesigner angestellt und arbeitet seit 2003 als freier Autor an Romanen, Drehbüchern und Texten für Computerspiele. Seit 2018 spricht er im Podcast »Kapitel Eins« (buchpodcast.de) über Romane und Sachbücher, seit 2022 im Podcast »Benutze Ohr mit Lautsprecher« (adventurepodcast.de) über Adventure-Games.
Coverfoto: Ansgar Schwarzkopf
Covergestaltung: Diana Löffler
Jeweils Verwendung unter Lizenz.
Impressum
Alle Texte Copyright © 1995-2025 by
Falko Löffler
Lindenstr. 8a
36355 Ilbeshausen
Alle Rechte vorbehalten. Verwendung der Texte zum KI-Training untersagt.
Tag der Veröffentlichung: 10.06.2025
Homepage: https://falkoloeffler.de
Vorwort
Ich liebe Kurzgeschichten.
Vielleicht deswegen, weil man in einer Kurzgeschichte etwas anreißen und vage lassen kann, womit man im Roman nicht durchkommt. Ein Roman muss Antworten bieten. Eine Kurzgeschichte stellt Fragen.
Ich liebe Pointengeschichten, deren letzter Satz einem den Boden unter den Füßen wegzieht.
Ich liebe verrückte Geschichten, die so skurril sind, dass einem die Spucke wegbleibt.
Und ich hoffe, Sie finden in dieser Sammlung auch Ideen, Sätze und Geschichten, die Ihnen gefallen. Dies sind nicht alle Geschichten, die ich jemals geschrieben habe. Fingerübungen bleiben im Archiv. Wie viele das sind? Viele. Ich glaube, ich habe damals zwei Aktenordner vollgeschrieben, allerdings war das Endlospapier, das die Nadeldrucker damals ausgespuckt haben, ziemlich dick. Außerdem habe ich einige Geschichten für diese Sammlung verworfen, die sogar veröffentlicht worden sind, weil sie mir inzwischen nicht mehr gefallen.
Jede Geschichte wurde behutsam überarbeitet, auf den aktuellen Stand der Rechtschreibung gebracht. Bei einigen gefiel mir immer noch die Idee, aber nicht mehr die Ausarbeitung – da habe ich dann etwas stärker eingegriffen. Den meisten Geschichten folgt ein kleines Nachwort, das auf die Originalveröffentlichung verweist und etwas zu Entstehung und Ideenfindung sagt. Gelegentlich überschreite ich darin die Grenze zur Autobiografie. Gerade die Geschichten, die sich für mich als wichtig erweisen sollten, haben direkten Bezug zu den jeweiligen Lebensumständen. Ohne Nachwort bleiben einige Kürzestgeschichten, die sich am ehesten als »Kopfschüttler« klassifizieren lassen – kurze, sinnentleerte Storys, die den Leser einzig kopfschüttelnd und verwirrt zurücklassen sollen. Ich kann nur empfehlen: schreiben Sie so was. Nehmen Sie einen richtig absurden Titel und halten Sie sich nicht zurück.
Noch ein Tipp zum Lesen dieser (oder eigentlich jeder) Geschichtensammlung. Bevor Sie zur nächsten Geschichte umblättern – atmen Sie tief durch. Dann ist der Schock, plötzlich in einer anderen Welt zu landen, nicht ganz so groß.
Durchgeatmet? Gut.
Fangen wir an.
Falko Löffler
Vogelsberg, Sommer 2013
Vorwort zur Neuausgabe von 2025
Moment, bitte wieder die Luft anhalten! Alles, was im (leicht angepassten) Vorwort aus 2013 steht, stimmt noch. Aber seitdem ist viel passiert. Bei jedem von uns. Wir sind alle andere Menschen geworden. Ich beispielsweise unerwartet Podcaster. Auf buchpodcast.de vor allem, dann auch auf adventurepodcast.de.
Nach 12 Jahren dachte ich mir: wird Zeit für eine Aktualisierung dieser Sammlung mit Sachen, die ich in der Zwischenzeit geschrieben habe. Ich war versucht, die eine oder andere ältere Geschichte auszusortieren, weil sie inzwischen nun wirklich nicht mehr dafür steht, wie ich schreibe und erzähle. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Verschwunden ist aus der Erstausgabe nur der Anhang: ein Interview, das Gunnar Lott mit mir geführt hatte, und ein Abdruck meiner allerersten Horrorstory. Wer noch ein Exemplar der Originalausgabe besitzt, kann sich über diese Exklusivität freuen.
Diese Neuausgabe besteht aus drei Teilen:
Teil 1: Neue Kurzgeschichten.
Teil 2: »Kopfschüttler«, also Minigeschichten, die ich nach Vorgaben von Freunden oder Buchpodcast-Hörerinnen und -Hörern geschrieben habe. Tipp: Lesen Sie jeweils die vorangestellte Vorgabe und fragen Sie sich, was Sie daraus für eine Geschichte entwickelt hätten. Und lesen Sie dann, was ich daraus gemacht habe.
Teil 3: Alle Geschichten der Originalausgabe von »Ausgewählt!« aus 2013 inklusive der kurzen Nachworte.
Jetzt aber wirklich: ausatmen.
Falko Löffler
Vogelsberg, Frühling 2025
Teil 1: Neue Kurzgeschichten
Ein Freund ist online gegangen
Svenja registrierte aus dem Augenwinkel die Nachricht unten rechts auf dem Monitor und ignorierte sie. Ein Freund war online gegangen, und das war jetzt nicht wichtig. Jetzt zählte nur ihr Angriffsmuster.
An diesem Bossgegner hatte sie sich immer die Zähne ausgebissen, und bislang hatte sie tapfer der Versuchung widerstanden, im Netz eine erfolgversprechende Taktik rauszusuchen. Diesen glühenden, turmhohen Bossgegner mit dem gewaltigen Morgenstern wollte sie selbst besiegen. Das ganze verdammte Spiel wollte sie ohne Hilfe schaffen. Ehrensache.
Sie scheiterte grandios.
Auch die Taktik, die herumliegenden Säulen als Deckung zu verwenden, und immer dann hinter ihnen hervorzukommen, wenn der Gegner mit dem Morgenstern ausholte, führte nicht zum Erfolg. Es dauerte keine zwei Minuten, dann hatte sie schon wieder ins Gras gebissen. Genauer gesagt ins Gestein der halb verfallenen Kirche. Wenn sie nicht mal diesen Gegner schaffte, würde es noch ewig dauern, bis sie in der legendären Zitadelle des Spiels dem letzten Feind gegenübertrat.
Genervt riss sie das Headset vom Kopf, beendete das Spiel und fand sich in der Benutzeroberfläche des Spiele-Clients wieder. Es war ein gutes Spiel, keine Frage, aber richtig Spaß machte Dark Dagger erst, wenn man es mit mehreren Leuten spielte und versuchte, Quests gemeinsam zu lösen. Sollte sie Schluss machen? Es war Sonntag Abend, kurz nach halb neun, aber noch hatten ihre Eltern nicht angemahnt, dass sie die Kiste ausmachen sollte. Vielleicht noch ein anderes Spiel? Oder einfach ab ins Bett? Nach der Fünf in Deutsch wäre es vielleicht kein Fehler, die vernünftige Tochter zu spielen. Andererseits war es sowieso nur noch eine Woche bis zu den Weihnachtsferien.
Sie bewegte den Mauszeiger schon zum Windows-Symbol, als ihr das Chatfenster mit der Freundesliste auffiel. Nur einer ihrer Freunde hatte den grünen Punkt neben dem Namen, der signalisierte, dass die Person eingeloggt war.
Als sie registrierte, welcher Name es war, erstarrte sie und vergaß, was sie hatte klicken wollen.
DemonSlayerNoob
Luis?
Das konnte nicht sein.
Erst, als sie keuchend ausatme, wurde ihr bewusst, dass sie die Luft angehalten hatte. Sie blinzelte, schloss die Augen, schüttelte den Kopf, öffnete die Augen wieder. Der grüne Punkt war immer noch da.
Vielleicht ein Systemfehler.
Ruckartig bewegte sie den Mauszeiger auf das Windows-Symbol, klickte es, dann auf das Energie-Symbol und bewegte den Zeiger auf »Herunterfahren«.
Einfach klicken und warten, bis die Lichter am PC erloschen und der Lüfter erstarb. Wenn sie morgen nach der Schule den Rechner wieder hochfuhr, würde der grüne Punkt verschwunden sein. Ganz sicher.
Doch sie klickte nicht.
Es würde ihr die halbe Nacht keine Ruhe lassen.
Bevor sie es sich anders überlegen konnte, raste sie mit dem Mauszeiger zu DemonSlayerNoob, sie doppelklickte, tippte die Nachricht ein und drückte Enter.
Im Chatfenster stand: hey
Der Cursor im Eingabefeld blinkte geduldig. Sonst geschah nichts. Was sollte auch passieren? Das war offensichtlich ein Fehler. Vielleicht hatte jemand seinen Rechner angeschaltet und sich mit seinem Konto eingeloggt, vielleicht sein Vater, und der Client war automatisch gestartet und–
Ihre Gedanken stürzten in einen Abgrund, als die drei hüpfenden Punkte im Chatfenster erschienen, die anzeigten, dass am anderen Ende der Leitung jemand etwas eingab.
Wieder musste sie sich zum Atmen zwingen.
Die Punkte hüpften. Hüpften. Hüpften. Wer auch da immer schrieb, brauchte ewig.
Nach einer Ewigkeit erschien die Antwort.
hey
Nur diese drei Buchstaben. Exakt, was sie es geschrieben hatte, alles klein, ohne Satzzeichen. War das ein Bot, der einfach ihre Nachrichten spiegelte?
Natürlich! Das war die Erklärung. Luis’ Account war gehackt worden. Entweder von einer Person oder von einem Bot oder … wem auch immer.
Während sie darüber nachdachte, ob sie den Hacker in einen Chat verwickeln sollte, um vielleicht herauszufinden, wer es war, erschienen die drei hüpfenden Punkte wieder.
Sie hielt ihre Hände über der Tastatur und zögerte.
Nach einer Minute erschien die Nachricht:
ne runde dark dagger?
Als der Wecker klingelte, schossen diese Worte immer noch durch ihre Gedanken, bevor sie richtig wach war.
Sie hatte schlecht geschlafen. Verdammt schlecht. Immer wieder hatte sie den Kopf gedreht, um sich zu vergewissern, dass der Rechner sich nicht angeschaltet hatte und eine weitere Nachricht auf dem Bildschirm prangte. Vielleicht etwas wie:
ich beobachte dich
oder
schlaf nicht ein
Der Tower hatte nur dagestanden, der Monitor war dunkel geblieben.
ne runde dark dagger? Es war exakt die Nachricht gewesen, mit der Luis sich bei ihr regelmäßig gemeldet hatte. Fast jeden Tag hatten sie im Laufe der letzten gemeinsamen Monate zusammen die Fantasy-Welt erforscht und versucht, die Gegner darin zu besiegen. Und immer hatten ihre Sessions mit dieser Chat-Nachricht begonnen. Niemand wusste davon.
Svenja quälte sich aus dem Bett. Kurz erwog sie, den Rechner anzuschalten und sich zu vergewissern, dass niemand online war, dass sie sich das vielleicht nur eingebildet hatte, aber sie hatte ihre Morgenroutine nach dem Wecker eng getaktet, damit sie nur duschen und schnell frühstücken musste, um dann aus dem Haus zu eilen und pünktlich mit dem Klingeln in der Schule anzukommen. Ihre Mutter hatte Frühschicht und war schon aus dem Haus, ihr Vater war wie immer spät dran und registrierte nur am Rande, dass sie am Küchentisch saß, dann war er schon weg.
Der eisige Dezemberwind, der ihr auf den fünfzehn Minuten Fußweg zur Schule ins Gesicht wehte, schien jeden Gedanken an den Chat wegzublasen. Die letzte Woche vor den Weihnachtsferien konnte nicht schnell genug vorbeigehen, aber natürlich wollten alle Lehrerinnen und Lehrer gerade jetzt noch richtig Gas geben. Sie hatten viel Stoff nachzuholen, seit vor vier Wochen der Unterricht für einige Zeit durch eine lähmende Trauerbewältigung der ganzen Schule ersetzt worden war. Erst nach einer Woche war wieder an etwas zu denken gewesen, was man Unterrichtsalltag hatte nennen können.
Sie war ein paar Minuten zu spät. Unter dem missbilligenden Blick der echsenhaften Lehrerin huscht Svenja an ihren Platz und machte sich klein.
In der Pause entfernte sie sich von ihren Freundinnen und hielt auf dem Schulhof nach Moritz Ausschau. Erst seit letzter Woche war er wieder an der Schule, und sie hatte seitdem kaum ein Wort mit ihm geredet. Er war Luis’ bester Freund gewesen. Und er hatte den Unfall mitangesehen.
Sie fand ihn in einer Ecke des Schulhofs auf einer Bank sitzen. Niemand war in seiner Nähe, als steckte er in einer unsichtbaren Blase, die sonst niemand durchdringen konnte. Auf seinem Schoß hatte er eine Brotbüchse, und er hielt den Kopf gesenkt, als überlegte er, wie er sie öffnen könnte.
Svenjas Schritte wurden langsamer, je näher sie ihm kam. Er schien sie nicht wahrzunehmen, als sie direkt vor ihm stand. Sie wollte Hey sagen, aber der Chat von gestern Abend fiel ihr ein, und sie bekam das Wort nicht über die Lippen.
»Kann ich dich was fragen?«
Moritz riss erschrocken den Kopf hoch, als hätte sie ihn bedroht, und unwillkürlich machte sie einen Schritt nach hinten. »Äh … klar«, sagte er schnell und schaute zur Seite.
Sie setzte sich neben ihn auf die Bank, aber ganz am Rand, als befürchtete sie, ihn zu verscheuchen.
Svenja wusste, wie übernächtigt sie aussah, aber verglichen mit Moritz musste sie wie das blühende Leben wirken. Er war blass, hatte dunkle Ringe unter den Augen und musste sich vor Tagen zuletzt gekämmt haben. Seine Hände hielten die Brotdose fest umschlossen.
Sie wollte ihn fragen, wie es ihm ging, aber das war nicht zu übersehen. Und sie wusste, dass er diese Frage seit Wochen hörte, genau diese Frage, keine andere, vielleicht noch gefolgt von wohlmeinenden Ratschlägen. Also beschloss sie, direkt zur Sache zu kommen.
»Hast du Luis noch in deinen Chatprogrammen als Kontakt?«
Er schaute sie mit leeren Augen an. »Was?«
Sie wollte ihre Frage nicht wiederholen.
Schließlich schüttelte er den Kopf. »Ich hab ihn rausgelöscht. Überall. Hab’s nicht ertragen, seinen Namen immer wieder zu sehen.«
Svenja nickte. Sie hatte es auch seltsam gefunden, aber gleichzeitig hatte sie es nicht übers Herz gebracht, ihn zu löschen. »Meinst du, irgendwer hat ihn noch als Kontakt?«
»Woher soll ich das wissen?« Nun klang er verärgert. »Ein paar andere haben ihn wohl auch rausgenommen. Denen ging es wie mir. Haben sie nach der Beerdigung erzählt.«
Sollte Svenja nun in der ganzen Klasse rumfragen, bis sie jemanden ausfindig gemacht hatte, der noch bei diesem Spiel-Client mit Luis verlinkt war? Unmöglich.
»Okay«, sagte sie, stand auf und eilte davon, bevor Moritz noch etwas sagen konnte. Sie spürte, wie sein Blick ihr folgte.
Nach dem Mittagessen musste sie sich zwingen, wieder in ihr Zimmer zu gehen, und als sie die Tür öffnete, rechnete sie damit, dass der Rechner schon lief und ein Chatfenster mit hey sie erwartete.
Doch das war nicht der Fall. Das Zimmer war so, wie sie es am Morgen zurückgelassen hatte.
Schnell schaltete sie den Rechner an, wartete, bis er hochgefahren und automatisch der Client gestartet war. Ihr Blick wanderte zu dem Chatfenster mit der Liste ihrer Kontakte – da wechselte die Anzeige, und die grünen Punkte erschienen bei allen, die online waren.
DemonSlayerNoob war einer davon.
Sie erschrak, als das Chatfenster mit seinem Namen und einer neuen Nachricht aufploppte.
ne runde dark dagger?
Wer auch immer da tippte, wollte ihr offensichtlich einen bösen Streich spielen.
Wut flammte in ihr auf. Wahrscheinlich war es jemand aus ihrer Klasse, der Luis’ Passwort kannte, sich eingeloggt hatte und ihr nun einen Schrecken einjagen wollte. Zugegeben, es war gelungen. Sie musste rausfinden, wer das war.
klar, antwortete sie.
Svenja startete Dark Dagger und fand sich nach kurzer Zeit in der Spielwelt wieder. Neben ihr stand Luis … genauer gesagt die drahtige Magierin in der Purpurrobe … seine Spielfigur.
Und ohne auf sie zu warten, rannte die Magierin los. Svenja beeilte sich, mit ihrer Figur hinterherzukommen – einem muskelbepackten Krieger.
Sie stießen auf die ersten Gegner, und sie harmonierten als Team wie immer. Die Angriffs- und Verteidigungsmuster, die sie über Monate verfeinert hatten, waren wieder da. Keinerlei Kommunikation war nötig, sie ergänzten sich perfekt.
Es war, als würde sie wirklich mit Luis spielen.
Svenja nahm überhaupt nicht wahr, wie die Zeit verflog. Gemeinsam kämpften und zauberten sie sich durch ein Level nach dem anderen, besiegten den Gegner mit dem Morgenstern zum ersten Mal und kamen sogar in Sichtweite der Zitadelle, doch scheiterten dann an einem Golem mit einem Flammenschwert. So weit waren sie noch nie vorher gekommen.
bis morgen erschien im Chatfenster.
Dann verschwand der grüne Punkt.
Es war Mittwoch Morgen. Dieser und dann noch zwei Tage bis zu den Weihnachtsferien, dann war auch schon Heiligabend. Niemand hatte mehr Lust auf Schule, die Schülerinnen und Schüler sowieso nicht, und auch der Elan der Lehrer erlahmte.
Die Pausen verbrachte Svenja damit, ihre Klassenkameraden möglichst unauffällig nach Luis zu fragen. Sie erntete damit nur gesenkte Blicke, zurückgehaltene Tränen und stockende Stimmen. Einzig Wunden riss sie auf. Niemand wirkte ertappt oder stotterte, niemand zeigte Andeutungen von Schuldbewusstsein, sein Konto gehackt zu haben.
Am Nachmittag fuhr sie den Rechner hoch. Kaum hatte sie sich eingeloggt, meldete sich Luis.
Nein, schalt sie sich. Nicht Luis. Jemand, der seinen Account gehackt hatte.
ne runde dark dagger?
Sie schrieb ein einfaches ja als Antwort und startete das Spiel. Da hatte sie eine Idee und tippte: lass uns dabei voice chat machen.
Sie schickte die Nachricht ab und war sicher, dass die Person am anderen Ende der Leitung das ablehnen würde.
Doch die Antwort war: gleich.
Ihre Spielfigur erschien auf dem Monitor und kurz darauf die von Luis.
Dass ihre Hände zitterten, merkte Svenja erst, also sie das Headset aufsetzte. Sie atmete tief durch, griff wieder nach der Maus, und im gleichen Moment erschien das Telefon-Symbol im Client.
DemonSlayerNoob ruft an, stand auf dem Bildschirm.
Sie klickte auf das grüne Telefonsymbol.
Stille. Ein kurzes Kratzen von weit weg. Dann wieder Stille.
»Hallo?«, fragte Svenja. Sie bemerkte, dass sie das Mikrofon am Headset noch hochgestellt hatte und drehte es schnell runter. »Hallo?«, wiederholte sie.
Wieder das Kratzen. Diesmal näher. »… hey …«
Die Stimme klang wie Eiswasser.
Sie wusste sofort, dass es Luis war. Kein Klassenkamerad, der seinen Account geknackt hatte, kein Lügner oder Betrüger. Es klang kratzig, es klang verrauscht, aber es war eindeutig Luis.
Luis, der vor vier Wochen an einem nebligen Novembermorgen auf dem Fahrrad zur Schule unterwegs gewesen und von einem abbiegenden LKW überrollt worden war.
»Luis …« flüsterte sie.
Die Magierin eilte los und verschwand hinter dem Bildschirmrand. Svenjas Krieger blieb alleine zurück.
»… wo bleibst du …«, kroch aus ihren Kopfhörern.
»Das kann nicht sein …«, murmelte sie.
»… komm schon …«
Die Stimme klang ungeduldig.
Luis klang ungeduldig.
Svenja war wie erstarrt. Sie hatte die rechte Hand auf die Maus gelegt, aber konnte sie nicht bewegen, konnte nicht klicken, konnte kaum atmen.
»… hilf mir … der Bossgegner … in der Zitadelle …«
Sie schüttelte unbewusst den Kopf. »Ich kann nicht, Luis.«
»… du kommst mit … du hilfst mir beim Bossgegner …«
»Ich … kann nicht …«
»… du hilfst mir, Svenja … du hilfst mir beim Bossgegner … du hilfst mir … DU HILFST MIR JETZT!«
Svenja riss das Headset herunter und ließ es auf den Tisch fallen.
»DU HILFST MIR JETZT!« Luis’ Stimme hallte so laut aus den Kopfhörern, dass sie das ganze Zimmer erfüllte.
Hektisch drückte sie den Ausschalten-Knopf am Tower und der blaue Hintergrund erschien auf dem Monitor, der signalisierte, dass der Rechner runterfuhr.
»DU HILFST MIR JETZT!«
Svenja glitt von ihrem Stuhl, kroch unter den Tisch und riss das Netzkabel aus dem Tower. Die Lichter am Gehäuse erloschen, der Lüfter verstummte langsam.
»DU HILFST MIR JETZT! DU HILFST MIR JETZT!«
Sie kroch unter dem Tisch hervor, rappelte sich auf und stürzte in den Flur.
Sie hörte Luis’ Schreie noch auf der Treppe.
Als sie aus dem Haus gehastet war, hatte sie instinktiv ihre Jacke und die Schlüssel mitgenommen. Nun stand sie schwer atmend in der Einfahrt und schaute zu ihrem Zimmer hoch. Alles wirkte friedlich und ruhig. Kein Mensch war auf der Straße unterwegs. Ihre Eltern waren arbeiten. Niemand hatte etwas mitbekommen.
Sie würde nicht wieder reingehen. Sie musste weg. Ohne Ziel lief sie los. Erst nach zehn Minuten wurde ihr bewusst, welchen Weg sie eingeschlagen hatte.
Luis hatte am Südrand der Kleinstadt gewohnt. Als sie die Klingel des Hauses drückte, wusste sie immer noch nicht richtig, was sie sagen sollte, wenn seine Mutter öffnete.
Es war sein Vater, der vor ihr erschien.
Er trug legere, aber saubere Kleidung; seine Haare waren gepflegt, und er roch nach frischem Duschgel. Doch beim Blick in seine Augen erkannte Svenja, dass dieser Mann noch so sehr von Tod und Chaos erfüllt war wie am Tag der Beerdigung.
Fragend schaute er sie an.
»Äh, es tut mir so leid, aber … also, ich hatte Luis ein Buch aus der Schulbücherei geliehen, und ich müsste es vor den Weihnachtsferien zurückgeben, und ich wollte fragen …«
Er nickte müde und zog die Tür weiter auf. »Schauen wir in seinem Zimmer«, sagte er leise und stieg die Treppe hoch. Svenja folgte ihm.
Im ersten Stock stieß er eine Tür auf und trat zur Seite, als wollte er selbst auf keinen Fall hineingehen. »Schau, ob du es findest.«
Widerwillig schritt Svenja über die Schwelle.
Es roch muffig in Luis’ Zimmer. Das Bett war ordentlich gemacht, aber es lagen einige abgelegte Kleidungsstücke herum. An den Wänden hingen Poster mit Fantasy-Motiven. Das ganze Zimmer war in der Zeit eingefroren.
Der PC stand unter einem kleinen Schreibtisch neben dem Fenster.
Svenja erinnerte sich daran, weswegen sie vorgeblich hier war und begann, die Bücher im Regal durchzusehen, wobei sie immer wieder verstohlen zum Rechner blickte. Die Steckerleiste unter dem Tisch war ausgeschaltet, aber alle Kabel angeschlossen.
»Findest du es?«, fragte Luis’ Vater vom Flur aus.
»Nein … hier ist es nicht.«
»Ich fürchte, dann kann ich auch nicht weiterhelfen. Wenn es in seiner Schultasche war … beim Unfall … dann …«
Seine Stimme brach.
Svenja wollte nur noch raus aus diesem Zimmer. »Ist nicht schlimm«, sagte sie schnell und eilte in den Flur hinaus, zog die Tür hinter sich zu. »Haben Sie Luis’ Rechner noch mal benutzt?«, fragte sie und schalt sich innerlich – wie doof klang das denn bitte.
»Nein«, wir haben nichts von ihm angerührt. »Irgendwann müssen wir …«
Sie sah in seinen Augen, dass Tränen nahten.
»Danke. Das mit dem Buch ist kein Problem«, sagte sie und beeilte sich, die Treppe runterzulaufen.
Wieder draußen musste sie sich beherrschen, nicht panisch hinter sich zu schauen.
Schon die zweite Flucht aus einem Haus innerhalb weniger Stunden.
Es half nichts. Sie musste wieder reingehen. Schließlich konnte sie nicht in der Kälte rumstehen und abwarten, bis ihre Eltern kamen. Und wenn sie zu einer Freundin ging, würde sie es nur aufschieben.
Mit klopfendem Herzen schloss sie die Haustür auf und rechnete damit, dass die Stimme herabdröhnte: DU HILFST MIR JETZT!
Doch das Haus war von Stille erfüllt.
Auf Zehenspitzen ging sie nach oben. Die Tür zu ihrem Zimmer stand weit offen und sie schaute vorsichtig hinein.
Alles normal. Alles wie immer. Der Rechner war ausgeschaltet. Das Headset lag stumm auf dem Schreibtisch neben der Tastatur.
Svenja schaltete den Rechner an. Loggte sich ein. Startete den Client.
Kein grüner Punkt neben DemonSlayerNoob.
Erleichterung durchströmte sie.
Erleichterung … aber auch etwas Bedauern.
Die Weihnachtstage zogen routiniert vorüber. Svenja war 16 und hatte die naive Freude über diese Feiertage schon lange abgelegt. Sie verbrachten den Heiligabend zu Hause, trafen sich am nächsten Tag zum Essen mit den einen Großeltern, fuhren am zweiten Feiertag durch die halbe Republik zu den anderen Großeltern. Dort blieben sie in paar Tage.
Svenja dachte immer wieder an Luis. An seine Stimme. An das gemeinsame Spielen. Sie konnte sich nicht vorstellen, wie schlimm es für seine Eltern sein musste, diese Zeit ohne ihn zu verbringen. Mit ihren Freundinnen chattete sie in diesen Tagen viel, und es war nur oberflächliches Gerede, geprägt von der Langeweile der Feiertage, aber sie war dankbar für den Tratsch und die Selfies und den Alltag.
Mit niemandem redete sie über Luis und was sie erlebt hatte.
Am Tag vor Silvester kamen sie nach Hause zurück. Die Diskussionen mit den Freundinnen drehten sich darum, wie sie ins Neujahr feiern sollten. Eine von ihnen hatte das Haus für sich, und damit war die Sache geklärt.
Wann immer sich Svenja an den Rechner setzte, wanderte ihr Blick zuerst zum Chatfenster.
DemonSlayerNoob war immer offline. Kein grüner Punkt neben seinem Namen.
Sie überlegte, ob sie ihn als Kontakt löschen sollte, so wie Moritz und alle anderen es getan hatten. Damit sie seinen Namen – seinenNick – nicht wieder und wieder sehen musste. Aber sie konnte nicht.
Als sie sich am Silvesternachmittag für die Party am Abend fertigmachte, ließ sie den Rechner Musik spielen. Diese wurde kurz von dem hellen Signal übertönt, dass ein Freund im Spielclient online gegangen war.
Sie konnte sich nicht erinnern, diesen gestartet zu haben.
Ein Teil von ihr wusste, welcher Freund das war, bevor sie sich an den Rechner setzte.
Er hatte schon eine Nachricht geschickt.
hey
Ihre Finger schwebten über der Tastatur, während sie nach Worten suchte. Letztlich erwiderte sie einfach nur das hey.
sorry, schrieb er.
Da öffnete sich ein neues Fenster. DemonSlayerNoob ruft an.
Svenja zögerte. Sie konnte den Anruf ablehnen. Sie konnte seinen Kontakt blockieren. Sie konnte all dem ein Ende bereiten.
Nein. Sie streifte das Headset über und klickte auf Anruf annehmen.
»Luis?«, fragte sie.
Das Rauschen einer schlechten Verbindung. Seine Stimme von weit weg. »… das war scheiße von mir …«
Sie wartete ab.
»… tut mir echt leid … ich war … so wütend …«
Das war Luis. Wo auch immer er war, von wo auch immer er mit ihr sprach, er war es ohne jeden Zweifel.
»… ne Runde Dark Dagger?«, fragte er.
Sie lächelte unwillkürlich. »Klar doch.«
Mit einem schnellen Klick startete sie das Spiel.
Sie spielten sich regelrecht in einen Rausch. In einem perfekten Tanz führten sie Schwerter wie Zaubersprüche, arbeiteten sich Level um Level voran, besiegten den Gegner mit dem Flammenschwert, und schließlich standen sie an der Pforte zur Zitadelle. Hier waren sie noch nie gewesen. Das letzte Gefecht stand bevor. Hinter diesem Tor wartete der letzte Gegner des Spiels.
Beide schwiegen. Sie wussten, dass heute der Tag war, an dem es ihnen gelingen würde. Sie mussten nur das Tor aufstoßen und der Kampf würde beginnen. Sie würden gewinnen. Zum ersten Mal würden sie Dark Dagger beenden. Gemeinsam.
Sie stellte ihre Spielfigur direkt vor das Tor und machte sich bereit. Aber Luis war noch nicht neben ihr.
Sie drehte die Kamera und sah seine Spielfigur, die Magierin, ein Stück von ihr entfernt dastehen. Reglos.
Sie schaute in die rechte untere Ecke zum Chat. Der grüne Punkt war noch bei seinem Namen. Er war online.
Zumindest so online, wie er sein konnte …
»Luis?«, fragte sie.
Das Rauschen in den Kopfhörern wurde lauter. Es klang nun wie das Meer.
»… Svenja …«, sagte Luis. »… ich weiß jetzt, was ich tun muss …«
»Am besten halte ich mich rechts, sobald das Tor offen ist, und du castest-«
»… nein … das meine ich nicht …«
Sie schaute aus dem Fenster. Es war längst dunkel geworden. Wie spät war es eigentlich? Wahrscheinlich hatte die Silvesterparty längst begonnen und ihre Freundin hatten vergeblich versucht, sie auf dem Smartphone zu erreichen. Doch das kümmerte sie nicht.
»… du hast es mir gezeigt … du hast mir geholfen …«
»Was?«
»… danke …«
Svenja fühlte Tränen. »Geh nicht.«
»… ich muss … ich hätte längst gehen sollen … aber …«
Sie wollte so viel sagen, aber konnte nicht.
»… kämpfe weiter …«, sagte Luis ganz leise.
Zuerst ging die Magierin auf dem Bildschirm in einem blauen Blitz. Dann verschwand im Chatclient der grüne Punkt neben DemonSlayerNoob. Diesmal für immer. Svenja war sicher.
Im Chatfenster erschien: Ein Freund ist offline gegangen.
Sie wischte mit dem linken Handrücken die Tränen weg und klickte mit dem rechten Zeigefinger.
Auf dem Bildschirm schwang das Tor zur Eingangshalle der Zitadelle auf und ein monströses Grollen drang aus den Kopfhörern.
»Für dich, Luis«, flüsterte Svenja und trat ein.
Ein Freund ist online gegangen (2018)
Erstveröffentlichung als gelesener Text auf gamespodcast.de
Im digitalen Zeitalter erleben wir alle irgendwann, dass wir eine Nachricht erhalten von einer Person, die nicht mehr lebt. Weil jemand aus der Familie von dem Account eine Mail schickt. Weil ein Rechner angeschaltet wurde, wo sich ein Account einloggt. Weil eine Handynummer neu vergeben wurde, die in unseren Kontakten noch jemandem zugeordnet ist, der uns verlassen hat. Kein schöner Moment.
Aber für mein Autorenhirn auch ein Impuls …
We never talk about Ulf
»Ich bin mir sicher, der ist tot«, sagte Ida. »So wie das riecht.«
»Das ist not new«, meinte Kenneth.
»Wir sollten die Hausverwaltung rufen«, verkündete Till. Er stand von der Couch auf, trat an die Tür und klopfte lautstark dagegen. Dann wartete er ab. »Da! Nichts! Vielleicht rufen wir besser gleich die Polizei.«
»Und er ist nicht rausgekommen? For sure?«, fragte Kenneth. Der schottische Soziologie-Student fuhr sich durch die schwarzen Haare.
»Gestern Morgen hab ich ihn zuletzt gesehen«, sagte Ida. »Da war ich gerade auf dem Weg zum Bad und er ist aus der Küche gekommen und in sein Zimmer verschwunden. Hab ›Guten Morgen‹ gesagt, und er hat mich ignoriert.«
»Wie immer«, sagte Till.
»As always«, echote Kenneth.
Till beugte sich an die Tür und lehnte das Ohr daran. »Da brummt was«, verkündete er.
»Wie, brummt?«, fragte Ida.
»Na, brummt halt. Hör doch selbst.«
»Nee. Es stinkt schon bis hier, da muss ich nicht näher dran.
Till streckte die Hand nach dem Türgriff aus, zögerlich, als befürchte er, einen Schlag zu bekommen. Das geschah aber nicht, als er ihn berührte, niederdrückte … abgeschlossen. Er setzte sich wieder zu den beiden anderen auf die WG-Couch.
Zu dritt saßen sie nebeneinander und starrten zur braunen Holztür, hinter der sich Ulfs Zimmer befand. Es war das kleinste Zimmer in der WG, nur etwa zehn Quadratmeter groß.
»Wie lange does he gelebt hier?«, fragte Kenneth.
»Er war schon da, als ich eingezogen bin, vor … wann war das … zweieinhalb Jahren?« Till war der älteste Bewohner der WG - vermutlich, denn niemand von ihnen kannte Ulfs Alter genau. Jedenfalls sah er jünger aus als der 48jährige Till, der nur unter der Woche in der WG in der Stadt war und eine Familie irgendwo in der Pampa von Rheinland-Pfalz hatte. Er war damals in die hiesige Niederlassung seines Arbeitgebers - einem Zulieferer in der Autoindustrie - versetzt worden und hoffte, bald wieder in den Stammsitz zurückkehren zu können. Bislang vergeblich. Seine WG-Notlösung wurde langsam Dauerzustand.
»Ich bin only drei Monats hier«, sagte Kenneth, als wüsste das sonst niemand.
Ida, die Jura-Studentin lebte etwas über ein Jahr in der WG. Sie hatte eine Vorliebe dafür, Regeln aufzustellen, an die sich kaum jemand hielt - Kenneth gab vor, sie nicht zu verstehen, Till war sowieso nur die Werktage da, und Ulf … man sah ihn fast nie.
»Was studiert er denn eigentlich?«, fragte Ida.
Die beiden anderen schauten sich ratlos an.
»Er studiert doch, oder?«, setzte sie nach und schaute zu Till. »Ich meine, als ich eingezogen bin, hast du gesagt, Ulf wäre Student, aber nicht so oft hier.«
»Keine Ahnung. Dachte immer, dass er Student ist, so wie er rumläuft. Er ist ja nicht so kommunikativ.«
»We never talk about Ulf«, warf Kenneth ein.
»Wir wissen eigentlich nie, wann er hier ist!«, entfuhr Ida. »Manchmal geht man nachts aufs Klo, und da steht er am Kühlschrank und isst irgendwas. Dann huscht er zur Tür raus, ist tagelang weg, und irgendwann ist er wieder da. Und dann immer wieder diese komischen Geräusche aus seinem Zimmer. Das Krachen. Das Scheppern.«
»Aber nie nachts«, meinte Till. »Das wäre echt nervig.«
»Wir rufen jetzt die Hausverwaltung«, verkündete Till und holte sein Handy raus. »Am Ende ist er da drin wirklich–«
Er unterbrach sich, als zu hören war, wie Ulfs Tür aufgeschlossen und so weit geöffnet wurde, dass ihr Mitbewohner heraustreten konnte.
Ulf trug einen hellblauen Anzug, wie man ihn bestenfalls im Ausverkauf eines Discounters fand, dazu eine riesige Sonnenbrille und Schuhe, die drei Nummern zu groß wirkten. Seine Augen waren nicht zu sehen, aber sein Kopf bewegte sich ruckartig von einem zum anderen. »Ich ziehe aus«, verkündete er.
Und damit drehte er sich um und wollte wieder in sein Zimmer gehen.
»Moment!«, rief Ida.
Er hatte die Hand auf den Türgriff gelegt und den Kopf zur Seite geneigt.
»Ulf, wir haben uns gerade gefragt … was studierst du eigentlich?«
Zuerst antwortete er nicht. Dann sagte er nur ein Wort, und er sagte es leise, doch es schien den Raum zu erfüllen: »Euch.«
Er trat in sein Zimmer und schloss die Tür hinter sich.
Das Brummen, das Till vernommen hatte, wurde intensiver.
»WHAT THE–«, rief Kenneth aus, sprang von der Couch auf und stieß Ulfs Tür auf.
Mitten in Ulfs kleinem Zimmer stand ein gleißendes Rechteck, das blaues Feuer zu verströmen schien und die Quelle des Brummens war. Die drei WG-Bewohner hoben die Hände vor die Augen und konnten gerade so den Umriss von Ulf erkennen, wie er in das blaue Fegefeuer trat.
Und dann erlosch es mit einem Schlag.
Stille. Kein Brummen mehr. Kein blaues Feuer.
Kein Ulf.
Nur ein WG-Zimmer mit einem einfachen Bett, einem Sperrholz-Schrank und einem Schreibtisch, der voller Schriftzeichen war, die niemand von ihnen erkannte.
»Ich ruf dann mal die Hausverwaltung an«, sagte Ida mit belegter Stimme. »Wir brauchen einen neuen Mitbewohner.«
We never talk about Ulf (2017)
Erstveröffentlichung in: »Die Rückkehr des grünen Kometen«, Phantastische Bibliothek Wetzlar, 2017.
Ich habe nie in einer WG gewohnt. Ein Studentenwohnheim hat mir in den ersten beiden Semestern gezeigt, dass ich etwas brauche, wo ich die Tür hinter mir zumachen kann. (Eine Geschichte, die direkt aus der Wohnheimzeit stammt, kommt viel weiter hinten in der zweiten Hälfte dieser Sammlung.) Und ich kenne genug Anekdoten aus dem Freundeskreis, die verdächtig klingen wie etwas, das ich hier beschrieben habe …
Fliegen wir!
Ellen machte die Hitze Nevadas nichts aus, sie mochte sie sogar. Doch sie trug auch ein leichtes Stoffgewand, das den gelegentlichen Windstoß, selbst wenn es warme Luft war, unter die Kleidung ließ und ihre Haut erfrischte.
Ihre beiden Begleiter allerdings waren angezogen, als erwarteten sie augenblicklich einen Wirbelsturm oder gar einen Blizzard. Unter ihren Gewändern musste es glühend heiß sein, doch es schien ihnen nicht das Geringste auszumachen.
»Aber natürlich könnte hier ein Wald wachsen! Diese Wüstenei muss doch nicht ewig so bleiben. Schau dir den Boden an. Mit ein wenig Mühe lässt er sich urbar machen.« Hobble-Frank ritt auf einem schwarzen Pferd voran, das er Mister Black nannte, und machte ausschweifende Handbewegungen. Dabei klimperten die Messingknöpfe an seinem Frack. Der Rest seiner Kleidung war Stückwerk, von dem breitkrempigen Hut abgesehen, der mit Straußenfedern geschmückt war. Vielleicht lag es an diesem Hut, der so viel Schatten spendete, dass Hobble-Frank nicht einmal der Schweiß auf der Stirn stand.
Tante Droll, eigentlich Sebastian Melchior Pampel, reagierte auf die Behauptung seines Kameraden zunächst nur mit einem Grummeln. Er ritt hinter Hobble-Frank auf einem müden, braunen Klepper, der wohl lieber weiter die Feldarbeit in der Nähe von Reno verrichtet hätte, statt seinen Passagier durch die Ödnis von Nevada transportieren zu müssen. »Frank, ich weiß nicht, wann es passiert ist, aber dir muss ein verdammt großer Ast auf den Kopf gefallen sein, wenn du denkst, du könntest diesen trockenen Flecken Erde begrünen. Das wird in tausend Jahren nicht geschehen.« Tante Droll wurde so genannt, weil er ein sackartiges Gewand trug, das seine sowieso rundliche Form fast weiblich erscheinen ließ. Seine hohe Stimme und die Haare, die meist zu einem Dutt zusammengebunden waren, taten ihre Übriges dazu.
Die Beiden waren Vettern, doch so sehr Ellen sich in den vergangenen Tagen bemüht hatte, körperliche Ähnlichkeiten auszumachen, so wenig war es ihr gelungen. Sicher, sie waren beide Deutsche und von Natur aus eher blass, doch weder die Augenfarbe, noch die Nase, ja nicht einmal ihre Ohren hatten den Anschein von Ähnlichkeit. Von ihrem Körperbau ganz zu schweigen.
»Ich sage ja nicht, dass es leicht wäre; im Gegenteil, es wäre eine Mammutaufgabe, doch du solltest inzwischen gemerkt haben, dass unsere amerikanischen Freunde nicht vor großen Aufgaben zurückschrecken.«
Ellen zog leicht an den Zügeln, um ihren Schimmel langsamer ausschreiten zu lassen. Die Hitze mochte ihr nichts ausmachen, das endlose Geschwätz der beiden schon. Es vergingen keine fünf Minuten, in denen sie sich nicht beharkten, meist wegen irrelevanter Kleinigkeiten. Vorhin waren sie an einer Art Busch vorbeigeritten, den sie nicht eindeutig zuordnen konnten, und wenn Ellen nicht eingeschritten wäre, hätte es gut in einer Prügelei enden können. Hobble-Frank hatte wutschnaubend einen Zweig abgebrochen und verkündet, diesen seinem guten Freund Professor Hansen von der botanischen Abteilung der Universität Leipzig zu schicken, um sich seine Vermutung bestätigen zu lassen.
Die beiden diskutierten Bewässerungsmethoden derart intensiv, dass sie gar nicht bemerkten, wie Ellen sich zurückfallen ließ.
Sie war mit ihrem Vater gereist, Old Firehand. Der hatte sich mit dem Sheriff von Reno getroffen, und das seltsame Paar, das sein Vater schon länger kannte, hatte dort auch vorgesprochen. Der Sheriff von Reno, ein mürrischer, ja unwirscher Kerl, suchte Leute, die einen Banditen dingfest machten – oder kurzerhand töteten – der in der Nähe der Stadt sein Unwesen trieb.
Als Ellen erfuhr, dass es um Bill Budge ging, musste sie aufhorchen.
Budge heuerte immer wieder neue Söldner an und pflegte den Ruf, besonders grausam und ruchlos zu sein. Seine Bande war in allen Ecken des Westens bekannt, und viele Legenden rankten sich um ihre Taten und ihre Blutrünstigkeit.
Doch forschte man genauer, stellte man fest, dass es keine Beweise für die Grausamkeiten gab, die man ihnen nachsagte. Sicher, es waren Banditen, und sie begingen Verbrechen, aber Ellen hatte sie schon aus nächster Nähe erlebt, auch wenn sie damals nicht gewusst hatte, um wen es sich gehandelt hatte.
Sie war in Arizona gewesen, zu Gast beim Stamm der Hualapei, die Ärger mit Siedlern hatten. Eines Abends war eine dreiköpfige Gruppe bei den Ureinwohnern aufgetaucht. Weiße, alle in guter Kleidung, gar nicht wie Westmänner wirkend, nur auf der Durchreise. Der Stamm hatte ihnen zunächst misstraut, aber sie dann nächtigen lassen, und ihnen von den Problemen mit den Siedlern berichtet. Das hatten die drei nur schulterzuckend hingenommen, denn das ginge sie ja nichts an.
Im Laufe des Abends hatte Budge Ellen schöne Augen gemacht und sie ausgefragt, woher sie komme. Als sie von ihrem Vater berichtete, hatten Budges Augen gefunkelt, doch er schien nicht erzählen zu wollen, woher er Old Firehand kannte. Nachts hatte sie ein Messer neben ihrem Bett griffbereit gehalten, für den Fall, dass Budge dem Irrglauben verfiel, sie wünsche seine Nähe.
Doch als sie am nächsten Morgen erwachte, waren Budge und seine beiden Kumpanen verschwunden.
Nicht nur das, auch die Siedler waren keine Gefahr mehr. Viele ihrer Pferde waren weg, die Wagen sabotiert und ein Großteil ihrer Kleider hatte sich in Luft aufgelöst, weshalb viele der Siedler in Nachtgewändern herumirrten. Mit dem letzten Rest ihrer Habseligkeiten zogen sie von dannen, und für den Augenblick konnten die Hualapei wieder in Frieden leben.
Wahrscheinlich würde Budge sich nicht an sie erinnern. Er zog durch alle Teile des Westens, und sicher waren viele Frauen ihm leichter erlegen als sie. Doch anders als Hobble-Frank und Tante Droll hatte sie einen Anknüpfungspunkt.
Sie würden improvisieren müssen. Vielleicht konnten sie es als zufällige Begegnung hinstellen, wenn sie ihn fanden, vielleicht gelang es den beiden sogar, sich in ihre Bande einzuschmuggeln. Und Ellen konnte behaupten, sich mit ihrem Vater überworfen zu haben.
Zwei, drei Stunden ritten sie unter der sengenden Sonne dahin, und nie gingen den beiden Männern die Themen aus. Irgendwann hatte Ellen wieder zu ihnen aufgeschlossen. Sie waren von Reno aus den Schienen der Union Pacific Railroad in Richtung Salt Lake City gefolgt. Als sie in den frühen Morgenstunden losgeritten waren, hatten die beiden die Vermutung geäußert, dass Budge sich in der hügeligen Landschaft nördlich der Gleise versteckte. Als Ellen die beiden darauf hinwies, dass sie eigentlich in eine andere Richtung reiten mussten, schauten sie sich kurz verwirrt um, stritten über ihren genauen Aufenthaltsort und einigten sich schließlich, den nächsten Hügel neben den Schienen hinaufzureiten, um sich einen Überblick zu verschaffen.
Als sie oben angekommen waren, sah Ellen die ganze Weite von Nevada. Nach Osten schlängelte sich die Bahnlinie in Richtung Salt Lake City, im Westen war Reno auszumachen - doch so weit sie sehen konnten, lag dazwischen nur die braune, glühende Hügellandschaft von Nevada. »Wie wollen wir Budge hier finden?«
»Er wird uns finden, wenn ich mich nicht irre«, sagte Hobble-Frank.
So kam es auch.
Sie ritten nach Norden. Meist hielten sie sich in den Tälern, manchmal erklommen sie Hügel, und niemals gaben sie sich Mühe, sich zu verbergen. Sie waren in langsamem Tempo eine weitere Stunde unterwegs, und Ellen begann sich Gedanken über das Nachtlager zu machen, denn die Sonne berührte schon den Horizont. Vor Einbruch der Dunkelheit würden sie nicht nach Reno zurückkehren können.
Da gerieten sie in den Hinterhalt.
Wenn man ihn so nennen wollte. Es war nur Bill Budge, der in ihrem Weg stand, als habe er sie erwartet.
Er wirkte fehl am Platze in dieser Wildnis, denn er war gekleidet, als sei er gerade aus einem Salon in Boston getreten, um sich gemächlich auf den Nachhauseweg zu machen. Der Frack betonte seine schlanke Figur, und er hielt beide Daumen in die Seitentaschen. Sein Zylinder war verstaubt, als wäre er den ganzen Tag damit durch Nevada gelaufen. Selbst die feine Hose wirkte frisch gestreckt. Nur zwei Dinge gaben einen Hinweis darauf, wer er wirklich war: der Patronengurt mit den beiden Revolvern und die Stiefel, die gar nicht zu dem sonst so herrschaftlichen Auftreten passen wollten.
In seinem frisch rasierten Gesicht stand ein Lächeln, und die Augen strahlten, als näherten sich da alte Freunde.
Er sah genau so aus, wie Ellen ihn in Erinnerung hatte.
Sein Erscheinen hatte schon ein Gutes bewirkt, nämlich dass Hobble-Frank und Tante Droll endlich Ruhe gaben. Sie verlangsamten den Schritt ihrer Pferde nicht, doch ihre Hände näherten sich ihren Waffen.
Ellen, die immer noch hinter ihnen ritt, behielt Budge genau im Auge.
»Ellen!«, rief er unvermittelt aus, und Hobble-Frank zog seine Büchse hinter seinem Rücken hervor und richtete den Lauf auf den Mann, während Tante Droll blitzschnell beide Revolver zog. Ruckartig zerrte Ellen an den Zügeln und ihr Pferd blieb stehen.
»Was für eine Freude, dich nach so langer Zeit wiederzusehen!« Budge streckte die Arme aus, trat an Hobble-Frank und Tante Droll heran, streichelte die Nüstern der Pferde, ohne dabei langsamer zu werden und schritt zwischen ihnen hindurch, um an Ellens Seite zu treten. »Wie geht es Old Firehand, diesem alten Halunken?«
»Wer der Halunke ist, müssten wir wohl noch klären.«
Budge lachte auf. »Schlagfertig wie eh und je! Nun, was verschafft mir die Ehre deiner Anwesenheit? Halt, sag nichts! Es hängt sicher mit deinen beiden Begleitern zusammen.«
Hobble-Frank und Tante Droll hatten inzwischen ihre Pferde gewendet, und standen wieder Seite an Seite. Mit einer angedeuteten Verbeugung begann Hobble-Frank: »Nun, Sir, mein Bruder James und ich, William Johnson, zu Diensten, hörten von Ihnen, dass Sie immer auf der Suche sind nach erfahrenen Westmännern, die für Angelegenheiten eingesetzt werden könnten, die manche Leute als kriminell …«
»Hobble-Frank und Tante Droll!«, rief Budge aus. »Bitte, macht euch nicht die Mühe mit der Scharade. Ein solches Paar hat einen gewissen Ruf, und ich wäre nicht, wer ich bin, wenn ich nicht von euch gehört hätte. Nun weiß ich auch, dass ihr beiden Herren nicht unbedingt Dinge tut, die manche Leute als kriminell empfinden könnten. Genauso wenig wie ich natürlich!«
Er lächelte Ellen breit an, die ihre Lippen zur Reglosigkeit mahnte.
»Hört euch an, was morgen geschehen wird, und dann werdet ihr es sicher mitansehen wollen. Seid Gast in meinem Heim!«
Das Heim entpuppte sich als ein Lagerfeuer in einer Talsohle im Schatten eines Felsens. Und die Budge-Bande in ihrer jetzigen Form war genauso wenig beeindruckend, denn sie bestand nur aus zwei weiteren Personen.
Budge sagte, dass Wendy Parsons die beste Schützin sei, die er jemals kennengelernt hatte. Dabei bezweifelte Ellen, dass die dünne, im flackernden Licht des Lagerfeuers ausgemergelt wirkende Frau überhaupt eine Flinte heben konnte. Sie schien in ihren schwarzen, schmucklosen Kleidern, die ein paar Nummern zu groß waren, regelrecht zu versinken. Die Neuankömmlinge beäugte sie mit großem Misstrauen und ohne ein Wort.
Den anderen musste Budge nicht vorstellen, denn er trat sofort nach vorne. Auf seiner Schulter saß ein Falke, der die wackeligen Bewegungen des Mannes gelassen ausglich und immer wieder den Kopf ruckartig drehte. »Lasse Ikstrom, der Name, und Sie sind – sagen Sie nichts! – Deutsche!« Er schaute von Hobble-Frank zu Tante Droll und wieder zurück. »Diese Gesichtszüge, wie Meißner Porzellan!«
Nun schauten die beiden sich verwundert an.
»Und Sie!« Er wandte sich an Ellen. »Indianisch, eindeutig, aber nicht so ganz. Ich vermute …«
»Genug, Lasse«, unterbrach ihn Budge. »Lass sie erst einmal absteigen und gib ihnen etwas Kaffee.«
Ellen nahm den redseligen Mann mit dem skandinavischen Akzent genauer in Augenschein. Er war klein, dicklich, aber nicht aufgedunsen, und hatte blondes Haar, das ihm ins Gesicht hing. Ein Wirbelwind von einem Menschen. Dazu der Falke, der nicht einmal mit einer Schnur gesichert zu sein schien, sondern einfach so auf seiner Schulter blieb.
Nachdem die drei ihreKaffeebecher dankbar angenommen hatten, erzählte Budge, dass Ikstrom ein Weltenbummler sei, der immer und überall nach Kuriositäten suchte, die am anderen Ende der Welt gebraucht wurden. Budge hatte ihn in Reno getroffen und sofort gemerkt, dass er seine Dienste benötigen könnte, denn er hatte etwas mitgebracht, was ihm sehr hilfreich sein konnte, wie er augenzwinkernd sagte.
»Hilfreich wobei?«, fragte Hobble-Frank.
Budge grinste. »Welche Lüge hat der Sheriff von Reno euch wohl aufgetischt?«, fragte er zurück.
Hobble-Frank setzte an, ihm eine Lügengeschichte aufzutischen, doch Tante Droll kam ihm zuvor. »Nun, Bill, man kann dir nichts vormachen, so viel merke ich schon. Legen wir die Karten auf den Tisch. Der Sheriff von Reno hat uns geschickt, um dich ausfindig zu machen, denn es heißt, dass du planst, die Bank of Reno zu überfallen.«
Budge lachte schallend. »Ein Banküberfall? Ich? Hält man mich inzwischen für einen Strauchdieb? Einen dahergelaufenen Halunken?«
»Nun, stimmt es?«, fragte Hobble-Frank.
Budge schaute die beiden und Ellen ernst an. »Ich weiß Ehrlichkeit zu schätzen. Ihr hättet auch wild um euch schießend heranstürmen können und dem Sheriff von Reno meinen Kopf bringen, was ihn sicher zufriedengestellt und euch ein gutes Kopfgeld eingebracht hätte. Außerdem wärt ihr zu Legenden geworden, wenn ihr endlich den legendären Bill Budge zur Strecke gebracht hättet!«
Tante Droll zuckte mit den Schultern, als könnte man das durchaus so zusammenfassen.
Nun nahm er Ellen in Augenschein. »Du bist mitgekommen, weil du geglaubt hast, du könntest die beiden einschmuggeln. Weil wir uns schon kennen. Richtig?«
»Nun«, erwiderte Ellen, »da du Ehrlichkeit zu schätzen weißt, kann ich das nur bestätigen.«
Budge stand auf und umkreiste in einem weiten Bogen das Lagerfeuer. »Dann lasst mich euch erzählen, was es mit der Bank of Reno auf sich hat. Ja, ich möchte sie erleichtern. Aber nicht, indem ich die Bank überfalle, aber dazu später. Es geht mir darum, der Bank das zu nehmen, was sie unrechtmäßig von ehrlichen Leuten gestohlen hat, und diesen möchte ich es zurückgeben. Wisst ihr, wem die Bank gehört?«
»Dem Sheriff von Nottingham?«, fragte Tante Droll.
Auch das ließ Budge schallend auflachen. »Ein Vergleich, der mir gefällt, mein Freund. Aber nein, nicht diesem, sondern Ernest Blackriver.«
»Der Viehbaron?«, fragte Ellen.
»Ex-Viehbaron. Vor einigen Jahren hat er begonnen, Land in Nevada zu kaufen. Von Ureinwohnern, vom Staat, von Privatpersonen. Er hat seinen Einfluss in der Verwaltung geltend gemacht und ist inzwischen der Strippenzieher im Hintergrund. Und er hat begonnen, Geld zu verleihen. Der halbe Staat steht inzwischen bei ihm in der Kreide. Auch der Sheriff von Reno persönlich.«
Hobble-Frank und Tante Droll wussten darüber offenbar nichts, und sie schauten zu Ellen, die nickte. »Ich habe viel über ihn gehört … und es sind nicht gerade gute Sachen.«
»Muss ich erwähnen, dass der Sheriff von Reno nichts weiter als ein williger Erfüllungsgehilfe ist? Und dass er ungern die Drecksarbeit machen möchte, mich selbst zur Strecke zu bringen? Ich vermute, euch ist eine beträchtliche Summe für meine Ergreifung geboten worden … Glaubt ihr etwa, das Sheriff Department von Reno könnte so etwas aufbringen?« Er beantwortete seine Frage selbst. »Nein. Nicht annähernd. Blackriver schaltet seine Feinde aus, und seine Waffe ist sein Geld.«
»Hältst du dich deswegen in dieser Einöde versteckt?«, fragte Hobble-Frank.
»Oh, dies ist kein Versteck. Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass in dem Zug, den Blackriver morgen in Richtung Ostküste aufbrechen lässt, nicht etwa nur Vieh und Weizen transportiert werden, sondern ein beträchtlicher Stapel Dollarnoten … das Geld, das er von den Bewohnern in und um Reno gestohlen hat.« Budge blieb stehen und stemmte die Hände in die Hüften. »Also, meine Damen und Herren: Ich werde diesen Zug morgen überfallen, und ich werde das Geld denjenigen zurückgeben, denen es gehört. Wenn ihr das verhindern wollt, könnt ihr mich nun dingfest machen und dem Sheriff von Reno übergeben, ich werde mich nicht zur Wehr setzen.« Er schaute seine drei Gäste herausfordernd an.
Ellen, Hobble-Frank und Tante Droll entfernten sich ein Stück vom Lagerfeuer, um miteinander zu reden. Da die Sonne inzwischen untergegangen war, machte sich die Kälte der Nacht bemerkbar.
Keiner der beiden Männer schien ein dringendes Bedürfnis zu haben, seine Meinung kundzutun – vielleicht wegen der Sorge, mit dieser alleine zu stehen, also erhob Ellen das Wort. »Es wäre ein Fehler, Budge festzunehmen.«
»Das finde ich auch!«, sagte Hobble-Frank, und gleichzeitig rief Tante Droll aus: »Genau!«
»Wir könnten einfach wegreiten …«, sagte Ellen zögerlich.
»Wenn ich mich nicht irre, sind wir noch nie einfach so weggeritten«, sagte Hobble-Frank.
»Sicher nicht«, bestätigte Tante Droll.
»Vor allem nicht, wenn wir viele Dollar bekommen können und gleichzeitig der guten Sache dienen«, meinte Hobble-Frank.
Tante Droll nickte nachdrücklich.
Budge wirkte nicht überrascht, als die drei ans Lagerfeuer zurückkehrten und verkündeten, dass sie ihm helfen wollten.
»Eines allerdings macht mir noch ein wenig Sorgen«, sagte Tante Droll. »Wenn in diesem Zug viel Geld transportiert wird, dann werden viele Wachen mit großen Waffen auf dem Zug sein.«
»Lasst das unsere Sorge sein«, sagte Parsons, die gerade ihre Flinte reinigte.
»Mit einem einzelnen Schützen wird sich kaum ein ganzer Zug aufhalten lassen.«
»Da komme ich ins Spiel«, sagte Ikstrom.
»Inwiefern?«
Budge lachte auf. »Nicht er selbst … seine … Kuriosität.« Er deutete mit dem Daumen zu den Pferden, die ein wenig abseits standen.
Erst jetzt bemerkte Ellen, dass dort noch etwas stand. Es war etwas länger als ein Pferd, nur halb so hoch und mit einem großen, grauen Tuch bedeckt. Sie wollte gerade fragen, worum es sich dabei handelte, als Budge verkündete, dass es Schlafenszeit war.
Es war eine kalte Nacht, trotz des Lagerfeuers, das sie mit dünnen Ästen aus den Büschen am Leben hielten, und die Morgensonne war ein Segen. Als Ellen sich aufsetzte, sah sie Ikstrom, der beim Feuer hockte und an der Kaffeekanne hantierte. Er bemerkte sie und ließ schnell etwas in seiner Tasche verschwinden, bevor Ellen es in Augenschein nehmen konnte. »Ah, schon wach?«, fragte er, goss etwas Kaffee in eine Tasse und reichte sie Ellen.
Sie nickte ihm dankbar zu und nahm einen Schluck. Die Wärme weckte ihre Lebensgeister. Doch der Kaffee schmeckte anders als noch am Vorabend. Sie wollte schon fragen, ob es eine andere Mischung war, als sich neben ihr Hobble-Frank und Tante Droll reckten und aufstanden, als habe der Kaffeegeruch sie geweckt.
Budge kam hinter einem Hügel herum, begrüßte sie und holte sich auch Kaffee. Dann trat er zu dem verhüllten Objekt. »Der Zug wird in etwa einer Stunde in Reno aufbrechen. Aber er wird nicht weit kommen, zumindest nicht ein gewisser Teil seiner Ladung.