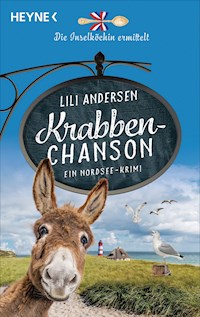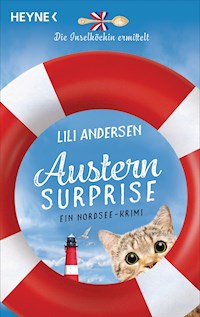
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inselköchin-Saga
- Sprache: Deutsch
Dieser Fall von Inselköchin Louise reicht Jahrhunderte zurück ...
Louise Dumas hat alle Hände voll zu tun. Die Französin und Wahlfriesin bekocht im Hotel Nordsee Lodge auf Pellworm eine illustre Gruppe aus Archäologen, Ethnologen und Historikern, die sich die „Rungholtfreunde“ nennen. Aufgrund der Funde im Wattenmeer streiten die „Freunde“ seit vielen Jahren leidenschaftlich über die Bedeutung der Handelsstadt Rungholt, die vor Hunderten von Jahren bei einer Sturmflut untergegangen war. Doch diesmal läuft der Streit aus dem Ruder: Drei Menschen sterben. Louise stellt mithilfe ihres treuen Freundes Momme Mommsen erste Ermittlungen an, die leider der Inselpolizistin Solveig Olms so gar nicht schmecken ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch
Gerade hat sich die Köchin Louise Dumas auf der beschaulichen Nordseeinsel Pellworm eingelebt. Sie genießt es, ihre Gäste zu bekochen und Land und Leute noch besser kennenzulernen. Da verschwindet plötzlich ein Journalist spurlos. Louise findet heraus, dass er einem archäologischen Fund auf der Spur war, auf den ein Jugendlicher zufällig im Wattenmeer stieß. Mit der Ruhe ist es vorbei, Louises detektivisches Gespür ist wieder erwacht. Für sie besteht kein Zweifel daran, dass der Journalist einem Verbrechen zum Opfer fiel. Und es kann kein Zufall sein, dass sie gerade jetzt die »Rungholtfreunde« bewirtet, eine Gruppe von Historikern und Archäologen, die über die Bedeutung der in einer Sturmflut versunkenen Stadt Rungholt diskutieren. Louises kriminalistischer Eifer stößt jedoch nicht nur auf Gegenliebe, vor allem nicht bei Solveig Olms, der offiziellen Inselpolizistin. Doch für Machtkämpfe ist keine Zeit, denn Louise liegt mit ihrem Verdacht richtig. Sie kommt dem Täter, der auch vor Mord nicht zurückschreckt, immer näher …
Die Autorin
Lili Andersen ist das Pseudonym der Krimiautorin und Kunsthistorikerin Liliane Skalecki. Wie ihre Protagonistin Louise Dumas hat auch Lili Andersen französische Wurzeln, ein Herz für kleine friesische Inseln und einen Hang zum Kochen köstlicher Gerichte. Sie lebt mit ihrer Familie in Bremen und Südfrankreich.
Lieferbare Titel
978-3-453-42500-2 – Krabbenchanson – Die Inselköchin ermittelt
LILI ANDERSEN
Die Inselköchin ermittelt
Ein Nordsee-Krimi
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 03/2022
© 2022 by Lili Andersen
Copyright © 2022 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Sandra Lode
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München, unter Verwendung von © Bigstock (maystra, paseven, yntheticmesssiah, Ku), iStockphoto (vora, MicroStockHub), Shutterstock.com (Sonsedska Yuliia)
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-26691-2V001www.heyne.de
Prolog
3. Oktober 1620
Am Horizont hatten sich unheilvolle Wolkenungetüme zusammengeballt. Mit einem Schlag war es dunkel geworden, und die Menschen hatten sich in ihre Häuser zurückgezogen. Mit Sorge beobachtete Ogge Brodersen den plötzlich aufkommenden Wind, der die Wasseroberfläche in Bewegung versetzte, geradeso als lauerten in der Tiefe Ungeheuer, die mit aller Macht nach oben drängten.
In zwei Monaten jährte sich zum fünften Mal die Große Schadensflut, die im Jahre des Herrn 1615 vierzig Wehlen in die Deiche geschlagen und dabei sogar den mitten durch Strand verlaufenden Moordeich beschädigt hatte. Dreihundert Menschen hatten den Tod gefunden, drei Kirchen waren zerstört worden, Dörfer verwüstet.
Der Wind zerrte an Ogges weitem Umhang aus Schafwolle. Er blies aus dem Westen, trieb das Wasser unerbittlich in Richtung Land. Er würde dafür sorgen, das Wasser nach der Flut trotz Ebbe nicht zurückweichen zu lassen. Und die nächste Flut kam so sicher, wie auf die Nacht der Tag folgte, das Wasser würde noch höher steigen. Sein Blick glitt über die Deiche. Sie würden dem standhalten. Noch im letzten Jahr waren sie erhöht und verstärkt worden.
Mit schweren Schritten trat Sönke Brodersen an Ogges Seite.
»Und?«
Der junge Mann schüttelte den Kopf.
»Wir sollten gelassen, aber wachsam bleiben. Die Sieltore werden sich öffnen, und das Wasser wird abfließen. Wenn der Sturm nicht noch zunimmt. Doch ich bin guter Hoffnung, dass der Allmächtige ein Einsehen mit uns hat.«
»Dein Wort in seinem Ohr. Möge er den Sturm zügeln.«
Sönke, Ogges jüngerer Bruder, hob den Kopf in Richtung Horizont, schnupperte wie ein Hund und sog die Luft tief in seine Lungen. »Ich rieche nichts. Und auf meine Nase kann man sich verlassen. Dieser Wind trägt keine Gefahr mit sich.«
Ogge lächelte und gab seinem Bruder einen Klaps auf den Hinterkopf. »Du und deine Nase. Wer ist denn gestern in die Schafscheiße gefallen? Wo war da deine Nase?«
Sönke grinste und knuffte Ogge in die Seite. Das war vielleicht ein peinlicher Auftritt gewesen. Das hatte man davon, wenn man den fliegenden Röcken zweier Mädchen hinterherschaute, statt auf den Weg zu achten. Er lenkte von diesem für ihn unerquicklichen Thema ab.
»Die alte Atje sitzt am Ofen und erzählt mal wieder vom Gottesfrevel der Rungholter. Macht sie ja immer, wenn eine Sturmflut droht. Man mag es kaum glauben, dass eine so stolze und reiche Stadt einfach so verschwindet, zunichtegemacht, weil es Gott so gefiel. Allerdings wüsste ich nicht, was zuletzt hier vorgefallen sein könnte, weswegen der Allmächtige uns zürnen könnte.«
Fragend sah er seinen älteren Bruder an. Der runzelte die Stirn und überlegte ernsthaft.
»Nein, nichts, was soll hier schon gewesen sein? Oder glaubst du, nur weil der versoffene Iven vor die Kirche gekotzt hat, droht uns nun der Untergang? Dann wären wir alle schon lange nicht mehr auf dieser Welt, so wie der säuft.«
Sönke brach in lautes Gelächter aus, das der immer wieder aufbrausende Wind davontrug. Er pfiff ihm um die Ohren, zerrte an seiner dunkelblauen Filzkappe, drohte, sie ihm vom Kopf zu reißen. Mit seiner rechten behaarten Pranke, die kaum zu dem schmächtigen Körper des Siebzehnjährigen passen wollte, hielt er sie fest.
»Sag, Ogge, glaubst du wirklich, die Geschichte mit der besoffenen Sau, den Oblaten im Bier und dem geschundenen Priester war der Grund für Rungholts Untergang? War es wirklich eine Strafe des Allmächtigen?«
Der Ältere zuckte mit den Achseln.
»Ich weiß es nicht, aber wir sind mit unseren Deichen gut gewappnet. Die Grote Mandränke war vor mehr als zweihundertfünfzig Jahren. Keiner von uns ist dabei gewesen, über Generationen ist darüber erzählt und gesponnen worden. Wer soll also noch wissen, was und warum sich das alles zugetragen hat.« Er räusperte sich. »Und ich möchte eigentlich nicht an einen zürnenden und rachsüchtigen Gott glauben.«
In diesem Moment drang Glockengeläut von der eine viertel Meile entfernten Kirchwarft an ihre Ohren.
»Pastor Heinsen läutet die Glocken. Hoffen wir, dass sie nicht von drohendem Unheil künden.«
Sönke hielt erneut seine Nase in den Wind. »Da kommt nichts auf uns zu.«
Auch Ogge ließ seinen Blick wieder über das Wasser schweifen, seine Augen tasteten den dunkelgrauen Himmel ab. Mit einem Seufzer der Erleichterung drehte er sich zu seinem Bruder um.
»Auf deine Nase und meine Augen ist Verlass. Geh zurück und verkünde allen, es wird nicht so schlimm werden. Der Sturm wird zulegen und die zweite Flut wohl um einiges höher werden. Schick mir noch vier Männer raus, wir werden die beiden Hauptsiele und den Deich vor der äußersten Warft im Auge behalten. Mehr können wir nicht tun, und mehr ist auch nicht erforderlich. Wir haben im letzten Jahr gute Arbeit geleistet.«
Auch wenn nach Einschätzung von Ogge Brodersen keine Gefahr für das Land bestand, näherte sich die Flut wie ein gefräßiges Tier. Sönke konnte die Faszination seines Bruders und seiner Schwester Levke für das alles hier, und damit meinte er wirklich alles – das windumtoste Land, die Warften, die Deiche, den schlickigen Boden nach und vor den Fluten, die Schauer- und Spukgeschichten, den Geruch nach verbranntem Torf und nasser Schafwolle, den Geschmack von gesalzenem und geräuchertem Fisch – nicht verstehen. Ihn zog es in die Ferne. Er würde hier nicht alt werden wollen, um bei jedem auch nur leise auffrischenden Lüftchen, das sich eventuell zu einem Orkan erheben konnte, mit dem Schlimmsten zu rechnen. Sein Ziel war Antwerpen. Er hatte schon viel von der großen Stadt in Flandern gehört. Dort würde er irgendwann sein Glück machen. Doch von seinem großen Traum hatte er noch niemandem erzählt. Sein Vater würde ihm das Fell gerben, wenn er damit ankäme. Sein Platz sei an der Seite der Familie. Doch noch fehlten ihm die geeigneten Mittel, von hier wegzukommen. Aber irgendwann … Und wenn er in der großen Stadt genügend Reichtum angehäuft hätte, würde er zurückkehren und die, die ihm lieb und teuer waren, daran teilhaben lassen. So lautete sein Plan.
Träumend starrte Sönke in die Ferne. Was war das? Ein Pfahl, der aus dem Wasser ragte? Doch noch bevor er seinen Bruder darauf aufmerksam machen konnte, war das Stück Holz schon wieder verschwunden. Die Flut war hungrig.
»Es ist wirklich nicht zu glauben, dass sich hier vor unseren Augen einmal eine reiche Stadt befunden hat«, kam er wieder auf Rungholt zu sprechen und verzog sich dabei schaudernd in seinen Umhang. »Alles weg, Mensch und Tier, einfach alles. Was meinst du, ob die Holzreste, die Vater vor drei Wochen entdeckt hat, ein Teil der Kirche von Rungholt waren? Ich habe keine zwei Tage, nachdem Vater davon berichtet hat, nach ihnen Ausschau gehalten, doch da war schon wieder alles unter dem Sand und Schlick vergraben.«
Ogge zuckte mit den Achseln. »Von der Kirche, vielleicht von einem Haus, einem Stall, ich habe keine Ahnung. Wie dem auch sei, hier irgendwo muss Rungholt gelegen haben.« Er wies mit seiner rechten Hand zum Wasser und schwenkte seinen Arm dann in alle Richtungen. »Denk nur an die beiden Münzen, die Levke gefunden hat, oder an den Krug mit dem merkwürdigen Wellenmuster, der bei der alten Sinja steht. Und noch viel mehr hat man hier immer mal wieder gesehen oder gefunden. Allerdings, ob die Stadt wirklich so unermesslich reich war, wie die Alten erzählen, vermag ich nicht zu beurteilen. Vielleicht war sie einfach nur ein wichtiger Handelsplatz mit einem Hafen, in dem Schiffe aus fernen Ländern angelegt haben.« Ogge hatte bei den letzten Worten nachdenklich und gespannt in die Ferne geschaut, als erwarte er, dort ein Schiff mit geblähten Segeln auftauchen zu sehen.
»So, nun wollen wir aber nicht mehr den alten Geschichten nachhängen, denken wir an das, was kommt. Zumindest werden wir in dieser Nacht kein Ungemach zu erleiden haben. Der Sturm wird sich ordentlich ins Zeug legen, aber er birgt keine Gefahr. Was stehst du also noch hier rum. Spute dich, es wird allen eine Erleichterung sein, das zu hören.«
Es kam, wie Ogge es vorausgesagt hatte. Der Sturm richtete keine Schäden an, die Deiche hielten, Mensch und Vieh hatten die Gefahr einmal mehr überstanden. Zwar hatte die erste Flut am Nachmittag am Deich geleckt, die zweite in den frühen Morgenstunden des Folgetages noch versucht, die Schutzwälle anzunagen. Doch dabei war es geblieben. Das nachfolgende Niedrigwasser gegen zehn Uhr am Vormittag ließ die Priele wie silberne ruhende Schlangen in der Herbstsonne glänzen.
Am Tag danach
Levke Brodersen wusste, nach solchen Unwettern zeigten sich die Schätze im Watt am ehesten. Die Kraft des Windes und die Wut des Wassers gaben so manchen Fund frei, ließen eine rote Scherbe oder eine von Seepocken vernarbte Schmuckschließe an die Oberfläche treten. Aber auch Knochen, von denen sie nicht hätte sagen können, ob sie von Menschen oder Tieren stammten, kamen zum Vorschein, oder bronzene bauchige Gefäße, die sich kaum von den Grapen unterschieden, die auch bei ihnen im Haus über dem Feuer hingen.
Altes Gelumps, so ihr Vater, wenn sie mit ihren Schätzen nach Hause zurückkam. Lediglich die beiden Münzen waren ihm einen erstaunten Blick wert gewesen. Es war zwar kaum etwas darauf zu erkennen, und die kaum lesbaren Schriftzeichen sahen sehr merkwürdig aus, aber die Geldstücke schienen aus Silber zu sein. Levke hatte sie in der kleinen Holzkiste mit der geschnitzten Ähre auf dem Deckel sicher verwahrt. Der Wetzstein dagegen, den sie aus dem Schlick geborgen hatte, war sofort in des Vaters Werkstatt gelandet.
Der soll aus der untergegangenen Stadt sein? Den wird jemand erst vor Kurzem dort verloren haben, so seine Einschätzung.
Warum sich allerdings irgendein Jemand mit einem Wetzstein ins Watt begeben haben sollte, erschloss sich Levke nicht wirklich. Nur, Widerspruch duldete der Vater nicht.
Das Wetter war nun ruhig, genau richtig, um sich auf Schatzsuche zu begeben. Die junge Frau hatte ihre Schuhe auf dem Deich gelassen und marschierte barfuß ins Watt. Sie trug unter ihrem dunkelblauen Rock eine Hose von Sönke, ihr eigenes langes weites Kleidungsstück war ihr nur hinderlich. Levke stopfte den Rock nun in die Hose und band diese mit einem Viehstrick um ihren Bauch herum enger, damit sie nicht rutschte. Den Leinensack, in dem sie immer ihre Schätze transportierte, hatte sie an das Seil geknotet.
Levkes Füße versanken im Schlick. Er war kalt und quetschte sich angenehm kitzelnd zwischen ihren Zehen hindurch. Es war ein für den Oktober erstaunlich milder Tag, der so nach dem letzten Sturm nicht zu erwarten gewesen war. Sie strich sich die langen lockigen Haare aus dem Gesicht und beschirmte ihre Augen mit beiden Händen. Wie ein Vogel auf der Jagd nach einem Wurm spähte sie über den glänzenden Sandboden. Ihr Blick wanderte Zoll um Zoll über die Fläche, unter der sie Rungholt vermutete. Das war kein Altweibergeschwätz, keine Spukgeschichte, wie ihr Vater gerne behauptete, diese Stadt hatte es wirklich gegeben. Davon war nicht nur Levke überzeugt. Warum sonst erzählten noch heute die Alten davon? Was waren schon zweihundertsechzig Jahre? Nichts! Ihre Großmutter hatte eine Tante gehabt, deren Cousine einen Vater hatte, dessen Großmutter wohl zusammen mit dem Pastor damals dem Untergang entkommen konnte. Oder so ähnlich.
Die Sonne sandte ihre Strahlen von einem Himmel, der so blau und unschuldig daherkam, dass ihm an einem solchen Tag niemand etwas Böses zutrauen würde. Levke blinzelte, als etwas Gleißendes sie für einen Moment blendete. Keine einhundert Schritte entfernt lockte ein glänzendes Etwas sie an. Doch augenblicklich machte Enttäuschung sich in ihr breit. Schon wieder eine Grape. Solche Dinger aus Bronze hatte sie schon drei an der Zahl gefunden. Die Enttäuschung wich bei näherer Betrachtung allerdings schnell einer gehörigen Portion Erregung. Diese Grape war größer als alle anderen und glänzte wie ein Aal in der Sonne. Das bauchige Gefäß steckte zu drei Vierteln im Sand. Irgendetwas musste darin verborgen sein, dessen Glitzern Levke angezogen hatte, als sich vorhin ein Sonnenstrahl in die Grape verirrt hatte.
Neugierig beugte sie sich über den Kessel, der ehedem von einer Schweinsblase abgeschlossen und abgedichtet worden war, die noch in Resten am Rand klebte. Vorsichtig steckte Levke ihre Hand hinein, wühlte damit ein wenig in den Tiefen der Grape herum, um dann einen brüchigen Lederbeutel hervorzuziehen. Sie öffnete ihn und riss die Augen auf. Der Beutel war voll mit Münzen, die den beiden ähnelten, die sie vor Wochen im Schlick gefunden hatte. Nur waren diese hier in einem wesentlich besseren Zustand. Sie zog die Lederschnur, die um den Beutel geschlungen war, zusammen und steckte ihn in ihren Leinensack.
Doch welches Glitzern hatte sie auf die Spur der Grape geführt? War es doch der bronzene bauchige Körper des Gefäßes selbst gewesen? Noch einmal tauchte ihre Rechte in den Kessel und beförderte einen kleinen Krug zutage, dessen einzelner Henkel abgebrochen war. Noch gut erkennbar zierten große Spiralen die feine Keramik.
Nun beugte sich Levke tief über die große Öffnung. Sie hielt den Atem an. Vorsichtig hob sie den Schatz ans Tageslicht. Der Becher schien ihr aus purem Gold zu sein. Er maß vielleicht drei Daumen in der Höhe und ebenso in der oberen Breite. Sie hob ihn gegen die Sonne. So etwas Wunderschönes hatte sie noch nie gesehen. Ehrfurchtsvoll strich Levke mit ihrem Zeigefinger über die kleinen Stiere, die zwischen den winzigen Bäumen sprangen – perfekt modelliert, lebensnah. Sie setzte den Becher vorsichtig zu dem Lederbeutel mit den Münzen in ihren Leinensack und zog einen zweiten Becher gleicher Machart aus dem Kessel. Die junge Frau errötete. Eine Reihe nackter Männer, die eine Waffe oder einen Dreschflegel, so genau konnte sie es nicht erkennen, über der Schulter trugen, zierten das kleine Gefäß mit den beiden winzigen Henkeln. Sie war auf einen echten Schatz gestoßen, und der Kessel barg noch mehr.
Als Levke sich auf den Heimweg machte, war der Leinensack gefüllt und schwer. Den Rest ihrer Beute trug sie in dem hochgeschürzten Rock mit sich, den sie aus der Hose gezogen hatte und nun mit beiden Händen zusammenraffte.
Jetzt musste sie zusehen, dass sie nach Hause kam. Der Wind hatte erneut aufgefrischt, und von Westen zogen mit großer Geschwindigkeit dunkle Wolken heran. Der Herbst hatte seine ganz eigenen Gesetze. Eben noch wärmte die Oktobersonne von einem blauen Himmel, den Flügelschlag eines Austernfischers später musste man sich sputen, wollte man trockenen Fußes das sichere Land hinter dem Deich erreichen.
Levke hoffte inständig, dass der abrupte Wetterwechsel kein Fingerzeig des Allmächtigen war, der ihr diesen Raub, diesen Frevel übel nahm. Aber das war doch schließlich nicht das erste Mal! So war es schon immer gewesen, so würde es auch immer sein. Was das Wasser freigab, das durfte man auch behalten. Nur hatte sie noch nie einen solchen Schatz geborgen. Es war also wirklich etwas dran an den Erzählungen der Alten. Diese Stadt und ihre Bewohner mussten wirklich reich gewesen sein, denn – dessen war sich Levke sicher – ihre Münzen, ihre Goldbecher und all das andere, was sie mit sich trug, waren Schätze aus dem untergegangenen Rungholt.
Kapitel 1
Pellworm im Oktober
Louise bremste ab und sprang vom Rad, als sie das gelbe Postfahrrad von Wimmer entdeckte, der eben wieder an die Straße trat. Er lächelte spitzbübisch.
»Moin, Louise. No, wi geiht? Du kannst dat wohl nich afftöb’n, dat de Post henn noh di kümmt.«
»Moin, Wimmer.« Louise tat so, als wäre sie überhaupt nicht interessiert am Inhalt der großen Tasche, die auf dem Transportvehikel festgeschnallt war, obwohl sie es tatsächlich nicht erwarten konnte. Sie fuhr sich durch die dichten kinnlangen Locken und richtete ihre Augen auf Wimmers hagere Gestalt. Ein Duell entspann sich, das sich seit mittlerweile fast acht Wochen zwischen ihnen abspielte. Hatte er nun was im Gepäck oder nicht? Machte Louises Herz heute einen Freudensprung oder nicht?
Die Locke, die sie eben hinters rechte Ohr gestrichen hatte, wurde von einer Windbö erwischt, und Louise versuchte, sie erneut zu bändigen. Ihre Haare, die sie sich in einem Anflug von Wut und Schmerz darüber, dass Thierry Worms sie nicht einfach nur verlassen hatte, sondern seine Ex-Frau ihr auch noch das Leben schwermachte, hatte abschneiden lassen, waren wieder gewachsen. Die Wochen des Ankommens, Einlebens und Heimischwerdens auf der kleinen Insel hatten ausgereicht, die Wunde langsam, aber sicher verheilen zu lassen.
Louise Dumas, einst Spitzenköchin im Elsass – ein Gourmetstern für sie und das La Grenouille d’Or war zum Greifen nahe gewesen – fühlte sich hier mittlerweile pudelwohl. Von ihrer ersten Reaktion nach der Trennung und der Drohung von Madame Worms, sie würde in keiner Küche auf dieser Welt mehr eine Anstellung finden, nie mehr kochen zu wollen, war sie mittlerweile weit entfernt. Sie lebte jetzt seit mehr als vier Monaten auf Pellworm im Haus ihrer Patentante Fine Dierksen, kümmerte sich mit ihr um Haus und Hof, um Katzen und Hühner und um Sture, den Esel. An zwei bis drei Tagen in der Woche tobte sie darüber hinaus ihre kulinarische Kreativität in der Küche des Warft Cafés von Frauke Winkler aus.
Fine war die älteste und beste Freundin ihrer Mutter, und es war keine Frage gewesen, dass sie Louise nach ihrer unglücklichen Liaison mit Thierry Worms mit offenen Armen empfangen hatte. Mit ihren fünfundsechzig Jahren war sie eine attraktive und bodenständige Frau, die es in den letzten Monaten verstanden hatte, Louises Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein wieder aufzubauen und zu festigen. Die wertvollen Kochmesser mit den eleganten und scharfen Damaszenerklingen, Louises wichtigste Utensilien in der Küche, kamen wieder regelmäßig zum Einsatz. Das alles hatte sie Fine zu verdanken. Daneben hatte der Zauber der Insel dazu beigetragen, dass sich Louise auf Pellworm einfach nur wohlfühlte und die Insel mittlerweile als ihr zweites Zuhause betrachtete.
Vor zwei Wochen hatte sie einige Besorgungen in Husum zu erledigen gehabt, und mit ihr waren zahlreiche Urlauber an Bord der Fähre gegangen. Sie hatten ihre Herbstferien auf Pellworm verbracht und reisten nun voll Bedauern wieder aufs Festland zurück. Ein Funke Stolz und eine ordentliche Portion Freude hatten Louise bei dem Gedanken durchströmt, in ein paar Stunden das Privileg genießen zu dürfen, wieder auf ihre Insel zurückzukehren.
Ja, sie war angekommen und genoss in diesem Moment das kleine Scharmützel mit Wimmer. Seine Augen hielten Louises Blick noch einen Augenblick stand, dann grinste er, öffnete die noch prall gefüllte Tasche, wühlte ein wenig darin herum und zog eine riesige Postkarte heraus. Frech hob er den Arm und wedelte ein wenig mit der bunten Ansichtskarte vor Louises Nase herum.
»Los, rück sie raus, sonst mach ich dich kalt.«
Louise reckte ihre knapp einhundertsechzig Zentimeter, kniff die Augen zusammen und zielte mit Daumen und Zeigefinger auf den Briefträger, der sie um mehr als einen Kopf überragte.
»Eine Karte aus Cartagena. Dein Freund kommt ganz schön rum.« Mit einem breiten Grinsen überreichte Wimmer Louise die bunte Ansichtskarte, auf der eine ockerfarbene Kirche in einen azurblauen Himmel aufragte. San Pedro Claver – Cartagena los Indios Columbia prangte in geschwungenen Lettern darunter.
»Die wie vielte ist das jetzt?«
»Wimmer, sei nicht so neugierig und wage es bloß nicht, meine Post auch noch zu lesen.«
Mit diesen Worten steckte Louise die Ansichtskarte in ihre Jackentasche und radelte los, nicht ohne sich noch einmal umzudrehen und Wimmer zuzuwinken.
In der reetgedeckten Kate angekommen stürmte sie, ein Chanson von Georges Moustaki trällernd, in die Küche. Der Text war zwar traurig, aber das Lied kam Louise jedes Mal in den Sinn, wenn sie auf Wimmer traf. Le jeune facteur est mort. Il n’avait que dix-sept ans. L’amour ne peut plus voyager, il a perdu son messager. Der junge Briefträger ist tot. Er war erst siebzehn Jahre alt. Die Liebe kann nicht mehr reisen, sie hat ihren Boten verloren.Wimmer war allerdings mindestens fünfzig, hatte also das kritische Alter schon längst überschritten.
Es duftete nach Apfelgelee, das Fine soeben in bereitgestellte Gläser füllte. Ein Hauch von Zimt erreichte Louises Nase und nach intensivem Schnuppern die nelkenlastige Würze des selbst gemachten Apfellikörs, den Fine in der Woche zuvor aus Äpfeln aus dem eigenen Garten, einem hochprozentigen Korn, einer Zimtstange und Nelken hergestellt hatte. Einen kleinen Schuss davon hatte sie in eine Hälfte des Gelees getan, während die andere einen zarten Rosenduft verströmte.
Fine löffelte eine kleine Portion des heißen Gelees in ein Schälchen, wo es schnell abkühlen konnte. »Ich bin gespannt, wie es dir schmeckt. Kannst du schon mal die Brötchen in das Körbchen legen? Ich bin hier gleich fertig, dann können wir frühstücken.«
Louise ließ die krossen Brötchen aus der Papiertüte in ein rundes Weidekörbchen fallen. »Es riecht einfach himmlisch, dein Gelee. Ich glaube, ich mag das ohne Schuss noch lieber als das mit. Es duftet herrlich. Hast du etwa Rosenblätter mitgekocht?« Sie nahm einen kleinen Löffel und überzog die Spitze mit einem Hauch des goldgelben Gelees. Sie kostete vorsichtig und schloss verzückt die Augen. »Mon Dieu, Fine, das ist eine Offenbarung. Du kennst mich, zu einer Mettwurst könnte ich niemals Nein sagen, ein Stück Inselkäse, für mich immer ein Hochgenuss, aber das hier … Zum Niederknien gut. Was ist das für eine Sorte, die in deinem Garten wächst? Ich habe sie wachsen und reifen sehen, aber nie einen Gedanken daran verschwendet, wie sie heißt. Ich vermute mal, eine ganz alte?«
Louise deckte den Tisch, während Fine das letzte Glas zuschraubte und es umgekehrt auf ein Küchentuch stellte.
»Ja, ganz recht. Es ist die Agathe von Klanxbüll. Nix Rosenblätter. Der Apfel selbst entwickelt dieses feinblumige Aroma.« Sie stellte den großen Kupfertopf in die steinerne Spüle und ließ warmes Wasser hineinlaufen.
»Was für ein origineller Name. Hast du eine Ahnung, wieso der Apfel so heißt?«
»Nicht nur das. Mein Großvater Tietje kannte sogar die Züchterin. Die Bäume in unserem Garten sind vor über achtzig Jahren gepflanzt worden. Die Setzlinge hat er noch von Agathe Petersen persönlich bekommen. Klanxbüll liegt so knapp sechzig Kilometer nördlich von Husum. Zwischen Klanxbüll und Rodenäs hat Agathe ein Gasthaus betrieben. Das muss jetzt auch schon hundert Jahre her sein. Opa Tietje hat erzählt, ein Reisender, der in Petersens Gasthaus abgestiegen war, habe einen Apfel gegessen. Der hat ihm so gut geschmeckt, dass Tante Agathe, wie sie von allen genannt wurde, nach dem Griebs fragte, also dem Kerngehäuse. Sie nahm die Kerne raus, setzte sie in einen Topf mit Erde und die Setzlinge dann in ihren Garten. Nach ein paar Jahren trugen die Bäumchen die ersten Früchte. Und wir haben Nachfahren von Agathes Apfelbäumen hier im Garten. Der Apfel ist eine echte Augenweide mit seinen roten Bäckchen, und sein Duft hält länger an als jedes Parfum.«
»Das ist eine wirkliche conte de fée, ein Märchen. Fehlt nur noch ein junger Prinz, der einen solchen Apfel seiner Angebeteten schenkt und sie damit für sich gewinnt. Vielleicht zähmt er einen Drachen, der ihr jedes Jahr zu einer bestimmten Zeit einen Apfel überbringt, sodass sie ihn, der in der Ferne weilt, nicht vergisst.«
Mittlerweile war der Kaffee aufgebrüht und verströmte sein kräftiges Aroma in Fines Küche. Louise liebte diesen Raum mit dem alten Holztisch, dessen Kerben von jahrzehntelanger Nutzung zeugten, dem Tellerschrank, in dem Fine ihr blau-weißes Geschirr mit dem Strohblumenmuster aufbewahrte, und die steinerne Spüle, in der das Wasser länger heiß blieb als in jedem Edelstahlbecken. Sie goss den Kaffee ein, während Fine zwei dunkle Walnussbrötchen aufschnitt.
»Du hast wirklich eine blühende Fantasie, mien Deern. Apropos Prinz in der Ferne. Kannst du deiner Postkartengirlande ein neues Stück hinzufügen? So fröhlich, wie du eben vor dich hin geträllert hast, bis du doch garantiert Wimmer, dem Drachenboten, über den Weg gelaufen, und der hatte was für dich dabei.«
Louise rollte gespielt genervt mit den Augen, während sie sich dick Butter auf eine Brötchenhälfte strich, die ein noch dickerer Klacks Apfelgelee krönte.
»Was seid ihr alle neugierig auf eurem Inselchen. Passiert denn hier sonst gar nichts, außer dass Mademoiselle Dumas ab und zu eine bunte Ansichtskarte bekommt?« Sie biss in ihr Brötchen. »Ist das délicieuse. Unglaublich lecker.« Dann grinste sie von einem Ohr zum anderen. »Aber es ist tatsächlich heute etwas angekommen. Warte.«
Louise leckte sich einen Finger ab, an dem etwas von der goldenen Köstlichkeit klebte, flitzte in die Diele und kam mit der Karte zurück, die sie freudestrahlend an ihre Brust drückte.
»Er macht ja nie viele Worte, aber das ist doch einfach nur süß. Egal wo er steckt, es kommt eine Ansichtskarte. Vor lauter Rosenapfelduft, der mich magisch in die Küche gezogen hat, hätte ich die Karte beinahe vergessen. Schön, nicht? Als wäre sie aus Gold, so leuchtet die Kirche in der Sonne.«
Fine setzte ihre Lesebrille auf und begutachtete das Motiv.
»Ja, wirklich sehr imposant. Cartagena, das ist in Kolumbien. Dann macht er sich sicher bald auf den Weg in die USA.«
»Er ist schon da. Ich habe zwar noch keine Karte, aber er hat eine WhatsApp geschickt. Er weiß, wie froh ich bin zu wissen, wenn er gut an seinem Ziel angelangt ist. Die Karte aus Cartagena wurde immerhin schon vor neun Tagen abgestempelt. Ich bin mal gespannt, ob die Post aus den USA schneller hier ankommt.« Louise lehnte die Ansichtskarte an die Zuckerdose und betrachtete sie mit einem verliebten Blick. »Vor Weihnachten ist er wieder auf der Insel. Dann sehen wir mal weiter.« Sie wurde ernst. »Es ist schon merkwürdig, welche Geschichte uns zusammengebracht hat. Wäre Klas Thams nicht gestorben, hätten wir uns wahrscheinlich nach Thams Geburtstag aus den Augen verloren.«
»Nun, wer weiß. Auf jeden Fall hat die Geschichte die Inselbewohner ganz schön aufgewühlt. So etwas hatten wir noch nie. Momme sagte neulich noch, so eine Aufregung hätte er sich vor seiner Pensionierung lieber erspart.«
Louise dachte mit großer Zuneigung an Momme Mommsen, den ehemaligen einzigen Inselpolizisten, der seit Ende Juni im Ruhestand war. Er hatte seiner Nachfolgerin noch angeboten, ihr in der ersten Zeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, was diese allerdings mit einer guten Portion Blasiertheit quittierte, wie er Louise erzählt hatte. Nein, diese Frau sei überhaupt nicht sein Fall, hatte er gemeint. Wer nicht will, der hat gewollt. Bevor ich mich über die ärgere, genieße ich doch lieber meine neue Freiheit, gehe zum Fischen oder schnitze aus Treibguthölzern meine fantastischen Wesen. Aber am liebsten sind mir die Ausflüge mit Fine, hatte er Louise dann mit einem Augenzwinkern gestanden.
Nach dem genussreichen Frühstück räumten die beiden Frauen auf und spülten das Geschirr. Louise brachte den Hühnern und Sture die Apfelschalen und zog sich dann in ihr Zimmer zurück, um die Karte zu ihren Kollegen an die rote Schnur zu hängen, die sie von Wand zu Wand gespannt hatte. Neunundzwanzig waren es mittlerweile. Die erste Karte hatte Chris bereits in Bremerhaven aufgegeben, bevor er das Schiff nach Lima bestiegen hatte. Von Wäscheklammern gehalten erzählten die Karten von Chris’ Reisen nach Lima und Porto Velho, nach Manaus, Boa Vista, Maturin, Caracas und Maracaibo. Allein vom Parque Nacional Del Catatumbo hatte er drei Postkarten gesandt, die atemberaubende Landschaften zeigten. Sein letztes Ziel auf dem südamerikanischen Kontinent war Cartagena gewesen, von wo aus er nach Florida geflogen war. Dort war Chris vor sechs Tagen gelandet, doch die Karte aus Miami stand noch aus.
Louise öffnete das Fenster. Eine kräftige Brise Seeluft bauschte die Vorhänge auf und ließ die Karten an der roten Schnur tanzen. Bald war die Feriensaison auf Pellworm zu Ende. Die Sommerwochen hatten Tausende von Touristen auf die Insel gespült, und die Herbstferien sorgten noch einmal für ordentlichen Schwung. Doch dann war es fast vorbei. Fine meinte, ab November könne man die Touristen mit der Lupe suchen. Weihnachten und der Jahreswechsel füllten dann noch einmal die Gästebetten, und dann war wirklich Schluss. Ab Januar war man bis zum nächsten Ansturm auf Pellworm unter sich.
Tief sog Louise die frische salzhaltige Luft ein und leckte sich über die Lippen, schmeckte noch immer die feine Süße des Apfelgelees. Eine wunderbare Kombination, ging es ihr durch den Kopf. »Ich weiß, es ist ein Sakrileg, aber ich muss es unbedingt ausprobieren«, murmelte sie und sprang die Treppe hinunter in die Küche.
»Fine?«
»Hmm?« Fine saß am Tisch und studierte das Nordfriesland Tageblatt.
»Kann ich das kleine Glas mit Gelee haben, ich hab da so eine Idee.«
»Natürlich, ich will deiner Kreativität ja nicht im Wege stehen. Was hast du denn vor?«
»Kannst du dich an den Feigensenf erinnern, den ich vor ein paar Wochen mitgebracht hatte? So was in der Art würde ich gerne mit dem Apfelgelee versuchen. Eigentlich ist es fast zu schade dafür, aber wenn das Ergebnis so wird, wie ich es mir wünsche … Und ich hab da noch eine Idee. Apfelsenf.« Sie biss sich auf die Lippen und überlegte. »Dazu brauche ich Senfkörner. Ich mach mich nachher auf den Weg in den Supermarkt. Also, wenn du noch was brauchst.«
Fine setzte ihre Brille ab. »Du machst mich neugierig. Ich schätze, du brauchst Senf für dein erstes Experiment?«
Louise nickte und öffnete den Kühlschrank. »Eigentlich nur von dem grobkörnigen und vom Gelee. Ich mische es zwei zu eins, et voilà haben wir einen wunderbaren Begleiter zum Käse. Ich bringe uns noch etwas Käse mit und ein paar Trauben, dazu ein schöner Roter. Was meinst du?«
»Das hört sich sehr gut an. Dann lass ich dich mal machen.« Fine setzte wieder ihre Brille auf und widmete sich den Todesanzeigen.
Während Louise mischte, rührte und abschmeckte, vernahm sie aus Fines Richtung ein Ach oder Na so wat.
»Fertig. Koste mal.« Sie hielt ihrer Patentante eine Tasse und einen kleinen Löffel hin. »Genau die richtige Mischung, hoffe ich, nicht zu süß und nicht zu scharf.«
Fine stippte den Löffel in den Apfelgeleesenf und probierte vorsichtig. »Ah, das ist absolut keine Vergeudung, das ist einfach nur lecker. Wo du immer nur die ganzen Ideen hernimmst, mien Deern.«
Zufrieden deckte Louise die Tasse ab und stellte sie in den Kühlschrank. »Entwickelt sich einfach so hier drin.« Sie tippte sich an die Stirn. »Dann mach ich mich mal auf den Weg. Hoffentlich haben die Senfsaat im Laden. Ich werde mich an einem echten Apfelsenf versuchen. Wenn dir noch was einfällt, was ich mitbringen soll, ruf einfach an.«
Ein starker Wind wehte Louise entgegen. Sie musste ordentlich auf dem Rad dagegen ankämpfen, doch sie fühlte sich frei und unbeschwert. Was gab es Schöneres, als sein Leben auf diesem wunderbaren Fleckchen Erde verbringen zu dürfen. Nur einmal schnürte es ihr die Brust zusammen, als sie das Holzkreuz am Straßenrand passierte. Ein frischer Strauß Herbstastern hing am rechten Kreuzarm. Hier war die junge Inken Jensen im Sommer vor drei Jahren zu Tode gekommen. Lange hatte man nicht gewusst, was damals wirklich geschehen war. Bis zum letzten Sommer, als die Wahrheit endlich ans Licht gekommen war.
Kapitel 2
Einige Monate zuvor
Artikel aus dem Husumer Nachrichtenblatt vom 13. Juli
Fast zum tödlichen Verhängnis geworden …
Fast zum tödlichen Verhängnis geworden ist einem jungen Mann aus Hannover seine leichtsinnige Erkundung des Wattenmeeres. Der Sechzehnjährige, der mit seinen Eltern die Ferien in Husum verbringt, war nach dem Besuch des Nissenhauses alleine zu einer Wattwanderung aufgebrochen, von der er beinahe nicht mehr zurückgekehrt wäre. Am Dienstagnachmittag schloss ihn die Flut ein. Der junge Mann konnte nur dank seines Handys mit GPS-Funktion und des Einsatzes des Amphi-Rangers aus dieser gefährlichen Situation gerettet werden. Das Amphibienfahrzeug mit Allradantrieb und Schiffsschraube erreichte den Watterkunder, als dieser bereits bis zur Hüfte im Wasser stand. Abenteuerlust sei sein Motiv gewesen, so der junge Mann, der sich von Fuhlehörn bei Ebbe auf den Weg zur Hallig Südfall gemacht hatte, in der Hoffnung auf Relikte des untergegangenen Rungholt zu stoßen.
An dieser Stelle sei noch einmal dringend darauf hingewiesen, dass es nur mit professioneller Führung erlaubt ist, eine Wattwanderung zur Hallig Südfall von Nordstrand aus zu unternehmen.
Bei sachkundiger Führung ist die Wattwanderung ein Erlebnis, bei dem man das alte Rungholt vor seinen Augen auferstehen sieht. Alleine, ohne Kenntnis der Gezeiten, jedoch ein manchmal tödliches Unterfangen, denn das Watt ist nicht immer ein fester Grund, den man sorglos betreten kann. Die Schlickablagerungen wandeln sich ständig, Schlickfelder, die auf keiner Karte zu finden sind, können zu einer tödlichen Falle werden. ADW
Artikel aus dem Husumer Nachrichtenblatt vom 21. Juli
Schatzsucher müssen sich an die Regeln halten
Wie das Husumer Nachrichtenblatt erfahren hat, sind vor einigen Tagen außergewöhnliche Artefakte im Watt vor der Hallig Südfall entdeckt worden. Ein sechzehnjähriger Urlauber aus Hannover, der nur knapp dem Tod im Wattenmeer entkommen ist (wir berichteten), hat eine Anzahl offenbar erstaunlicher Funde einer Mitarbeiterin des Nissenhauses übergeben, von wo sie an das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein weitergeleitet werden. Ein ausführlicher Bericht zu den entdeckten Gegenständen folgt. Leider konnte der junge Mann keine genauen Angaben mehr zum Fundort machen, was die Einschätzung und Einordnung der Funde nicht nur erschwert, sondern quasi unmöglich macht.
Daher an dieser Stelle ein Hinweis an alle »Schatzsucher« im Wattenmeer, in dem bis heute Überreste längst versunkener Siedlungen und Ortschaften erhalten sind. Im Wattboden schlummern die letzten Spuren von Warften, Deichen und Brunnen, die nicht selten an den Prielrändern wieder auftauchen. Dabei stoßen Wattwanderer auf Keramikscherben, Steine, Knochen, Metallgegenstände und mehr.
Was ist zu tun, wenn der Wattwanderer über ein Zeugnis der Vergangenheit stolpert?
Zunächst ist die Fundmeldung oberstes Gebot. Alle archäologischen Funde unterliegen der Meldepflicht (Meldung an das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein). Stellt sich der Fund als bedeutend heraus, erfolgt eine wissenschaftliche Bearbeitung und eventuelle Konservierung. Doch der Finder sei beruhigt, oftmals dürfen die Funde nach der Begutachtung zurück zu ihrem Entdecker.
Wichtig sind das Lokalisieren des Fundes und die genaue Angabe der Fundumstände. Dazu sollten, wenn möglich, die genauen Koordinaten festgehalten werden, dies mittels Smartphone, Fotos oder auch durch Einzeichnen in eine mitgeführte Umgebungskarte. ADW
Artikel aus dem Husumer Nachrichtenblatt vom 2. August
Noch keine Stellungnahme zu den sensationellen (?) Funden aus dem Wattenmeer vor der Hallig Südfall
Auch auf mehrfaches Nachfragen des Husumer Nachrichtenblattes hat das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein in Kiel noch keine Angaben über die Funde im Wattenmeer vor der Hallig Südfall gemacht. Wie berichtet, hat ein junger Mann aus Hannover, der sich leichtsinnig im Wattenmeer in Lebensgefahr gebracht hatte, eine Reihe von Funden gemacht, die er dem Nissenhaus in Husum übergeben hat, von wo sie in das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein in Kiel gelangt sein sollen. Wie aus Insiderkreisen bekannt geworden ist, soll es sich bei diesen Funden um eine kleine archäologische Sensation handeln.
Wir hoffen, bald Näheres berichten zu können. ADW
Kapitel 3
Husum im September
Als Adrian Willner die Ausgabe des Husumer Nachrichtenblatts vom 13. Juli in Händen gehalten hatte, hätte er den Artikel am liebsten ausgeschnitten, gerahmt und auf seinen Platz gestellt. Sein erster größerer Zeitungsbeitrag. Weitere waren gefolgt, seine journalistische Karriere hatte begonnen. Vorbei die Zeit, da er sein Talent in einer Schülerzeitschrift mit dem Aufreger über verschmutzte Toiletten vergeudet hatte oder sich über einen Professor mit rechtsradikalen Äußerungen in der Unizeitung echauffierte, nein, es war ein echter Artikel in einer echten Wochenzeitung. Doch leider hatte er noch immer keinen festen Arbeitsplatz, auch keinen Vertrag mit dem Husumer Nachrichtenblatt, noch nicht einmal einen Stuhl in den Redaktionsräumen. Adrian war frisch von der Journalistenschule nach Husum gekommen, die Welt stand ihm offen. Glaubte er, hoffte er. Doch es war alles nicht so einfach. Keine Zeitung stellte mehr fest ein, ein Volontariat war das Höchste der Gefühle, und sein erster Artikel über den Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr in Wittbek war erst gar nicht gedruckt worden.
Und dann hatte es der Zufall gewollt, dass Adrian, den Kopf voller trüber Gedanken und mörderischer Ideen – wie schafft man sich eine überhebliche, seine Qualitäten nicht erkennende und, noch schlimmer, diese negierende Chefredakteurin vom Hals? – Zeuge der Rettungsaktion im Watt geworden war. Dieser kleine Idiot aus Hannover hätte fast sein Ende in der Flut gefunden. Er erinnerte sich daran, als wäre es gestern gewesen. Kreidebleich und bis über den Hintern durchnässt hatte man den Jungen aufs Festland gebracht. Adrian hatte seine Chance ergriffen und den jungen Tölpel nicht mehr aus den Augen gelassen, nachdem der zitternd vor Kälte und Schreck aus dem roten Amphibienfahrzeug herausgeklettert war.
Der Wattranger warf dem Jungen noch einen aufmunternden Blick zu und begann, einen Zettel mit seinem Bericht auszufüllen. Wann war er gerufen worden? Wie lange hatte der Einsatz gedauert? Wo genau hatte er den Wattwanderer in Not aufgegabelt? Wie war zu diesem Zeitpunkt dessen Zustand? Und ganz sicher folgte bald die Rechnung für die Rettungsaktion, mutmaßte Adrian. Und das mit Recht. Hoffentlich war sie saftig. Der Rettungswagen, der schon vor Ort bereitstand, war wieder abgerauscht, nachdem die Eltern den jungen Mann in ihre Arme geschlossen und der Vater sich als Notfallmediziner der Sophienklinik in Hannover entpuppt hatte, der sich um seinen Sprössling kümmern würde.
Adrian hatte sich mit besorgter Miene dazugesellt und dabei ganz den Eindruck erwecken können, er habe irgendetwas mit der Rettung des Jungen zu tun. Also, ich war mir ja nicht sicher, aber als ich da draußen in der Ferne diesen Punkt entdeckte, habe ich mir gleich gedacht, dass da … Natürlich habe ich sofort reagiert. Die Eltern schüttelten ihm die Hand, Adrian zog auch noch seine Jacke aus und legte sie demonstrativ zusätzlich über die Wolldecke, die zum Wärmen über den Schultern des unglücklichen Wattwanderers lag.
»Na, so was passiert aber nicht noch einmal«, meinte er dann großväterlich, obwohl er kaum fünf oder sechs Jahre älter als der junge Hannoveraner war. »Wohl auf Schatzsuche gewesen und die Zeit vergessen, hm?«, fügte er noch mit einem Blick auf die ausgebeulten Hosentaschen des jungen Mannes hinzu. Das würde ein netter Artikel werden, den die Kaiser ganz sicher abdruckte.
Dass noch viel mehr daraus werden konnte, war Adrian spätestens dann klar geworden, als der Junge bei dem Wort Schatzsuche rot anlief, in seine rechte Hosentasche griff und einen kleinen, auf der Oberfläche von Seepocken besetzten Gegenstand herauszog. Während die glücklichen Eltern sich ein letztes Mal bei ihrem Wattretter vor dem roten Amphibienfahrzeug bedankten, versuchte Adrian zu erkennen, was da in der Hand des Jungen lag.
»Zeig mal her«, forderte er ihn auf, doch Tom, wie der Knabe von seinen Eltern genannt worden war, machte keinerlei Anstalten, seinen Fund preiszugeben, schloss stattdessen die Hand zur Faust. Bleich stand er da, seine Unterlippe zitterte verdächtig.
»Hör mal, ich mach dir keine Schwierigkeiten, aber du weißt, dass du das da abgeben musst. Alles andere, was du gefunden hast, natürlich auch. Komm, lass mich wenigstens Mal einen Blick drauf werfen.«
Tom zögerte, dann öffnete er die Hand und drehte sein Fundstück um. Es war rund, etwas kleiner als ein Eineurostück, aber etwas dicker, schätzte Adrian. Vielleicht eine Münze? Die zweite Seite war von den Seepocken verschont geblieben, sie war lediglich verdreckt. Mit seinem Fingernagel kratzte der Junge auf der Oberfläche herum, noch immer schweigsam und von einem sichtbar schlechten Gewissen geplagt.
»Tom, ab nach Hause. Du gehörst in die heiße Badewanne und dann ins Bett.«
Die Eltern rückten an, um ihren Sprössling in ihr Feriendomizil zu geleiten. Tom ließ seine Hand in der Hosentasche verschwinden. Doch Adrian hatte erkennen können, was den Gegenstand in dessen Hand zierte – ein Vogel mit kurzen abgespreizten Flügeln.
Toms Vater murmelte ein letztes Dankeschön und zog Adrians Jacke von den Schultern seines Sohnes. Dann verschwanden die drei in Richtung eines Audis mit Hannoveraner Kennzeichen. Der Mann redete auf Tom ein, worauf sich der Junge umdrehte und Adrian zurief, dass er natürlich seine Funde abgeben würde, das hätte er von Anfang an vorgehabt.
Den ersten Artikel zum Geschehen im Watt hatte Adrian allgemein gehalten, über die Rettung des Jungen geschrieben und eine Warnung hinzugefügt, wie gefährlich eine Wattwanderung ohne kundigen Führer sein könne. Für den zweiten Artikel hatte er Kontakt mit dem Nordfriesland Museum und dem Archäologischen Landesamt in Kiel aufgenommen, um zu erfahren, was das Watt preisgegeben hatte. Doch die Antworten waren sehr allgemein ausgefallen, man müsse die Funde zunächst sichten, blablabla. Überhaupt hatte Adrian den Eindruck gewonnen, man sei dort nicht sehr auskunftsfreudig.
Er hatte dann ein zweites Mal nachgehakt, wieder ohne Erfolg. Bei seinem dritten Anruf in Kiel wollte er dann wissen, wie lange denn eine solche Untersuchung dauerte. Er hätte sich das Telefonat sparen können. Nicht nur, dass nichts dabei herausgekommen war, es hatte auch noch einen Anschiss der dämlichen Kaiser zur Folge gehabt. Er solle endlich Ruhe geben. Ihr sei zu Ohren gekommen, er würde sich mit seiner ewigen Fragerei nach den Fundstücken aufführen wie ein investigativer Journalist. Was er denn erwarte, ob er glaube, in Kiel würden sie auf einem Schatz sitzen, den sie vor der Öffentlichkeit geheim halten wollten? Er solle die Leute ihre Arbeit machen lassen. Wenn es von den Archäologen etwas Interessantes zu berichten gäbe, würden sie das tun.
Investigativer Journalist. Das konnte die Kaiser haben. Wenn sie ihm schon unterstellte, sich wie ein Enthüllungsjournalist zu gebärden, dann würde er dem gerne nachkommen.
Adrian fertigte aus dem Gedächtnis eine Zeichnung der Münze an. Der Durchmesser ähnelte dem einer Eineuromünze, also etwa dreiundzwanzig Millimeter. Sie war nicht richtig rund wie die modernen, gestanzten Münzen, sondern eher unförmig in ihrem Umriss. Aus welchem Material sie war, hätte er nicht sagen können. Er brauchte genauere Informationen, die wahrscheinlich der Finder der Münze haben würde. Doch irgendwie hatten sich alle gegen ihn verschworen. Ein erstes Telefongespräch mit Hannover hatte ihn nicht weitergebracht. Tom ging bereits wieder zur Schule. Seine Mutter teilte Adrian mit, man habe am selben Tag noch alles im Nissenhaus abgegeben, von wo man die Funde nach Kiel weiterleiten wollte. Es wäre ja nichts Besonderes gewesen. Ein paar Scherben, etwas, was wie ein Klumpen zusammengeschmolzenes Metall ausgesehen hätte, vielleicht ein Gewicht, denn etwas Ähnliches habe man im Nissenhaus als Exponat gesehen, und so was wie eine Münze, wahrscheinlich ein ganz normales, verdrecktes Geldstück.
Von wegen normales, verdrecktes Geldstück. Adrian konnte sich das Gefühl nicht erklären, aber er war sich sicher, dass es etwas Besonderes war. Genauso ein Gespür und der Drang, dem nachzugehen, machten einen guten Journalisten aus. Wenn er nur genauer hingesehen hätte. Er versuchte, sich den Vogel in Erinnerung zu rufen, doch seine Recherche im Internet zu dem Motiv war ernüchternd. Zig Länder hatten Vögel auf ihren Münzen. Neuseeland prägte sie mit einem Kiwi, in Kroatien war es eine Nachtigall und auf der griechischen Euromünze eine Eule. Die kam dem Ganzen noch am nächsten. Also doch nichts Außergewöhnliches? Einfach ein Geldstück, das lange im Wasser gelegen hatte, von Pocken überzogen worden und Wind und Wetter ausgesetzt war, die an dem guten Stück genagt hatten?
Verdammt noch mal, nein! Das war kein normales Geldstück gewesen, es war dicker und die Ränder unregelmäßig. Wenn er sich doch nur genauer an den Vogel erinnern könnte. Die Flügel waren sehr klein gewesen. Ein Engel? Nein! Was hatte sonst noch Flügel? Und wenn er sich nun von dem Begriff Vogel verabschiedete? Vielleicht besser geflügeltes Wesen?
Adrian googelte die Begriffe Münze, geflügeltes Wesen, alt, antik, und die Suchmaschine spuckte ihm in Sekundenschnelle zahlreiche Beispiele aus. Sphingen, Greife, echte Vögel, alles war dabei, geprägt auf Gold und Silber, Kupfer oder Bronze. Aber auch Siegel und Siegelringe waren mit diesen Motiven geschmückt worden und das seit der frühesten Antike. Vielleicht war es ja gar keine Münze, sondern die Platte eines Rings, der der eigentliche Ring verloren gegangen war?
Adrian suchte weiter und stieß auf die Abbildung eines antiken Siegelrings, der dem, was er in Erinnerung hatte, schon recht nahekam. Abgedruckt war das Stück in einer Heidelberger Dissertation zum Thema Goldene Siegelringe der ägäischen Bronzezeit. Flugs lud er sich die wissenschaftliche Arbeit herunter und blätterte virtuell darin herum. Plötzlich blieb ihm der Atem weg. Das war tatsächlich kein Vogel gewesen, es war ein Greif, ein mythisches Wesen mit Flügeln. Und genau eine solche sagenhafte Gestalt hatte er als Abbildung in dieser Arbeit entdeckt. Er war sich jetzt zu hundert Prozent sicher. Das war nicht die Prägung auf einer Münze, sondern die Zierde eines Siegelrings. Das war ja ein Ding! Laut dem in der Doktorarbeit erläuterten Grabungsbefund gehörte der abgebildete Siegelring in die Zeit der minoischen Kultur. Mann, das war ja ewig her, mindestens dreitausend Jahre. Doch wie kam ein solches Stück ins nordfriesische Wattenmeer? Oder ging jetzt der journalistische Gaul mit ihm durch? Spann er sich da irgendetwas zusammen?
Und dann hatte Adrian keine Ruhe mehr gegeben, hatte die Mitarbeiter im Museum in Husum und im Archäologischen Landesamt mit Anrufen und Fragen bombardiert, doch vergebens, er bekam keine brauchbare Auskunft. Husum hatte die Funde weitergeleitet, ohne sie groß zu untersuchen, das war Aufgabe der Archäologen in Kiel. Man könne sich nicht erinnern, ob da eine Münze dabei gewesen sei. Sie erhielten täglich Fundstücke. Natürlich seien da auch Geldstücke dabei, Gulden, sogar römische Münzen, aber an ein Stück mit geprägtem Greifenwesen könne man sich beim besten Willen nicht erinnern. Und in Kiel lagen die vielen Wattfunde bis zur weiteren Begutachtung in irgendeinem Depot. Es war frustrierend.
Ein erneuter Anruf in Hannover brachte Adrian zunächst immer noch nicht weiter. Zwar hatte er dann Tom persönlich an der Strippe, doch der Junge hatte seinen Funden wohl nur oberflächliches Interesse geschenkt, er sagte, er sei froh gewesen, das ganze Zeug loszuwerden, ohne noch irgendeinen Anschiss zu erhalten. Adrian nahm ihm das zwar nicht ab, aber was hätte er machen sollen?
Noch einmal nahm er sich die Doktorarbeit aus Heidelberg vor und druckte sich die Umzeichnung des Siegelrings groß aus. Keine Frage, das Motiv erinnerte ihn an das auf Toms Fund. Dann hatte sein Festnetztelefon geklingelt, die Nummer war unterdrückt. Auch wenn es in den meisten Fällen bei solchen Anrufen Werbefuzzis waren, die ihm irgendetwas andrehen wollten, nahm Adrian sie meist entgegen. Man wusste ja nie.
Die etwas unsichere Stimme von Tom aus Hannover drang an sein Ohr. Er habe es total vergessen, er habe ja ein Foto von dem Steinding gemacht. Es sei ja total verdreckt gewesen. Er habe es etwas gereinigt und als Erinnerung mit seinem Handy fotografiert. Erst jetzt, als er mal den ganzen Müll löschen wollte, sei er wieder drübergestolpert. Die ganze Aufregung, wissen Sie. Sorry. Aber wenn Adrian das Foto haben wolle, er könne es ihm gerne schicken.
Nach einer Minute piepste Adrians Handy, das Foto war da. Zwar etwas unscharf, aber nach Adrians Einschätzung eindeutig. Das Motiv, das die Münze, den Ring, oder was auch immer es war, zierte, ähnelte stark dem auf dem Siegelring, einem Fund aus einem minoischen Grab Tausende von Kilometern vom Wattenmeer vor Husum entfernt.
Kapitel 4
Als Louise mit ihren Einkäufen zurückkehrte, war Fine unterwegs. Ihre Patentante hatte sie doch noch beauftragt, aus Thams Hofladen, den Louise fast jede Woche mit großer Begeisterung aufsuchte, Esskastanien mitzubringen. Sie gehörten zwar nicht zu den Früchten, die die Natur Pellworms hervorbrachte, aber zu einem herzhaften Herbstgericht passten sie allemal, und so wurden sie von Zeit zu Zeit auch hier angeboten. Marrons. Louise liebte Esskastanien. Was Fine wohl mit ihnen vorhatte? Vielleicht ein Maronenpüree? Es würde wunderbar zu der Hähnchenterrine passen, die sie vorbereiten wollte, denn ein frisch geschlachtetes Hähnchen hatte sie im Hofladen ebenso angelacht wie der herzhafte Speck von bester Bioqualität. Für ihre Terrine würde sie zwar nur das Brustfleisch brauchen, doch ein Hähnchen sollte nicht umsonst gestorben sein, alles würde sie verarbeiten. Von den Knochen bis zu den Innereien.
Louise breitete ihre Einkäufe auf dem Tisch aus, die Maronen, Hähnchen, Speck, dunkelrote Trauben, eine Tüte mit Senfkörnern – natürlich hatte es die im Supermarkt gegeben, schließlich legten die Leute ihre Gurken meist selbst ein, wie Louise sich sagte – , ein Päckchen mit Pistazien für die Terrine und ein großes Stück Inselkäse mit dem Namen Rungholt von der Insel-Käserei für das Abendbrot.
Mit einem großen Korb marschierte sie in den Garten. In den letzten Rosen tummelten sich summend und brummend nimmermüde Insekten, und die Hühner kamen aufgeregt angerannt, in der Hoffnung auf eine kleine Futterration zwischendurch. Louise warf ihnen eine Handvoll Körner ins Gehege, die sie mit ruckenden Köpfchen aufpickten. Sture beäugte das Ganze aufmerksam aus der Entfernung. Noch stand genügend Gras auf der Weide, da blieb er lieber, wo er war, nicht, dass man noch irgendwas von ihm wollte. Louise wanderte zwischen den Beeten entlang, erntete Mohrrüben, Zwiebeln, zwei Pastinaken und ein Büschel Petersilie.
Die beiden Rezepte, die sie sich für heute ausgedacht hatte, würden wahrscheinlich, wenn sie glückten und mundeten, wie sich Louise das vorstellte, Eingang in ihr geplantes Kochbuch finden. Noch hatte sie keinen Schimmer, wie sie das Projekt aufziehen wollte. Doch ihre Sammlung vergrößerte sich täglich um mindestens zwei Rezepte. Und das, was sie auftischte, war nicht einfach nur schmackhaft, wie ihr Fine oder die Landfrauen, die sie ab und an bekochte, und die Gäste des Warft Cafés versicherten, sie waren auch ein Augenschmaus, liebevoll angerichtet wie ein kleines Kunstwerk. Doch Kochbücher gab es wie Sand am Meer. Wahrscheinlich wurden die Verlage, die solche Bücher herausbrachten, geradezu mit Ideen überschüttet. Mediterrane Küche, vegane Küche, Herbstküche, Kochen mit dies, Kochen mit das. Louise hatte sich auf den gängigen Plattformen im Internet kundig gemacht, es gab eigentlich für jeden Geschmack und für jede persönliche Lebenseinstellung bereits das passende Kochbuch.
Ihre Besonderheit lag in der Kombination der raffinierten französischen Küche und der traditionellen Küche hier im Norden mit ihren wunderbaren Produkten von den Weiden und aus dem Wasser. Sie liebte die kleinen Nordseekrabben, die hier Porren hießen, wie sie schon am ersten Tag auf Pellworm gelernt hatte. Ob eine solche Kombination einen Verlag überzeugen würde? Leider hatte sie es bis heute versäumt, ihre Küchenkreationen einmal zu fotografieren. Wenn es auch nur für sie selbst gewesen wäre. Es war ja geradezu eine Mode geworden, Selbstgebackenes oder Gekochtes abzulichten und ins Netz zu stellen. Auch in den Restaurants wurde fleißig geknipst, bevor man sich mit Messer und Gabel über sein Essen hermachte. Das war natürlich im La Grenouille d’Or gar nicht gerne gesehen worden. Louise war es mittlerweile egal. Wenn die Leute ihre Speisen fotografieren wollten, warum nicht. Vielleicht würde sie auch Hubertus Schulte bitten, wenn dieser mal wieder auf Pellworm seinen Urlaub verbrachte, eines ihrer Gerichte abzulichten. Hubertus war ein begnadeter Hobbyfotograf. Sie hatte ihn im Sommer auf dem Fährschiff nach Pellworm kennengelernt, und er war ihr zu einem guten Freund geworden. Nicht nur das. Ihm verdankte sie ihr Leben.
Für einen Moment schweiften Louises Gedanken zurück in diese aufregende Zeit, als sie das Geburtstagsfest für Klas Thams, alias Jeff Storm, Schlagersänger, der die Massen begeisterte, ausgerichtet hatte. Nur gut, dass das ausgestanden war. Sie schüttelte die Erinnerung ab und begann mit der Zubereitung ihres Apfelsenfs.
Die kleinen gelben Senfkörner mahlte sie zu einem feinen Mehl. Ein Agathe-Apfel verlor seine rote Schale – die Hühner würden sich freuen –, dann schnitt Louise ihn in winzige Würfel. Zusammen mit dem Senfmehl, Apfelsaft und Apfelessig wanderten sie in eine Pfanne, dazu gepresster Knoblauch, eine in winzige Stücke geschnittene Zwiebel, etwas Honig, Pfeffer und Salz. Zu guter Letzt gab Louise, nachdem die Masse knapp zehn Minuten geköchelt hatte, einen weiteren Esslöffel Senfkörner dazu. Der Biss auf die Körnchen würde zu einer ganz besonderen Geschmacksexplosion führen. Sie schmeckte ab. Sehr schön, der Senf genügte ihren Ansprüchen. Die Menge reichte für zwei kleine Gläser, die sie sofort verschloss. Noch ein paar Tage im Kühlschrank, dann wäre der Senf gut durchgezogen, und man konnte ihn servieren. Zu ihrer Hähnchenterrine ein perfekter Begleiter und ein harmonisches Geschmackserlebnis.
Flink wusch sie das Hähnchen, trennte das Brustfleisch heraus und legte es beiseite. Das Gemüse wurde geschält, die Schalen wanderten mit dem Rest des zerlegten Geflügels in einen großen Topf mit kaltem Wasser. Noch zwei Lorbeerblätter, drei Nelken, eine getrocknete Chilischote, ein Teelöffel Pfefferkörner und etwas Salz dazu, und in neunzig Minuten würde der Duft einer kräftigen Brühe die Küche erfüllen. Dann widmete sie sich der Leber, die sie mit einer kleinen gewürfelten Zwiebel in Butter anbriet, dazu ein Schuss Apfelschnaps, etwas Majoran, Salz und Pfeffer, das Ganze im Anschluss grob püriert – eine Gaumenfreude auf einer Scheibe dunklen Brotes. Sie füllte die kleine Portion in ein Schälchen, deckte es ab und stellte es in den Kühlschrank.
Für die Terrine musste sie mehr Zeit einplanen. Fein geschnittene Zwiebeln, eine geriebene Möhre und eine Pastinake dünstete sie mit einem Hauch Knoblauch in Öl an, fügte Thymian, Salz, Pfeffer und ihr geliebtes Piment d’Espelette hinzu. Nach zehn Minuten war das Gemüse bereit abzukühlen. Schon jetzt zog ein verführerischer Duft durch die Küche. Die Hähnchenbrust drehte Louise durch den Fleischwolf, mischte sie mit der Gemüsemischung und schmeckte die Farce noch einmal kräftig ab. Sie legte eine Kastenform großzügig mit dem in Streifen geschnittenen Speck aus und füllte etwas mehr als die Hälfte der Farce ein, darüber eine Handvoll gerösteter und gehackter Pistazien, eine letzte Schicht Hackfleischmischung und zum Schluss das Ganze mit Speck abgedeckt. Bei einhundertachtzig Grad im Backofen wäre die Terrine nach einer knappen Stunde fertig. Heiß oder kalt, ein wahrer Genuss. Louise lief jetzt schon das Wasser im Mund zusammen, wenn sie nur daran dachte. Bis dahin war Zeit genug aufzuräumen, zu spülen und schnell unter die Dusche zu springen, bevor sie zum vorletzten Mal in dieser Saison zum Warft Café radelte.
Die Zwiebelschalen und die winzigen Federn samt Kielen, die sie noch aus dem Hähnchen gezupft hatte, wanderten in den Biomüll. Um den Mülleimer nicht zu verschmutzen, packte Louise ihren Abfall immer in die Seite einer alten Zeitung, die Fine neben dem Mülleimer aufbewahrte, um sie gleich zur Hand zu haben. Mittlerweile hatte sich der Zeitungsstapel sehr verkleinert. Das Exemplar, das Louise herauszog, erschien ihr wie ein letzter Gruß des Sommers. Es war eine Zeitung von Anfang August, als die Temperaturen die sechsundzwanzig Grad überschritten hatten und das Leben auf der Insel noch von den Feriengästen geprägt gewesen war. Louise konnte sich tatsächlich noch an die Schlagzeile des Husumer Nachrichtenblattes erinnern, das einmal in der Woche kostenlos im Supermarkt auslag, die ihr jetzt wieder ins Auge sprang. Eine archäologische Sensation aus dem Wattenmeer war angekündigt worden. Merkwürdig, da war wohl nichts draus geworden, sonst hätte man doch in den folgenden Wochen und Monaten mal etwas davon gehört. Louise zuckte mit den Achseln und wickelte den Abfall in das Blatt.
Kapitel 5
Bremen drei Wochen zuvor
Christine Evers hatte in den letzten Wochen in ihrem Werkstattatelier für einen Privatsammler ein kleinformatiges Gemälde von Max Liebermann aufwendig restauriert. Ein solch hochkarätiges Bild hatte noch nie den Weg zu der Gemälderestauratorin gefunden. Es war ihr eine Freude gewesen, den Farben, die der Impressionist für seinen Spaziergang am Meer verwendet hatte, zu ihrer alten Strahlkraft zu verhelfen. Jetzt waren die winzigen Risse in der Leinwand ausgebessert, der Schmutz und der gelbliche Firnis entfernt und die Fehlstellen mithilfe einer Lupenbrille Millimeter für Millimeter mit der Farbe, die sie nach mehreren Versuchen perfekt zusammengemischt hatte, retuschiert worden.
Wenn sie einem Gemälde wieder zu seiner ehemaligen Schönheit verholfen hatte, es in neuem Glanz erstrahlte, konnte sie sich nur mit Mühe davon trennen. Neben dem Künstler, der sein Sujet auf die Leinwand, einen Holzuntergrund oder einen Karton gebannt hatte, war sie die Person, die das Kunstwerk, seine Entstehung, seine Aussage am besten kannte und verstand, es war ihr Baby.
Schon früh hatte Christine ihre Leidenschaft zur Malerei entdeckt, ein Studium an der Kunsthochschule in Bremen folgte fast zwangsläufig. Doch irgendwann hatte sie sich eingestehen müssen, dass es einfach nicht ausreichte, den puren Willen zum Malen und eine Portion Begabung mitzubringen. Es fehlte ganz einfach der Esprit. Sie konnte kopieren, Porträts anfertigen, eine achtbare Aktzeichnung, die handwerklich von bester Qualität war, zu Papier bringen. Doch das Genie fehlte. Als sie es sich eingestanden hatte, war sie in ein tiefes Loch gefallen. Doch ihr Vater tröstete sie, wusste weiter und überredete Christine zu einem Studium, das sie in den letzten Jahren zu einer anerkannten Gemälderestauratorin hatte heranreifen lassen.
Christine Evers arbeitete selbstständig in ihrer eigenen Werkstatt im Bremer Viertel. Nach den ersten beiden Jahren, in denen sie jeden Cent zweimal hatte umdrehen müssen, konnte sie sich mittlerweile über ein ordentliches Auskommen freuen, ihre Auftragsbücher waren gut gefüllt. Nebenbei ging sie selbst auf die Jagd nach Gemälden, die sie meist bei Haushaltsauflösungen ergatterte, im Anschluss restaurierte und für ein Mehrfaches des von ihr bezahlten Preises weiterverkaufte. Allerdings war bisher noch nie der »Kracher« dabei gewesen. Ein kleiner echter Campendonk, ein unerkannter Runge, das wäre es. Doch leider war ein solcher Hochkaräter bisher nie dabei gewesen. Und so war Christine wieder vor zwei Wochen in der Erwartung aufgebrochen, unter dem Gerümpel auf einem Dachboden – das Haus sollte demnächst abgerissen werden – nichts wirklich Aufregendes zu entdecken.
Das Gemälde stand mit drei weiteren Bildern im Wohnzimmer, in dem es nach abgestandener Luft und Verfall gerochen hatte. Die drei Werke, die sie zuerst begutachtet hatte, entpuppten sich auf den ersten Blick als Drucke, doch mit dem vierten hatte sie den Fund ihres Lebens gemacht. Hoffte sie.
Die Erben waren froh gewesen, den alten Plunder für fünfhundert Euro loszuwerden. Christine hatte das Bild sorgsam in weiches Papier und Noppenfolie verpackt und in ihrem Sprinter zur Werkstatt transportiert. Vor Aufregung konnte sie kaum einen klaren Gedanken fassen und wäre fast einem vorausfahrenden Wagen an der auf Rot schaltenden Ampel ins Heck gefahren. Was, wenn sie wirklich recht hatte? Ihr geschultes Auge hatte sie eigentlich noch nie getrogen. Wenn sie nicht alles täuschte, verbarg sich unter dem Schmutz der Jahrhunderte ein ganz besonderes Gemälde, ein wahrer Schatz, ein Stillleben der flämischen Malerin Clara Peeters.