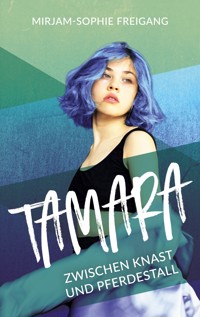Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brunnen Verlag Gießen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine neue Stimme im Genre Faithful New Adult: Mirjam-Sophie Freigang nimmt ihre Leser mit auf einen Pferdehof nach Mecklenburg und entwickelt eine wunderschöne Enemy-to-Lovers-Liebesgeschichte. Nach einem tragischen Reitunfall flieht Elle nach Frankfurt, um ihren Schmerz und die Schuldgefühle hinter sich zu lassen. Doch zwei Jahre später führt der drohende Ruin des elterlichen Hofes sie zurück nach Mecklenburg. Dort trifft sie auf Lenny, ihren einstigen Mitschüler, der sich zum Liebling ihrer Eltern entwickelt hat – sehr zum Ärger von Elle. Während die Gespräche mit ihm sie oft auf die Palme bringen, weckt sein Vertrauen in Gott etwas in ihr, das sie lange zu verdrängen versucht hat. Kann Elle den Hof ihrer Eltern retten und zugleich Frieden mit ihrer Vergangenheit und mit Gott finden? Ein bewegender Roman über Heimkehr, Vergebung und Neuanfang.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mirjam Sophie Freigang
Back into Your Arms
Roman
Die Nutzung von Bild-, Sprach- und Textdaten für sog. KI-Trainings und ähnliche Zwecke ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung erlaubt.
© 2025 Brunnen Verlag GmbH Gießen
Gottlieb-Daimler-Str. 22, 35398 Gießen
www.brunnen-verlag.de; [email protected]
Lektorat: Carolin Kotthaus
Umschlagillustration: Adobe Stock
Umschlaggestaltung: Daniela Sprenger
Satz: Brunnen Verlag GmbH
ISBN Buch 978-3-7655-2056-3
ISBN E-Book 978-3-7655-7749-9
Für alle, die sich in dieser Welt hin und wieder verloren fühlen.
Inhalt
Prolog
Albträume, Flirts und Sabbershirts: Eine Woche zuvor
Aufgeschobenes Wiedersehen
La chica está loca
„Gott, schenk mir Kraft!“
Der Deal
Zwangsurlaub
Ein Blick hinter die Fassade
Hüter einer grauenvollen Erinnerung
Ein holpriger Start
Ein weiterer Deal
Ausflug in die Vergangenheit
Ein Lächeln, das Kriege beenden kann
Nur ein Termin im Kalender
Coole Junggesellen
Mitternachtsgespräche
Der Rivale
Eindringlinge
Unerwünschter Zimmergenosse
Sterbende Schmetterlinge
Höhlenmenschen und verzweifelte Gebete
Risky business
Eine Augenweide
Der Bauernball
Ein Mann mit Gefühlen und einem Herzen
Mache es gut, Elisabeth
‚Nein, nicht …‘
Ein Tochterherz kehrt heim
Neuorientierung
Noch eine Prügelei
Kein Happy End in Sicht
Blaulicht in der Nacht
Matschkopf und rote Rosen
Von Überraschungen und Neuanfängen
Angekommen
Nachwort
Danksagung
Prolog
Mein roter Audi düst über die Schlaglöcher hinweg, so schnell, dass ich kaum eine Erschütterung spüre. Das Gefühl in meinem Fuß habe ich bereits auf der Autobahn kurz hinter Frankfurt verloren. Seitdem ich zurück auf der Landstraße in Richtung mecklenburgische Pampa bin, habe ich jeglichen Sinn für Geschwindigkeit verloren. Nicht, weil ich schnell am Ziel ankommen will – im Gegenteil! –, sondern weil ich es verabscheue, langsam unterwegs zu sein.
Die Überholspur ist meine Spur! Überholt zu werden, bedeutet Schwäche. Bedeutet, abgehängt zu werden und als Letzter durchs Ziel zu gehen. Das vor der Nase weggeschnappt zu bekommen, was man selbst hätte haben können.
Nein, ich gehöre auf die Überholspur. Nirgendwo anders hin!
Der Fahrtwind dringt durch die geöffneten Fenster und wirbelt meine Haare auf, die ich heute Morgen noch mit meinem Lockenstab in Form gebracht habe. Jetzt flattern mir zerzauste Strähnen in und ums Gesicht. Die harten Gitarrenriffs der Rockband Greta Van Fleet bringen meinen Körper zum Vibrieren und lassen mich mein Herzrasen vergessen. Ich kralle meine Hand fest um das schmale Lenkrad, um meinen Sportwagen auf der buckeligen Straße zu halten, während ich auf dem Display meines Handys herumtippe.
„So ein Mist“, entweicht mir ein Fluch, als das Telefon plötzlich samt der Saugnapfhalterung in den Fußraum vom Beifahrersitz fällt. Das Auto ruckelt und holpert über den ungesicherten Straßenrand, als ich zu weit nach rechts abkomme, während ich meine Hand unter den Sitz zwänge.
„Komm her, du Mistteil“, schimpfe ich weiter. Den Blick auf die Straße gerichtet, taste ich den Fußraum ab, bis ich das Handy erwische. In dem Moment, als ich den Saugnapf der Halterung mit Schmackes zurück auf das Armaturenbrett stemme, ploppt eine neue Nachricht auf.
Mein Vorgesetzter, Christoph, hat mir neue Informationen zu unserem aktuellen Projekt gemailt. Das Projekt, bei dem ich nicht anwesend sein werde, weil ich mich auf dem Weg in die Vergangenheit befinde.
Mein Blick springt zwischen Fahrbahn und Display hin und her. Dann schlage ich mit der Faust aufs Lenkrad. „Warum?“, brülle ich gegen den Fahrtwind an. „Warum ausgerechnet jetzt?!“
Mit einem Grollen atme ich aus. Sofort findet mein rechter Daumen das Tattoo auf meinem linken Unterarm und streicht sanft darüber. Live fast, die young steht da auf meiner Haut. Ein Spruch, den ich mir besoffen habe stechen lassen, als der Herzschmerz am größten war.
Es wäre nur eine Belanglosigkeit, ein peinlicher Fehler, wenn die Erinnerung an den Schriftzug, den der Tattoo Artist damals mit Edding daruntergeschrieben hatte, nicht so präsent wäre. Selbst wenn der Edding mittlerweile längst abgewaschen ist, sehe ich es noch deutlich vor mir: But because He loved me, He died for me first. Und dahinter ein Kreuz.
Als hätte er gewusst, dass ich meinen Absturz am nächsten Morgen bereuen würde und stattdessen eine Ermutigung bräuchte. Eine Interpretation eines Bibelverses, der Licht in mein Dunkel bringen sollte.
Dennoch löscht er nicht den Akt der Rebellion aus, der darübersteht. Ausgenüchtert erscheint dieser Spruch wie ein Schlag ins Gesicht. Eine Provokation an mich selbst. Obwohl ich mit dieser Aktion meine Vergangenheit leichter vergessen wollte, ist es nun eine konstante Erinnerung an diese. An den grausamsten Tag meines Lebens. Auch meine Flucht aus der Heimat hat nicht geholfen, die Bilder meiner Erinnerung komplett auszuradieren.
Und nun bin ich auf dem Weg dorthin zurück. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diesen Schritt bereuen werde.
Je offener das Land wird, desto mehr steigert sich mein Unwohlsein ins Unerträgliche. Wieder checke ich mein Handy, aber Christoph hat mir keine weiteren Nachrichten geschrieben. Ich sperre das Display und kralle meine Finger fester um das Lenkrad, um ihr Zittern zu unterdrücken. Das Lied wechselt gerade von Highway Tune zu When the Curtain Falls, als ein rotes Absperrband immer näher kommt. Ich rücke meine Brille auf der Nase zurecht.
„Was zum …“ Ich nehme den Fuß vom Gas und lasse den Wagen ausrollen. Vor der Absperrung halte ich an und drehe den Zündschlüssel um. Greta Van Fleet erstirbt und sofort überfällt mich die Stille der Natur. Ich atme stoßartig aus und lass meinen Blick aus dem Seitenfenster über die Landschaft schweifen.
Links und rechts der Straße ziehen sich weite Wiesen sanfte Hügel hinauf. Ein Meer von Gräsern wiegt sich im Wind sanft hin und her wie das flauschige Fell von Sulley aus der Monster AG. Im Gegensatz zu der Betonwüste Frankfurts gibt es hier Natur, so weit das Auge reicht. So viele Pflanzen auf einem Haufen habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Unwillkürlich beruhigt sich mein Herzschlag und das Vibrieren in meinem Körper ebbt ab.
Ich schnalle mich ab und steige aus. Den Rücken durchstreckend, schaue ich mich um – weit und breit ist niemand zu sehen. Die provisorische Flatterband-Absperrung erinnert mich an einen Viehtreibgang. Erst jetzt fällt mir auf, dass die Wiesen zu beiden Seiten mit Viehlitze, einem dünnen Elektrodraht, eingezäunt sind. Wahrscheinlich wird jeden Moment eine hungrige Rinderherde über die Hügel getrampelt kommen. Die Wartezeit nutze ich, um mich umzuziehen. Nur äußerst ungern will ich in Hotpants, luftigem Tanktop und meinem Tattoo auf dem Arm bei meinen Eltern aufschlagen. Von dem Tattoo wissen sie nämlich nichts. Wie auch? Gesehen habe ich sie in den letzten zwei Jahren ja nicht.
Aus dem Kofferraum hole ich mein zurechtgelegtes Ich-sehe-meine-Eltern-nach-Jahren-der-Abwesenheit-wieder-Outfit heraus. Klamotten, die meine zähe, durchtrainierte Figur verstecken, anstatt sie zu betonen. In der locker sitzenden Jeans und der langärmeligen Bluse fühle ich mich wie in einem Faschingskostüm. In dem Moment, als ich mein anderes Outfit wieder im Kofferraum verschwinden lasse, kommt eine dunkle Welle von schwarzen Rindern über den linken Hügel geschwappt.
Neugierig lehne ich mich mit verschränkten Armen gegen die Motorhaube. Die Kühe muhen aufgeregt, links und rechts in Schach gehalten von zwei Reitern – genauso wie mein Vater und ich es früher gemacht haben. Die Flächen der hiesigen Bauernhöfe sind oftmals zu weitläufig, um den Umtrieb zu Fuß zu gestalten, und mit den Pferden ist man einfach agiler. Außerdem ist man auf dem Pferderücken besser davor geschützt, von einer aktiven Rinderherde platt getrampelt zu werden. Die Spitze der Herde vor mir macht ein Quadfahrer, der bis gerade einen Lockruf wie ein Mantra gebrüllt hat. Jetzt beschleunigt er und rast auf mich zu.
An der Straße angekommen, stellt der junge Mann das Quad ab. Er bedenkt mich mit einem kurzen Nicken und wendet sich wieder der nahenden Rinderherde zu. Dann jedoch schnellt sein Kopf erneut zu mir und fängt mich mit einem Blick ein, als hätte er ein Gespenst gesehen. Er trägt ein Baseballcap, mit dem Schild nach hinten gedreht, und hat eine kräftige Statur. Gleichzeitig zeugen seine Arme von harter Arbeit und dass er durchaus fähig ist, problemlos ein Kalb zu tragen. Während seine Augen immer noch abschätzen, ob ich Gespenst oder Mensch bin, rutsche ich unruhig auf der Motorhaube hin und her.
„Dauert das noch lange?“, werfe ich dem Typen entgegen, damit er endlich mit der Glotzerei aufhört.
Jetzt zeichnet sich ein breites Lächeln auf seinem Gesicht ab. „Es kommt ganz darauf an, wie schnell ich die Ladys davon überzeugen kann, den Asphalt zu überqueren.“
„Na, hoffentlich hast du an deiner Motivationsrede gefeilt. Ich habe nämlich nicht ewig Zeit.“ Was gelogen ist, weil mir die Unterbrechung meiner Autofahrt ganz gelegen kommt.
„Du hast eine lange Fahrt hinter dir“, stellt der junge Mann fest.
Irritiert runzle ich die Stirn. „War das eine Frage oder eine Aussage? Und woher willst du das überhaupt wissen?“
Er nickt in Richtung meines Wagens. „Das Nummernschild.“
Hm, richtig. Ich habe ein Frankfurter Kennzeichen an der Stoßstange. Das Auto hatte ich mir erst nach meinem Umzug gekauft. Sofort beruhigt sich mein Puls bei dem Gedanken, dass der Typ mich nicht kennt. Es ist schlimm genug, meinen Eltern wieder gegenübertreten zu müssen. Auf weitere bekannte Gesichter aus der Vergangenheit kann ich gerne verzichten.
Der Kerl springt vom Quad und läuft im Bogen hinter die ersten Rinder, die vom Rest der Herde mutig vorgeschoben werden. Doch die Vorläufer stoppen abrupt, sobald sie die Grenze zwischen Wiese und Asphalt erreicht haben. Mit gesenktem Kopf und weit aufgerissenen Augen starren sie den dunklen Streifen an, der ihre Weidefläche kreuzt. Eines der Rinder schüttelt den Kopf, so als wolle es sagen: „Ihr habt doch nicht mehr alle Milchtöpfe im Schrank. Garantiert setze ich keinen Fuß auf diesen grauen Streifen!“
Ich trete ein paar Schritte zur Seite, um den Tieren mehr Raum zu geben, und widerstehe dem Drang, den Männern zu helfen, die nun mit lauten Rufen und Klatschgeräuschen die Tiere zum Überqueren der Straße drängen wollen. Doch je mehr Druck sie aufbauen, desto unruhiger wird die Herde, und ich befürchte, dass der Kerl zu Fuß jeden Moment von einer panischen Kuh niedergewalzt wird. Über ihre Hilflosigkeit kann ich nur die Augen verdrehen. Wenn die sich weiterhin so dümmlich anstellen, stehen wir noch morgen früh hier.
„Ihr müsst sie locken, statt sie unter Druck zu setzen. Sonst machen die euch noch platt“, rufe ich über das Muhen und Brüllen den Männern zu. Doch die sind zu sehr damit beschäftigt, die Tiere vom seitlichen Ausbrechen abzuhalten. Sie beachten mich gar nicht.
„Ach, Mist“, schimpfe ich über mich selbst, dann schlüpfe ich kurzerhand unter der Absperrung hindurch und stelle mich auf die Mitte der Straße. Ich habe keine Ahnung, ob mein Vorhaben bei diesen Kühen Erfolg haben wird, aber ich probiere es trotzdem: Mit den Händen wie einen Trichter um den Mund gelegt, mache ich den markanten Lockruf, den mir mein Vater als Kind beigebracht hat. Sofort schwenkt die Aufmerksamkeit der ganzen Herde zu mir über. Rufend und rhythmisch klatschend gehe ich langsam rückwärts auf die andere Straßenseite.
Es zeigt Wirkung! Wie Dornröschen von der Spindel angezogen, setzen sich die ersten Rinder mit einem Bocksprung in Bewegung und preschen durch die Schleuse hindurch. Gerade noch rechtzeitig kann ich mich mit einem Satz zur Seite retten, bevor ich von den buckelnden Kühen überrannt werde.
Das Blut rauscht in meinen Ohren, und mein Herz klopft schwer gegen die Brust, als ich mich hinter die Umzäunung rette. Meine weichen Knie können mich gerade so davor bewahren hinzufallen. Erinnerungen kommen hoch an eine ganz ähnliche Szene …
Ich wende mich von den Männern ab und versuche, tief Luft zu holen. Beruhige dich, Elle, es ist nichts passiert, rede ich mir zu.
Mit geschlossenen Augen atme ich durch die Nase ein, halte die Luft drei Sekunden an und atme durch den Mund wieder aus. Dann drehe ich mich wieder zu den Männern um. Sie stehen wie zur Salzsäule erstarrt da und blicken mich entgeistert an.
„Gern geschehen“, sage ich und bäume mich vor ihnen auf, um mein immer noch wild pochendes Herz zu überspielen. Als sie sich nach weiteren fünf Sekunden immer noch nicht rühren, zeige ich auf die beiden Männer zu Pferd. „Von jemandem, der sich traut, Herdenmanagement zu Pferd anzugehen, hätte ich definitiv mehr erwartet. Das war ja das reinste Trauerspiel.“
Fassungslos schüttele ich den Kopf. „Wurdet ihr von dem Bauern engagiert? Gehört ihr zu diesen Rinderhirten-Vereinen, die man in dieser Gegend buchen kann, wenn man extensive Weidehaltung betreibt?“
Die beiden Männer auf den Pferden sehen mich an, als hätte ich sie nach der Herleitung der Relativitätstheorie gefragt. Dann werfen sie sich gegenseitig einen Blick zu und reiten anschließend hinter der Herde her. Ganz im Gegensatz zu dem Kerl mit dem umgedrehten Baseballcap.
„Vielen Dank für deine Mithilfe“, sagt er, während er sich daranmacht, die Koppelzäune zu schließen und die Schleuse abzubauen.
Mit verschränkten Armen schaue ich ihm dabei zu. „Hätte ja sonst noch den ganzen Tag gedauert.“
Der Typ schüttelt amüsiert den Kopf. „Und um auf deine Frage einzugehen: Nein, wir sind nicht vom Rinderhirten-Verein. Wir sind so etwas wie Festangestellte.“
„Hm.“
Er hat das Absperrband fertig aufgerollt und verstaut es in der Hecktasche seines Quads. Die Fahrbahn ist wieder frei, und ich drehe mich um, um zurück zum Wagen zu gehen. Da fällt mein Blick auf einen Baum: Er wächst nicht gerade gen Himmel, sondern parallel zum Boden, was ihn von den anderen Bäumen unterscheidet. Es ist der Baum, der eine der vielen Grundstücksgrenzen meiner Eltern markiert. Da fällt es mir wie Schuppen von den Augen und ich wirbele herum.
„Arbeitet ihr für Mikaela und Erwin Mohr?“, frage ich, doch meine Frage wird vom lauten Knattern des startenden Quads geschluckt. Der Typ nickt mir noch einmal zu, dann düst er davon und lässt mich alleine zurück.
Als Muhen und Motorknattern hinter den Hügeln verschwunden sind, kehrt wieder Stille ein. Ich verharre noch lange dort, völlig irritiert über das, was soeben passiert ist. Erst als ein Mann aus einem vorbeifahrenden Auto fragt, ob ich eine Panne hätte, erwache ich aus meiner Starre. Ich verneine, steige zurück in meinen Wagen und setze meine Fahrt ohne Musik fort.
Albträume, Flirts und Sabbershirts
Elle
Eine Woche zuvor
Meine nackten Schultern schaben an Felswänden entlang. Scharfe Kanten ritzen meine Haut auf und zeichnen ein rotes Muster darauf. Mein Atem geht schwer, und obwohl mein Herz rast, kommt kaum sauerstoffreiches Blut in meinem Gehirn an. Die Felsspalte, in der ich eingeklemmt bin, wird gefühlt immer enger. Das Sonnenlicht endet einen Meter über mir – ich liege so tief, dass noch nicht einmal mehr die Sonne auf mich herabschauen kann. Angestrengt versuche ich, eine neue Position einzunehmen. Plötzlich höre ich unter mir ein schmatzendes Geräusch.
Umständlich drehe ich meinen Kopf und schaue an mir herab. Ich sehe eine Pfütze – eine Pfütze aus Blut. Mein Blut! Die kleinen Kratzer auf meinen Armen und Beinen haben ihre Tore geöffnet und lassen das Blut haltlos fließen. Ich öffne meinen Mund, um nach Hilfe zu schreien. Doch mein Hals wird durch einen fetten Knoten verstopft. Panik erfasst mich. Der Blutpegel steigt kontinuierlich an. Ein letzter tiefer Atemzug, dann verschlingt mich die dicke Flüssigkeit im Ganzen. Meine Schreie werden verschlungen. Ich winde mich hin und her, bekomme keine Luft.
Im nächsten Moment wache ich in einer Arena auf. Meine Finger fahren zittrig über meine Oberarme. Die feinen Kratzer sind nun wulstige Narben, die heller sind als der Rest meiner Haut. Laute Buhrufe reißen mich von den Narben los.
Auf den Tribünen hocken Menschen, die hässliche Grimassen ziehen und mich beschimpfen. Schon fliegt die erste Tomate und landet an meinem Kopf. Daraufhin ein Salatkopf. Ein Stein. Schützend reiße ich die Arme hoch. Ein Geräusch, ähnlich dem Öffnen eines Tores, lässt die Buhrufe zu Jubelschreien werden.
Ich drehe mich dem Geräusch entgegen und blicke einem gewaltigen Stier in die Augen. Der Ring in seiner Nase blitzt in der Sonne, die Augen feuerrot. Wütend scharrt er im Sand und schnaubt, dass es in der Arena widerhallt und sogar das Publikum übertönt. Dann rennt er los!
Seine gewaltigen Hörner sind auf mich gerichtet. Ich will losrennen, aber meine Beine sind wie gelähmt, als hätte ich Gewichte an den Fesselgelenken. Hinter mir donnert es, als der Stier mit gesenkten Hörnern auf mich zurast und schneller näher kommt, als ich fortlaufen kann. Und im nächsten Moment sehe ich meinen Tod.
„Elle. Elle!“
Eine vertraute Stimme zieht mich aus meinem Albtraum Stück für Stück zurück in die Gegenwart.
„Wach auf! Alles ist gut. Es ist nur ein Traum.“
Jetzt ist die Stimme meines Freundes Fabian direkt neben mir, doch ich schmeiße mich im Bett immer noch hin und her. Eine Berührung an meiner Schulter lässt mich hochschrecken.
„Schatz, es war nur ein Traum.“
Endlich öffne ich die Augen und schaue mich um. Ich bin zurück in dem Schlafzimmer meiner Wohnung, das schwach von den Straßenlaternen von draußen beleuchtet ist. Fabian sitzt auf meiner Bettkante, rutscht nun an mich heran und nimmt mich in den Arm. Mein Nachthemd klebt mir kalt am Rücken, am Hinterkopf spüre ich einen verfilzten Knoten.
„Alles ist gut. Es war nur ein Traum“, wiederholt Fabian ganz dicht an meinem Ohr wie ein Mantra, bis meine Atmung zu ihrer normalen Frequenz zurückfindet. Ich schlucke und ertaste meinen Hals. Der Knoten löst sich langsam und nimmt mir damit das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Das Bettzeug raschelt, und im nächsten Moment vertreibt meine Nachttischlampe, die Fabian angeknipst hat, die letzten Schreckgespenster meines Albtraums.
Im Schein der Lampe betrachte ich meine Arme, doch bis auf das kleine Tattoo auf dem linken Unterarm sind sie völlig unversehrt. Mit einem erleichterten Seufzer lasse ich mich wieder in die Kissen sinken.
Mit faltiger Stirn mustert mich Fabian und streicht mir eine verklebte Haarsträhne aus dem Gesicht. Dann steht er auf und geht zum Wandschrank. „Ich hab dich bis ins Wohnzimmer schreien gehört. Ich hole dir was zu trinken. Und du ziehst dir in der Zwischenzeit etwas Neues an.“
In diesem Moment hätte ich ihn gerne neben mir gehabt, mich wieder an ihn geschmiegt, um dieses Gefühl der Einsamkeit loszuwerden, das sich in meiner Brust breitmacht. Doch Fabian greift mitten in den Klamottenstapel und zieht wahllos ein Shirt heraus, das er neben mich aufs Bett legt. Immer noch nicht ganz erholt von dem Schock, starre ich auf den schwarzen Stoff des T-Shirts.
„Hey, schau mich an.“ Er stellt sich an die Bettkante und streichelt meinen Scheitel. Erschöpft schaue ich zu ihm auf. „Du bist wach und ich bin bei dir. Alles ist gut.“ Er drückt mir einen Kuss auf die Stirn und lächelt mich an.
Nur schwach erwidere ich sein Lächeln, doch die Tränen in meinen Augen kann es nicht ganz aufhalten. Erst als ich nicke, verlässt er das Schlafzimmer.
Wie gerne ich seinen Worten Glauben schenken würde. Dass alles gut ist, glaube ich schon lange nicht mehr. Glück und Zufriedenheit hat irgendwer bereits vor Jahren über Bord geworfen. Nichts ist gut! Das sommerliche Wetter vielleicht, aber das war es auch schon.
Erst als das Geräusch des laufenden Wasserhahns aus der Küche dringt, kommt Bewegung in mich. Hastig werfe ich die Bettdecke zurück und tausche mein nasses Nachthemd gegen das trockene Shirt. Kaum dass ich umgezogen bin, klopft Fabian an die Tür.
„Bist du angezogen?“, dringt seine Stimme hinter dem Holz hervor.
„Mhm.“
Die Tür geht auf und Fabian kommt mit einem großen Wasserglas herein. „Hier. Das sollte auch den Rest des Albtraums wegspülen.“
Zittrig nehme ich das Glas in beide Hände und führe es an den Mund. Beinahe rutscht es mir aus der Hand, doch Fabian kann es sich rechtzeitig schnappen und auf den Nachtschrank stellen. Meine Lippen beben und meine Bauchmuskeln krampfen sich zusammen.
„Hey, Süße, nicht weinen.“
„Es tut mir so leid“, schniefe ich. „Ich will dich nicht jede Nacht mit meinem Herumgeschreie aufwecken.“
Plötzlich übermannt mich eine gewaltige Müdigkeit. Wie ein kleines Kind, das nicht weiß, ob es weinen oder schlafen soll, falle ich in mich zusammen. Finde keinen Halt an mir selbst.
„Das muss dir nicht leidtun.“
Fabian klettert über mich hinweg auf die andere Seite des Bettes und breitet die Arme aus, damit ich mich an ihn kuscheln kann. Dankbar rutsche ich an ihn heran und lege mein verquollenes Gesicht auf seine Brust. Seine Arme legen sich mit der Decke wie ein Kokon um mich. Ein mir vertrauter Ort, der mir aber bei Weitem nicht die Sicherheit geben kann, die mein Herz so dringend braucht. Seine Umarmung kann die Leere in mir nur ein Stück weit verdrängen, aber nicht komplett ausfüllen.
Fabian ist nicht nur mein fester, sondern auch mein bester Freund und das einzige Vertraute in dieser anonymen Großstadt, aber retten kann er mich nicht vor den Schmerzen in meinem Inneren. Während wir eng umschlungen daliegen, hocken meine Dämonen in der Ecke des Zimmers, grinsend und nur wartend darauf, dass ich wieder in einen unruhigen Schlaf falle.
Fabians gleichmäßiger Atem und das wohlige Brummen in seinem Brustkorb besänftigen mich. Es dauert eine Weile, bis mich wieder eine normale Müdigkeit überfällt.
„Danke, dass du bei mir bist“, flüstere ich in die Bettdecke hinein.
Fabian drückt mich als stille Antwort enger an sich. Ein tiefes Seufzen verrät mir, dass er schon wieder am Einnicken ist. Meine Gedanken hingegen kreisen wild umher. Dabei muss ich nicht mehr an den Albtraum denken, denn diesen kenne ich mittlerweile in- und auswendig. Stattdessen denke ich an meinen Job, mein Leben hier in Frankfurt, meine Beziehung zu Fabian, ja sogar an meine Eltern.
„Bist du glücklich?“ Dass ich diesen Gedanken laut ausgesprochen habe, merke ich erst an Fabians leisem Stöhnen.
Kurz darauf brummt er ein unverständliches „Was?“.
„Bist du glücklich, Fabian?“, frage ich erneut, dieses Mal in der Hoffnung auf eine Antwort.
Er gräbt seine Nase in meine Haare und spitzt die Lippen zu einem Kuss auf meine Stirn. „Jetzt gerade sehr“, brummelt er.
„Ich meine eher so allgemein. Du stehst kurz vor deinem ersten Staatsexamen und kannst nebenbei in der Kanzlei deines Vaters anfangen. Deine Zukunft ist gesichert. Kannst du das Glück nennen?“
Fabian gähnt. „Das sind ziemlich gewichtige Fragen, dafür dass es mitten in der Nacht ist. Können wir das vielleicht morgen besprechen?“
„Ja, vielleicht“, murmle ich etwas enttäuscht.
„Versuche zu schlafen, okay?“
„Okay.“
An Schlaf kann ich dennoch nicht denken. Der überkommt mich erst, als mein ratterndes Hirn den Kampf gegen meinen ausgelaugten Körper verliert. Gott sei Dank haben meine Dämonen es eingesehen, dass eine Attacke pro Nacht ausreicht, und mich schlafen lassen.
Frustriert rolle ich meine Yogamatte zusammen. Nach der grauenvollen Nacht hatte ich gehofft, dass etwas Meditation mir guttun würde. Aber meine bewussten Atemübungen haben mein Herz nicht zur Ruhe gebracht. Ich habe schon vieles ausprobiert, um von meinen Albträumen und der inneren Unruhe loszukommen. Yoga und Meditation waren nun meine letzte Idee. Doch obwohl der Hype in meinem Freundeskreis darüber sehr groß ist, dringt es bei mir nicht zum Kern durch. Kein Flow kann die Risse in mir kitten.
Wenigstens konnte eine Dusche meinen Angstschweiß abwaschen. Nun wickelt mein geliebter Airwrap-Föhn meine Haare zu einer geordneten blonden Wellenfrisur. Es gibt keinen Tag, an dem ich ohne meinen Föhn auskomme. Das gute Ding zaubert aus einem lustlosen, platten Schleier eine ansehnliche Lockenpracht.
Mein dezentes Make-up sitzt bereits, meine weiße Bluse ist gebügelt und schmiegt sich eng an meinen Körper. Unter meiner schwarzen Stoffhose trage ich Turnschuhe, um das sonst so formelle Outfit etwas aufzupeppen. Zwar wird der eigentlich geforderte professionelle Auftritt von den Mitarbeitern der IT-Abteilung, in der ich arbeite, nicht unbedingt eingehalten, doch ich muss mich in einer Männerdomäne behaupten. Frauen im Programmierbereich sind selten. Also setze ich mit meinem Stil auf „ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen draufgängerisch“, und schon nehmen sie einen für voll. Der Großteil zumindest. Sabbershirt-Karl tut es nämlich nicht.
Ich lege meinen Föhn beiseite und schüttele mit den Fingerspitzen die Frisur etwas auf. I am ready to go!
„Fabi, hast du meine goldenen Creolen gesehen?“, rufe ich durch die Wohnung, als ich meine Lieblingsohrringe nicht in meiner Schmuckschatulle finden kann.
Seine kratzige Stimme dringt gedämpft aus dem Schlafzimmer. „Meinst du die hier?“ Ich folge Fabians Stimme und finde ihn mit Kissenabdruck im Gesicht und strubbeligen Haaren noch immer in meinem Bett vor. Meine Ohrringe hält er sich an die Ohrläppchen.
„Herr Anwalt, diese Art von Schmuck steht Ihnen nicht“, sage ich kichernd und lehne mich zu ihm über das Bett, um ihm die Ohrringe abzunehmen.
„Uh, mein Vater würde toben, wenn ich mit gepiercten Ohren in der Kanzlei auftauchen würde.“
„Und am besten noch mit diesen zerzausten Haaren.“
Er rubbelt sich durch das Haar, das er sich sonst mit Gel und Spray nach hinten gekämmt an den Kopf klebt.
„Gefällt dir mein natürlicher Look?“, fragt er und hat dabei ein schelmisches Grinsen aufgelegt.
Ich denke viel zu ernst über diese Frage nach, da ich Fabian tatsächlich nur in seinem „Ich-übernehme-eines-Tages-die-Kanzlei-meines-Vaters“-Look kenne. „Wenn du deinen Vater nicht mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus schicken willst, solltest du besser bei Krawatte, Hemd und Gelhaaren bleiben.“
Ich krieche zu ihm über das Bett und gebe ihm einen flüchtigen Kuss. Noch nicht einmal sein Morgenatem riecht unangenehm. Fabian ist der Schniekemann in Person.
„Hast du heute noch Vorlesungen oder musst du in die Kanzlei?“, frage ich, während ich versuche, die erste Creole durch mein Ohrloch zu fädeln.
Fabian reibt sich die Augen, vor denen sonst eine grazile Brille sitzt, und stöhnt. „Ab heute fängt mein Repetitorium an. Du musst also in den nächsten Wochen mit einem Zombie leben.“
„Bleib positiv. Bald hast du dein erstes Staatsexamen und damit die Hälfte geschafft.“
„Wenn ich es überhaupt in der Regelstudienzeit schaffe.“
„Das packst du schon“, versuche ich es weiter, ihn aufzumuntern, und fummele nun den zweiten Ohrring in das andere Ohrloch.
Fabian gibt einen verächtlichen Laut von sich. „Toll, dass immer alle an mich glauben, dass ich es schaffe. Würde es nach meinem Vater gehen, hätte ich das Repetitorium schon im letzten Semester angefangen.“
„Jeder hat eben sein eigenes Tempo. Außerdem ist der Zeitaufwand wirklich nicht zu stemmen.“
„Könntest du das bitte noch einmal meinem Vater sagen?“
Ich verziehe das Gesicht zu einer entschuldigenden Grimasse. Ich kenne Fabians Vater, ein einschüchternder Mann. Zu mir ist er immer überaus freundlich und zuvorkommend, aber das ist alles Fassade. Er lebt für seinen Job und verlangt dasselbe von seinem Sohn. Doch der hat sich viel lieber in meiner Wohnung eingenistet und würde wahrscheinlich alles hinschmeißen wollen. Wenn er selbst nicht so perspektivlos wäre.
Fabian rollt sich auf die Seite und zupft an meinem Hosenbein. Mit drolligen Augen schaut er mich von unten an. „Ich würde am liebsten mit dir in den Flieger steigen und irgendwohin fliegen, wo wir nur in Bikini und Badehose herumlaufen brauchen. Dann schlürfen wir den ganzen Tag Cocktails und machen abends die Klubs unsicher. Wäre das ein Plan?“
Ich gebe seinem Zug an meiner Hose nach und lass mich neben ihm aufs Bett fallen. „Das klingt wirklich sehr verlockend. Aber aktuell hast du das Geld nicht, weil dir dein Vater seine Unterstützung gestrichen hat, damit du endlich dein Examen angehst. Und ich muss nach wie vor meinen Wagen abbezahlen, sodass Urlaub für zwei in meinem Portemonnaie einfach nicht drin ist.“
Fabian lässt sich nach hinten in die Kissen fallen. „Immer diese verantwortungsbewussten Frauen“, stöhnt er.
„Und trotzdem gibst du dich mit mir ab.“
„Eure Korrektheit ist ja auch irgendwie sexy.“
„Du meinst meine Korrektheit.“
„Ja, habe ich doch gesagt.“
Wir leisten uns ein stillschweigendes Augenduell, als plötzlich mein Klingelton die Duellrunde unterbricht. Ich ziehe das singende Telefon aus meiner Handtasche und lese „Mama“. Schnell schließe ich den Sperrbildschirm wieder und lasse mein Handy zurück in die Tasche gleiten.
„Ist das etwa schon wieder deine Mutter?“
Ich nicke knapp.
„Sie versteht den Wink mit dem Zaunpfahl aber auch nicht“, brüskiert sich Fabian, mit einem Mal ganz wach. „Das ist jetzt schon der dritte Tag Telefonterror. Langsam müsste sie es doch gerafft haben, dass du nicht zurückrufst, oder?“
„Ja, wahrscheinlich“, murmle ich und stehe auf. Fabian schwingt sich ebenfalls aus dem Bett und läuft hinter mir her in den Flur.
„Es ist einfach unglaublich, dass sie immer noch die Dreistigkeit besitzen, sich bei dir zu melden, nach allem, was sie dir angetan haben.“
Plötzlich schiebt sich wieder eine dunkle Wolke vor meine gerade aufgegangene Sonne. Wortlos schlüpfe ich in meine Sneaker. Den Wohnungsschlüssel verstaue ich in meiner Handtasche.
„Ich meine ja nur“, redet Fabian fort. „Wie kann man sein Kind verstoßen? Dafür gehören sie eigentlich eingebuchtet.“
„Hey“, fahre ich herum. Erschrocken reißt Fabian die Augen auf. „Es sind immer noch meine Eltern. Du hast kein Recht, so schlecht über sie zu reden. Ist das klar?!“
„Äh, sorry. Ich dachte nur, weil du immer so schlecht –“
„Ich rede überhaupt nicht über meine Eltern“, unterbreche ich ihn. Meine Stimme zittert. Und bevor ich erneut in Tränen ausbreche und meine verletzliche Seite vor Fabian preisgebe, wirbele ich herum und verlasse fluchtartig die Wohnung.
Auf der Straße heißen mich Hupen, Sirenen und Stimmgewirr in der neuen Arbeitswoche willkommen. Dank meines Gehaltes kann ich mir eine Wohnung nahe am Stadtkern leisten. Meinen neuen Sportwagen brauche ich daher nur selten. Niemals hätte ich gedacht, dass ich als ehemaliger Bauerntrampel aus der Pampa einmal in einem IT-Unternehmen mitten in Frankfurt arbeiten würde.
Der Lärm legt sich wie eine schwere Decke auf mein aufgewühltes Herz. Auch wenn Atmen in der Großstadt toxisch ist, nehme ich ein paar tiefe Atemzüge. Es nervt mich, dass ich mich mit Fabian streite. Er ist normalerweise der Anker, an den ich mich klammere und der mir in meiner neuen Welt Halt gibt. Er kennt meine Vergangenheit nicht und das ist auch gut so. Ich lege sehr viel Wert darauf, dass ich mein altes Leben von meinem neuen Leben hier in Frankfurt abgrenze. Und weil ich ihn von der ganzen Wahrheit abschirme, verstehe ich mich mit Fabian auch so gut. Unsere Beziehung ist von Leichtigkeit geprägt. Mit ihm muss ich normalerweise keine Probleme wälzen. Und genau deswegen nervt es mich, wenn wir streiten. Es nervt mich, dass es am Montagmorgen sein muss. Und es nervt mich, dass sich Fabian bei mir eingenistet hat, nur um nicht in seiner uncoolen Studentenbude zu hocken. Ja, er spendet mir warme Arme, wenn ich aus einem Albtraum aufschrecke. Aber manchmal wünschte ich, ich könnte einfach allein sein und alle Menschen einfach nur loswerden.
Ich schüttele den Ärger ab und marschiere los. Guter-Morgen-Kaffee, ich komme! Auf dem Weg zu meinem Lieblingsstarbucks klingelt mein Telefon schon wieder. Doch dieses Mal kann ich mir selbst die Ausrede geben, dass die Stadt lauter ist und ich den Anruf einfach überhört habe.
Im Starbucks tummelt sich bereits eine Menschentraube, die gebannt darauf wartet, ihre Kaffeekreationen in Empfang zu nehmen. Mein Blick huscht über die Köpfe hinweg zur Theke. Ja, der süße Barista hat Frühschicht!
Als hätte er meine Präsenz trotz des Stresses gespürt, schaut er auf. Unsere Blicke ziehen sich an wie zwei entgegengesetzte Pole. Durch seinen dunkleren Teint und den schwarzen Bart strahlt sein Lächeln noch heller und verursacht bei mir Kribbeln im Bauch. Ich ignoriere mein schlechtes Gewissen, das anschlägt, wenn ich mit anderen Männern flirte, und schiebe mich an der Menschentraube vorbei hin zur Theke.
„Guten Morgen“, sagt er lächelnd und zwinkert mich an.
„Einen wunderschönen guten Morgen“, versuche ich mein polterndes Herz zu überspielen.
„Ein Chocolate Waffle Cone Frappuccino?“, fragt er mich mit wackelnden Augenbrauen.
Mit dem größten verknallten Schulmädchen-Lächeln, das mein Gesicht hergeben kann, nicke ich. Vor lauter Aufregung, welchen süßen Spruch er mir heute auf den Becher schreiben wird, kaue ich auf meinem Daumennagel herum. Fabian taucht plötzlich in meinen Gedanken auf und erinnert mich daran, dass ich einen Freund habe. Aber der Gedanke ist schon wieder verpufft, sobald mir der hübsche Latino zuzwinkert.
Obwohl die Baristas vor lauter Bestellungen in Arbeit untergehen, konzentriert sich mein Barista auf meinen Frappuccino, zwinkert mir wieder mit diesem strahlend weißen Lächeln zu und überreicht mir den Becher. „Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag“, haucht er und verweilt noch einen Moment bei mir.
„Danke schön. Ich hoffe, du musst bei diesem tollen Wetter nicht allzu lange arbeiten“, antworte ich und weiß im nächsten Moment gar nicht, was ich damit bezwecken wollte.
Sein Blick fällt kurz auf meinen Kaffeebecher, der in meinem Griff schon leise knackst. Gebannt halte ich meine Augen auf mein Gegenüber gerichtet, dabei ist meine Neugierde, was auf meinem Becher steht, kaum auszuhalten. Doch damit muss ich mich gedulden, bis ich um die nächste Ecke verschwunden bin. Ich will ja nicht irgendwie verknallt wirken.
„Ich habe heute tatsächlich nur einen kurzen Tag“, sagt er und blinzelt ein weiteres Mal zu meinem Becher. Dann klopft er auf die Theke und wendet sich den ungeduldig wartenden Gästen zu.
Ich presse die Lippen fest aufeinander und halte die Luft an, bis ich zurück auf der Straße bin. Ich stehe kurz vorm Platzen. Hinter der nächsten Ecke drehe ich den Becher hastig herum und lese: Ruf mich an – und dann steht da seine Nummer.
Enttäuscht sacken meine Schultern nach unten. Warum hat er mir nicht wie jeden anderen Tag einfach eine süße Nachricht draufgeschrieben? Jetzt muss ich ihn anrufen, was ich natürlich nicht machen werde. Und damit war es das Ende für mich, meinen Starbucks und meine Flirterei. Denn solange der süße Barista dort arbeitet, kann ich nicht dorthin zurückkehren.
Plötzlich verlässt mich die Kraft. Die letzten Stunden auf der Achterbahn meiner Gefühle zehren mich völlig aus. Was mache ich hier eigentlich? Ich bin in einer festen Beziehung, flirte aber heftig mit fremden Männern und bin dann enttäuscht, wenn ich mich nicht mit ihnen treffen kann. Was ist denn bloß los mit mir?
Ich bleibe stehen, während die Welt sich um mich herum rasant weiterdreht. Es dauert einige Minuten, bis mir wieder einfällt, dass ich auf dem Weg zur Arbeit war. Ich zücke mein Telefon. Doch statt der Uhranzeige springen mich die verpassten Anrufe meiner Mutter an.
Unsichtbare Hände legen sich um meinen Magen und wringen ihn wie ein nasses Handtuch. Ohne dass ich etwas dagegen tun kann, ploppen unheimliche Bilder vor meinem inneren Auge auf: Mein Pferd lässt mich am Boden liegend zurück. Im nächsten Moment stürmt eine Kuh auf mich los. Mit ihren Hörnern kommt sie immer näher und dann –
Ein Ruck holt mich aus meinem Albtraum. Derjenige, der mich angerempelt hat, läuft mit seinem Handy am Ohr weiter, ohne sich umzudrehen. Der Deckel floppt von meinem Kaffeebecher, als ich zu fest zudrücke, und der Frappuccino läuft klebrig über meine Hand.
Ich glaub, ich muss mich übergeben! Japsend beuge ich mich vornüber. Sofort machen die vorbeieilenden Leute einen großen Bogen um mich, aber niemand hält an. Ich schlucke meine Galle herunter, während sich das Ende meines Albtraums im Nebel der Angst verläuft.
„Geht es dir gut, Schätzchen? Willst du dich hinsetzen?“ Eine kleine kalte Hand legt sich auf meinen Rücken. Als ich aufblicke, schaue ich in das faltige Gesicht einer alten Dame. Sie lächelt mich warm an, auch der zottelige Terrier am Ende ihrer Leine verströmt mit seinem Schwanzwedeln dieselbe Wärme.
Erst jetzt bemerke ich, dass ich die Luft angehalten habe. Tief hole ich Luft und nicke. „Danke. Geht schon wieder“, antworte ich knapp und drücke meinen Rücken durch.
„Der Morgen ist zu wundervoll, als dass man ihn mit Sorgen an sich vorbeiziehen lässt. Sieh dir nur diesen Sonnenaufgang an. Es ist einfach herrlich.“
Ich presse die Lippen aufeinander, damit ich der Frau nicht ins Gesicht kotze, und ringe mir ein schmales Lächeln ab. Ich weiß nicht, was schlimmer ist: dass meine Albträume sich in die Realität kämpfen oder dass diese Dame denkt, dass ein Sonnenaufgang, der von Wolkenkratzern verdeckt wird, wunderschön sein kann. Die Sonnenaufgänge in meiner Heimat sollte sie mal sehen!
Liebevoll tätschelt sie meinen Arm, bevor sie mit einem glückseligen Lächeln im Gesicht und ihrem Fiffi weiterzieht.
Und ich? Ich mache das, was ich am besten kann: verdrängen und meinem neuen Leben nachgehen.
„Guten Morgen, Frau Mohr“, begrüßt mich Hans, der Pförtner in der Lobby des Bürogebäudes. Mit einer erstklassigen Haltung lächelt er mich an und tippt sich an seine Mütze. Normalerweise halte ich an und verwickle ihn in ein kurzes Gespräch.
Die Scheidung von seiner Frau ist noch in vollem Gange, und dennoch schafft Hans es, mir jeden Morgen dieses Lächeln entgegenzubringen. Und das kommt von Herzen. Doch ich schaffe es heute nicht einmal, ihn anzuschauen. Mit gesenktem Kopf schiebe ich mich an ihm vorbei und durch die Tür in das riesige Glasgebäude. Im Nacken spüre ich seinen verwunderten Blick, schüttele jedoch das schlechte Gewissen mit erhöhter Geschwindigkeit ab. Auf dem Weg zum Fahrstuhl werfe ich meinen klebrigen Kaffeebecher in einen Mülleimer. Dann zwänge ich mich in den Fahrstuhl zwischen ein paar Kollegen, die ich während der zwei Jahre, die ich nun schon hier arbeite, noch nie gesehen habe. Zwei Jahre, in denen ich mich von der IT-Studentin zur rechten Hand meines Abteilungsleiters hochgearbeitet habe. Zwei Jahre, in denen ich mich als junge Frau in der von Männern dominierten IT-Welt behauptet habe.
Zwei Jahre, in denen ich keinen Fuß in meine Heimat gesetzt habe.
An jedem erdenklichen Stockwerk öffnet der Fahrstuhl seine Türen und Menschen strömen hinaus, bis nur noch eine weitere Frau und ich zurückbleiben. Mit meiner klebrigen Hand suche ich Halt am Griff meiner Handtasche.
Die Dame neben mir, mit Bleistiftrock und einer Bluse mit Rüschen bekleidet, kramt in ihrer Tasche und zieht eine Dose mit Hygienetüchern heraus. „Hier“, hält sie eines der Tücher unter meine Nase. „Sonst beschmierst du noch dein schickes Outfit.“
Ihre Miene ist undurchdringlich, ich kann darin weder Mitleid oder Zuneigung noch Abneigung erkennen. Ich vermute, dass sie ihre Gefühle hinter dem perfekten Make-up versteckt hält, weil sie sich in diesem Gebäude genauso behaupten muss wie ich.
„Danke“, murmle ich und beginne, die klebrige Masse von meiner Hand zu rubbeln. Als der Fahrstuhl erneut die Türen öffnet, stöckelt die Frau davon, ohne mich ein weiteres Mal mit einem Blick zu bedenken.
Die Türen schließen sich wieder und mit einem Surren geht es für mich weiter hinauf. Mit geschlossenen Augen atme ich zweimal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Die Ruhe vor dem Sturm inhalieren. Die Zahlen auf der digitalen Anzeige schlagen auf eine 12 um. Es macht ping, die Fahrstuhltüren öffnen sich, und ich steige aus. Sofort werde ich von lauter Technomusik begrüßt, die eindeutig zu viel für einen frühen Montagmorgen ist. Gerade noch rechtzeitig kann ich mich vor einem herumfliegenden Ball abducken.
„Karl, der Anti-Stress-Ball ist zum Kneten und nicht zum Werfen da“, schnauze ich meinen Kollegen an. „Du bist nicht mehr in der Schule. Also benimm dich gefälligst so.“
„Ey, Elli, die Rechtsabteilung ist zwei Stockwerke weiter oben“, bekomme ich zurück. Mit hochgezogenen Augenbrauen und einem gehässigen Lächeln weist Karl mit einem Nicken auf mein Outfit.
Ich grinse ironisch zurück. „Mit meinem Gehalt und meiner Position kann ich es mir nicht erlauben, mit vollgesabbertem Shirt zur Arbeit zu kommen.“ Mein Blick wandert an seinem Oberteil herunter und bleibt an einem sehr offensichtlichen Fleck hängen. Er verstummt. „Und jetzt entschuldigt mich. Ich muss in mein Büro. Das bekommt man nämlich, wenn man endlich bei Mami auszieht und sein Leben im Griff hat.“
„Uh, pass auf, Karlchen, sonst kriegst du noch einen Eintrag ins Klassenbuch“, kommt es hinter einem der Bildschirme hervor.
„Ach, halt die Schnauze“, zischt Karl zurück.
Erhobenen Hauptes marschiere ich nach hinten, an den Schreibtischen vorbei, auf denen je zwei bis drei Monitore stehen. Das Gemeinschaftsbüro ist auf einen Schlag still geworden. Selbst die Lautsprecher scheinen sich für die Situation ausgeschaltet zu haben. An meiner Bürotür drehe ich mich um. „Und es heißt Elle. Nicht Elli.“ Mit Schwung knalle ich die Tür hinter mir zu.
Mit einem Grollen klatsche ich meine Tasche auf den Schreibtisch. Ebenso ungalant plumpse ich in meinen ergonomischen Stuhl und vergrabe mein Gesicht in den Händen. Was für ein beschissener Wochenstart! Ich bin jetzt schon wieder reif fürs Wochenende. Vielleicht sollte ich Fabians Vorschlag, irgendwohin ins Warme abzuhauen, tatsächlich ernst nehmen. Doch wie ich mich kenne, werde ich auch da nicht abschalten können. Das Wissen, dass meine Position unbesetzt, Schmarotzer-Karl aber anwesend ist, würde mir keine Entspannung bringen. Ganz im Gegenteil: Zwischen Karl und mir herrscht ein inoffizieller Krieg um die besten Aufträge und die Gunst unseres Abteilungsleiters Christoph. Und ohne meine Verbissenheit hätte ich mir diesen Vorsprung zu Karl niemals aufbauen können. Nein, Urlaub kann ich mir im Zuge dieses Machtkampfes und des aktuellen Projekts schlichtweg nicht leisten! So stabil ist meine Karriere dann eben doch noch nicht.
„Okay, dann wollen wir mal Karriere machen“, spreche ich mir Mut zu und setze mich in Bewegung. Ich richte mich auf und bereite meinen Arbeitsplatz für den Tag vor.
Während mein PC hochfährt, mache ich mir einen einfachen Kaffee mit Milch und Zucker. Hinter meinen zwei Monitoren verschwunden, beantworte ich anschließend zuerst die eingegangenen E-Mails und strukturiere dann meine Aufgaben des Tages. Wenn es etwas gibt, was ich gut kann, dann ist es priorisieren und organisieren. Etwas, was ich den Jungs im Männerkostüm weit voraushabe.
Als ich endlich alle Benachrichtigungen abgearbeitet und Aufgaben verteilt habe, geht die Tür nach einmaligem Klopfen auf. Christoph steckt den Kopf rein.
„Moin, Elle“, hebt er den Finger zum Gruß. „Ich wollte nur kurz Bescheid geben, dass ich nur bis Mittag mache. Hochzeitstag und so. Hatte ich völlig vergessen. Morgen bin ich wieder voll da.“
„Oh, okay. Dann herzlichen Glückwunsch. Sie war hoffentlich nicht wütend darüber, dass du ihn vergessen hast.“
„Sie hat ihn auch vergessen. Unsere Telefone haben uns daran erinnert.“
Ich rolle amüsiert mit den Augen.
„Alles in Ordnung bei dir?“ Christoph tritt ganz ins Zimmer. Hinter seinem Rücken kann ich Karl und die anderen sehen, wie sie über ihre Bildschirme hervorlunzen. „Du siehst irgendwie krank aus.“
„Nein, nein. Alles gut“, lächle ich über das Chaos in mir hinweg. „Sollen wir dann das Meeting für den aktuellen Stand des Projekts auf morgen verschieben?“, weiche ich stattdessen aus.
Christoph zieht die Augenbrauen zusammen. „Klar. Schick den Termin an alle raus.“
Zur Bestätigung nicke ich und öffne gleich den Onlinekalender.
Obwohl er schon wieder gehen will, dreht sich Christoph noch einmal um. „Elle, ich weiß, du bist sehr ehrgeizig. Und es gibt eine lange Liste von Gründen, weshalb ich dich an meiner Seite haben will. Aber wenn du Urlaub brauchst, dann –“
„Mir geht es gut, Christoph“, unterbreche ich ihn etwas zu barsch.
Christoph mustert mich mit den Händen in der Tasche. Obwohl er für Meetings regelmäßig ins Büro unseres Chefs muss, verzichtet Christoph auf den strengen Business-Look. Stattdessen setzt er auf locker sitzende Hemden und weite Stoffhosen, die seine rundliche Figur umspielen. Damit macht er sich zwar nahbarer und ich fühle mich ihm fast schon freundschaftlich statt allein geschäftlich verbunden. Aber eben nur fast. Als er sich nicht schickt, seine Musterung zu beenden, versichere ich ihm ein weiteres Mal: „Christoph, es ist alles in Ordnung.“
Wortlos nickt er endlich, doch ich kann ihm ansehen, dass er mir nach wie vor nicht glaubt. Dann zieht er sich zurück und schließt die Tür von außen.
Neben Fabian habe ich hier in Frankfurt keine Freunde, bei denen ich mich ausheulen könnte. Vielleicht wünsche ich mir deswegen manchmal, ich könnte mit Christoph reden wie mit einem Vertrauten. Er sagt zwar ständig, dass seine Tür jederzeit offen stehe, er ist aber immer noch mein Vorgesetzter. Und Vorgesetzten gibt man nicht unbedingt vertrauliche, persönliche Informationen preis. Ich mag ihn, was aber nicht bedeutet, dass ich mich zu ihm auf die Couch lege und ihm mein Leid klage.
Mit einem lauten Seufzen ziehe ich die AirPods aus ihrem Gehäuse und stecke sie mir in die Ohren. Heute dürfen mir Imagine Dragons in meinen Workflow verhelfen. Dann mache ich mich an den aktuellen Code. Trotz guter Musik dauert es, bis ich in meinen Flow finde. Doch dann huschen meine Finger flüssig über die Tastatur, und auf meinem Bildschirm wird das JavaScript HTML-Element um HTML-Element erweitert.
Plötzlich wird der Song von der Klingelmelodie meines iPhones unterbrochen.
„Argh! Es lief gerade so gut.“ Knurrend hebe ich das Telefon auf und schaue auf das Display. Mama. Natürlich! Wer auch sonst sollte mich allein an einem Vormittag bereits fünfmal anrufen. Ich lege das Telefon beiseite und widme mich wieder meinem Code. Doch dieses Mal habe ich nicht mit der Ausdauer und Penetranz meiner Mutter gerechnet. Als sie auch nach drei Minuten nicht auflegt, nehme ich endlich ab.
Bevor ich irgendeine Begrüßung formulieren kann, schrillt die aufgebrachte Stimme meiner Mutter bereits durch den Hörer. „Na, endlich! Ich versuche seit Tagen, dich zu erreichen. Ich habe schon mit dem Schlimmsten gerechnet!“
Es ist eigenartig, ihre Stimme nach so langer Zeit zu hören. Und dann noch in diesem verzweifelten Ton, was so gar nicht zum Bild meiner Mutter passt. Der Klang ihrer Stimme boxt mir in die Magengrube und sofort ist mir erneut speiübel.
„Mama, ich bin bei der Arbeit. Kann ich dich vielleicht heute Abend –“
„Elisabeth, du musst nach Hause kommen.“
Bei meinem vollen Namen rollen sich mir die Fußnägel hoch. Elisabeth hat mich schon lange niemand mehr genannt. Denn hier in Frankfurt kennen mich alle nur unter dem Namen Elle. Ich nehme das Telefon vom Ohr, atme einmal durch, bevor ich es wieder ans Ohr lege.
„Ich kann hier gerade nicht weg, Mama“, protestiere ich. „Ich stehe gerade kurz vor meiner Beförderung und wir stecken mitten in –“
„Es gibt einen Notfall“, platzt sie dazwischen. „Du musst nach Hause kommen. Ich brauche dich, Elisabeth.“
Ich spüre, wie jegliche Farbe aus meinem Gesicht weicht. Papa, schießt es mir durch den Kopf. Der kalte Schweiß an meiner Handinnenfläche lässt das Telefon langsam aus meiner Hand gleiten, sodass ich es mit der anderen Hand auffangen muss.
„Ich rufe dich gerade vom Krankenhaus aus an.“
„Ist mit Papa alles okay?“, kommt eine mickrige Stimme aus meinem Mund gekrochen. Sofort blitzen grauenvolle Bilder vor meinem inneren Auge auf.
Ich kann hören, wie Mama tief Luft holt, als würde sie sich dafür wappnen, mir die grauenvollste Nachricht meines gesamten Lebens mitzuteilen.
„Deinem Vater geht es den Umständen entsprechend“, antwortet sie schließlich. „Bitte komm einfach nach Hause.“ Ihre Stimme ist nun ganz sanft.
Meine Zunge ist wie gelähmt, sie ist unfähig, Worte zu formen. Doch was sollte ich auch sagen? Ja klar, Mama, ich springe sofort ins Auto und komme nach zwei Jahren zurück. Und dort werde ich dir und Papa um den Hals fallen? Ganz bestimmt nicht! Ich will nicht zurück an den Ort, der für meine Albträume verantwortlich ist. Ich will aber auch kein Monster sein, das seine Mutter im Stich lässt.
„Ich möchte dich so gerne wieder in die Arme schließen, Elisabeth.“
Das Elisabeth sagt sie mit so viel Sanftheit, dass sich ihre Stimme wie eine warme Umarmung um mich legt. Ich schließe die Augen und reibe mir mit der freien Hand über die Stirn. Erst heute Morgen habe ich Fabian vertröstet, dass ich hier nicht weg und mit ihm in den Urlaub düsen kann. Und jetzt sollte ich doch alles stehen und liegen lassen für einen Notfall in der Familie, die ich seit zwei Jahren nicht gesehen habe? Und um was für einen Notfall genau handelt es sich überhaupt?
Ich beiße mir kurz auf die Unterlippe, bevor ich antworte. „Okay“, willige ich ein. „Aber ich kann frühestens am Wochenende. Ich bin die rechte Hand vom Chef und damit habe ich einige Fäden in der Hand. Bevor ich hier die Biege mache, muss ich noch ein paar Aufgaben delegieren.“
„Früher kannst du wirklich nicht kommen?“, fragt sie, als würde sie bewusst über meinen Karriereaufstieg hinweghören.
„Nein.“
Ein Seufzen dringt durch den Hörer. „Na gut. Dann sehe ich dich am Samstag. Ich freue mich, Liebes.“
„Ja, bis dann“, sage ich und lasse meinen Finger auf den roten Punkt auf dem Display gleiten.
Ich lasse mich zurück in die Lehne fallen und meine Arme an der Seite herunterbaumeln. „Wofür werde ich nur bestraft?“, frage ich laut in den Raum hinein. Aber bis auf die Musik aus dem Großraumbüro und das Gequatsche der Jungs bleibt es still.
Es ist noch nicht einmal zehn Uhr und für mich ist dieser Tag bereits gelaufen. Die ganze Woche ist hinüber! Innerlich zerreißt mich die Angst – aus zwei verschiedenen Gründen: Einerseits will ich nicht zurück in die Heimat und mich dem ganzen Mist der Vergangenheit stellen. Andererseits tappe ich im Dunkeln, weshalb meine Mutter vom Krankenhaus aus angerufen hat. Geht es wieder um meinen Vater oder ist sogar ihr selbst etwas zugestoßen?
Mit Schwung stehe ich auf, sodass mein Stuhl gegen die Wand prallt. Mit ein paar Streckübungen bereite ich mich auf das Gespräch mit Christoph vor. Ich will das Feld nicht einfach so Karl überlassen, der wie ein aasgieriger Geier hinter seinem Bildschirm hockt und nur darauf wartet, dass er sich die Beförderung krallen kann, sobald ich zur Tür raus bin. Ich muss Chris irgendwie davon überzeugen, dass ich von Mecklenburg aus arbeiten kann. Es sind ja nur ein paar Tage. Dann bin ich wieder zurück und kann den Heimatbesuch für die nächsten fünf Jahre von meiner To-do-Liste streichen.
Den Streckübungen schiebe ich noch ein paar Atemübungen hinterher. Dann reiße ich die Tür mit Schwung auf und marschiere mit wehendem Haar nach nebenan. Christophs Tür steht offen. Ohne nach Einlass zu fragen, schließe ich die Tür hinter mir.
„Chef, wir müssen reden.“
Entgeistert schaut Chris von seinem Handy auf. „Ui, was kommt jetzt?“
„Ich habe eben einen Anruf aus der Heimat bekommen, und wie es scheint, muss ich für ein paar Tage verreisen. Ich weiß, die Zeit ist aktuell sehr ungünstig. Wir stecken mitten in der Entwicklung einer neuen Plattform. Aber ich werde nur für ein paar Tage fort sein. Und wenn ich den VPN-Zugang auf meinem Laptop eingerichtet habe, kann ich auch von dort aus weiterarbeiten, und niemand merkt, dass ich eigentlich nicht da bin.“
„Elle!“
Ich knete meine Hände so fest, bis es schmerzt.
„Hole erst einmal Luft.“
Tatsächlich wird der Sauerstoff in meinem Gehirn gerade knapp. Zittrig hole ich Luft und warte gebannt Christophs Meinung ab.
„Selbstverständlich kannst du in die Heimat fahren. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung?“
„Das weiß ich selbst noch nicht. So viel konnte ich aus dem Anruf nicht heraushören.“
„Mach dir wegen der Arbeit keinen Stress. Fahr nach Hause. Du hast ohnehin so viele Überstunden, dass es für mindestens zwei Wochen reicht. Ich kann ein paar Aufgaben an Karl abtreten.“
„Aber der hat doch überhaupt keine Ahnung“, platzt es aus mir heraus, und ich bereue sofort, dass ich keine professionelleren Argumente gefunden habe. Verdattert guckt mich Chris an. „Ich meine, ich habe ohnehin erst vor, am Wochenende zu fahren“, schiebe ich hastig hinterher. „Also habe ich ausreichend Zeit, alle Vorkehrungen zu treffen, damit ich nur meinen Laptop benötige. Und das VPN richte ich mir auch noch ein.“
Euphorisch nicke ich, um Chris klarzumachen, dass Karl als meine Vertretung absolut überflüssig ist.
„In Ordnung“, gibt Chris nach. „Dann stell einen Plan auf und schicke ihn mir zur Freigabe durch. Ich schaue drüber und werde eventuell Verbesserungen machen, die wir morgen im Meeting besprechen können.“
„Danke, Chef“, sage ich sichtlich erleichtert und verlasse das Büro mit etwas weniger Übelkeit. Trotzdem, die Angst bleibt. Denn wie es aussieht, hat mich meine Vergangenheit eingeholt. Das Fliehen hat ein Ende. Jetzt muss ich mich ihr stellen.
Aufgeschobenes Wiedersehen
Elle
In den vergangenen fünf Tagen habe ich alles darangesetzt, dass Karl in meiner Abwesenheit keine einzige meiner Aufgaben übernehmen muss. Leider ist es immer noch ein Gemeinschaftsprojekt und Karl Teil des Teams, sodass ich es nicht komplett ausschließen kann, dass mein Rivale etwas an sich reißt.
Aber wenigstens konnte ich den Laptop einrichten, sodass ich versuchen kann, meinen Vorsprung zu halten. Alle Vorkehrungen sind getroffen, sodass ich nun einen freien Kopf für das habe, was mich in der Heimat erwartet.
Die restliche Strecke nach dem Kühe-Zwischenfall fahre ich, ohne wirklich darüber nachzudenken, wo ich abbiegen muss. Denn diese holprigen, zum Teil mit Pflastersteinen ausgelegten Straßen kenne ich im Schlaf. Gedanklich hänge ich immer noch bei der Begegnung mit dem Typen, der anscheinend die Rinder meiner Eltern umgetrieben hat. In den Tiefen meines Gedächtnisses blitzt eine Kopie seines Gesichts auf, aber ich kann diesen Erinnerungsfetzen irgendwie nicht mit dem Kerl verknüpfen, der eben noch vor mir stand.
Noch in Gedanken versunken lenke ich den Wagen von der Hauptstraße auf die mit Schlaglöchern übersäte Zufahrtsstraße zum Hof meiner Eltern. Als der linke Vorderreifen durch ein Schlagloch kracht und ich in meinem Sitz hochgeschleudert werde, sodass ich fast mit dem Kopf am Dach anstoße, werde ich endlich wach und sehe sie vor mir:
Meine Heimat, meine Kindheit – eine Zeit ohne Sorgen.
Ich drossele die Geschwindigkeit, als ich durch das große Hoftor fahre. Es dient eigentlich nur als optische Abgrenzung zum Umland, denn einen Zaun um den Hof selbst gibt es nicht. Auch wenn unser Aussiedlerhof in dieser offenen Landschaft auf den ersten Blick irgendwie verloren wirkt, sticht das Wohnhaus mit seiner Massivholzbauweise und der überdachten Terrasse sofort ins Auge.
Links neben dem Haus und direkt neben dem Hoftor befindet sich eine kleinere Hütte, die wir früher für Gäste verwendet haben. Zur Rechten befinden sich der Reitplatz, der Round-Pen, in dem wir die Pferde im Kreis bewegen können, und ein Schuppen. Die Stallungen liegen hinter dem Wohnhaus einen leichten Hang hinunter. Alles wirkt alt, beinahe verwahrlost. Sähe ich nicht das Auto meiner Mutter vor dem Wohnhaus und einen rostigen Pick-up vor der Hütte stehen, würde ich daran zweifeln, dass meine Eltern hier noch leben.
Anstatt auf das Haupthaus zuzuhalten, lenke ich den Wagen nun vor die kleine Hütte links davon. Sie wird mein Übernachtungsquartier werden – mit Sicherheit werde ich nicht in mein altes Kinderzimmer einziehen. Mit meinen Eltern wieder unter einem Dach zu wohnen, kommt für mich gar nicht in die Tüte. Sonst gibt es Tote.
Als ich aussteige, summt in mir alles, als hätte ich sechs Stunden auf einem Presslufthammer gesessen. Ich drücke den Rücken durch und schaue mich um. Hinter dem Haus ertönt von den Stallungen ein Wiehern herüber, gefolgt von einem Schnauben. Auf den Dächern zwitschern die Schwalben, die ihre Brut bereits aus dem Nest geworfen haben. Ansonsten ist es auf dem Hof ungewohnt still, die Kühe sind auf den entfernten Weiden unterwegs.
Mit der Ruhe der Natur verliert mein Körper allmählich sein Gehetztsein; die innere Unruhe bleibt jedoch und mischt sich jetzt mit Nervosität, als sich quietschend die Tür vom Wohnhaus öffnet. Ich presse die Zunge gegen den Gaumen, damit mein Herz nicht auf den Schotter springt, und drehe mich um. Auf der leicht erhöhten Veranda erscheint meine Mutter. Ungewollt bin ich erleichtert.
„Elisabeth, endlich“, ruft mir Mama zu. Beim Klang meines vollen Namens presse ich die Fingernägel in die Handflächen. Mama kommt mit geöffneten Armen auf mich zu, sieht dabei aber auf die zwei Treppenstufen. Es hat den Anschein, als müsste sie genau darauf achtgeben, dass sie nicht neben die Stufen tritt. Wenig enthusiastisch gehe ich ihr langsam entgegen. Jetzt erst fällt mir auf, wie die dunklen Augenringe auf ihrer blassen Haut hervorstechen.
„Hallo, Mama“, sage ich und nehme sie kurz in den Arm. Wir haben Temperaturen um die fünfundzwanzig Grad und trotzdem fühlt sich Mama kalt an. „Geht es dir gut? Du siehst ziemlich blass aus.“
Mama winkt ab. „Ich war heute noch nicht viel an der frischen Luft.“
Sie sieht eher aus, als hätte ein Vampir sie gebissen, denke ich, nicke jedoch stattdessen.
„Oh, du glaubst gar nicht, wie schön es ist, dich wieder in den Armen halten zu können. Es ist viel zu lange her.“ Ein weiteres Mal zieht sie mich an sich und hält mich fest im Arm.
„Ja, das ist es“, bringe ich gezwungen hervor und versteife mich. Ihre Berührung schmerzt. Einerseits ist eine Umarmung genau das, was ich am dringendsten nötig habe, andererseits ist unsere Berührung wie ein Zeitspeicher: Der körperliche Kontakt weckt so viele Erinnerungen, die ich die letzten Jahre sehr gut unter Verschluss halten konnte und die ich am liebsten vergessen hätte.
Vorsichtig, um das gebrechliche Individuum, das meine Mutter geworden ist, nicht zu verletzen, schiebe ich sie von mir. Dann stehen wir unbeholfen voreinander. Innerlich flehe ich sie an, die Gesprächsführung zu übernehmen, denn von hier aus weiß ich nämlich nicht weiter.
„Dein Vater schläft gerade. Aber du kannst ihn ja später begrüßen.“
Vater ist hier? Er ist gar nicht mehr im Krankenhaus? „Nein, nein. Ich kann das gleich machen“, sage ich mit etwas Verspätung und springe auch schon in Richtung Wohnhaus.
„Elisabeth, er wird dich doch gar nicht mitbekommen.“
Genau das ist ja der Plan.
Ich betrete das alte Holzhaus, das in seinem Inneren noch genauso riecht und aussieht wie in meiner Kindheit. Nichts hat sich verändert. Selbst die Winkel, in denen die Bilderrahmen auf der Kommode zueinanderstehen, haben sich nicht verändert.
Der Flur ist relativ kurz und öffnet sich nach wenigen Metern zur linken Seite in die große Küche mit Essbereich. Von dort geht es weiter in das Wohnzimmer. Folgt man dem Flur an der Küche vorbei, kommt man zur rechten Seite zu einem Gästebad, und daneben befindet sich das Gästezimmer. Die Treppe hinauf befinden sich das Elternschlafzimmer, mein Zimmer, das Bad und ein Arbeitszimmer. Doch dort muss ich überhaupt nicht hin. Denn mein inneres Navigationsgerät befiehlt meinen Füßen, den Weg zum Gästezimmer anzupeilen. Schon im Flur höre ich das Surren und Pumpen des Sauerstoffgeräts.
Auf leisen Sohlen nähere ich mich in Zeitlupengeschwindigkeit der nur angelehnten Tür. Das Rauschen in meinen Ohren übertönt beinahe das Quietschen der Scharniere, als ich die Tür vorsichtig aufdrücke. Der Knoten in meinem Hals treibt mir die Tränen in die Augen, als ich den schlaffen Körper meines Vaters im Krankenhausbett liegen sehe. Er hat die Augen zwar geschlossen, aber etwas Weiß kann ich noch erkennen. In seiner Nase steckt eine Sauerstoffbrille, um ihm das Atmen im Schlaf zu erleichtern. Die einst starken Arme, die Kälber umhergetragen haben und mich mühelos auf mein Pony hieven konnten, ähneln zwei Streichhölzern. Die Hände, die Holz für meine versteckte Hütte im Wald abgeschliffen haben, sind blass und adrig. Unter der aufgeplusterten Decke ist sein Körper komplett verschwunden, als hätte er überhaupt keinen Unterleib. Und die Wangen, die durch sein warmes Lächeln immer rund und stramm waren, enthalten keinerlei Leben mehr und sind mit grau schimmernden Bartstoppeln übersät.
Das ist nicht mein Vater. Ich weiß nicht, wer dort in dem Krankenbett liegt, aber er kann es nicht sein. Mein Gehirn beginnt einen Kampf mit meinem Herzen, das sich weigert zu glauben, dass dies einmal mein Idol war, und mir wird ganz schwindelig. Ich wende mich ab und stürme zurück nach draußen. Dass ich nur für einen Wimpernschlag im Haus gewesen sein muss, wird mir erst bewusst, als meine Mutter gerade einmal die Stufen zur Veranda erreicht. Mit müden Augen schaut sie mich überrascht an.
„Seit wann ist er zurück aus dem Krankenhaus?“, frage ich und zeige mit dem Daumen über meine Schulter.
Verwirrt blinzelt meine Mutter. „Dein Vater war das letzte Mal zur Routineuntersuchung vor drei Monaten im Krankenhaus“, sagt sie dann.
Hm, wenn er nicht im Krankenhaus war, wer dann?
„Hattest du eine gute Fahrt?“, wechselt Mama eilig das Thema.
„Gut, gut“, sage ich, noch in meine Grübelei vertieft, bevor ich mich mit einem Kopfschütteln davon befreie. „Und weshalb hast du mich nun hierhergelockt?“, frage ich und stemme die Hände in die Hüfte. Hoffentlich bemerkt sie nicht meine zittrigen Knie.
„Ich habe dich nicht hergelockt“, entgegnet Mama.
„Du hast gesagt, du brauchst Hilfe. So, hier bin ich. Aber auch nur für ein paar Tage, bevor ich zurück ins Büro muss. Wegen meiner Beförderung und so. Daher würde ich vorschlagen, dass du mir gleich zeigst, worum es geht.“
Mama schließt kurz die Augen, als wolle sie vertuschen, dass sie sie verdreht hat. Gesehen habe ich es trotzdem. Dann winkt sie mich hinter sich her. „Lass mich dir den Hof zeigen, dann wirst du es sicherlich verstehen.“
Bezweifelnd, dass ich irgendetwas verstehen oder nachvollziehen werde, folge ich ihr um das Wohnhaus herum. Mein Blick fliegt zuerst zum Reitplatz und Round-Pen hinüber. Bereits von der Veranda aus kann ich sehen, dass die Bodenpflege mehr als zu wünschen übrig lässt. Doch dort entlang führt mich meine Mutter nicht. Stattdessen biegen wir um die rechte Hausecke und gehen an der Gästehütte vorbei.