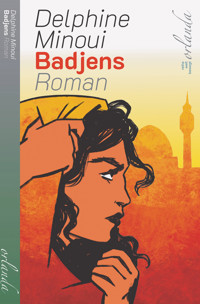
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Orlanda Verlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: welt bewegt
- Sprache: Deutsch
In jeder Iranerin steckt eine Rebellin … Wort für Wort bedeutet Bad-jens: nicht akzeptabel. Und im Alltagspersischen: schelmisch oder aufmüpfig. Schiras, Herbst 2022. Mitten im Aufstand »Frau, Leben, Freiheit« klettert die sechzehnjährige Iranerin Badjens bei einer Demonstration auf einen Müllcontainer, um in aller Öff entlichkeit ihr Kopftuch zu verbrennen. Während sie vor der sie anfeuernden Menschenmenge steht, zieht in Rückblenden ihr bisheriges Leben an ihr vorbei: ihre unerwünschte Geburt, ihr konservativer Vater, ihr Smartphone voller rebellischer Hits, ihre Freundinnen, ihre erste Liebe, ihr Körper, der nach Freiheit verlangt, und die Kleiderordnung für Frauen, die dieses Stück Stoff auf dem Kopf vorschreibt, von dem sie sich unbedingt befreien will. »Meine Heldin Badjens verkörpert all diese Mädchen der Generation Z, die mit der Propaganda des islamischen Regimes gefüttert wurden, aber auch Zugang zu sozialen Netzwerken, Taylor Swift und Netflix hatten. Sie sind Lichtjahre von ihren Großmüttern entfernt und ganz anders als ihre Mütter, die zwischen den Verboten navigiert haben. Sie lassen alles hinter sich.« Delphine Minoui Delphine Minoui erzählt die radikale Entwicklung ihrer Protagonistin in Form eines inneren Monologs. In ihrem bewegenden Entwicklungsroman verweben sich ausdrucksstarke Worte zu einer neuen Sprache, die in ihrer Feinfühligkeit und Rebellion Ausdruck für eine neue Generation im Aufbruch ist. Die Grundlage für den Roman bildeten Social Media Posts und Online-Interviews, die Minoui mit jungen Iranerinnen geführt hat. Es ist ihr gelungen, daraus einen Text zu schaff en, der die Wut, die Rebellion, aber auch den Mut der jungen Frauen ungeheuer kraftvoll zum Ausdruck bringt. »Delphine Minoui setzt starke Akzente und komponiert aus Sätzen, die sie wie in Strophen arrangiert, eine traurige und mitreißende Hymne.« Le Figaro
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Delphine
Minoui
Badjens
Roman
Aus dem Französischen von Astrid Bührle-Gallet
Im Andenken an Mahsa, Nika, Sarina, Armita … und all den schönen Rebellinnen im Iran gewidmet.
Wenn ich mein duftendes Haar
dem Wind überlasse,
werde ich alle Gazellen auf den Feldern erhaschen.
Wenn ich meine zarten Narzissen mit Kajal bemale,
werde ich die Welt in Finsternis tauchen.
Wenn der Himmel wünscht, mein Gesicht zu betrachten,
wird er jeden Morgen seinen goldenen Spiegel hervorholen.
Tahere (Qurrat al-ʿAin), 1817–1852, mystische persische Dichterin und Vorkämpferin für Frauenrechte im Iran, die hingerichtet wurde, nachdem sie vor einer Versammlung von Männern ihren Schleier abgelegt hatte.
Schiras, 24. Oktober 2022
Hörst du sie rufen?
Hörst du, wie sie dir Beifall klatschen, obwohl du noch gar nichts gemacht hast?
Schisserin! Das bringst du ja doch nicht.
Du bringst es nicht, auf den Container draufzusteigen.
Um dich herum rufen sie: »Boro dokhtaram!«, »Los Mädchen!«
Mitten auf dem Zand-Boulevard haben die Demonstrierenden eine große Mülltonne aus Metall umgeworfen.
Sie zieht dich magisch an.
Du hast eine Wahnsinnslust draufzuklettern.
Du bist ganz kribbelig.
Du siehst dich wieder vor dir. Klein und ängstlich.
Unsichtbar unter diesem obligatorischen Kopftuch, das jetzt an der Spitze deines Zeigefingers baumelt wie an einem Galgen.
Du siehst dich wieder vor dir und fragst dich: Was mache ich da eigentlich?
Vor ein paar Minuten hast du dich noch aufgespielt wie ein Kerl und dir den Hidschab vom Kopf gerissen.
Und jetzt machst du dir in die Hose wie ein kleines Mädchen.
Los jetzt, mach schon!
Du hast nichts mehr zu verlieren.
Siehst du diese Straßen, die schwarz vor Menschen sind, die ganzen Leute, die sich geschlossen vor die Polizei stellen?
Ausnahmsweise beschützen die Männer dich mal, statt dich unterzubuttern …
Auf geht’s, nur noch zwei kleine Schritte.
Beeil dich!
Nicht umdrehen!
Was ziehst du bloß für ein Gesicht!
Jetzt endlich, du hältst dich an dem Müllcontainer fest.
Ja, du bist die, die man da bejubelt.
Du, die Königin für einen Abend, die endlich ihren Thron besteigt.
Pass auf! Deine Hände rutschen ab. Deine Beine … zappeln im Leeren!
Konzentrier dich!
Konzentrier dich auf diesen Körper, der sich dir immer entzogen hat.
Ja, so ist’s gut … Du hast es geschafft!
Denk an einen Actionfilm.
Du spaltest dich auf.
Du kennst das in- und auswendig.
Echt jetzt, du machst ganz schön Eindruck!
Schau nach unten.
Ja, diese Finger, die das V-Zeichen machen, die sind für dich.
Diese abgeschnittenen Haarbüschel sind für dich.
Und diese Scheren, die wie Schwerter hochgestreckt werden, auch für dich.
Krass, das ist voll abgefahren, oder?
Und das Gehupe. Hörst du das Gehupe?
Und die Lieder und die Slogans: »Tod dem Diktator!«, »Ihr bekämpft uns, und wir bekämpfen euch!«, »Ich werde mich entblößen, bis dir Hören und Sehen vergeht« …
Du hörst dir das an.
Du lachst und du weinst.
Denn in Wirklichkeit hast du echt Bammel.
Vor einem Monat wurde ein Mädchen aus deinem Land, Mahsa Amini, wegen eines falsch sitzenden Kopftuchs umgebracht.
Sie ging auf der Straße.
Die Polizei hat sie festgenommen.
Es ist schlecht ausgegangen.
Wegen Mahsa bist du hier.
Denn Mahsa, das hättest du sein können.
Oder deine Nachbarin. Oder deine beste Freundin.
Du wischst deine nassen Wangen ab.
Du bindest deine zerzausten Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen.
Ja, so ist’s besser!
Jetzt ist alles bereit. Die Schauspielerin und die Statisten.
Die Hauptfigur, das bist du.
Die Rolle ist dir auf den Leib geschrieben.
Du drückst auf deiner Mülltonne die Brust raus.
Deine schwarzen Augen bohren sich in den Horizont.
Zu deinen Füßen brüllt die Menge immer lauter: »Los, Mädchen!«
Du hörst nichts mehr.
Weder die Slogans noch das Quietschen der Reifen, noch das immer lautere Dröhnen der Motorräder.
Die Schlagstöcke der Milizionäre krachen gegen das Metall.
Aber auch das hörst du nicht.
Du denkst nur an das Feuerzeug, das in deinem BH versteckt ist.
Deine Hand schiebt sich unter deinen Manto, berührt deine Brust.
Du greifst nach dem Feuerzeug.
Du holst es raus und umklammerst es ganz, ganz fest.
Du hast dich noch nie so lebendig gefühlt.
Ein Funke genügt, damit dein Kopftuch sich in Rauch auflöst.
Fertig?
Action!
Ich bin 16 Jahre alt.
Kein Schrei dringt aus meinem Mund.
Ich spreche aus diesem Körper, der mir nie gehört hat, zu mir selbst. Ich bin 16 Jahre alt. Ich wiege 47 Kilo und bin 1,59 Meter groß.
Ich höre sie »Los, Mädchen!« brüllen und muss wieder an den ersten Schrei denken:
»Gott, es ist ein Mädchen!«
Dieser Schrei vor meiner Geburt.
Der alles begründende Schrei.
Ursprünglich.
Der der Männer aus meiner Familie, die sich über Mamas Bauch drängten.
Ich stelle mir vor, wie mein Vater, mein Großvater, seine Brüder und seine Cousins auf den Bildschirm starren, auf dem mein Fötus in 3D zu sehen ist. Die Geburtshelferin stammelt »Es tut mir leid«, »Es tut mir leid«, und sie sind so bestürzt, als wäre gerade eine Atombombe auf Schiras gefallen.
Es war mein Vater gewesen, der auf den Ultraschall bestanden hatte. Er wollte sich die blaue Tapete an der Wand meines zukünftigen Zimmers und die hübsche Korbwiege sparen, falls es einen »Fehler« geben sollte. So hat er mich lange genannt.
Ich bin 16 Jahre alt, und ich spule alles im Schnelldurchlauf zurück.
Die Flüche. Die Klagen. Die zugeschlagene Tür. Dieser Satz, »Es tut mir leid«, »Es tut mir leid«, wie eine Schallplatte mit Sprung.
Maman hat mir diese Szene so oft erzählt, dass es mir vorkommt, als ob ich sie selbst ganz bewusst miterlebt hätte. Das Fruchtwasser im Mutterleib wirkt wie ein Resonanzkörper.
Meine kleinen Füße flippen aus. Wiederholte Tritte gegen die Wand. Das dumpfe Stöhnen der Schwangeren, die mit ihrem Schmerz, ihren Dämonen und ihrem halb leeren Bauch allein gelassen wird, weil Frauen in meinem Land nur die Hälfte wert sind.
Man sagt, dass der Teufel im Detail steckt, dass Details tödlich sein können. Bei mir war es mein Großvater gewesen, der mich beinahe umgebracht hätte.
Während die Gynäkologin meiner Mutter aufhalf, hatte er alle Männer der Familie beiseitegenommen, um mein vorzeitiges Urteil in die Wege zu leiten:
»Eine Abtreibung! Wir müssen unbedingt eine Abtreibung ins Auge fassen!«
Der Islam, der Staatsreligion ist, verbietet Abtreibungen. Aber im Iran ist alles Verhandlungssache, sogar die Religion.
Mein Großvater behauptete, er kenne einen Arzt, der seinen Keller heimlich, still und leise als illegale Klinik benutze.
»Ein Mann, dem man vertrauen kann«, hatte er betont.
Er hatte ihm in aller Eile eine SMS geschickt.
Fünf Minuten später zeigte sein Handy die Antwort an. Zwei knappe Zeilen bestätigten ihm, dass ein unerlaubter Eingriff möglich war, zu einem überaus gesalzenen Preis, der weit über der erwarteten Summe lag.
Mein Großvater war aus allen Wolken gefallen.
Er war ein Veteran aus dem Iran-Irak-Krieg, mein Großvater, der Wächter einer Revolution, als deren Held er sich fühlte.
Er hatte zum Telefon gegriffen und mit martialischer Stimme die Gnade Allahs und das Andenken an Ayatollah Chomeini, den Gründungsvater der Islamischen Republik, beschworen, in der Hoffnung, im Namen der Heiligen Verteidigung des Vaterlands einen Rabatt herauszuschlagen.
Der Arzt am anderen Ende der Leitung hatte sich nicht beschwatzen lassen: Der Preis war nicht verhandelbar, und er war ausschließlich in Dollar und vor der Operation zu bezahlen.
Mein Großvater hatte einfach aufgelegt und widerwillig auf meine allzu kostspielige Ermordung verzichtet.
Im Nachhinein betrachtet müssen sich diese Gespräche meinem Fötus wohl eingeprägt haben.
Am Ende des neunten Schwangerschaftsmonats spürte meine Mutter nicht das geringste Anzeichen von Wehen.
Ihr Gebärmutterhals öffnete sich nicht.
Ihre Gebärmutter rührte sich nicht.
Ich fühlte mich in diesem Bauch wohl. Ich wollte dieses Exil nicht.
Geboren zu werden, bedeutete zu sterben.
In den Augen der Männer zu sterben.
»Los, Mädchen!«
Ich schließe die Augen und werde von einer Art Trance erfasst. Die ganzen Rufe dringen mir unter die Haut und lullen mich ein.
Ich glaubte, ich hätte alles vergessen.
Ich glaubte, ich hätte alles weggewischt.
Ich glaubte das, weil ich mir keiner Sache sicher war.
Weil man im Iran, von frühester Kindheit an, an allem zweifelt, sogar an sich selbst.
Jetzt, da ich an meine unerwünschte Geburt zurückdenke, auf diesem Müllcontainer stehe, wo mein Körper endlich wieder zum Leben erwacht, kommen die Erinnerungen zum Vorschein, wie mein Haar.
Ich bin 16 Jahre alt.
Ich bin an dem Tag gestorben, an dem ich zur Welt kam.
Bei lebendigem Leib gestorben, einundzwanzig Tage zu spät und mit ganz schrumpeliger Haut.
Drei Wochen nach dem errechneten Geburtstermin hatte man mich schließlich mit Gewalt per Kaiserschnitt herausgezerrt.
Angeblich hatte ich so viele Falten auf der Stirn, dass mein Vater sich geweigert hatte, mich auf den Arm zu nehmen.
Wie er sich auch geweigert hatte, mir einen Vornamen zu geben.
Nur konnte der »Fehler« eben nicht namenlos bleiben, wenn er Ausweispapiere bekommen sollte.
Maman Zari, meine Großmutter väterlicherseits, schlug Zahra vor, ihren eigenen Vornamen, und Papa fügte sich.
Eigentlich sah ich ja auch aus wie eine kleine Alte.
Außerdem ist Zahra eine Ikone des Islam, eine Tochter des Propheten Mohammed und seiner ersten Frau Chadīdscha.
Durch seine Zustimmung zu diesem Namen wusch sich Papa von der Sünde rein, dass er daran gedacht hatte, mich zu beseitigen.
Mama dagegen war nicht gefragt geworden.
Genauso wenig, wie sie jemals auch nur die allerkleinste Glückwunschnachricht erhalten hatte.
Daran hatte Mama ganz schön zu knabbern.
Es hatte ihr die Sprache verschlagen, dass sie so übergangen worden war – und sie hatte insgeheim rebelliert.
Für sie würde ich Badjens sein.
Zwei Silben, die einem ganz schnell über die Lippen gehen – so schnell, wie man mit mir kurzen Prozess hatte machen wollen.
Wort für Wort bedeutet Bad-jens: nicht akzeptabel.
Und im Alltagspersischen: schelmisch oder aufmüpfig.
Vor dieser Menschenmenge muss ich an ein Bild denken. Das einzige von mir auf dem Küchenschrank. Von mir, oder eher von meinem gespensterhaften Schatten, dessen Gesicht zur Hälfte von den Pausbacken Mehdis, meines kleinen Bruders, verdeckt wird.
Ich bin drei Jahre alt und drücke ihn fest an meine Brust, weil ich Angst habe, ihn zu zerbrechen. Um uns herum sieht man haufenweise Spielzeug, mit Helium gefüllte blaue Luftballons, bunte Girlanden und einen Stapel Babykleidung aus Baumwolle.
Mehdi, der heimliche Imam, auf den mein Vater seit Menschengedenken gewartet hatte, ist endlich da!
Ein Baby, das verwöhnt, bemuttert und wie ein Truthahn gemästet wird.
Mehdi, der auftaucht, um dich noch mehr verschwinden zu lassen.
In diesem Schatten habe ich mich entwickelt.
Im Schatten meines jüngeren Bruders, eines angehenden Mini-Despoten.
Ich weiß noch, wie man ihn mir in die Arme gedrückt hat, für das Foto auf der Geburtskarte, die man an die entfernten Cousins in Kalifornien schicken wollte. Das ist tatsächlich das einzige Mal gewesen, dass ich ihn auf dem Arm gehalten habe.
Mehdi wurde am 21. März 2009, dem persischen Neujahrstag, in der besten Privatklinik von Schiras geboren – kein Vergleich mit dem öffentlichen Krankenhaus, in dem ich zur Welt gekommen bin.
Die Feier zu seiner Geburt konnte es mit einer Hochzeitszeremonie aufnehmen. Genauso würde es bei seinem ersten, seinem zweiten, seinem dritten, und bei all seinen Geburtstagen sein … Ganz anders als bei meinen.
Während ich nicht einmal eine falsche Barbie wert bin und mit einer rosa Haarspange in einem Plastikbeutel abgespeist werde, bekommt er die kuscheligsten Plüschtiere und die allerneuesten ferngesteuerten Autos.
Während man für mich einen schäbigen Kuchen ohne Glasur kauft, verwöhnt man ihn mit einer mehrstöckigen, mit einer Manga-Figur dekorierten Torte, die im Voraus in der besten Konditorei der Stadt bestellt wurde.
Wenn er nach einem Eis verlangt, serviert ihm mein Vater automatisch drei Kugeln. Er darf sogar am Ende den Becher auslecken.
»Ich bin doch auch dein Kind!«
Eines Tages ist mir dieser Satz ganz unvermittelt aus dem Mund gesprudelt.
Es war am Tag vor den Ferien. Mehdi hatte gerade die importierten Turnschuhe geschenkt bekommen, von denen ich immer geträumt hatte, die man mir aber stets verweigerte. Ich war stinksauer!
Papa drehte sich um. Er sah mir eindringlich in die Augen und fuhr mich an:
»Hör auf mit deiner Eifersucht!«
Seine Worte trafen mich wie ein Keulenschlag.
In diesem Moment begriff ich es.
Ich begriff, welche Rolle man mir zugedacht hatte.
Bisher war ich nur ein Fehler gewesen.
Von nun an würde ich diejenige sein, die keinen Mucks macht, die schweigt.
Diejenige, die auf den Boden blickt.
Die nicht zu laut spricht.
Die sich nicht beschwert und nicht auffällt.
Diejenige, die ihren Cousins, ihren Onkeln, ihrem Vater und ihrem Großvater zuhört, aber selbst nie zu hören ist.
Außer für Mama zähle ich nicht.
Ich bin unsichtbar.
Wie auf dem Foto.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mein Vater mich einmal gefragt hat: »Wie geht es dir?«
Oder mich überhaupt irgendetwas gefragt hat.
Dafür erinnere ich mich ganz genau an eine Nacht, als ich vier Jahre alt war.
Schreie in der Ferne lassen mich aus dem Schlaf hochschrecken.
Stickige Hitze reizt meine Haut.
Mein Hals kratzt.
Meine Augen brennen.
Im Dunklen springe ich aus dem Bett und laufe aus meinem Zimmer.
Der Flur ist voller Rauch!
»Hilfe!«
Ich schreie ins Leere …
»Papa! Mama!«
Keine Antwort. Nicht einmal das Echo eines Schluchzers von Mehdi, der gewöhnlich bei ihnen schläft.
Eine Wand liegt zwischen meinem Zimmer und ihrem.
Ich trommle gegen ihre Tür, aber niemand reagiert.
Ich stelle mich auf die Zehenspitzen, um an den Türknauf heranzukommen. Er widersteht mir. Ich bin zu klein, um ihn zu drehen.
Vom Ende des Flurs stürzen Flammen auf mich zu.
Ich schwitze, habe das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen.
Ich verfluche diesen Tod, der es wirklich auf mich abgesehen hat.
Ich schreie immer lauter.
Ist da jemand, der mich hört und mir hilft?
Niemand. Niemand. Niemand.
Schließlich frage ich mich sogar, ob ich wirklich geschrien habe.
Ich versuche, im Flur ein paar Schritte vorzugehen.
Das Wohnzimmer ist unerreichbar: zu viele Flammen und zu viel Rauch.
Ich kann die Wohnungstür sehen. Sie steht einen Spalt breit offen.
Ich stürze los.
Ich renne die Treppe hinunter, barfuß, im Schlafanzug.
Draußen schlägt mir eisige Kälte ins Gesicht.
Ich reiße die Augen auf.
Mitten auf dem Bürgersteig, unter dem Blaulicht der Krankenwagen, haben sich, in Rettungsdecken eingewickelt, mein Bruder, meine Eltern und ein paar Nachbarn versammelt.
Mein Vater hebt den Kopf und dann eine Hand, als er mich auf sie zulaufen sieht.
Und er ruft: »Oh, verflixt, wir haben dich vergessen!«
Schon sehr früh in meinem Leben habe ich mich in diesem Vergessen herangebildet.
Ich habe gelernt, mich aufzuspalten, um zu existieren. Ich bin »ich«. Ich bin »du«. Zahra und Badjens zugleich. Zu zweit fühlt man sich besser. Man addiert sich, um das Weggenommene auszugleichen.
Soweit ich zurückdenken kann, ist die Schule der Ort gewesen, an dem ich mir diese doppelte Identität voll und ganz zu eigen gemacht habe.
Im Klassenzimmer muss man sich unter dem allgegenwärtigen Blick von Ayatollah Chomeini und Ali Chamenei, seinem Nachfolger mit dem schwarzen Turban, musterhaft verhalten.
Die beiden Gesichter sind bombensicher über der Tafel befestigt, so unverrückbar wie die Islamische Republik seit vier Jahrzehnten.
Frau Jamchidi, die Grundschullehrerin, spricht über sie, als wären sie Gottes Abgesandte auf Erden. Apropos Gott: Sie beendet keinen einzigen Satz ohne ihn. »So Gott will«, »Gott sei gelobt«, »Gott schütze dich«, »Möge Gott euch vergeben« … Frau Jamchidi trägt einen schwarzen Tschador über ihrem Maghnaʿeh, einem kapuzenähnlichen Kopftuch, das ihr Kinn fest umschließt und aus dem zwei schwarze Härchen herausschauen, wenn sie vergisst, sie herauszuzupfen. Sie trägt eine filigrane Brille und Socken mit Micky-Maus-Muster, die sie sympathisch machen, obwohl sie wie eine Predigerin aussieht.





























