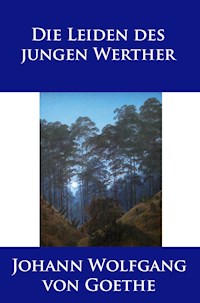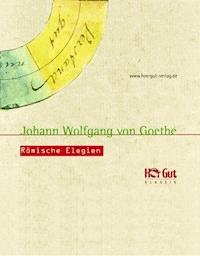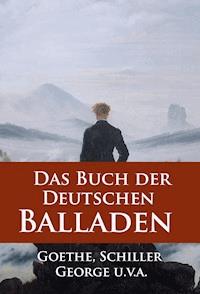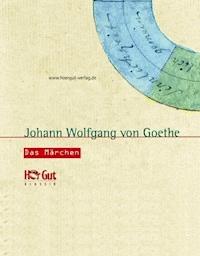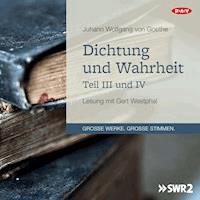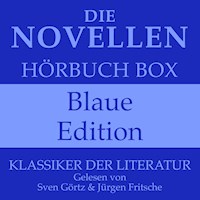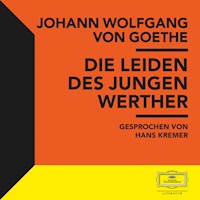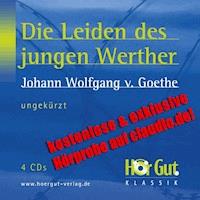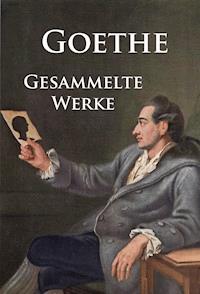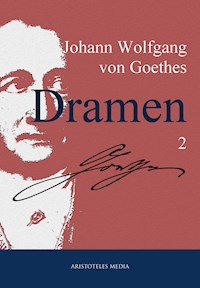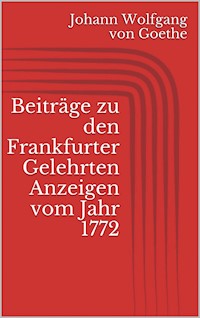
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Johann Wolfgang von Goethe (* 28. August 1749 in Frankfurt am Main als Johann Wolfgang Goethe; † 22. März 1832 in Weimar, geadelt 1782) gilt als einer der bedeutendsten Repräsentanten deutschsprachiger Dichtung. Goethe stammte aus einer angesehenen bürgerlichen Familie; sein Großvater mütterlicherseits war als Stadtschultheiß höchster Justizbeamter der Stadt Frankfurt, sein Vater Doktor der Rechte und kaiserlicher Rat. Er und seine Schwester Cornelia erfuhren eine aufwendige Ausbildung durch Hauslehrer. Dem Wunsch seines Vaters folgend studierte Goethe in Straßburg und Leipzig Rechtswissenschaft und war danach als Advokat in Wetzlar und Frankfurt tätig. Gleichzeitig folgte er seiner Neigung zur Dichtkunst, mit dem Drama "Götz von Berlichingen" erzielte er einen frühen Erfolg und Anerkennung in der literarischen Welt. Als Sechsundzwanzigjähriger wurde er an den Hof von Weimar eingeladen, wo er sich schließlich für den Rest seines Lebens niederließ. Er bekleidete dort als Freund und Minister des Herzogs Carl August politische und administrative Ämter und leitete ein Vierteljahrhundert das Hoftheater. Die amtliche Tätigkeit mit der Vernachlässigung seiner schöpferischen Fähigkeiten löste nach dem ersten Weimarer Jahrzehnt eine persönliche Krise aus, der sich Goethe durch die Flucht nach Italien entzog. Die zweijährige Italienreise empfand er wie eine "Wiedergeburt". Ihr verdankte er die Vollendung wichtiger Werke ("Tasso", "Iphigenie", "Egmont"). Nach seiner Rückkehr wurden seine Amtspflichten weitgehend auf repräsentative Aufgaben beschränkt. Der in Italien erlebte Reichtum an kulturellem Erbe stimulierte seine dichterische Produktion und die erotischen Erlebnisse mit einer jungen Römerin ließen ihn unmittelbar nach seiner Rückkehr eine dauerhafte, "unstandesgemäße" Liebesbeziehung zu Christiane Vulpius aufnehmen, die er erst achtzehn Jahre später mit einer Eheschließung amtlich legalisierte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Beiträge zu den Frankfurter Gelehrten Anzeigen vom Jahr 1772
Johann Wolfgang von Goethe
Beiträge zu den Frankfurter Gelehrten Anzeigen vom Jahr 1772
Wittenberg und Zerbst
Empfindsame Reisen durch Deutschland von S. 2ter Teil. Bei Zimmermann, 8. 22 Bog.
Aláss the poòr Yorick! Ich besuchte dein Grab, und fand, wie du auf dem Grabe deines Freundes Lorenzo, eine Distel, die ich noch nicht kannte, und ich gab ihr den Namen: Empfindsame Reisen durch Deutschland. Alles hat er dem guten Yorick geraubt, Speer, Helm und Lanze. Nur schade! inwendig steckt der Herr Präzeptor S. zu Magdeburg. Wir hofften noch immer von ihm, er würde den zweiten Ritt nicht wagen; allein eine freundschaftliche Stimme von den Ufern der Elbe, wie er sie nennt, hat ihm gesagt: er soll schwatzen. Wir raten es ihm als wahre Freunde nicht, ob wir gleich zu dem Scharfrichtergeschlecht gehören, mit denen er so viel im 1sten Kap. seines Traums zu tun hat. Ihm träumt, er werde aufgehängt werden neben Pennylaß! Wir als Polizeibediente des Literaturgerichts sprechen anders, und lassen den Herrn Präzeptor noch eine Weile beim Leben. Aber, ins neue Arbeitshaus muß er, wo alle unnütze und schwatzende Schriftsteller Morgenländische Radices raspeln, Varianten auslesen, Urkunden schaben, tironische Noten sortieren, Register zuschneiden und andre dergleichen nützliche Handarbeiten mehr tun.
Es ist alles unter der Kritik, und wir würden diese Makulaturbogen nur mit zwei Worten angezeigt haben, wenn es nicht Leute gäbe, die in ihren zarten Gewissen glauben, man müsse ein solches junges Genie nicht ersticken. Um unsern Lesern nur eine Probe zu geben, welche schwere Handtierung wir treiben, dem Publiko vorzulesen, so ziehen wir einige Stellen aus. Eine kindische Nachahmungssucht, die der Herr Präzeptor mit seinen Schülern in Imitationibus Ciceronianis et Curtianis nicht lächerlicher treiben kann, gibt den Schlüssel zu allen den Palliassestreichen, womit er seinem Meister Yorick vor unsern Augen nachhinkt. Yorick empfand, und dieser setzt sich hin zu empfinden; Yorick wird von seiner Laune ergriffen, weinte und lachte in einer Minute, und durch die Magie der Sympathie lachen und weinen wir mit; hier aber steht einer und überlegt: wie lache und weine ich? was werden die Leute sagen, wenn ich lache und weine? Was werden die Rezensenten sagen? Alle seine Geschöpfe sind aus der Luft gegriffen. Er hat nie geliebt und nie gehaßt, der gute Herr Präzeptor! Und wenn er uns eins von seinen Wesen soll handeln lassen, so greift er in die Tasche und gaukelt aus seinem Sacke was vor. Ein Pröbchen Yoricksche Apostrophe. Bei Gellerts Grab findet er in der Dämmerung seine Bäckerin wieder, die ihm ehemals den Dukaten geschenkt hatte. Hier ruft er aus: »Komm mit! Und warum komm? De Gustibus non est disputandum, könnte ich hier füglich antworten: aber ich will de gustibus disputieren um mein ganzes deutsches Vaterland, wenn es sich von einem jungen Menschen will belehren lassen – zu belehren, welch einen falschen und unrichtigen Gebrauch es von den Wörtern: Du, Er, Sie, Ihr, Sie, zu machen gewohnt ist. Überhaupt zu reden ist es seltsam und lächerlich, daß man sich durch ein Sie von andern muß multiplizieren lassen, so wie man selbst andere damit multiplizieren muß – – so wie es widersinnig ist, daß ich von jemanden, als von einer ganz fremden Person, spreche, den ich vor mir sehe, höre, – – und fühlen kann, wenn ich will – – Allein Deutschland weiß das so gut, wie ich, ohne es ändern zu können – Also muß ich davon schweigen. Um wie viel aber würde nicht das Übel vermindert werden, wenn man den Gebrauch der Wörter dergestalt fest setzte.« Er führt endlich die Bäckerin in sein Wirtshaus, und legt sie schlafen. Er erwacht sehr früh und hört den Hofhund bellen. »Das war mir unleidlich – – bei jedem Hau fürchtete ich, meine Mutter würde aus ihrem Schlaf auffahren – – Ich suchte in dem ganzen Zimmer nach einem Stück Brot herum. Nichts war zu finden – – Aber sollte denn ein Hundemagen nicht Biskuit verdauen können, dachte ich – und damit eilte ich mit einem großen Stück in der Hand nach dem Hofraume – – die Bestie wollte rasend werden, so bald sie mich erblickte. – – Das ist eine Bestieκατ έξοχην sagte ich, und damit ergriff ich in vollem Eifer den Stock und bläuete ihm Stillschweigen ein – – Laß es gut sein, redete ich ihn nach einigen Minuten abbittend an – – Ich will dir deine Schläge reichlich vergütigen – – Die arme Bestie krümmte sich jämmerlich – – Ich wünschte, daß ich ihm keinen Schlag gegeben hätte, oder daß mir der Hund wenigstens die Schläge zurückgeben könnte – – Aber dachte ich bei mir selbst, vielleicht verstellt sich das listige Tier nur! Nach seiner Höhe, Länge und Dicke zu rechnen, können ihm die paar Püffe, die ich ihm gegeben habe, unmöglich so wehe tun – Noch nie hat mein von der Wahrheit in die Enge getriebenes böses Gewissen eine so feine Ausflucht ersonnen.« (Ein schöner Pendant zu Yoricks Szene mit dem Mönch!) »Der Hund fuhr fort zu winseln – – hätte ich gestohlen, und man ertappte mich auf frischer Tat, so glaube ich immer es würde mir nicht ängstlicher zu Mute sein, als mir bei dem Lamento des Hundes war« – – Endlich wird der Hund mit Eau de Lavande begossen; – – denn der Herr Präzeptor sieht Blut – – »Der Hund ließ mit sich machen. Er roch den lieblichen Geruch des Wassers und leckte, und wedelte mit dem Schwanze – – Nun konnte ich mich nicht länger erhalten ihn zu streicheln, ob ich gleich für seinem Bisse noch nicht sicher war – – Eine so großmütige Überwindung des erlittenen Unrechts schien mir einer kleinen Gefahr mehr als zu würdig zu sein. Die Hundegeschichte hatte in meiner Seele eine kleine Säure zurück gelassen, die mit den Freuden schlechterdings inkompatibel war, die ich dem angebrochenen Tage bereits en gros bestimmt hatte. Ich suchte sie los zu werden, und folglich war ich sie auch schon halb los – – Es kam darauf an, daß sich meines Wirts Küchenmagd aus ihren Federn erhob. Sie tat es – – Ich überraschte sie in ihrem Neglige, und machte dadurch sie und mich so beschämt, daß ich ihr geschwind ein Stück Fleisch für den Hund abforderte« etc. etc. Der Mann hat auch ein Mädchen, die er seine Naive nennt, und er tut wohl daran, wie jener, der auf sein Schild zum Bären schrieb: das ist ein Bär. Ein Gemälde von der schönen Naiven! Sie fragt ihn, ob es sein Ernst sei, wenn er sagt daß sie ihn zum glücklichsten Sterblichen mache – – »Sie zog mich ans Fenster – – nickte mit dem Kopfe, daß ich mich bücken sollte – – ergriff mich mit beiden Händen bei dem Kinne – – drehte meinen Kopf langsam hin und her – – Ihre Augen fielen bald in die Fronte, bald in die Flanke der meinigen – – diese drehten sich allemal nach der Seite der Attaque.«
Von Wendungen eine Probe! »Jedoch ut Oratio mea redeat, unde – – O küssenswürdiger Cicero, durch dieses herrliche Kommandowort denke ich von meiner Abschweifung eben so geschwind wieder nach Hause zu kommen, als eine Kugel in die Köpfe der Feinde durch Tann, Tapp, Feuer.« – – Endlich bekommt der Verf. S. 73. ein ganzes Bataillon Kopfschmerzen, weil er was erfinden soll; und wir und unsere Leser klagen schon lange darüber.
Leipzig
Journal für die Liebhaber der Literatur. 2tes Stück, bei Christian Gottlob Hilscher, 8.
Schulübungen, und zwar von der elendesten! Virgil und Horaz werden in die schwerfälligste Prose zerstückt, und auf dem Sylbenmaß von Ramler und Zachariä die deutlichsten Worte hergezählt. Ich möchte nicht der Herr Senator Lochner in Görlitz sein, dem das Ding zugeschrieben wird.
Dresden und Leipzig
Thrasybulus. Oder von der Liebe zum Vaterlande. Bei Johann Nic. Gerlach Witwe und Sohn, 1771. 8. 56 S.
Eine Schulchrie, die ohngeachtet sie nur drei und einen halben Bogen beträgt, doch zum Durchlesen viel zu lang ist. Wir dachten indessen bei ihrem Anblick, da wir sahen daß sie gut gedruckt war, und eine saubere Vignette hatte, wie der Abbe Olivet, wann er mit allem seinem Enthusiasmus vor die Schönheiten der Alten, die Menge Menschen zu einer schlechten Tragödie stürzen sähe: Cela ne fait point de mal à personne.
Leipzig
Die Jägerin ein Gedicht. 1772
Der Rhein, ein Eichenwald, Hertha und Gefolge, dazu der Name Wonnebald charakterisieren es zum deutschen Gedicht. Wir erwarteten hier keine markige Natur unsrer Älterväter; aber auch nicht das geringste Wildschöne, trutz Titel und Vignette nicht einmal Waidmanns Kraft, das ist zu wenig. Des Dichters Wälder sind licht, wie ein Forst unsrer Kameralzeiten, und das Abenteuer verpflanztet ihr so glücklich in ein Besuchzimmer, als nach Frankreich. Auch hat der Mann gefühlt, daß seine Akkorde nicht mit Bardengewalt ans Herz reißen. Die spröde Kunigunde, der er lang sein Leidenschäftchen vorgeklimpert, schmilzt endlich und spricht: Ich liebte dich geheim schon längst! Notwendig zur Wahrscheinlichkeit der Entwicklung, nur kein Kompliment für die Harfe. Wir bedauern, daß der Dichter, wie noch mehr Deutsche, seinen Beruf verkannt hat. Er ist nicht für Wälder geboren. Und so wenig wir das Verfahren seines Hrn. Vaters billigen, der in dem angehängten Traumlied, mit leidiger Grabmisanthropie, ihm die Harfe zertritt; so sehr wir fühlen, daß sie das nicht verdient; so sehr wünschten wir, er möge sie gegen eine Zitter vertauschen, um uns, an einem schönen Abend, in freundlicher Watteauischer Versammlung, von Lieblichkeiten der Natur, von Niedlichkeiten der Empfindung vorzusingen. Er würde unsre Erwartung ausfüllen, und wir ihn mit gesellschaftlichem Freudedank belohnen.
Leipzig
Vermischtes Magazin eine Wochenschrift, bei Bischel, 1. Band 6 Stücke 8. 380. S.
Eine Gesellschaft von (vermutlich) Studenten, wirft hier die Mücken, die sie in ihren Nebenstunden mit Pfeilen erschossen haben, aus dem Fenster ins Publikum. Man kann es wirklich keinem Menschen übel nehmen, wenn er in den Stunden, da er sonst nichts getan hätte, Bücher schreibt; doch, wenn er es nicht besser macht, als die Verf. dieses Magazins, so raten wir ihm immer, sich einen andern Zeitvertreib zu suchen. Wenn man unter so vielen Steckenpferden zu wählen hat, so ist es in der Tat Eigensinn, gerade auf das zu steigen, welches nie so ganz Steckenpferd ist, um nicht auch oft den Reuter sehr unsanft abzuwerfen. Es kommen in diesem Magazin prosaische Verse, und gereimte Prosa, Satyren, Betrachtungen, Epigramme und sogar auch ein prosaisches Heldengedicht die Reformation vor, welches nebst allem übrigen, was wir die Geduld hatten zu lesen, unter der Kritik ist. Wir schweigen also davon – – Aber Eins müssen wir sagen, die Verfasser trotzen sehr auf ihren Eifer für die Religion. Wir loben sie deswegen; doch bitten wir sie zugleich, erst zu lernen, was Religion ist. Denn in allen ihren so genannten geistlichen Aufsätzen und Versen glimmt nicht ein Funken davon; und man ist endlich das Geleier von der Tugend und Religion überdrüssig, wo der Leiermann mehr nicht sagt als: wie schön ist die Tugend! wie schön ist die Religion! und wie ist die Tugend und Religion doch so schön! und was ist der für ein böser Mensch, der nicht laut schreit: sie ist schön u.s.w. Was tun die Leute, die so ohne Gefühl mit den heiligsten Dingen tändlen, was tun sie anders, als daß sie einem blauen Schmetterling nachlaufen? Und mit aller ihrer Schwärmerei werden sie doch keinen Pedrillo bekehren.
Leipzig
Ernst Christian Westphals, der Rechte und Philosophie Doktor und der erstem ordentlichen Professor, Versuch einer systematischen Erläuterung der sämtlichen römischen Gesetze vom Pfandrechte. In der Weygandischen Buchhandlung, 1770. 8. 456. S.
Herr W. wird uns verzeihen, wenn wir sein Buch nicht mit dem vollen Munde loben, wie andere Journalisten getan haben. Wir haben nun einmal so unsern eignen Kopf, und ein Mensch, der durch das Präjudiz des Journalistenansehens gefesselt wird, kommt uns gerade so lächerlich vor, als der Knabe, der sich von seinem Schulmeister zur Strafe mit einem Faden Zwirn an den Ofen binden läßt; doch zur Sache. Das Buch besteht aus Text und Noten. Der Text ist eine systematische Abhandlung vom Pfandkontrakt und Pfandrecht. In den Noten werden die Sätze des Textes mit Gesetzen dokumentiert, die der V. wörtlich anführt, auch größtenteils erläutert, so daß man die sämtlichen Gesetze aus dem corpore juris vom Pfandrecht auch die fugitiven, hier beisammen findet. Die systematische Abhandlung ist nicht übel; aber, die Erläuterung der Gesetze nicht selten sehr seicht und unzulänglich. Und dies war kein Wunder! Die literarischen Kenntnisse des Verf. waren, als er das Buch schrieb, höchst eingeschränkt. Er kannte beinahe keine kritische Schriftsteller, als den Cujaz und Anton Faber (welchen letzten er in Parenthesi zu merken, für den Autor der Semestrium hält, s. die Einleitung auf dem vierten Blatte.) Als er mit seiner Arbeit fertig war, lehrte ihn Hommels corpus juris cum notis variorum, daß es auch noch andere Kommentatoren über die Gesetze vom Pfandrecht gibt. Er brachte also die Erklärungen, die er hier noch kennen lernte, zu großer Beschwerlichkeit des Lesers in einen Anhang. Was aber Hommel nicht angeführt hat, kennt auch Herr W. nicht. Beyma der doch über die sämtlichen Titel der Pandekte und des Codicis vom Pfandrechte kommentiert und ebenfalls alle einzelne Gesetze erläutert hat, ist ihm ein unbekannter Mann. Bei dem L. 8. quibus in causis hätte billig Herr von Lüttichau angeführt werden sollen. Doch wer kann die Unterlassungssünden unsers Verf. alle zählen? Will man eine Probe von seiner Denkart haben, so lese man die erste Stelle, die uns auffällt, Seite 149. Wenn die Frage zu beantworten ist: Was hat ein Mündel für ein Recht auf eine Sache, die mit seinem Gelde erkauft worden ist? so ist ein Unterschied zu machen, ob jemand mit dem Gelde, das dem Pflegbefohlnen noch eigen war, gekauft, oder ob der Pupill jemanden Geld zur Erkaufung einer Sache vorgestreckt hat. Im ersten Falle hat entweder der Vormund oder ein anderer, der das Geld des Pupillen in Händen hat, etwas damit für sich erkauft. Hat der Vormund gekauft: so kommt dem Pupillen eine stillschweigende privilegierte Hypothek, auch utilis actio ad vindicandum zu; sie entstehe nun aus einem Eigentum, wie einige wollen, oder unmittelbar aus der Billigkeit, wie andere glauben. Hat ein anderermit des Pupillen Geld etwas für sich erkauft, so muß man billig ein gleiches behaupten. Leihet endlich der Pupill Geld zu Erkaufung einer Sache weg: so findet das gemeine Recht statt, er hat keine Legalhypothek, aber sein Pfandrecht ist privilegiert, wenn er sich ausdrücklich eins geben läßt. So denken wir uns die Sache in ihrer Ordnung. Nun lese man unsern V. im angeführten Ort, und urteile! Nur etwas aus dieser Stelle anzuführen. »Das letztere Gesetz (L. 7. pr. qui pot. in pign.) sagt er, erklärt man gemeiniglich von dem Fall, da der Ankauf mit des Mündels Gelde nicht von dem Vormunde sondern von einem dritten geschehen. Man behauptet, daß auch in diesem Falle ein Unmündiger eine stillschweigende Hypothek habe. Der Beweis aber ist sehr schwach, (Wir dächten nicht.) Wenn die Absicht des Gesetzes wäre, dem Mündel ein stillschweigendes Pfandrecht in diesem Falle zu erteilen: so gehörte es unter den Titel In quibus caus. pign. nicht aber unter den, worunter es steht.« (ein seltsames Argument! Das Pfandrecht von dem wir reden ist ein stillschweigendes privilegiertes. Warum konnte denn davon nicht im Titel qui potiores in pign. geredet werden?) »Überdem ist es aus dem 3. Buch der Disputationen des Ulpians genommen, in welchem nicht von stillschweigenden Hypotheken, sondern von der Rangordnung der Gläubiger geredet worden. (Aus gleichem Grunde schwach!) Außerdem ist auch mit keinem Wort eines dritten Mannes, der die Gelder des Pupillen verwendet hätte, gedacht.« Eben darum weil das Gesetz ganz allgemein sagt: si nummis pupillorum res comparata, so kann man keinen Unterschied machen, ob der Vormund oder ein anderer die Gelder des Mündels verwendet hat. Wir müssen aus Mangel des Raums abbrechen. Kurz, Reichtum an Begriffen hat unser Autor, aber sie sind oft nicht tief eindringend, nicht gründlich genug. Und lucidus ordo? Nun, man lese das Buch und fühle sich an die Stirne!
Kupferstiche
Les douceurs de l'Eté von Moitte nach Boucher in einem ovalklein Folio. Die schönste Bouchersche Figur, die nackend da sitzt wie sie aus dem Bade kommt, und sich von der Aufwärterin abtrocknen läßt. Auf einem Piedestal sieht man zween Jungen, die mit einem Ziegenbock spielen. Die Aussicht ist ganz mit Gesträuch geschlossen.
Le Fanal exhaussé. Eins der trefflichsten Blätter Vernets von Willem Byrne gestochen. Sechs der schönsten Vernetschen Figuren ziehen eine Schaluppe mit allen Kräften ans Land. Das Meer ist in voller Bewegung, und man sieht aus der Angst der am Ufer stehenden Personen, und einem Schiffe, das in Gefahr ist, wie notwendig die Errichtung des Leuchtturms war, von dem das Blatt den Namen führt. Das linke Ufer, wo er auf einer Anhöhe steht, ist mit den schönsten Ruinen bedeckt.
Cassel
Carl Philipp Kopps, Fürstlich Hessen-Casselischen Oberappellationsgerichtsrats, ausführliche Nachricht von der älteren und neueren Verfassung der geistlichen und Zivilgerichte in den Fürstl. Hessen-Casselischen Landen. Erster oder historischer Teil. Im Verlag bei Johann Jacob Cramer, 1769. 4. 4½ Alph. Anderer oder praktischer Teil. Ebendaselbst 1771. 4. 2½ Alph.
Ein klassisches Werk, das einen wahren Kenner der vaterländischen Rechte ankündigt; einen Mann, der nicht gleich manchen, si dis placet! herrlichen Germanisten, aus Hert, Senkenberg, Grupen, Dreyer, Olenschlager, wie die Apotheker eine Mixtur aus Gläsern und Büchsen, sein Buch zusammen geschüttet hat; einen Mann, der aus den Quellen, den ehrwürdigen deutschen Rechtsbüchern, aus der Geschichte, aus Urkunden geschöpft hat; der Forscher und Denker ist, der mit seiner Belesenheit den Leser unterrichtet und unterhält, ihn nicht ermüdet und zerstreut, ihm nicht den Wunsch auspreßt: O daß doch der Mann nicht so gelehrt sein möchte! Man wird in einer gelehrten Zeitung weiter nichts als eine kurze Anzeige des Inhalts erwarten. Der erste Band besteht aus 4 Stücken. Das erste enthält eine Geschichte des Hessischen Landrechts in den mittleren Zeiten. Hessen war in zwei pagos, den Sächsischen und Fränkischen eingeteilt; im ersten galt Sächsisches, im letzten Kaiserrecht und Schwabenspiegel. Gegen das Ende des 15. Jahrhunderts wurde das römische Recht in den hessischen weltlichen Gerichten eingeführt. Das zweite Stück handelt von der Gerichtsbarkeit der Bischöfe in weltlichen Sachen und ihren weltlichen Gerichten; von deren Jurisdiktion in geistlichen Sachen; von den Sandgerichten, den Eingriffen der geistlichen Gerichte in die weltliche Gerichtsbarkeit der Stände. Überall wird die Beschaffenheit dieser Dinge besonders in der Maynzischen Diöces, und am Ende die Verfassung der geistlichen Gerichte in Hessen gezeigt. Drittes Stück von den Grafschaften und Centen in Hessen, den Landgerichten und der Landgräflichen obersten Gerichtbarkeit; von den Centgerichten, Stadtgerichten, Oberhöfen, von einigen Partikulargerichten; von den Friedensgerichten, Gastgerichten. Viertes Stück von den Prozessen in den alten Hessischen Gerichten. Den Beschluß dieses Bandes macht ein Anhang von wichtigen und instruktiven noch ungedruckten Dokumenten. Der zweite Band zeigt die jetzige Verfassung der Hessischen Gerichte. Man suche hier keine Kompilation aus Brunnemann, Stryk, Ludovici etc. mit Hessischen Verordnungen verbrämt. Nur allein die Hessischen Gesetze über den Prozeß sind epitomiert, digeriert und in ein System gebracht. Die Verschiedenheit des gerichtlichen Verfahrens bei den Untergerichten, Regierungen, geistlichen Konsistorien und dem Oberappellationsgericht macht, daß dieser Teil in 4 Bücher zerfällt – – Möchten doch mehrere Patrioten durch dieses Beispiel gereizt, die Gerichtsverfassung ihres Vaterlandes so vortrefflich als Herr Kopp des seinigen beschreiben!
Pressburg
Neue Schauspiele aufgeführt in den Kaiserl. Königl. Theatern zu Wien. Erster Band, 8. 1 Alph. 2 Bog.
Diese Sammlung enthält fünf Drame, oder Schauspiele, oder Lustspiele, oder Trauerspiele – – die Verf. wissen so wenig als wir, was sie daraus machen sollen, aus der Wiener Manufaktur. In allen hat tragikomische Tugend, Großmut und Zärtlichkeit so viel zu schwatzen, daß der gesunde Menschenverstand und die Natur nicht zum Wort kommen können. Hier ist der Inhalt der Stücke; denn wir wollen sie nicht umsonst gelesen haben. Die Kriegsgefangnen: wenn nicht die Festung gerade in dem letzten Auftritt der letzten Handlung glücklich an die Freunde der Kriegsgefangnen übergegangen wäre; so hätte ein entlaufner Feldwebel einen Haufen sehr moralisch sententiöser Leute, wider seinen Willen und wider alle Theatergerechtigkeit, an den Galgen gebracht. Gräfin Tarnow: Zwei entsetzlich Verliebte wären nimmermehr ein Paar geworden, wenn nicht durch eine gewisse Exzellenz ein Wunder geschehen wäre, dergleichen nur auf der Wiener Nationalschaubühne erhört worden sind. Schade, daß die Exzellenz einen Schuß bekommt! Doch nicht Schade, sie wäre sonst am Ende der Welt gewesen, ehe das Wunder zu Stand gekommen wäre, und dann weiß der Himmel, wie die Verliebten geheult haben würden.
Hanchen