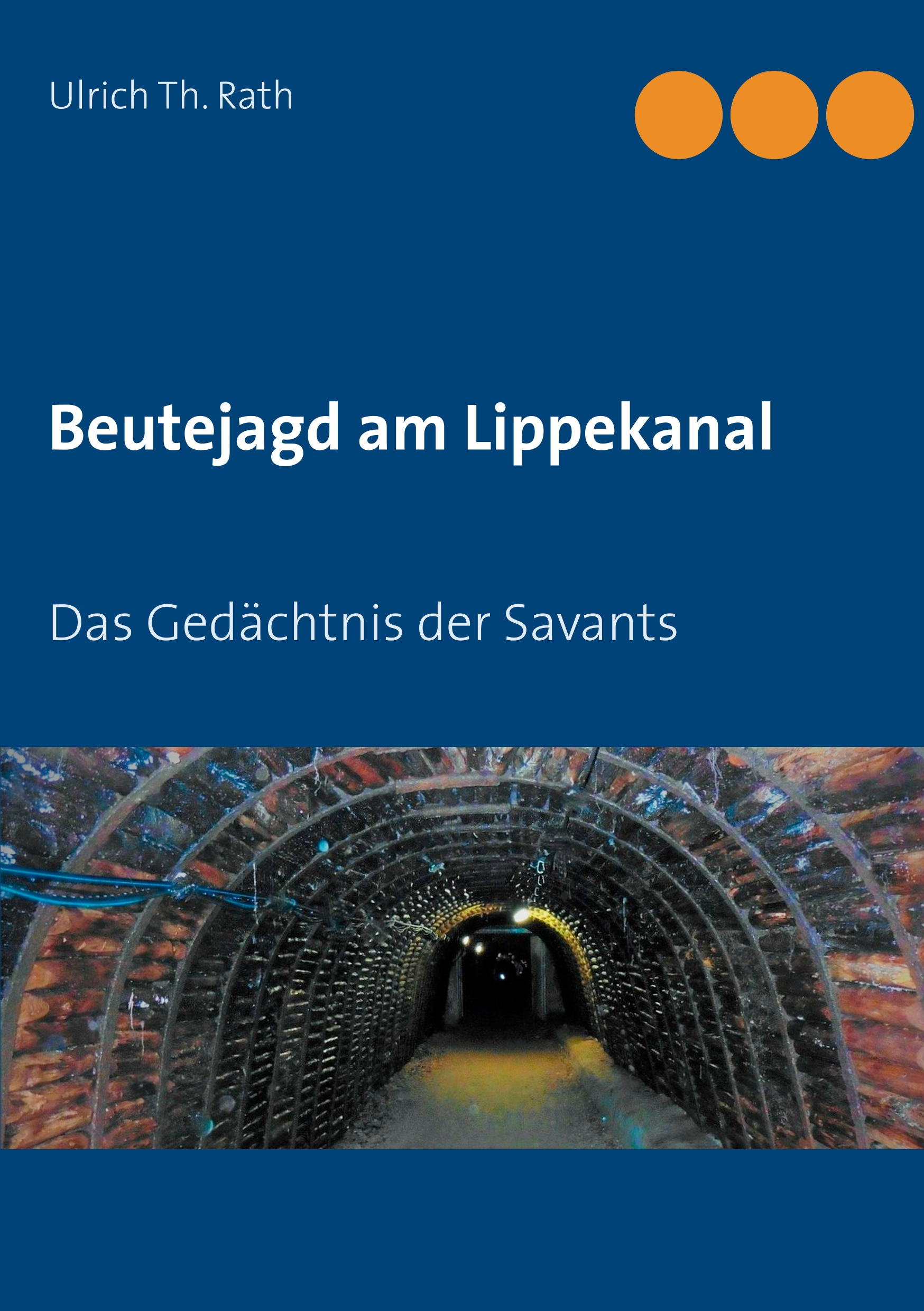
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Clemens Brann, früherer Architekt, war nach einem Unfall zum Sprachgenie geworden. Seine Freundin, die Ärztin Sarah Blum, hat sich auf die Erforschung solcher rätselhaften Sonderbegabungen ("Savant-Syndrom") spezialisiert. Bei ihren Forschungen stößt sie auf den russischen Gedächtnis-Savant Scherschewski, dessen Erinnerungsvermögen in den 20er Jahren des 20. Jahrhundert für Aufsehen sorgte. Mit ihrer Arbeit sticht Sarah Blum ungewollt in ein Wespennest. Hoch geheime Vorgänge aus den Schlussmonaten des Weltkriegs kochen empor. Eines der Drehkreuze dieser Geheimaktionen war die Stadt Dorsten. Schritt für Schritt kommen Sarah Blum und ihre Freunde der Entzifferung der düsteren Geheimnisse auf die Spur. Aber sie geraten dabei in höchste Gefahr. War die Suche das wert?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel: And the Healing has Begun
Kapitel: Rekonstruktion
Kapitel: Enigma
Kapitel: Des toten Mannes Kiste
Epilog
VORWORT
Schon seit langen Zeiten hören wir von Menschen, die ihre Zeitgenossen zum Staunen brachten mit ihren ganz ungewöhnlichen Fähigkeiten und Talenten. Im alten Griechenland schuf der geniale Archimedes beinahe im Alleingang die Grundlagen der Physik und gab den Menschen mit seiner Schraube die erste wirksame Wasserpumpe (unter anderem). Als Einzelner legte der persische Arzt Ibn Sina (Avicenna) um 1.000 n. Chr. die Korsettstangen der modernen Medizin. Das Jahrtausendgenie Leonardo erkundete vor über 500 Jahren die Geheimnisse der Perspektive, des Vogelflugs und der Anatomie und schenkte der Menschheit Gemälde und Zeichnungen für die Ewigkeit.
Musikgenie Mozart und Schachgenie Bobby Fischer, Mathematiker wie Gauss, Leibniz, aber auch Sprachwunder wie Kardinal Mezzofante und Emil Krebs gehören zu diesen merk-würdigen Menschen – aber auch ein Alan Turing ist zu nennen, der mit der Entschlüsselung der deutschen Enigma für Großbritannien den Weltkrieg (mit)gewann und nebenbei die Basis unseres Computerzeitalters legte. Sie alle leisteten Dinge, die jenseits normaler menschlicher Vorstellungskraft liegen. Gemeinsam ist diesen sog. Savants ein gerüttelt Maß an Eigenwilligkeit und ein schwieriger sozialer Umgang.
In diesem Roman geht es unter anderem um das Gedächtnisgenie Solomon Schereschewski, dessen Biografie ich in diesem Roman neu entfalte. Schereschewski litt unter seiner Sonderbegabung. Er war tatsächlich auf der Suche nach dem „Radiergummi“, mit dem er die ihn quälenden Erinnerungsbilder tilgen könnte. Schereschewski soll in einer russischen Psychiatrie verstorben sein. Genaueres ist aber eher unklar.
Am Ende fragt man sich vielleicht, was an der Geschichte mit den Nazi-Raub-Schätzen dran ist. Klar ist, dass etliche Nazigrößen in den besetzten Gebieten nach Kunst- und anderen Schätzen suchten und diese systematisch beiseiteschafften. Man hört des Öfteren, dass diese Preziosen in irgendwelchen Verstecken im Osten gelandet seien. Diese Annahme erscheint mir ziemlich unlogisch. Denn es gab angesichts der sich abzeichnenden Niederlage für die Nazisherrscher nur ein einziges Hoffnungs-Fünkchen: Dass am Ende die Briten und Amerikaner doch noch umschwenken würden, um gemeinsam mit Nazi-Deutschland gegen den Bolschewismus zu kämpfen.
Solche utopischen Vorstellungen hatte selbst Hitler noch im April 1945 im Kopf. Warum sollten dann die Raub-Schätze (quasi die Morgengabe der Nazis) ausgerechnet in Richtung der nach Berlin vordringenden Rote Armee geschafft worden sein?
Ich danke allen, die mir bei der Arbeit an diesem Buch geholfen haben.
Ich danke meinem Freund Jürgen Miehl für sein geduldiges Zuhören und seine Anregungen. Ich danke vor allem meiner lieben Frau Gabi, die diesen Roman nicht nur durch ihre umfassende Lektoratsarbeiten begleitete und stilistisch Vieles glättete. Vielen Dank auch für viele kluge Rückmeldungen und Hinweise auf den Verlauf der Geschichte.
Selbstredend gehen alle historischen, biografischen und sachlichen Fehler und Irrtümer allein auf meine Rechnung.
Castrop-Rauxel, 11. Januar 2020
Ulrich Th. Rath
1. Kapitel:
And the Healing has Begun
Schnurgerade führt der - ein wenig unterhalb der energisch vor sich hin mäandernden Lippe gelegene – Dorstener Kanal von seiner Rheinmündung bei Voerde landeinwärts bis zum Kanalkreuz bei Datteln – sauber ausgerichtet von West nach Ost. Seit seinem Bau nach dem Ersten Weltkrieg gehört dieser Kanal zu den verkehrsreichsten deutschen Wasserstraßen. 25 km vor der Rheinmündung öffnet sich vor der imposanten Doppelschleuse die prachtvolle Kanal-Promenade der »kleinen Hansestadt an der Lippe« mit der großzügig angelegten Wohn- und Einkaufszone am Uferpark. Auch wenn die ehrgeizige Stadtkernsanierung anfangs heftig umstritten war – schon kurz nach ihrem Abschluss sind Promenade und Kanalzentrum allerseits beliebt, und das nicht zu Unrecht: Schließlich ist die Dorstener Altstadt in einem kühnen städtebaulichen Entwurf mit der schmalen Insel zwischen Lippe und Kanal verbunden worden. Man sagt mitunter, das Städtchen atme seither ein gewisses venezianisches Flair. In historischen – mittelalterlichen – Zeiten hatte die Stadt Dorsten die erste Querung über die Lippe östlich von Wesel geboten und beherrschte damit die wichtige Straßenverbindung. Von diesem strategischen Punkt aus ließ Napoleon deshalb einen seiner schnurgeraden Wege Richtung Norden anlegen; die neue urbane Mitte Dorstens liegt nun symbolträchtig neben dem Kreuzungspunkt dieser beiden geradlinigen Verkehrswege.
Und er hat einiges gesehen, der hundertjährige Kanal. Er hat sich gefreut, seinen Anrainern in Sommerzeiten zur Abkühlung dienen zu können, und er hat sich gefreut mit den jungen Pärchen, die – begleitet vom leisen Rhythmus seiner Wellen - zueinander fanden. Er freut sich bis heute darüber, Lebensader der Region zu sein. Manchmal grummelt er leise im Moosgrün seiner Ufersteine. Er denkt dann an die übermütigen Jungs, die er nach ihrem allzu mutigen Sprung in sein kaltes Wasser später im Rollstuhl wiedersah. Und er denkt voller Wehmut an die beiden dummen Knaben, die ihren Mut sogar mit ihrem jungen Leben bezahlt haben. Wenn Anfang des Winters die Wasser dunkler werden und die Schiffswellen an den stählernen Wänden in Moll-Tönen versinken, dann denkt unser alter Kanal traurig zurück an die Zeit, als er dreimal auslief, nachdem seine Deiche von Fliegerbomben getroffen wurden. Ein wenig zornig erinnert er sich an jene dämlichen Sprengarbeiten auf seiner Lippe-Insel, in jenem Jahr vor Weihnachten, kurz bevor die Altstadt in Schutt und Asche gelegt wurde. 1944 muss das gewesen sein. Und traurig hört er dann die Seufzer der armen Menschen, die während des Krieges auf der lang gestreckten Lippe-Insel zusammengepfercht und dann, nach den brutalen Arbeitseinsätzen in Viehwaggons wegtransportiert wurden. Er hatte schon vermutet, dass sie einem bösen Ende zugeführt wurden, und die Berichte der Waggons bestätigten seine schlimmsten Befürchtungen. Das war genau das, wozu diese Kommandeure, die stets so laut und böse auftraten, fähig waren. Bei solchen Gedanken gluckerte das Wasser seufzend aus den grünen Tiefen. Ach, wie gerne wäre er dann ein Meer gewesen und hätte dieser Bande eine Sturmflut geschickt!
Für die meisten heutigen Dorstener sind die Erinnerungen des alten Kanals aber nicht viel mehr als verblichene Reminiszenzen einer letztlich doch noch glücklich überstandenen Zeit. Kaum einer sieht heute hinter den Fassaden der modernen Altstadt noch die alten Fachwerklinien, - und wer - außer dem alten Kanal - denkt noch an die Sklavenarbeit, die von den bedauernswerten „Fremdarbeitern“ und Kriegsgefangenen bis zu ihrem Tod zu verrichten war?
Nein, heute sind die mühsam ausgetretenen Pfade der Gefangenen auf der langgezogenen Insel zwischen dem Kanal und dem Lippefluss längst zu beliebten Flanier-, Spazier- und Fahrradwegen geworden. Vor allem aber sind sie auch zu unschätzbar bequemen und angenehmen Verbindungen zum Arbeitsplatz geworden. Und nicht wenige der Bewohner um Schiffbauerdamm, Kanal- und Lippepromenade sind gerade wegen der fahrradgünstigen und fußläufigen Lage an die neu entstandene Grachtenlandschaft um den Lippe-Ufer-Park hierhergezogen.
,Wie kann man den Arbeitstag schöner beginnen als mit einem Spaziergang am Wasser?’ dieser Philosophie folgen seit der Fertigstellung des neu entstandenen Dorstener Kanal-Viertels etliche städtische Bedienstete. Ebenso gern lassen sich viele der Angestellten der innerstädtischen Geschäfte und etliche Mitarbeiter des Dorstener Krankenhauses von dem Charme dieser Stecke einfangen.
Auch die 38-jährige Ärztin Sarah Blum genoss an diesem Frühsommer-Morgen ihren fußläufigen Weg zur St.-Jakobus-Klinik. Schon seit fünf Jahren genießt sie die frische Morgenluft auf ihrem Arbeitsweg. Sarah konnte als eine ausgesprochene Schönheit gelten, besonders wenn sie ihre großen ausdruckvollen Augen in die Ferne schweifen ließ und ihre Mundwinkel zu einem warmen Lächeln nach oben zog. Ihre dunkle Haartracht ringelte sich am Ende an den Schultern sanft ein, was ihr ein leicht madonnenhaftes Aussehen gab. Mit ihren schmalen Händen unterstrich sie selbst beim Gehen die fließenden Bewegungen ihrer schmalen und ausgesprochen sportlichen Figur. Sarah war sich durchaus bewusst, dass ihr Äußeres und vor allem der tiefe Augenausdruck ihr dabei halfen, einen raschen und vertrauensvollen Kontakt zu ihren Patienten aufzubauen. Und sie hatte es in ihren Krankenhausjahren wohl gelernt, ihre aparte Erscheinung durch wohlgesetzte feminine Techniken in Geltung zu bringen.
Ansonsten hielt Sarah große Stücke auf modische Bescheidenheit. Letztlich unterstrich sie hierdurch nur ihre angeborene (vielleicht aber von ihrer Großmutter ererbte) Fähigkeit, sich dezent und geschmackvoll zu kleiden. Der Assistent ihres Prüfungs-Professors hatte ihr einmal prophezeit, ihre „auffällig unauffällige Art“ sei der Garant für ihre Karriere, ein Spruch, der im Freundeskreis schnell herumging und sie bis heute verfolgte. Aber sie blieb ihrem persönlichen Stil in Kleidung und Aufmachung treu: Irgendwie elegant, aber fern von den angesagten Trends der Saison.
Es waren meistens dieselben Leute, die ihr entgegenkamen. Man grüßte einander mit einem freundlichen Blick des Wiedererkennens und murmelte manchmal einen Guten-Morgen-Gruß.
Sarah war nun schon in Sichtweite der Klinik gekommen, als sie auf eine Frau aufmerksam wurde, die ihr schnellen Schritts entgegenkam. Es dauerte eine kleine Weile, bis Sarah bemerkte, wie bekannt ihr die Gestalt in der hellen Lederjacke vorkam. Sarah stutzte, als sie die rote Haarmähne bemerkte, die unter einem karierten Käppi hervorquoll, aber erst, als die Frau ihre Hand hob und Sarah entgegenwinkte, fiel bei Sarah der Groschen: „Gunda!“, rief sie laut aus, „Mensch, ich dachte du wärst noch bis zum Sommer in Irland!“ Tatsächlich war es Sarahs alte Schulfreundin Gunda-Lena, die Sarah auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit abgefangen hatte.
„Ich bin schon seit zwei Wochen wieder hier!“, erklärte Gunda und schüttelte so heftig den Kopf, dass ihre Bob-Marley-Mütze auf die Seite rutschte. „Nee, der Job war nicht das Richtige für mich!“.
Ihre Freundschaft pflegten Gunda-Lena Barberini und Sarah Blum schon seit Grundschultagen. Es mochten Monate und manchmal sogar anderthalb oder zwei Jahre ohne jeden Kontakt zwischen ihnen verstreichen. Aber wenn sie wieder zusammentrafen, dann waren sie sofort wieder ein Herz und eine Seele. Das heißt nicht, dass sie immer in völligem Gleichklang tickten: Nein, es waren gerade die Spannungen zwischen Herz und Seele, die ihrer Freundschaft Würze und Tiefe gaben.
Bevor Sarah nachfragen konnte, sprudelte es aus Gunda: „Der Typ bei der Zeitung in Dublin, der schien ja auch wirklich ganz nett, aber kannst du dir vorstellen, der wollte mir schon am ersten Abend an die Wäsche. Und am übernächsten Abend im Pub, da kommt so der Möchte-Gern-Chef mit exakt der gleichen Masche. Ich weiß nicht, sende ich immer falsche Signale aus?“
Sarah blickte Gunda an – sie war nach der überraschenden Begegnung und dem Wortschwall einfach nur perplex. Aber Gunda lachte kurz auf: „Ok, brauchst gar nicht weiter zu überlegen, wie du es sagen sollst. Hab´ schon verstanden, die Antwort ist: JA!“ Sarah verzog ihren Mund zu einem leichten Grinsen. Über dieses Thema hatten sie schon des Öfteren gesprochen. „Aber sag mal, Gunda, du bist mir ja nicht so einfach über den Weg gelaufen.“ Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. „Ich habe noch zehn Minuten Zeit, ich muss dann die Schicht übernehmen. Also: Was gibt´s?“
„Na ja,“ beeilte sich Gunda zu sagen. „Wie weit bist du denn mit deinem Projekt in Nancy? Das hast du doch im März auf diesem Hirnforschungs-Kongress in Wien vorgestellt! Ich steh so ein bisschen auf dem Schlauch, finanziell, und zufällig“ – Gunda betonte dieses Wort recht stark – „zufällig weiß ich, dass die „Allgemeine“ fürs nächste Wochenende eine Wissenschaftsseite über die Forschungs-Landschaft im Ruhrgebiet macht. Redaktionsschluss ist morgen 16.00 Uhr. Ich könnte da noch einen Beitrag über dein Projekt unterbringen. Ich dachte an ein Interview. Ganz einfach! Nur so ein paar Informationen, die eigentlich alle schon wissen.“
Sarah wiegte zweifelnd den Kopf. „Ich möchte eigentlich …“ Gunda-Lena fuhr dazwischen: „Ich verstehe, jetzt hast du ja keine Zeit, stimmt´s. Wie wäre es mit heute Abend? Ich würde dann schon mal was vorbereiten.“
Sarah blickte noch einmal auf die Uhr. „Nu gut, aber ich muss wirklich los. Ich kann den Kollegen nicht warten lassen. Komm am besten nach sieben am Abend vorbei. Ich bin dann zu Hause.“ Gunda-Lena nickte, erkennbar zufrieden. „Und mhm,“, fuhr sie halb-fragend, halb-suggestiv fort, „Gnocchi mit Tintenfisch?!“
Sarah nickte, ein wenig zögerlich. Hatte Gunda-Lena sie wieder einmal über den Tisch gezogen? „Ich bringe alles mit. Dann bis nachher.“
Und, mal unter uns gesprochen, liebe Leser: Gnocchi mit Tintenfisch, das ist wahrscheinlich kein schlechter Beginn für eine schwierige Geschichte.
Am Abend trafen sich die beiden Freundinnen, wie sie es verabredet hatten. Gunda-Lena entlockte Sarah ein paar Details zu dem Projekt, das ihr ab dem Herbst ein lukratives Forschungs-Stipendium in Nancy bringen sollte.
Es wurde, wie so häufig, ein langer Abend. Gemeinsam bereiteten sie ihre Gnocchi zu (ein altes Rezept von Gundas italienischer Mama). Während des Essens hatte Gunda die Gelegenheit, in ihrer unkomplizierten Art von ihrem Abenteuer in Dublin zu berichten. Da sie dabei ihr Essbesteck in der Hand hielt, wirkte ihre Erzählung nicht ganz ungefährlich. Sie hatte sich eine Stelle bei einer kleinen Zeitung gesucht und war zunächst freundlich empfangen worden. „Ich sollte zuerst dem Wirtschafts-Redakteur zuarbeiten. Der hat mich am Abend in einen Pub eingeladen, das war zuerst auch ganz nett.“ Die Gabel in der rechten Hand pointierte die Hauptbegriffe. „Dann kam der mit einer traurigen Geschichte von seiner Schwester, und wie er so erzählte, wurde er immer trübsinniger. Ich blöde Kuh habe mit großen Augen zugehört und ihn getröstet. Er wollte mich dann ins Hotel fahren und na ja, er war so traurig mit seinen Hundeaugen. Und als er mir dann vorgeschlagen hat, bei ihm noch einen Whisky zu trinken, bin ich mitgegangen.“ Gunda blickte Sara kurz an, die murmelte etwas von „Hundeaugen“. Gunda legte die Gabel auf den Tisch, nahm das Rotweinglas und kippte den Inhalt entschlossen hinunter. „Das Bekloppte war: Zwei Tage danach war ich abends mit dem Sportredakteur unterwegs. Es wurde später und er meinte, wir sollten doch in einem Pub zu Abend essen. Und was glaubst du? Der führte mich in das Lokal von vor zwei Tagen. Dass wir nicht auf denselben Plätzen saßen, war reiner Zufall. Aber kaum sitzen wir da, da fängt der an und erzählt was von seiner armen Schwester. Das war Wort für Wort die gleiche Leier wie die von dem Wirtschaftler. Und das lief dann ab wie eine billige Kopie. Ich dachte mir `Gunda, das Spielchen machst du mal mit. Mal sehen, wo es endet`.“
Sarah hörte Gunda aufmerksam zu. Sie hielt eine vorsichtige Distanz, denn Gunda erzählte nicht nur mit ihrem Mund, sondern mit Armen, Händen und manchmal auch mit den Füßen. „Der hat für seine“, hier hob Gunda bedrohlich ihre Stimme, „Verführungs-Schmeicheleien“, sie stockte, „exakt, Wort für Wort und Geste für Geste eine Kopie des Kollegen abgeliefert“. Heftig atmete Gunda aus. Sie war aufgestanden und baute sich, die Hand in ihre Hüfte gestemmt, bedrohlich vor Sarah auf. „Ich hatte da“, sie hob ihre Stimme, „zufällig“, nach einer kurzen Pause fuhr sie fort, „meinen Schlüssel in der Hand. Ich muss ihm dabei – zufällig – zu nahe gekommen sein. Jedenfalls kam er am nächsten Morgen mit einem ordentlichen Verband in die Redaktion.“ Sarah lachte aus vollem Herzen. Sie kannte die Freundin mit ihrer impulsiven Spontaneität und konnte die Szene vor ihrem inneren Auge leicht abspielen.
„Ich war eine halbe Stunde vor ihm da und hatte den Wirtschaftler zusammengefaltet. Der war klein wie eine Maus. Der hat mich sogar noch zum Hotel und dann zum Flughafen gefahren. Ich glaube, die waren ganz froh, als sie mich wieder los waren.“
„Das kann ich sehr gut nachvollziehen,“ lachte Sarah, mit Tränen in den Augen.
Später klagte Sarah der Freundin ihr Leid mit Clemens Brann, der in Personalunion die Rollen des Lebensgefährten und des Forschungsobjektes ausfüllte. In der letzten Zeit hatte sich ihr Verhältnis merklich verschlechtert.
Dafür stünde ihr Projektantrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft vor der Bewilligung. Zunächst einmal Junior-Professorin in Nancy. „Ich arbeite mit der Bochumer Uni zusammen. Wer weiß, vielleicht ergibt sich dann langfristig sogar eine Professur? Aber das steht alles noch in den Sternen. Und bitte, Gu-Le: Davon kein Wort im Interview! Ich möchte auch nicht, dass das Thema Schereschewski breitgetreten wird.“
„Schereschewski? Ja, ja, ich weiß, dein russischer Brann ja, ich weiß schon.“
So kamen sie auf das Interview zu sprechen. Sarah machte den Fehler, doch noch mal auf Schereschewski zu sprechen zu kommen. Der sei der Gedächtnis-Künstler schlechthin gewesen. Sie war bei ihren Vorarbeiten auf interessante Dokumente über das russische Gedächtnis-Genie gestoßen. „Offen gesagt, da gibt es noch einiges an Dokumenten, die bisher nicht richtig ausgewertet wurden. Aber bitte: Schereschewski gehört nicht an die große Glocke.“
Es gebe da auch Parallelen zu Clemens Brann. Auch der zeige, zusammen mit seiner Sprachbegabung, ganz ungewöhnlich Gedächtnisleistungen. „Aber bitte, das ist nichts für das Interview.“ Der Abend war inzwischen schon etwas fortgeschritten. Gunda-Lena kannte etliche Details aus früheren Gesprächen, so dass sie das Ganze schließlich nur in groben Zügen besprachen. Gunda machte sich flüchtige Notizen. „Zu Hause mache ich ein ordentliches Interview draus, keine Sorge,“ versicherte sie ihrer Freundin.
„Aber: Übertreib nicht! Bitte nichts Überkandideltes!“
Gunda nickte pflichteifrig. „Du kannst dich auf mich verlassen.“ Es war kurz nach Mitternacht, als Gunda schließlich aufbrach.
Am nächsten Tag, gegen Mittag, bekam Sarah den Interview-Text auf ihr Smart-Phone. Sie überflog den Text, brachte zwei Korrekturen an und machte sich dann an ihre gewohnte Arbeit.
FORSCHUNGSREGION RUHRGEBIET
Hirnforscherin Sarah Blum:
Medizin-Nobelpreis für Dorstenerin? im Interview mit Gunda-Lena Barberini
Das Ruhrgebiet hat sich innerhalb von 50 Jahren von einer Kohle- und Stahlregion zur wichtigsten und dichtesten Hochschullandschaft in Europa gemausert. Auch die Stadt Dorsten, gelegen an der Nahtstelle zwischen Ruhrgebiet und Münsterland steht bei diesen Entwicklungen nicht im Abseits. Zu den glänzenden Perlen der Forschungs-Landschaft zählt die Neurologin und Hirnforscherin Sarah Blum. Sie soll ab dem Herbst ein Forschungsprojekt der Universitäten Bochum und Nancy zum Thema „Herausragende Hirnleistungen im Bereich Sprache und Gedächtnis“ koordinieren. Unsere Mitarbeiterin Gunda-Lena Barberini hatte die Gelegenheit, die Forscherin zu ihrem Projekt zu befragen.
D. N.: Frau Blum, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Forschungsprojekt. Worum geht es dabei genau?
S. B.: Ich darf Sie erst einmal bremsen. Noch ist das Projekt nicht endgültig in trocken Tüchern. Die Bewilligung liegt derzeit noch in Berlin.
D. N.: Unterschriftsreif, habe ich gehört?
S. B.: Ja, mehr oder weniger. Aber eine definitive Zusage habe ich noch nicht.
D. N.: Gut, dann behalten wir das so im Hinterkopf. Worum wird es gehen?
S. B.: Thema sind besondere Hirnleistungen bei Menschen mit speziellen Begabungen. Es gibt immer wieder einzelne Menschen, die höchst verblüffende Fähigkeiten hervorbringen. Wir haben das früher unter Überschriften wie „Wunderkinder“, „Genies“ oder auch „Savants“ eingeordnet.
D. N.: Ja, Ich verstehe, Rechengenies zum Beispiel. Wir hatten neulich über die Kopfrechenweltmeisterschaften berichtet. Um so etwas geht es, oder?
S. B.: Ja und nein. Was ich meine, das führt noch weiter: Hier geht es um Menschen, die so etwas von vorneherein mitbringen, ohne dass sie etwas dafür tun müssten. Jemand wie Stephen Wiltshire gilt als „lebendige Kamera“. Der fliegt über eine Stadt und zeichnet dann ein fotoexaktes Bild – nach einmaligem Sehen. Das ist mehr als ein Talent. Das kann nur einer unter einer Milliarde Menschen.
D. N.: Ja, das ist nun ja wirklich etwas ganz Besonderes!
S. B.: Wir sprechen in diesem Zusammenhang von „Savants“ oder von dem „Savant-Syndrom“.
D. N.: Können Sie das erklären?
S. B.: Sehen Sie, es gab in den 80 er Jahren einen Film mit Dustin Hofmann über den „Rain man“. Vorbild war das Gedächtnisgenie Kim Peek, einer der bekanntesten Savants überhaupt. Peek hat tageslang in der Bibliothek gesessen und gelesen – immer zwei Bücher parallel, eines mit dem rechten, eines mit dem linken Auge. Und alles, was er gelesen hat, das hat er auswendig behalten. Telefonbücher der US-Städte, Fußball-Ergebnisse, alles. Aber ein Ei in der Pfanne, das konnte er sich nicht zubereiten.
D. N.: Ich habe den Film, glaube ich, gesehen.
S. B.: Und die Betroffenen zahlen für ihre einsame Begabung einen hohen Preis: Die meisten sog. Savants sind autistisch veranlagt, kommen also nur schwer mit ihrer Umwelt und ihrer Umgebung klar.
D. N.: Sie haben so ein Genie in Ihrem näheren Umfeld, Herrn Brann?
S. B.: Na ja, ich habe Clemens Brann nach einem Unfall behandelt, und wir sehen uns regelmäßig. Er hilft mir einfach dabei, das Savant-Syndrom besser zu verstehen.
Anmerkung der Redaktion: Vor sieben Jahren waren Dr. Sarah Blum und Clemens Brann, Hauptdarsteller in einem echten Krimi. Brann wurde nach einem Auto-Unfall in der Dorstener Klinik behandelt. Seine Rekonvaleszenz war ungewöhnlich, da er nach den Verletzungen unglaubliche besondere Sprachfähigkeiten entwickelte. Die DN berichteten damals darüber.
Brann verschwand unter mysteriösen Umständen aus Dorsten und wurde unter ebenso mysteriösen Umständen in Ligurien wiederaufgefunden.
D. N.: Ich verstehe: Brann ist so eine Art Muster-Savant, oder?
S. B.: Brann ist in der Tat etwas Besonderes. Früher gingen wir davon aus, dass bei diesem Savant-Syndrom bei den Betroffenen irgendetwas vor der Geburt geschehen ist. Bei Brann aber war das anders: Er hat sein unglaubliches Sprachtalent nämlich nicht von Geburt an besessen, sondern erst nach seinem Unfall entwickelt. Er kann sich eine Sprache fast über Nacht aneignen.
DN: … ich verstehe: Wenn bei Brann durch den Unfall etwas im Kopf passiert ist, dann kann das auch bei normalen Menschen passieren. Ab morgen kriegen die Kinder einen Schlag auf den Kopf und zack – haben wir lauter kleine Genies!“
S. B.: (lacht) Das ist damit natürlich nicht gemeint, Aber die Frage bleibt, ob bei Clemens Brann irgendein Schalter umgelegt worden ist oder was sonst passiert ist.
D. N.: Neue Frage: Ihr Projekt wird Sie ins französische Nancy führen? Sie sprechen Französisch?
S. B.: Ja, das stimmt. Es ist ein Forschungsprojekt zwischen der Ruhr-Universität und der Universität Nancy.
D. N.: Sie gelten inzwischen als eine der weltweit führenden Spezialisten in der Sprach-Hirnforschung, das ist doch richtig?
S. B.: Aber nein, das bin wirklich nicht. Ich habe ein paar Beobachtungen machen können und ein paar Aufsätze dazu veröffentlicht. Das ist nichts Sensationelles.
D. N: Wenn Sie dieses Projekt übernehmen, dann werden Sie sich aus Dorsten verabschieden?
S. B.: Nicht wirklich. Es ist ein Kooperationsprojekt, da ist auch die Jakobus-Klinik mit eingebunden. Ich bleibe unserem Dorsten erhalten.
DN: Das klingt sehr spannend. Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Projekt? Sie haben vorhin von Sprache und Gedächtnis gesprochen. Bei Gedächtnis, da fällt einem ja sofort das Thema Alzheimer ein. Hängt das auch damit zusammen?
S. B.: Das ist ein interessanter Zusammenhang. Aber zunächst stehen Sprache und Gedächtnis eng nebeneinander. Auch z.B. bei Clemens Brann konnten wir mit der Erweiterung seiner Sprachkompetenzen sehen, dass sein Gedächtnis größer geworden ist. Welche Auswirkungen sich für das Thema Alzheimer ergeben, das müssen wir erst noch sehen.
D. N.: Sie meinten doch vorhin, dass unter diesen Savants auch Gedächtniskünstler zu finden seien? Das spielt in Ihrem Projekt doch auch eine Rolle?
S. B.: Ja, sicher, das ist ein wichtiger Punkt. Es hat immer Menschen mit besonderen Gedächtnisleistungen gegeben. Ich denke da z. B. an Solomon Schereschewski, der im vergangenen Jahrhundert in Russland lebte und als Gedächtniskünstler aufgetreten ist.
D. N: Dieser Schereschewski spielt für Ihre Forschung eine Rolle?
S. B.: Ich habe im Vorfeld einige Arbeiten des russischen Hirnforschers Lurija ausgewertet. Der hat Schereschewski untersucht und ihn jahrelang begleitet.
D. N.: Also, diese Schereschewski-Papiere fließen jetzt in Ihre Arbeit ein?
S. B.: Lurija hat damals vieles beobachtet, musste dann aber leider aus politischen Gründen seine Arbeit unterbrechen. Aber das möchte ich hier nicht weiter vertiefen. Wie gesagt, wir stehen, wenn überhaupt, am Anfang. Und man sollte dieses Projekt auch wirklich nicht zu hoch aufhängen. Ich kann im besten Fall ein paar bescheidene Beiträge zur Kognitionsneurologie liefern, mehr nicht.
D. N.: Frau Dr. Blum, Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihr Projekt in Dorsten und Bochum.
Anmerkung der Redaktion: Wer das Glück hat, Frau Dr. Blum persönlich zu kennen, der wird ihre angeborene Bescheidenheit und Zurückhaltung schätzen. Wie es bei guten Wissenschaftlern üblich ist, so neigt auch Frau Dr. Blum dazu, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen. Schereschewski und Lurija waren vor 80 Jahren ein perfektes Tandem. Das Schereschewski-Thema hat Lurija dabei geholfen, seinen Weltruhm als Neuropsychologen zu begründen. Es heißt, dass Lurija nur wegen der Stalin´ schen Wirren den Medizin-Nobelpreis nicht erhalten hat. Nach allem, was wir gehört haben, tritt nun Frau Dr. Blum in der Erforschung des Savant-Syndroms in die Fußstapfen des großen russischen Forschers.
Warten wir ein paar Jahre, vielleicht dürfen wir dann in Dorsten eine Nobelpreisträgerin feiern.
Am Tag darauf stapfte gegen Mittag eine schmale und sportliche Gestalt, dezent gekleidet, beinahe wütenden Schrittes durch den Kanal-Ufer-Park. Unverkennbar: Sarah Blum hegte auf dem Weg zur Mittagsschicht aggressive Gedanken.
Selbst ihre sonst ausdrucksstarken dunklen Augen waren heute erkennbar eingetrübt.
An diesem Morgen hatte sie ihren hellen Trenchcoat übergezogen, in dem sie normalerweise die Lässigkeit der Filmschönheiten der 70er Jahre nachvollzog. Doch im Augenblick wirkte Sarah Blum in ihrer Entschlossenheit eher wie der Barlach´ sche Racheengel auf dem Weg zu seinem schuldbeladenen Opfer.
Sarah erreichte ihren Arbeitsplatz an diesem Tage fast eine halbe Stunde vor ihrer normalen Zeit. Es war genau 13.20 Uhr, als sie ihr Diensttelefon aufnahm und Gunda-Lenas Nummer wählte. Schließlich ahnte sie, dass Gunda auf einen Handyanruf von ihr nicht reagieren würde. Und Gunda ließ sich Zeit: Jeder unerwiderte Klingelton schien Sarahs Ärger weiter zu steigern. Als sie schließlich ihre Freundin am Telefon hatte, zischte sie mehr als sie sagte: „Du bist in einer Viertelstunde hier, oder …“.
Der offene Wutausbruch hatte die junge Ärztin ein wenig beruhigt; denn als ihre Gunda-Lena sich nach exakt 12 Minuten in der Notaufnahme des Krankenhauses meldete, hatte sie sich wieder einigermaßen im Griff.
Sarah Blum konnte Gundas Erscheinen aus der Sicht der Überwachungskameras genau verfolgen. Sie stieg aus ihrem kreischend-blauen Sportflitzer und kam gemächlichen Schrittes auf die Hebetür der Notaufnahme zu. Trotz ihres überstürzten Aufbruchs war sie sorgfältig gekleidet wie immer, auch wenn sie, wohl wegen der knappen Zeit, auf Make-up-Schnickschnacks verzichtet hatte. Mit ihrem Hosenanzug und den schmalen dunklen Schuhen wirkte sie, als käme sie gerade von einer hochwichtigen gesellschaftlichen Veranstaltung, aus einem „Meeting“ oder … . Gunda verstand es dabei, ihre eher mittlere Körpergröße so zu betonen, dass die meisten Beobachter sie später als größer gewachsen in Erinnerung behielten. In Erinnerung bleibt meist auch Gunda-Lenas lange fuchsrote Haarmähne, die sie im Gespräch gerne mit einer lasziven Kopfbewegung von der Stirn scheuchte. Bemerkenswert war zudem ihr rundes Gesicht, dem die dunklen Augen - im Zusammenspiel mit ihren blassen Lippen – einen spöttischen und leicht arroganten Ausdruck verliehen. Freunde wussten, dass dieses besondere Minenspiel weitestgehend außerhalb von Gunda-Lenas bewusster Kontrolle lag. In der Schule war sie deswegen einige Male bei ihren Lehrern übel aufgelaufen.
Als ihre Freundin so in die Notaufnahme hereinsegelte, stand Sarah Blum von ihrem Stuhl auf und klatschte die Dorstener Zeitung auf den Tisch. Sarah fixierte Gunda mit einem wütenden Blick aus ihren dunklen Augen: „Hier! Hab´ ich heute Morgen auf meinem Tisch liegen gehabt! Um halb acht hat der erste Kollege angerufen: Nobelpreis in Dorsten! Mensch, dass du bekloppt bist, weiß ich, aber schämst du dich denn gar nicht?“ Sarah Blum flüsterte mehr, als sie sprach, und ihre besondere Flüsterstimme klang ziemlich bedrohlich. „Du hast mir doch gestern den Vorabdruck geschickt, und der war doch ganz in Ordnung. Den hatte ich auch abgesegnet. Wenn ich nicht mal dir vertrauen kann …“
Wären sie im Freien gewesen, dann hätte es gut sein können, dass Sarah ihrer Freundin ins Gesicht geschlagen hätte. Gunda-Lena sah Sarah fassungslos an: „Meine Güte, reg dich doch nicht so künstlich auf! Ich habe mir das nochmal durchgelesen. Das war mir dann zu fad. Da hab´ ich einfach noch an 2-3 Stellen ein bisschen Würze dazugegeben.“ Sarah schüttelte den Kopf. „Mensch, Sarah““, fuhr Gunda-Lena fort, „Du spielst immer die Bescheidene! Man muss doch mal sagen dürfen, was du alles so draufhast. Schon damals, nach der Geschichte mit Clemens, da waren wir uns ja zu fein, auch nur mit dem WDR zu sprechen. Immer hübsch Understatement! Wenn ich das schon höre: Gunda nahm ihre Micky-Maus-Stimme an. „Ich kann da nichts weiter zu sagen! Mensch, du bist doch ´ne Kapazität in der Hirnforschung! Hast du letztes Jahr den Erstvortrag in Lausanne gehalten oder nicht?!“
Sarah blickte ihre Freundin an, ihre Ruhe kehrte zurück. Denn irgendwo hatte Gunda auch recht. Nach einem langen Schnaufzer sagte sie schließlich, mehr an sich selbst gerichtet als an Gunda:
„Mensch Gunda, ich wollte einfach nur Clemens aus allem raushalten. Der ist schwierig genug.“ Sarah seufzte. „Weiß Gott, ich möchte ihn nicht in alles Mögliche reinziehen. Das Projekt in Nancy, das ist wirklich schön, aber ich weiß gar nicht, ob Clemens mitmacht. Und ich weiß nicht mal, ob ich ihn gerne in Nancy dabeihätte. Ist schwierig geworden.“ Wieder seufzte Sarah. Dann kam sie wieder auf das Interview zurück: „Ich hatte dich so gebeten, die Sache nicht aufzubauschen. Und du drehst am Rad, faselst was von Schereschewski-Papieren und Nobelpreis!“
„Mensch, ich wollte dir nur helfen, damit du ein bisschen Rückenwind kriegst!“ Gunda-Lena schlüpfte nun in die Rolle der größeren Schwester, die der kleinen Sarah dabei helfen muss, auf eigenen Füßen zu stehen.
„Mensch, du hast wirklich ein gesegnetes Talent als Märchenerzählerin! Die Kollegen zerreißen sich jetzt hinter mir das Maul!“
Sarah hielt inne und holte tief Luft: „Mensch, GuLe, warum kannst du nur deinen vorlauten Mund nicht halten?! Und wie steh ich jetzt da? Riesenprojekt! Nobelpreis! Da bin ich auf einmal die Karrieristin, die unbedingt ihren Professor-Titel haben will auf Deibel komm raus. Mit so was gefährdest du eher mein Projekt, als mir zu helfen!“ Gunda-Lena sah, wie Sarah sich heftig auf ihre Kieferknochen biss – und schämte sich für ihre Unbedachtheit, wenn auch nur ein wenig; dass Sarah sie bei ihrem Kurznamen GuLe anredete, war andererseits wieder beruhigend, denn wenn Sarah ernsthaft böse war, dann nutzte sie den vollen Namen.
„Tut mir leid“, fing sie an. Aber Sarah unterbrach sie barsch: „Und ich hatte dir auch ausdrücklich gesagt, dass du das Thema Schereschewski nicht weiterverfolgen sollst. Das sind alles noch ungelegte Eier! Ach, lass mich doch einfach nur in Ruhe!“.
Gunda-Lena tat etwas, wobei man sie nur selten beobachten kann. Sie neigte den Kopf nach unten und schaute – schuldbewusst die Bodenfliesen an. Sarah ließ ihre Freundin noch eine Weile zappeln und warf ihr, immer wenn diese etwas sagen wollte, einen vorwurfsvollen Blick zu, so dass sich ihr Nicht-Gespräch über einige Schweigeminuten ausdehnte. Erst nach einer Weile fügte sie hinzu: „Von mir aus können wir morgen Abend noch einmal darüber reden – bei mir. Ich wollte sowieso Lasagne machen.“
Trotz dieses halben Friedensangebotes fühlte sich Gunda Lena Barberini bedröppelt, als sie später und einigermaßen schuldbewusst die Klinik verließ: Sarah hatte ja vollkommen Recht. - Gunda-Lena bewunderte Sarah Blum vorbehaltlos. Und sie hatte nun eine Gelegenheit gesehen, Sarahs Licht endlich einmal aus dem Scheffel hervorzurücken, unter den Sarah sich nun einmal gerne selbst stellte.
Was ihre Freundin ihr vorwarf, das hatte schon Hand und Fuß. Aber sie hatte es in ihrer spontanen Art einfach zu gut gemeint. Ach ja, tröstete sie sich zum Schluss: Es würde schon alles gut gehen!
Gehen wir aber ein paar Hundert Kilometer nach Süden, Richtung Strasburg. Kurz hinter Grenze treffen wir auf die Kleinstadt Wissembourg, die heute verschlafen an der Grenze döst. Vor einigen Jahrhunderten wurde die Gegend von einem mächtigen Kloster beherrscht. Noch heute kann der Tourist die bescheidenen Überreste der Anlage besichtigen. Wer sich in der Gegend sehr gut auskennt, der weiß, dass unweit der Ruinen eine zweite Kloster-Anlage errichtet worden war, die aber auf den aktuellen Landkarten nicht eingezeichnet ist. Die Kartenlegende vermeldet an dieser Stelle Militärgelände: In den 1930 er Jahren hat Frankreich hier im Grenzbereich nach Deutschland großflächig die Bunkeranlagen der Maginot-Linie aufgebaut.
Das Kloster ist heute noch in Betrieb; es beherbergt keine Mönche, sondern dient als eine Art Internat. Die Möglichkeit, den Nachwuchs hier anzumelden, besteht für Eltern aber nicht. Träger der Einrichtung ist eine Stiftung, die nicht auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet ist. Die „Alumni“ des Internats sind handverlesen und weisen alle eine Besonderheit auf. Die „Avicenna-Stiftung“ wurde benannt nach dem persischen Arzt Ibn Sina, der in Europa unter dem Namen Avicenna bekannt wurde. Ibn Sina lebte vor tausend Jahren (980-1037) und war ein weltbekanntes Genie. Er revolutionierte die arabische Medizin und wurde auch im christlichen Europa vorbehaltlos als Kapazität anerkannt. Die Idee der Stiftung soll sich auf ihn zurückverfolgen lassen. Ziel ist es, junge Menschen mit extremen Sonderbegabungen („Savants“) auf ein normales Leben vorzubereiten. Denn meist paart sich die Extrembegabung mit Problemen, sich im Leben zurechtzufinden. Und es sind immer nur eine Handvoll alumni, die hier liebevoll betreut werden. Die angeschlossene Bibliothek und die kleine Akademie werden auch von den Ehemaligen genutzt, die die Ruhe und die Abgeschiedenheit des alten Klosters schätzen. Ein Stab von etwa 40 Leuten betreibt Schule, Internat und Bibliothek. Der Zugang ist streng begrenzt und wird natürlich streng überwacht. An den Korridoren und in den Fluren hängen Portraits von Ehemaligen. Carl Friedrich Gauss kann man dort im Bild sehen, das Sprachengenie Emil Krebs grüßt in seiner Diplomaten-Uniform aus China, neben ihm thront der Mathematiker und Codebrecher Alan Turing, der die Grundlagen des heutigen Internet legte, Schachweltmeister Bobby Fischer, aber auch Mozart, Napoleon Bonaparte oder Isaac Newton: sie alle waren einige Zeit in Wissembourg. Diesen Genies gemeinsam war ein etwas schwieriger Charakter, so dass sie gesellschaftlich oft aneckten, was natürlich die Nutzung ihrer Talente erschwerte. Hier in Wissembourg fanden sie die notwendige Ruhe und Entlastung. Hier lernten sie, wie sie ihre Talente behutsam am besten brauchen und anwenden konnten.
Im Büro des Maître Maison stoßen wir auf Jean François LeFebvre, der etwas besorgt wirkt. Maître LeFebvre ist hochgewachsen, hager: Er hat das Alter schon überschritten, in welchem die Haare dunkel bleiben. Sein weißer Schopf verleiht ihm die würdige Aura eines römischen Senators. Dazu passen seine „gemessenen“ Bewegungen. Er pflegt in seiner Kleidung eine gewisse Eleganz, die auch auf seine Mimik und seine Körpersprache zurückwirkt. Zusammen mit einem Mitarbeiter aus dem Internats-Büro geht er Listen durch; sie zeigen beunruhigende Aktivitäten. Auf einer Karte, welche einer der Bildschirme im Büro zeigt, bündeln sie mehrere Stränge auf einen Punkt im Westen Deutschlands, einige 30 km vom Rhein entfernt: „Dorsten“ blinkt ein eingeblendetes Feld.
„Seit wann haben wir diese Aktivitäten?“, fragt LeFebvre den Mitarbeiter.
„Das hat sich vor zwei Tagen ganz flott entwickelt; es gab da ein Zeitungs-Interview …“ hier unterbrach LeFebvre, unerwartet unhöflich: „Mit Sarah Blum, nehme ich an.“
Sein Gegenüber nickte: „Genau! Da wurde ganz schön vom Leder gezogen. Sarah Blum und der Medizin-Nobelpreis!“
„So etwas passt eigentlich nicht zu Mme Blum! Sie ist doch eher zurückhaltend. Ich hatte eigentlich auch darauf gezählt!“
„Na ja, das hat man ihr eher in den Mund gelegt,“ räumte LeFebvres Gegenüber ein. Und der Zeitungsartikel hat dann gewirkt wie ein Weckruf! Auf einmal wurden da Leute ganz unruhig. Ich konnte die Reaktionen gut nachvollziehen.“
„Und Dorsten war das Epizentrum, nehme ich an?“
„Ganz genau. Und das ist jetzt seit zwei Tagen so!“
„Ich habe Sarah gebeten, sie solle sich und Brann aus der Öffentlichkeit heraushalten,“ murmelte LeFebvre, mehr zu sich selbst als zu seinem Gesprächspartner. „Ich habe noch vor ein paar Tagen mit ihr am Telefon gesprochen.“
„Frau Blum, die war doch damals mit Clemens Brann hier bei uns. Ich erinnere mich noch ganz gut an sie. Eine ausgesprochene Schönheit.“
„Ja, das stimmt, sie kennt unser Wissembourg. Sie hat mich erst in der vorletzten Woche angerufen; sie hat seit längerem ihre lieben Probleme mit Clemens Brann. Ich denke, wir müssen da unbedingt mal nachschauen. Könntest du dich bei Estragon erkundigen, ob er Zeit hat?“
„Soll ich Sie denn bei Frau Blum ankündigen?“
„Ich denke, wir sehen uns erst einmal genauer um in Dorsten. Bitte keine weiteren Infos noch Außen. Wir fahren am besten gleich am Nachmittag los!“
Ein paar Tage waren seit dem Interview vergangen. Tatsächlich hatte sich die Aufregung um Sarah Blums Nobelpreis-Ehrgeiz wieder ein wenig gelegt. Gunda hatte sich in der Zeitung offen dazu bekannt, dass ihr in dem Bericht die journalistischen Pferde durchgegangen waren, und das wurde allgemein als Entschuldigung und Erklärung akzeptiert.
Heute war Donnerstag. Der Arbeitstag der Sarah Blum dauerte an diesem Tag bis tief in den Abend. Es war schon weit nach 22 Uhr, als sie ihren Rückweg durch den Kanalpark antrat.
Da Sarah im Schichtdienst arbeitete, kannte sie inzwischen den Melodienwechsel der Tageszeiten. Der Frühling wurde nun immer greifbarer, und mit ihm war der morgendliche Gesang der Vögel zurückgekommen. Sarah Blum konnte bereits einige der Morgenvögel an ihren Liedern erkennen. Aber auch die Geräuschkulisse auf ihrem Abendweg war wohl vertraut. Sie mochte es, die sanften Wasserschläge an den Spundwänden und den Steinhängen des Kanals zu vernehmen; in solchen Momenten schloss Sarah kurz die Augen und dachte zurück an die kleinen Strände der ligurischen Küste und die beschauliche Ruhe auf ihrem Segelboot im Meer.
Wenn es noch später wurde und die angehende Oberärztin nach ihrer Abendschicht erst tief in der Nacht nach Hause ging, weil ein nächtlicher Patient ihre Aufmerksamkeit beansprucht hatte, dann betrachtete sie die Kanalpromenade mit ganz anderen Augen und Ohren. Denn obwohl ihr Heimweg von einer Kette kalt strahlender Laternenlichter beleuchtet war, empfand sie das wohlig-unheimliche Grausen aus Kindheitstagen; sie spürte jene hundertmal geträumten Phantasmen, die sich gegen jede Vernunft immer wieder in ihre Wahrnehmung drängten und sie hin und wieder vorsichtig umschauen ließ.
Manchmal blieb sie dann stehen und lauschte atemlos auf das kaum vernehmbare Murmeln der Angler, die rund um das Jahr ihre einsam-geselligen Treffen am Kanalrand hielten, um Aale, Grünaugen oder Karpfen an Land zu ziehen.
In den vergangenen Tagen hatte sie sich immer häufiger dabei überrascht, wie sie auf ihrem Heimweg Pausen einlegte und ihre Gedanken weiter hinaustreiben ließ: War es wirklich schon sieben Jahre her, dass sie Clemens als ihren ersten interessanten Patienten entdeckt und sich gleich in ihn verliebt hatte? Ihre Erinnerungsbilder waren jetzt hilfreich und tröstlich. Denn Clemens Brann hatte sich verändert. Sie hatte ihn damals als einen freundlich-neugierigen Menschen erlebt, aber von dem war in den beiden letzten Jahren wenig übriggeblieben. Seine neue, ruppige und abweisende, Art irritierte sie zunehmend.
Seine Arbeit als Architekt hatte Brann inzwischen weitgehend aufgegeben. Auch wenn er noch sein Büro betrieb, hier hielt sein Partner das Heft fest in der Hand. Sein Geld verdiente Brann nun vor allem mit Übersetzungen: Es waren hauptsächlich komplexe technische Texte wie Normen und technische Beschreibungen, die Brann in Sprachen wie Finnisch, Koreanisch oder ins Russische übertrug. Er hatte sich inzwischen einen Namen damit gemacht. Aber das Übersetzen solcher Fachtexte gestaltet sich in der Regel viel schwieriger als normale oder verwaltungssprachliche Texte. Mitunter war Brann gezwungen, Neubildungen für technische Begriffe in der Fremdsprache zu prägen. Für solche Arbeiten musste Brann viel Zeit und viele Denkarbeit investieren. Auf jeden Fall fesselte ihn seine Übersetzungsarbeit an sein Studierzimmer; und sein Schach-Spiel war auch nicht gerade etwas, das ihn enger an Sarah band.
„Mensch, warum machst du nicht mal wieder richtig Urlaub mit Clemens?“ hatte Gunda gefragt, als sie sich über Clemens´ mürrische Einsiedelei geklagt hatte. „Sprachprobleme habt ihr doch auf keinen Fall, oder?!“
Aber Sarah hatte ihre Zweifel, ob zwei Wochen in Finnland oder in Korea eine Erholung wären: „Weißt du, ich habe das ein paarmal mitgemacht: Da sitzt Clemens mit unseren finnischen Gastgebern, glänzt mit seinen flüssigen Finnisch-Kenntnissen und erklärt den Einheimischen wie ihre Sprache so richtig funktioniert. Und ich sitze daneben und muss mit den anderen Herrschaften Konversation in einfachstem Touristen-Englisch über Clemens´ glänzende Sprachkenntnisse führen.“
Nach dem Unfall hatte es sehr lange gedauert, bis er sich aus den Verstecken im Innern seines Kopfes herausbewegt hatte – vorsichtig war er.
Seine tastende Orientierungssuche machte ihn so verletzlich und dabei so liebenswert. Sie erinnerte sich noch genau an die fragend-vorsichtige Gesprächsart, mit der Brann sie in den ersten Jahren fasziniert hatte. Maître LeFebvre, der Savant-Experte, hatte sie damals darauf vorbereitet, dass Clemens irgendwann einmal schwierig werden könnte. Aber dass er sich nach Jahren plötzlich so stark verändern würde ….
Das Gespräch, dass sie mit LeFebvre bei ihrem letzten persönlichen Treffen geführt hatten, war tief in ihre Erinnerungen eingebrannt: LeFebvre schien gesehen zu haben, was kommen würde.
„Wir können niemals wissen, wie Clemens das doppelte Hirntrauma verarbeitet“, hatte LeFebvre ihr damals erklärt. „Es kann schon sein, dass seine neuen Fähigkeiten erhebliche Auswirkungen auf seine Wahrnehmung und auf seine Persönlichkeit haben. In jedem Fall kommt einiges auf Sie zu!“
Sarah betrachtete nachdenklich das ruhig dahinfließende Wasser des Kanals, indem sie versuchte, aus den Laternenlichtern ein Muster zu gewinnen.
Wieder rollten ihre Gedanken zurück. Ja, sie erinnerte sich sehr genau an dieses Gespräch, denn schließlich war es das erste Mal gewesen, dass sie ihren väterlichen Freund nicht richtig verstanden hatte. „In Clemens Gehirn hat sich einiges verändert. Da sind völlig neue Leitungen und Verbindungen gelegt worden. Es dauert, bis sich so etwas stabilisiert.“
Sarah hatte LeFebvre zweifelnd angeschaut. „Sehen Sie, Sarah, vielleicht ist es ähnlich wie in der Pubertät. Das Gehirn wird erwachsen. Da werden die Synapsen völlig neu verkabelt. Wir wissen nicht genau, wohin das führen wird. Vielleicht ist Clemens jetzt genau wieder an einem solchen Punkt.“
Sie hatten sich eine Weile kurz angeschaut, dann hatte Sarah mit den Schultern gezuckt. „Sie müssen einfach abwarten,“ hatte LeFebvre ihr noch mit auf den Weg gegeben. „Aber wer weiß, was die Zeit bringt. Welche langfristigen psychischen Auswirkungen es geben mag, das ist ganz unsicher. Solche Traumata können noch nach Jahren ungewöhnliche Folgen zeigen. Schließlich ist ja sein ganzer Denkapparat umgekrempelt worden.“
Und was LeFebvre an die Wand gemalt hatte, war in irgendeiner verqueren Weise auch eingetreten. Lange hatte sie sich in der euphorischen Hoffnung gesonnt, „sie würden es zusammen schaffen“ und hatte sich über alle gut gemeinten Bedenken hinweggesetzt.
Aber nun musste Sarah ehrlicherweise zugeben, dass Clemens ihr tatsächlich in den letzten zwei Jahren ein fremder Mensch geworden war. Er hatte sich weiter und immer weiter von ihr entfernt.
Sie hatte damals gern, mit den fliegenden Fahnen der frisch Verliebten, die Verantwortung für Clemens übernehmen wollen, als Ärztin, als Freundin, als Mutterersatz, als Geliebte. Sie hatte für ihn gedacht und in seinem Sinne entschieden. Nun aber, wo er wieder zu sich gekommen war, igelte er sich immer weiter ein und wehrte sie ab. Hatte sie sich so getäuscht - in Clemens und in seiner Zuneigung?
Was sie nun mehr und mehr an ihm störte, das war seine fehlende Bereitschaft, etwas Gemeinsames mit ihr zu unternehmen. Schon, wenn er überhaupt ihren Gesprächsfaden aufnahm, dann geschah dies mit spürbarem Widerwillen. Sie störte ihn immer; er verschanzte sich lieber hinter seine permanenten Schachstudien. Stundenlang saß er vor seinem Brett, und seit Wochen hatte er die Wohnung nicht mehr verlassen. Und nur selten setzte er sich zu Sarah auf die Terrasse – sonst nur Schach, Schach, Schach.
„Ich glaube, ich mache alles falsch!?“, hatte sie letztens ihre Freundin Gunda-Lena angejammert.
„Quatsch! Du musst ihn einfach nur fordern. Du gewährst ihm zu viele Freiräume. Warum lässt du es zu, dass er immer nur Schach spielt! Bei mir wäre das Schachbrett schon längst verschwunden! Du hast doch auch deine Bedürfnisse, oder? Ihr beiden habt doch schon Wochen nicht mehr miteinander gebumst, oder?“ Sarah schüttelte den Kopf und nickte stumm. GuLe konnte immer so erfrischend direkt sein. „Du musst endlich was unternehmen. In sechs Wochen bist du vielleicht in Nancy, und du weißt immer noch nicht, wie es dann mit euch weitergeht. Mensch, Sarah, tu doch endlich was!“
Tatsächlich hatte das Centre neurologique Nancéien in Nancy ihren Projektvorschlag sehr positiv aufgenommen. Sie hatte alte, fast verschüttete Kontakte wieder aufgefrischt und man zeigte sich noch sehr angetan von Sarah. Dr. Saglier, die Personal-Chefin des CPU Nancy, hatte ihr gegenüber augenzwinkernd eine Oberarzt-Stelle ins Spiel gebracht. Allerdings hatte sie Clemens gegenüber noch immer nicht reinen Wein eingeschenkt; so saß sie wieder in der Zwickmühle.
Sarah Blum schaute kummervoll in das kräuselnde Wasser des Kanals, das leise glucksend unter ihr seine sanft-vertraute Melodie erklingen ließ. GuLe hatte wie so oft den Finger auf die Wunde gelegt. Nancy rückte jetzt immer näher und Clemens wich immer weiter zurück. Sarah seufzte: Eigentlich hätte sie schon vor sieben Jahren in Nancy an der CHU anfangen können. Brann hatte damals mitkommen wollen, aber inzwischen …. . Wieder ließ sie ihren Blick über den Kanal schweifen, um ihr stummes Zwiegespräch fortzusetzen. Ihre Erinnerung trieb sie wieder zurück.
In den beiden letzten Tagen hatte Brann an seinem PC gesessen und Schach gegen den Computer gespielt; Blindpartien, ohne Brett. Er ließ sich nur die Figurenpositionen durchsagen und reagierte prompt. Gestern hatte er alle sieben Partien gegen sein PC-Programm gewonnen. Als Sarah ihn auf Nancy ansprach, hatte er kurz aufgeblickt und erklärt:
„Ach, lass mich doch damit in Ruhe. Ich habe jetzt 23 Schachpartien im Kopf, und du willst mir was von Nancy erzählen. Du kannst ja gehen, wenn du willst.“
Sie versuchte noch einmal, sich diese Szene ins Gedächtnis zu rufen, vielleicht war es die Schlüsselszene ihrer Beziehung? Warum hatte sie ihn nicht angeschrien, warum hatte sie akzeptiert, dass er sich wieder in sein Zimmer mit Blick auf den Kanal zurückzog, und dort weiter seinen Schachgedanken nachging? Aber, so hörte sie eine leise Stimme in sich anfragen: Vielleicht ist es doch genau das, was du willst? Würdest du mit einem starken und selbstbewussten Clemens überhaupt auskommen?
Mit einem unguten Gefühl im Bauch hatte sie vor ein paar Tagen nach langer Zeit LeFebvre wieder angerufen. Sie hatten lange miteinander gesprochen, und das Grollen ihres Bauches hatte sich langsam wieder verflüchtigt. Aber seitdem tauchte ihr Bauchgrimmen jedes Mal auf, wenn sie sich über Clemens´ Eigensinn ärgerte, - so, als wollte ihr Bauch ihre Unzufriedenheit verstärken. Vielleicht würde es helfen, wenn LeFebvre in Dorsten vorbeischauen und mit Clemens reden würde.
Vielleicht würde sich sein Besuch positiv auf Clemens auswirken. Brann war LeFebvre für seine Hilfe in Italien bis heute unendlich dankbar, das wusste sie mit Sicherheit.
So ließ die junge Frau die Gedanken auf ihrem Heimweg weiter über den Kanal streifen. Es war bereits kurz vor Mitternacht, und eine merkliche Nachtkühle verbreitete sich unaufhaltsam. Dennoch drängte es sie immer noch nicht nach Hause. Schließlich war es nach der langen letzten Kältewoche der erste wirklich schöne Abend dieses Frühsommers. Im Kanal schimmerte die Sichel des Mondes und die leichten sanften Wellen unterstrichen die feierliche Stille.
Aus der Ferne hörte sie das schrille Surren einer Angel und das typische Ächzen und Stöhnen: Ein Angler war dabei, sein Angelglück zu bergen. Er hatte, ganz offenbar, einen kapitalen Fisch an der Leine, denn er kämpfte laut vernehmlich um seine Beute. Schließlich schien es gelungen; nach einer Weile vernahm sie in der Abendruhe ein kurzes spitzes Aufplatschen: Also hatte dann doch der Fisch seinen Kampf gegen den Angler gewonnen. Sarah seufzte und ging langsamen Schritts nach Hause.
Als sie die Tür aufschloss, saß Clemens Brann im Kanalzimmer und grübelte über seinem Schachbrett. Seine gelegentlichen „Mhms“ wurden übertönt durch Van Morrisons „And the healing has begun“, ein Stück, bei dem Brann stets die Lautstärke hochregelte. Sarahs freundlichen ‚Guten Abend’-Gruß überhörte er zunächst; die - ein wenig lauter, nachhaltiger und langsamer vorgetragene - Wiederholung quittierte er mit einem brummeligen Lautbrei, aus dem ein gutmütiger Zeitgenosse durchaus auch einen Antwort-Gruß hätte heraushören können. Sarah indessen war heute Abend alles andere als gutmütig und blaffte laut und heftig zurück: „Ist es dir schon eine zu große Mühe, mir dummen Kreatur zu antworten?“ Sarah Blum eilte mit vier schnellen Schritten an den haute mit ihrer Faust auf die Platte, so dass mindestens drei der Schachfiguren umfielen und brüllte Brann an: „Meine Güte, was ist aus dir geworden! Du benimmst dich wie ein Trampeltier und bist kalt wie ein Fisch!“ – Sie stutzte und fügte dann hinzu: „Schade, dass es im Schach keine Fisch-Figur gibt; du könntest wahrlich ein Standard-Werk darüber schreiben.“
Brann hatte seinen stummen Dialog mit dem Schachbrett unterbrochen und schaute nun zu der Störerin empor, indem er aber einen Teil seiner Aufmerksamkeit den umgeworfenen Figuren widmete, die er umständlich wieder auf deren alte Felder zurückstellte: „Ist die Signorina Dottoressa heute Abend schon wieder einmal zickig? Me ne frego!“, fiel er ins Italienische, wohl wissend dass er es inzwischen mindestens genauso gut sprach wie Sarah, die doch ein Jahr an der ‚Sapienza’, der römischen Universität, studiert hatte. Sein „Me ne frego!“ stellte eine hübsche Beleidigung dar.
Branns Unverschämtheit, vor allem aber seine kühle Selbstsicherheit trieben sie beinahe zur Weißglut; ihr Bauch meldete sich vernehmlich. Sie hielt ihm nun endlich die Dinge vor, die sie ihm schon längst hatte sagen wollen: Sie habe damals alles aufs Spiel gesetzt, um ihn zu retten, und sie hätte es ja schließlich auch geschafft, mit Hilfe von LeFebvre und seinen Freunden. Aber sie habe ihn auch danach nicht allein gelassen, sie habe vieles drangegeben, um bei ihm zu bleiben und ihn weiter zu unterstützen. Seit fast einem halben Jahr lag das Thema Nancy in der Luft, sie zögerte auch seinetwegen.
„Ach, erzähl doch nichts! Du gehst in sechs Wochen weg; ich bin dir dankbar für deine Hilfe, aber – verdorrich noch mal – du hast mich damit nicht als Kuscheltier gekauft“, giftete Brann zurück. „Geh doch nach Nancy. Deine Dr. Wildsau wartet doch nur auf dich.“
Sarah merkte, wie sich ihr Ärger über Clemens im ganzen Körper ausbreitete. Selbst ihr Magen begann zu rebellieren. Sie warf die Tür hinter sich zu und lief ins Bad, wo sie einen galligen Schleim erbrach. Dann schleppte sie sich in die Küche und holte die offene Weißweinflasche aus dem Kühlschrank. Eigentlich sollte sie jetzt lieber einen Kamillentee trinken, aber das war Sarah ziemlich egal. Sie füllte ihr Glas und nahm zwei Schlucke. Als sie ihr Glas auf den Küchentisch abstellte, klingelte es an der Haustür.
„Meine Güte, kennen denn deine Freunde keine Erziehung“, rief Clemens Brann aus dem Kanalzimmer. „Es ist fast Mitternacht!“, rief er ihr vorwurfsvoll zu.
„Du kannst ja sicher sein, dass es nicht deine Freunde sein können. Du hast ja überhaupt keine mehr!“, blaffte sie zurück. Erst in der letzten Woche war ein Kollege aus dem alten Architektur-Büro spontan bei ihnen vorbeigekommen. Brann war so sehr in sein Schachspiel vertieft, dass er Hennes, seinen Kollegen, nur flüchtig begrüßt und sich dann zurückgezogen hatte. Sarah sah sich verpflichtet, noch Konversation mit Clemens´ Gast zu pflegen, was Clemens ihr aber nicht gedankt hatte.
Sarah Blum seufzte resigniert in sich hinein. Entgegen der ersten spontanen Reaktion ging sie doch an die Tür. Gunda-Lena, vermutete sie, und drückte die Klinke herunter.
Aber gehen wir eine Stunde zurück. Wir schauen auf die Kanalpromenade, die dem Beobachter im fahlen Licht des fast vollen Mondes ein beschauliches Panorama zu entfalten schien. Unweit von der Stelle, an der Sarah vorhin verträumt in die glucksenden Wellen geblickt hatte, lehnt, einige Bänke entfernt, ein einzelner nächtlicher Spaziergänger an einen Zaunpfahl. Er ist eher von hoher Statur, schlank, ja fast hager. Der Mann macht insgesamt einen sportlichen, beinahe austrainierten Eindruck, so dass sein Alter sich oberflächlichen Schätzungen entzieht. Vermutlich Ende 50, vielleicht aber auch älter. Sein weißes Haar verdeckt er mit einem dunklen Filzhut, so dass nur der äußere Haarkranz sichtbar ist. Eine gepflegte Erscheinung - von den Schuhen bis zum Hut. Zurückhaltend und dezent bewegt er sich auch durch den Abend und strahlt eine ruhige und selbstsichere Souveränität aus. Er hatte, leicht schmunzelnd, die Angler-Szenerie beobachtet, deren Ohrenzeuge Sarah Blum gerade vorher geworden war. Aber für diesen Augenzeugen stellte sich die Sache etwas anders dar als für Sarah Blums Ohrenzeugenschaft.
Immerhin war unser dezenter Spaziergänger, zusammen mit einem Begleiter, schon seit zwei Abenden zwischen der Wohnung der Sarah Blum und ihrem Arbeitsplatz unterwegs. Und er hatte dabei einiges sehen und beobachten können: Nicht bloß eine junge Ärztin mit wehmütigem Blick, die sich für ihren Weg zur Arbeit und zurück ungewöhnlich viel Zeit nahm. Dem Spaziergänger und seinem Begleiter waren auch mehrere „Unauffällige“ aufgefallen, die sich stundenlang am Kanalufer aufhielten oder dort etwas zu tun vorgaben. Dem geübten Beobachter waren sie sofort ins Auge gestochen, als sie nach stundenlangem Verweilen ihren Platz erst verließen, wenn Sarah Blum an ihnen achtlos vorbeigelaufen war.
Nächtliche Beobachter und selbst professionelle Spurenfolger sind aber mitunter recht unbedarft, wenn sie selber observiert werden; und darum hatten Sarahs Verfolger auch nicht bemerkt, dass sie selber nicht unbemerkt geblieben waren.
M. LeFebvre, unser abendlicher Spaziergänger, war froh, dass er sich der Mithilfe seines Schützlings „Estragon“ versichert hatte. Während LeFebvre seine elegant-unauffälligen Alltagskleider trug, war Estragon in seinem gewohnten anthrazit-farbenen Anzug erschienen, in dem er, schon nach wenigen Schritten, von der Dämmerung verschluckt wurde. Dass er so unauffällig wirkte und ohne fassbares Nachbild blieb, mochte auch daran liegen, dass er nicht nur in seinem Äußeren von ausgesprochenem Mittelmaß war, weder besonders groß, noch besonders klein, weder dick noch dünn, ohne einprägsame Gesichts- oder Haarfarbe, und auch seine Minenzüge waren ohne jegliche Besonderheit. Sein Freund Vladimir, mit dem er manchmal unterwegs war, hatte im Scherz einmal erklärt, Estragon könne im Momo-Film doch prima die Rolle eines „Grauen Herren“ übernehmen.
Estragon war einer jener Menschen, der mit seinen besonderen Wahrnehmungsfähigkeiten seine Umgebung immer und immer wieder verblüffte. Als Kind war bei Estragon „Autismus“ diagnostiziert worden. Aber er hatte das Glück gehabt, kurz darauf in das Internat der Avicenna-Stiftung in Neuf-Wissembourg aufgenommen zu werden. Seine Betreuer hatten ihn gewissermaßen an die Hand genommen und ihn durch die Schule und später durch sein Ingenieur-Studium geführt. Das „An-die-Hand-Nehmen“ konnte man durchaus wörtlich verstehen. Denn Estragon war von Geburt an blind; er hatte es aber gelernt, ‚mit den Ohren zu sehen’. Manchmal, wenn er ganz alleine unterwegs war, stieß er leise, kaum hörbare Laute aus, mit deren Hilfe er sich nach Art der Fledermäuse sicher in schwierigem Terrain zurechtfand.
Sie bereiteten ihn gründlich auf seinen bürgerlichen Beruf vor. Seit gut 20 Jahren arbeitete er als Freiberufler; wobei allein schon die Patentrechte, die er innehatte, ihm ein sorgloses Auskommen ermöglichten. So konnte er sich erlauben, ein Leben in gelassener Zufriedenheit zu führen, wobei das Wort „zufrieden“ für Estragon nur annähernd zutrifft. Man müsste besser ein Adjektiv finden, das eine Lebenssituation kennzeichnet, in der der Betreffende vollkommen in sich ruht und mit Spannung auf die Dinge wartet, die auf ihn zukommen. Jedenfalls nutzte Estragon seine besondere Arbeitssituation immer wieder gern, um der Stiftung und den „Alumni“ zu helfen. Maître LeFebvre hatte in der Vergangenheit mehrfach die effektive Unterstützung Estragons schätzen gelernt – so auch in dem ligurischen Abenteuer um Clemens Brann.
Heute war es Estragon gewesen, der LeFebvre darauf hingewiesen hatte, dass Sarah Blum auf ihrem Arbeitsweg gleich mehrfach beobachtet wurde. Obwohl LeFebvre die besonderen Talente seines Schützlings schon seit Jahren kannte, war er immer wieder verblüfft über die Wahrnehmungsfähigkeiten des Blinden. Mit seinen Hinweisen hatte Estragon die Befürchtungen des Maître, die er aus der Analyse der Turing-Knoten des Internets gewonnen hatte, voll und ganz bestätigt.
Warum aber waren hier gleich zwei Gruppen tätig? Zumal zwei Gruppen, die voneinander überhaupt nichts zu wissen schienen? Estragon war sich absolut sicher: Die beiden Verfolgergruppen waren hier an der Kanalpromenade separat voneinander hinter der Dorstener Ärztin her, jeder ohne Kenntnis der anderen. Und beide Beobachtergruppen hatten nicht mitbekommen, dass sie nun selber von den beiden dezent gekleideten Herren beobachtet wurden. Mit Leichtigkeit konnte man beide Gruppen osteuropäischen Zirkeln zuordnen. Russenmafia? – Sie würden es heute testen. Hätte es noch einen weiteren Beobachter der Beobachter gegeben, ihm wäre sicherlich M. LeFebvres insgeheime Freude bei diesem Gedanken aufgefallen.
In der Ferne konnte LeFebvre noch Sarahs weiche Umrisse erkennen, die langsam unter den Laternen verschwanden. Er konnte sehen, wie sie nachdenklich am Kanalufer stand und in die mondbeschienene Stille des Kanals horchte. Und er konnte vor allem sehen, dass sie dabei von zwei Männern „unauffällig“ beobachtet wurde.
Estragon wandte sein Gesicht in LeFebvres Richtung, so als würde er ihn ansehen können: „Piccola provocazione?“ fragte er stimmlos. LeFebvre nickte kurz. Jetzt, da Clemens Brann und seine Freundin so offensichtlich ins Visier von diesen Gruppen geraten waren, würde es vielleicht hilfreich sein, die Verfolger zu verwirren und gegeneinander aufzubringen.
Estragon hatte sich – wie immer - gut vorbereitet. Als er LeFebvre verließ, hielt er einen ordentlichen Knüppel in der Hand. Er nutzte ihn kurz darauf bei einem der Angler, der es sich auf seinem Campinghocker breitbeinig bequem gemacht hatte. Estragons Knüppel traf den Angler mit großer Wucht – genau dort, wo es einem Mann „besonders weh tut“. Estragons Orientierungsvermögen hatte LeFebvre immer wieder erstaunt; wie der Blinde sein Ziel so präzise treffen konnte, blieb dessen Geheimnis. Tatsächlich war ihm gelegentlich der Gedanke gekommen, der unscheinbare Blinde verfüge doch noch über einen Rest an Sehkraft, die ihm in derartigen Situationen helfe. Egal, wie es sein mochte: Das Opfer von Estragons unvorhergesehenen Angriff krümmte sich sofort zusammen; sein keuchendes Einatmen ließ erkennen, dass er - neben seinen Schmerzen - auch an großer Luftnot litt.
Das Keuchen des Knüppelopfers hatte Sarah Blum von ihrem Platz aus als das Sirren der Angelleine wahrgenommen; aber zugleich waren auch andere Ohren am Kanalufer hellhörig geworden. Der nächste „Angelnachbar“ saß gerade einmal 70 Meter oberhalb. Er hatte den Vormittag noch im orange-farbenen Anzug der lokalen Abfallgesellschaft am Kanal verbracht und sich erst am frühen Abend den Trainingsanzug mit dem Emblem eines Angelvereins übergezogen. Das ungewöhnliche Geräusch ließ ihn aufspringen. Er beugte sich vor, um besser sehen zu können. Er stand eine kleine Weile und horchte in die Abendstille. Die Geräusche schienen in den Wellen des Kanals zu verschwinden. Er legte eine Hand an sein Ohr und beugte sich vor. Kurz darauf spürte auch er Estragons Knüppel auf seinem Rücken. Seine Reaktion bewies den geschulten Kämpfer: Wild um sich schlagend versuchte er, seinen Angreifer zu stellen. Tatsächlich gelang es ihm zunächst, den weiteren Schlägen seines Widersachers auszuweichen; am Ende aber konnte er das Bad im kühlen Kanal nicht vermeiden. Da ihm das akrobatische Kunststück gelang, sich an dem Rand der Spundwand festzukrallen, konnte er sich rasch wieder aus seiner misslichen Lage befreien. Von seinem Angreifer war nichts auszumachen: Das musste also ein echter Profi gewesen sein!
LeFebvre hatte bei Estragons Spielchen zustimmend genickt; sein angedeutetes Lächeln ließ ihn zufrieden wirken. Sicherlich hegte er für die im Kanal versenkten Widersacher nur sehr geringe Sympathien. Wenn er ehrlich wäre, müsste er zugeben, dass es ihm sogar ein gewisses Vergnügen bereitet hatte, wie sein Freund mit zwei zielgenauen Schlägen die verdutzten nächtlichen Kontrolleure getroffen hatte. Jetzt sollten die Überwacher genug damit zu tun haben, sich untereinander zu sortieren.
LeFebvre blieb nur noch eine kleine Weile im Dunkel des Kanalweges verborgen und machte sich dann auf den Weg in Richtung Schiffbauerdamm. Die selbst gestellte Frage, ob er um die Zeit noch bei seinen Schützlingen anklingeln könne, hatte er ohnehin schon längst mit „Ja“ beantwortet.
Im Haus am Schiffbauerdamm hatte Sarah inzwischen die Eingangstür geöffnet und wartete auf ihre späten Gäste. Als sie LeFebvre und dessen Begleiter aus dem Fahrstuhl kommen sah, wechselte ihr skeptischer Blick in den Ausdruck von Freude und Herzlichkeit. Auch Clemens Brann war, als er die Stimmen vernahm, sofort aufgesprungen und in den engen Flur gekommen. Er zeigte sich – „von hück auf nück“ - wie ausgewechselt. Sarah hatte ihn in den letzten Wochen noch nicht so strahlend und fröhlich gesehen. Er drängte sich an Sarah vorbei, umarmte LeFebvre und begrüßte ihn à la française mit drei Wangenküssen, genauso wie anschließend Estragon. Clemens schien wie von einer Euphoriewelle getragen, so dass seine Freundin sich erst im zweiten Versuch Geltung verschaffen konnte.
„Maître LeFebvre und M. Estragon, wie schön Sie hier haben! Kommen Sie doch herein!“
Wieder drängte Clemens sich in den Vordergrund. Er ließ Sarah weder zu Wort noch zu Gedanken kommen und plapperte nun wie eine aufgezogene Puppe. Seine Backen glühten und zeigten, dass die nach Außen getragene Freude wirklich seinen tiefsten Gefühlen entsprach. Schließlich gelang es Sarah, sich zu LeFebvre vorzutasten: „Sie haben mir doch gesagt, Sie wollten frühestens im Sommer nach Dorsten kommen. Habe ich das falsch verstanden?“ Erst als sie ihre Frage gestellt hatte, erkannte sie den impliziten Vorwurf und bemühte sich, LeFebvre entschuldigend anzuschauen.
LeFebvre nahm ihren Blick auf und sah sie aus seinen tiefgründigen dunklen Augen an. Er hatte eine ausgesprochen nachdenkliche und fast zögerliche Art zu sprechen. Nun aber schien es, als habe er sich eine besonders starke Denkbremse übergeworfen. Er blickte Sarah direkt ins Gesicht, doch fast schien es, als blicke er durch sie hindurch. Schließlich antwortete er ihr, als müsse er jedes einzelne Wort erst aus der Tiefe seines Sprachzentrums herauswringen.
„Nun ja, es gibt schon ein paar Dinge, die uns verstören.“ Sie registrierte das „uns“; irgendetwas irritierte sie an der Wortwahl.
„Geht es etwa um das Interview von Gunda?“ So sehr sie sich auch mühte, sie konnte ihrer Frage die Schärfe kaum nehmen.





























