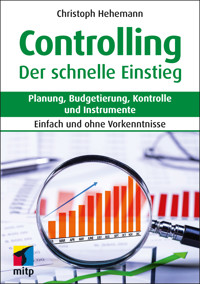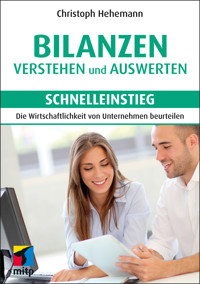
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MITP
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: mitp Schnelleinstieg
- Sprache: Deutsch
- Grundlagen einer Bilanz auch für Nicht-BWLer verständlich erklärt
- Jahresabschlüsse verstehen und auswerten
- Die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen einschätzen lernen
Jahresabschlüsse auch ohne BWL verstehen
Sie möchten Bilanzen lesen und auswerten, obwohl Sie kein BWL studiert haben? Egal ob als Geschäftsinhaber, Unternehmensgründer, Mitarbeiter der Finanzabteilung oder einer Regulierungsbehörde, als Investor, Kreditgeber oder Lieferant – das Verstehen von Geschäftsbilanzen ist von unschätzbarem Vorteil.
Wirtschaftliche Zusammenhänge einfach erläutert
Der Finanzexperte Christoph Hehemann führt Sie Schritt für Schritt an die Grundsätze einer Bilanz heran, so dass Sie deren Aufbau und Elemente verstehen. Er erklärt die nötigen wirtschaftlichen Begrifflichkeiten und deren Zusammenhänge leicht verständlich. Die verschiedenen Bilanzarten, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Kapitalflussrechnung werden Ihnen ganz anschaulich nähergebracht und deren fundierte Auswertung für ein Unternehmen aufgezeigt.
Die finanzielle Stabilität von Unternehmen beurteilen
Dabei geht es über das reine Verständnis hinaus, denn Sie lernen, Bilanzen für Ihre Zwecke zu nutzen und die finanzielle Stabilität und Ertragssituation von Unternehmen zu beurteilen.
Aus dem Inhalt:
- Grundlagen des betrieblichen Rechnungswesens verstehen
- Übersicht über die drei zentralen Finanzberichte
- Zusammenhang von Bilanz, GuV und Kapitalflussrechnung
- Aufbau und Struktur einer Bilanz
- Die Gewinn- und Verlustrechnung verstehen
- Einblick in die Liquidität mit der Kapitalflussrechnung erhalten
- Zielsetzung und Grenzen der Bilanzpolitik
- Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss gewinnen
- Beurteilung von Ertragssituation und finanzieller Stabilität
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christoph Hehemann
Bilanzen verstehen und auswertenSchnelleinstieg
Die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen beurteilen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-7475-0819-0
1. Auflage 2024
www.mitp.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 7953 / 7189 - 079
Telefax: +49 7953 / 7189 - 082
© 2024 mitp Verlags GmbH & Co. KG, Frechen
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Dieses E-Book verwendet das EPUB-Format und ist optimiert für die Nutzung mit Apple Books auf dem iPad von Apple. Bei der Verwendung von anderen Readern kann es zu Darstellungsproblemen kommen.
Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des E-Books das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Der Verlag schützt seine E-Books vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die E-Books mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert. Bei Kauf in anderen E-Book-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Lektorat: Katja Völpel, Nicole Winkel
Covergestaltung: Christian Kalkert
Bildnachweis: goodluz/stock.adobe.com
Satz: Petra Kleinwegen
electronic publication: CPI books GmbH, Leck
Inhalt
Bilanzen verstehen und auswerten
Was können Sie hier erwarten?
An wen richtet sich das Buch?
Aufbau des Buchs
Teil 1: Grundlagen
1 Das betriebliche Rechnungswesen
1.1 Das Unternehmen in seinem Umfeld
1.1.1 Die zentralen Akteure unseres Wirtschaftslebens
1.1.2 Die Aktivitäten des Unternehmens
1.2 Aufgaben des betrieblichen Rechnungswesens
1.2.1 Dokumentationsfunktion
1.2.2 Informationsfunktion
1.2.3 Planungsfunktion
1.2.4 Kontrollfunktion
1.2.5 Zahlungsbemessungsfunktion
1.3 Adressaten von Finanzinformationen
1.3.1 Interne Stakeholder
1.3.2 Externe Stakeholder
1.4 Internes und externes Rechnungswesen
1.4.1 Internes Rechnungswesen
1.4.2 Externes Rechnungswesen
1.5 Die Bilanz im betrieblichen Rechnungswesen
1.6 Verschiedene Arten von Bilanzen
1.6.1 Eröffnungs-, Schluss- und Liquidationsbilanzen
1.6.2 Einzel- und Konzernbilanzen
1.6.3 Handels- und Steuerbilanzen
1.6.4 Ordentliche und außerordentliche Bilanzen
1.7 Unterschiedliche Rechnungslegungsvorschriften
1.7.1 Lokales Handelsrecht
1.7.2 International Financial Reporting Standards (IFRS)
1.7.3 US Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP)
2 Der Jahresabschluss
2.1 Aufstellungs-, Prüfungs- und Offenlegungspflichten
2.1.1 Aufstellungspflicht
2.1.2 Prüfungspflicht
2.1.3 Offenlegungspflicht
2.1.4 Zwecke der Aufstellungs-, Prüfungs- und Offenlegungspflichten
2.2 Die Kernbestandteile des Jahresabschlusses
2.2.1 Die Bilanz
2.2.2 Die Gewinn- und Verlustrechnung
2.2.3 Die Kapitalflussrechnung
2.3 Bestands- und Stromgrößen
2.3.1 Bestandsgrößen
2.3.2 Stromgrößen
2.3.3 Bestands- und Stromgrößen in den Finanzberichten
2.4 Zusammenhang zwischen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Kapitalflussrechnung
Teil 2: Jahresabschluss
3 Die Bilanz verstehen
3.1 Zwei Seiten einer Medaille
3.2 Die Aktivseite verstehen
3.2.1 Anlage- und Umlaufvermögen
3.2.2 Goodwill und immaterielle Vermögensgegenstände
3.2.3 Sachanlagen
3.2.4 Finanzanlagen
3.2.5 Vorräte
3.2.6 Forderungen aus Lieferung und Leistung
3.2.7 Flüssige Mittel
3.3 Die Passivseite verstehen
3.3.1 Eigen- und Fremdkapital
3.3.2 Eigenkapital
3.3.3 Rückstellungen
3.3.4 Langfristige Verbindlichkeiten
3.3.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
3.4 Working Capital
3.4.1 Was ist Working Capital?
3.4.2 Working CapitalDays
3.4.3 Cash Conversion Cycle
3.4.4 Working Capital Management
3.5 Investitionsmanagement
3.5.1 Der Wertbegriff und Shareholder Value
3.5.2 Investitionen im betrieblichen Umfeld
3.5.3 Der Zeitwert des Geldes
3.5.4 Statische und dynamische Verfahren
3.5.5 Kapitalwertmethode
4 Die Gewinn- und Verlustrechnung verstehen
4.1 Grundstruktur einer Gewinn- und Verlustrechnung
4.2 Umsatz- und Gesamtkostenverfahren
4.2.1 Das Umsatzkostenverfahren
4.2.2 Gesamtkostenverfahren
4.3 Umsatzrealisierung
4.4 Auftragseingang und Auftragsbuch
4.5 Funktionskosten
4.5.1 Umsatzkosten
4.5.2 Forschungs- und Entwicklungskosten
4.5.3 Marketing- und Vertriebskosten
4.5.4 Allgemeine Verwaltungskosten
4.6 Kostenarten
4.6.1 Materialkosten
4.6.2 Personalkosten
4.6.3 Weitere Kostenarten
4.7 Abschreibungen verstehen
4.7.1 Abschreibungsmethoden
4.7.2 Nutzungsdauer
4.8 Finanzergebnis
4.8.1 Finanzerträge
4.8.2 Finanzaufwendungen
4.9 Steuern
4.9.1 Körperschaftsteuer
4.9.2 Gewerbesteuer
4.9.3 Weitere Steuern
4.10 Ergebniskennzahlen
4.10.1 Bruttoergebnis
4.10.2 Operatives Ergebnis/EBIT
4.10.3 EBITDA
4.10.4 EBT
4.10.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
4.11 Ausschüttungs- und Dividendenpolitik
4.11.1 Gründe für die Gewinnthesaurierung
4.11.2 Gründe für die Ausschüttung von Gewinnen
5 Die Kapitalflussrechnung verstehen
5.1 Die Bedeutung der Liquidität
5.2 Drei Bereiche mit Liquiditätswirkung
5.3 Operativer Cashflow
5.4 Investitions-Cashflow
5.5 Finanzierungs-Cashflow
5.6 Liquiditätsmanagement
5.6.1 Kurzfristiges Liquiditätsmanagement
5.6.2 Langfristiges Liquiditätsmanagement
6 Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses
6.1 Anhang
6.1.1 Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze
6.1.2 Erläuternde und zusätzliche Angaben
6.1.3 Sonstige Angaben
6.2 Lagebericht
6.2.1 Rahmenbedingungen und Geschäftsentwicklung
6.2.2 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
6.2.3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren
6.2.4 Zukünftig: Nachhaltigkeitsbericht
6.3 Segmentberichterstattung
7 Bilanzpolitik
7.1 Zielsetzung der Bilanzpolitik
7.1.1 Positivere Darstellung
7.1.2 Negativere Darstellung
7.2 Formelle und materielle Bilanzpolitik
7.2.1 Formelle Bilanzpolitik
7.2.2 Materielle Bilanzpolitik
7.3 Grenzen der Bilanzpolitik
Teil 3: Bilanzanalyse
8 Einführung in die Bilanzanalyse
8.1 Einsatzgebiete der Bilanzanalyse
8.1.1 Analyse aus Investorensicht
8.1.2 Analyse der Kreditwürdigkeit
8.1.3 Analyse der Stabilität eines Geschäftspartners
8.1.4 Analyse zu internen Zwecken
8.2 Spielarten der Bilanzanalyse
8.3 Benchmarking und interner Vergleich
8.3.1 Interner Vergleich
8.3.2 Externes Benchmarking
8.4 Ablauf und Vorgehen bei der Bilanzanalyse
8.4.1 Quellenbeschaffung
8.4.2 Aufbereitung des Zahlenmaterials
8.4.3 Berechnung der Kennzahlen
8.4.4 Interpretation der Ergebnisse
8.5 Vorausschauende Bilanzanalyse
8.6 Grenzen der Bilanzanalyse
9 Beurteilung der finanziellen Stabilität
9.1 Analyse der Vermögensstruktur/Investitionsanalyse
9.1.1 Anlagenintensität
9.1.2 Umlaufintensität
9.1.3 Investitionsquote
9.1.4 Wachstumsquote
9.1.5 Investitionsanteil am Umsatz
9.1.6 Anlagenabnutzungsgrad
9.1.7 Abschreibungsquote
9.1.8 Vorratsintensität
9.1.9 Anlagenbindung
9.1.10 Umschlagshäufigkeit der Vorräte
9.1.11 Lagerdauer
9.1.12 Debitorenlaufzeit
9.1.13 Kreditorenlaufzeit
9.2 Analyse der Kapitalstruktur/Finanzierungsanalyse
9.2.1 Eigenkapitalquote
9.2.2 Fremdkapitalquote
9.2.3 Gearing/Verschuldungsgrad
9.2.4 Dynamischer Verschuldungsgrad
9.2.5 Selbstfinanzierungsgrad
9.2.6 Anlagendeckungsgrad I und II
9.2.7 Nettoverschuldungsgrad
9.3 Analyse der Liquidität
9.3.1 Liquidität 1. Grades
9.3.2 Liquidität 2. Grades
9.3.3 Liquidität 3. Grades
9.3.4 Gründe für schlechte Liquidität
10 Beurteilung der Ertragssituation
10.1 Rentabilitätsanalyse
10.1.1 Eigenkapitalrendite
10.1.2 Gesamtkapitalrendite
10.1.3 Umsatzrentabilität
10.1.4 Profitabilitätsmargen
10.1.5 Kapitalumschlag
10.1.6 Return on Capital Employed
10.2 Ergebnisanalyse
10.2.1 Ergebnisspaltung
10.2.2 Vorgehen bei der Ergebnisspaltung
10.2.3 Personalintensität
10.2.4 Materialintensität
Schlussbemerkungen
Danksagungen
Für Mama und Papa
Einleitung
Bilanzen verstehen und auswerten
Sie möchten sich mit dem Thema Bilanzen auseinandersetzen und ein Verständnis für die Finanzen eines Unternehmens entwickeln? Vielleicht haben Sie sogar ein konkretes Projekt, bei dem Ihnen das Wissen um die Situation eines Unternehmens helfen würde? Wunderbar, ich heiße Sie herzlich willkommen!
In den letzten siebzehn Jahren habe ich mich intensiv mit Unternehmensfinanzen beschäftigt. Als Investmentbanker habe ich die Zahlen eines Unternehmens zur Bewertung herangezogen. Als Unternehmensberater haben mir die Zahlen meiner Kunden geholfen, Ansatzpunkte für Optimierungsmaßnahmen zu finden und deren Wirksamkeit zu überprüfen. Und als Leiter des Rechnungswesens eines mittelständischen Produktionskonzerns bin ich nun selbst für die Erstellung des Jahresabschlusses verantwortlich.
All diese Erfahrungen habe ich in dieses Buch einfließen lassen und versucht, das Thema Finanzen möglichst einfach und anwendergerecht darzustellen.
Was können Sie hier erwarten?
Sie erhalten eine verständlich geschriebene Einführung in die Thematik der betrieblichen Finanzwirtschaft. Sie entwickeln ein Grundverständnis für die Rahmenbedingungen, unter denen Unternehmenszahlen entstehen. Darüber hinaus lernen Sie die wesentlichen Bestandteile des Jahresabschlusses kennen. Er ist das zentrale Instrument, um Außenstehende über die Lage eines Unternehmens zu informieren. Darüber hinaus möchte ich Ihnen erste Ansatzpunkte vermitteln, wie Sie diese Zahlen weiter analysieren können, um noch mehr Erkenntnisse aus den Zahlen der Unternehmen, mit denen Sie zu tun haben, zu gewinnen. Am Ende dieses Buchs werden Sie in der Lage sein, eine Bilanz »zu verstehen und auszuwerten«.
Was dieses Buch jedoch nicht leisten kann, ist eine detaillierte und vollständige Beschreibung aller Aspekte der Buchführung und des Jahresabschlusses. Sie werden hier nicht lernen, wie man Geschäftszahlen erzeugt und in einem Jahresabschluss zusammenfasst.
Dieses Buch ist eine schnelle Einführung in das Thema, die Ihnen einen soliden Ausgangspunkt bietet, auf dem Sie aufbauen können. Mithilfe dieses Buchs können Sie sich ein erstes Bild von der Lage eines Unternehmens machen. Sie können die Informationen, die ein Unternehmen veröffentlicht, kritisch hinterfragen und sich eine erste eigene Meinung bilden. Das ist doch schon mal was!
Wir leben in einer stark wirtschaftlich geprägten Welt. Jeden Tag haben wir mit Unternehmen zu tun. Dabei ist es hilfreich, wenn wir diese Unternehmen besser einschätzen können. Wenn wir wissen, wie es einem Unternehmen geht, hilft uns das, selbst bessere Entscheidungen zu treffen. Deshalb lohnt es sich meiner Meinung nach für jeden, sich zumindest ein Grundwissen über Unternehmensfinanzierung anzueignen. Genau das bietet dieses Einführungsbuch.
An wen richtet sich das Buch?
Daher richtet sich dieses Buch in erster Linie an den Einsteiger1, der sich für das Thema Unternehmensfinanzen interessiert. Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf den Nutzern der Zahlen, die ein Unternehmen veröffentlicht. Dies sind die Adressaten des veröffentlichten Jahresabschlusses eines Unternehmens.
Aus diesem Grund ist das Buch eher nicht für fortgeschrittene Leser geeignet, die bereits über ein Grundverständnis des Themas verfügen. Ebenso wenig ist es für Personen geeignet, die eine Karriere als Buchhalter oder Controller im Finanzbereich eines Unternehmens anstreben. Es hilft eher denjenigen, die sich mit Buchhaltern und Controllern auf Augenhöhe darüber unterhalten wollen, was die Zahlen eines Unternehmens eigentlich bedeuten.
1Rein aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwende ich in diesem Buch im Regelfall die männliche Form. Selbstverständlich richtet sich dieses Buch dennoch an Leser aller Geschlechter.
Aufbau des Buchs
Um dem Zweck dieses Buchs gerecht zu werden, ist es in drei Teile gegliedert. Jeder Teil baut auf dem vorhergehenden auf. Es lohnt sich daher, das Buch von Anfang bis Ende durchzuarbeiten.
In Teil 1 werden wir uns mit den absoluten Grundlagen der Unternehmensfinanzierung befassen und eine solide Basis schaffen, die es Ihnen ermöglicht, in detailliertere Themen einzusteigen.
Dazu betrachten wir in Kapitel 1 den organisatorischen Rahmen, in dem ein Unternehmen agiert und seine Zahlen produziert. Auf diese Weise arbeiten wir uns langsam und behutsam in das Thema ein.
Kapitel 2 gibt dann einen ersten Überblick über die wichtigsten Berichte und Informationen, die Unternehmen über ihre Aktivitäten veröffentlichen. Sie erhalten auch ein Verständnis für die Art der Informationen und wie diese miteinander in Beziehung stehen.
In Teil 2 des Buchs geht es »ans Eingemachte«. Wir werden uns im Detail mit den wichtigsten Berichten beschäftigen, die von Unternehmen veröffentlicht werden. Dabei beginnen wir in Kapitel 3 mit der Bilanz, die als das »Herzstück« der Informationen über ein Unternehmen angesehen werden kann. Abgerundet wird das Kapitel durch eine Einführung in das zentrale Thema »Working Capital Management«. Darüber hinaus wird auch auf die Investitionstätigkeit eines Unternehmens in sein Vermögen eingegangen.
Kapitel 4 widmet sich der Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens. Sie gibt Aufschluss über den Erfolg eines Unternehmens und die Quellen, aus denen er sich speist.
Kapitel 5 befasst sich mit der Kapitalflussrechnung, die einen wichtigen Einblick in die verschiedenen Zahlungsströme eines Unternehmens gibt. Wie wir noch sehen werden, ist diese Sichtweise von großer praktischer Bedeutung.
In Kapitel 6 werden weitere Bestandteile des Jahresabschlusses vorgestellt. Diese helfen, einen noch tieferen Einblick in die Situation eines Unternehmens zu gewinnen.
Das Thema Bilanzpolitik wird in Kapitel 7 behandelt. Denn auch wenn es nicht den Anschein hat, kann man bei den Zahlen eines Unternehmens nicht immer zwischen »Schwarz« und »Weiß« unterscheiden.
Im dritten Teil des Buchs wird der Frage nachgegangen, wie mithilfe der Bilanzanalyse noch mehr Informationen aus den veröffentlichten Zahlen der Unternehmen gewonnen werden können. Dazu wird in Kapitel 8 ein erster Überblick gegeben und das Thema eher konzeptionell erläutert.
In Kapitel 9 gehen wir detailliert auf die Analyse der finanziellen Stabilität eines Unternehmens ein. Sie lernen verschiedene Kennzahlen kennen, mit deren Hilfe neue Informationen gewonnen und Aussagen zu einzelnen Kennzahlen verdichtet werden können.
Das abschließende Kapitel 10 widmet sich der Analyse der Ertragslage eines Unternehmens. Sie lernen, wie Sie mithilfe weiterer Kennzahlen die Qualität des Unternehmenserfolgs beurteilen können. Außerdem erfahren Sie, wie Sie den Erfolg in nachhaltige und Sondereffekte aufteilen können.
Sie sehen, es erwartet Sie eine Fülle neuer Informationen, Konzepte und Ideen, die Ihnen einen schnellen Einstieg in das spannende Thema Finanzen ermöglichen sollen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.
Christoph Hehemann
Poing, im März 2024
Teil 1
Grundlagen
1 Das betriebliche Rechnungswesen
2 Der Jahresabschluss
Kapitel 1
Das betriebliche Rechnungswesen
Die Wirtschaft ist ein untrennbarer Bestandteil unseres gesellschaftlichen Lebens. Täglich kommen wir mit ihr in Berührung und nehmen selbst am wirtschaftlichen Geschehen teil. Morgens kaufen wir unser Frühstück beim Bäcker. Danach fahren wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit. Am Arbeitsplatz setzen wir unsere Arbeitskraft und Kreativität ein, um unseren Arbeitgeber zum Erfolg zu führen. Auch in unserer Freizeit interagieren wir wirtschaftlich mit anderen Akteuren, wenn wir zum Beispiel auf dem heimischen Sofa den neuesten Netflix-Blockbuster konsumieren.
Damit bestimmt die Wirtschaft maßgeblich unsere Lebensqualität. Denn all die Produkte, die wir so selbstverständlich konsumieren und nutzen, wurden von wirtschaftlich geprägten Unternehmen hergestellt. Weil Unternehmen Produkte und Dienstleistungen anbieten, die für uns einen hohen Mehrwert haben, sind wir bereit, unser hart verdientes Geld dafür auszugeben.
Diese finanzielle Komponente schafft gleichzeitig Anreize für Unternehmen. Die Aussicht auf Erfolg treibt Innovationen und Verbesserungen voran, die uns in Zukunft einen noch größeren Mehrwert bieten sollen.
Obwohl unser tägliches Leben untrennbar mit der Wirtschaft verbunden ist, haben die meisten von uns wenig oder gar keinen Bezug dazu. Unser eigenes wirtschaftliches Handeln ist meist von Gewohnheiten geprägt und eher intuitiv. Nur wenige von uns haben einen wirklichen Einblick in die Wirtschaft und ihre Funktionsweise, geschweige denn ein wirkliches Verständnis dafür.
Finanzen sind die »Sprache« der Wirtschaft
Ein erster Schritt zu einer bewussteren Teilnahme am Wirtschaftsleben ist ein besseres Verständnis der »Sprache«, in der man in der Wirtschaft miteinander kommuniziert: der Finanzen.
Fast jede Handlung im Wirtschaftsleben lässt sich in Zahlen ausdrücken. So führt der Kauf unseres Frühstücksbrötchens beim Bäcker zu einem Umsatz. Im Gegenzug entstehen dem Bäcker Kosten für Mehl, Hefe und Personal. Auch die Kosten für den Backofen müssen bei der Preiskalkulation berücksichtigt werden. Wer versteht, wie sich all diese Vorgänge in den Finanzen eines Unternehmens niederschlagen, kann unsere Wirtschaft besser verstehen.
Das betriebliche Rechnungswesen bildet den organisatorischen Rahmen
Aus Sicht eines Unternehmens bildet das betriebliche Rechnungswesen den organisatorischen Rahmen für das Finanzwesen. Seine Aufgabe ist es, alle Geschäftsvorfälle des Unternehmens
□ zu erfassen,
□ abzubilden,
□ aufzubereiten,
□ zu berichten und
□ zu analysieren.
In diesem Kapitel wollen wir uns daher mit verschiedenen Aspekten des betrieblichen Rechnungswesens beschäftigen. Wir beleuchten die unterschiedlichen Aufgaben, die es erfüllt. Wir gehen auf die verschiedenen Adressaten ein, an die sich das betriebliche Rechnungswesen wendet. Wir betrachten den Aufbau des betrieblichen Rechnungswesens. Und wir ordnen die Bilanz in diesen organisatorischen Überbau ein. Außerdem stellen wir die verschiedenen Rechnungslegungsstandards vor, die die Arbeit des betrieblichen Rechnungswesens bestimmen. Vor allem aber wollen wir ein einzelnes Unternehmen in seinem Umfeld betrachten. Sie werden verstehen, in welche Art von Beziehungen ein Unternehmen eingebunden ist und wie sich diese in den Finanzen niederschlagen.
1.1 Das Unternehmen in seinem Umfeld
Unser Wirtschaftsleben ist dadurch gekennzeichnet, dass Geschäfte auf verschiedenen Märkten abgeschlossen werden. Bei einem einzelnen Geschäft stehen sich zwei Parteien gegenüber. Der eine ist der Nachfrager, der andere der Anbieter.
1.1.1 Die zentralen Akteure unseres Wirtschaftslebens
Unsere Wirtschaft besteht aus einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure. Diese verschiedenen Parteien vertreten ihre eigenen Interessen und handeln im Wirtschaftsleben miteinander.
Private Haushalte
Private Akteure wie Sie und ich nehmen am Wirtschaftsleben teil. Wir Privatpersonen treten meist als Nachfrager und Konsumenten von Gütern und Dienstleistungen auf. Wir kaufen Waren des täglichen Bedarfs, nehmen Dienstleistungen in Anspruch oder schaffen uns größere Güter wie Fahrzeuge oder Einrichtungsgegenstände an.
Öffentliche Haushalte
Aber auch öffentliche Haushalte wie Kommunen oder Bundesländer sind im Wirtschaftsleben aktiv. Auch sie treten in der Regel als Konsumenten auf.
Allerdings kaufen öffentliche Haushalte Güter, um ihre hoheitlichen Aufgaben zu erfüllen. So kaufen Kommunen Straßenbeleuchtungen, um die Straßen ihrer Gemeinde sicherer zu machen. Oder sie beauftragen Busunternehmen mit dem Betrieb eines Schulbusses.
Unternehmen
Unternehmen nehmen im Wirtschaftsleben eine besondere Stellung ein. Denn sie stehen auf beiden Seiten des Wirtschaftsgeschehens. Einerseits sind Unternehmen ebenfalls Nachfrager. Sie kaufen verschiedenste Güter und Dienstleistungen ein, die sie für ihre Aktivitäten benötigen.
Gleichzeitig produzieren Unternehmen aber auch selbst Produkte und Dienstleistungen, die sie anderen Teilnehmern am Wirtschaftskreislauf zum Kauf anbieten.
1.1.2 Die Aktivitäten des Unternehmens
Betrachten wir diese verschiedenen Aktivitäten eines Unternehmens etwas genauer. Denn aus Sicht des Unternehmens entspricht jede Handlung in der Wirtschaft einem einzelnen Geschäftsvorfall. Die Geschäftsvorfälle wiederum werden in der Buchhaltung erfasst und schlagen sich in den verschiedensten Berichten des Unternehmens nieder.
Das Unternehmen auf dem Beschaffungsmarkt
Beginnen wir mit dem Kerngeschäft eines Unternehmens. Um seine eigentliche Leistung zu erstellen, benötigt ein Unternehmen Input. Dazu gehören Materialien, die das Unternehmen zu seinen Produkten weiterverarbeitet. Für die Weiterverarbeitung werden verschiedenste Maschinen benötigt, die ein Unternehmen auch anschaffen muss. Aber auch Arbeitskräfte werden benötigt, um die Materialien zu Produkten weiterzuverarbeiten und die Maschinen zu bedienen. Auch administrative Arbeitskräfte werden von Unternehmen im Rahmen seiner Leistungserstellung eingesetzt.
Diese verschiedenen Inputfaktoren beschafft sich ein Unternehmen auf dem Beschaffungsmarkt. Dort tritt es als Nachfrager auf und trifft in der Regel auf andere Unternehmen. Diese liefern dem Unternehmen die benötigten Materialien und Maschinen. Arbeitskräfte beschafft sich ein Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt, der ein Teilmarkt des Beschaffungsmarktes ist, und stellt Mitarbeiter ein oder beschäftigt Leiharbeitnehmer.
Die Leistungserstellung im Unternehmen
Der nächste Prozessschritt betrifft die eigentliche Leistungserstellung im Unternehmen. In einem produzierenden Unternehmen werden die verschiedenen Inputfaktoren miteinander kombiniert, um die Produkte des Unternehmens herzustellen. Das von den Lieferanten eingekaufte Material wird aus den Regalen des Lagers an die Arbeitsplätze in der Fertigung gebracht. Dort wird es mithilfe von Maschinen und anderen Produktionsmitteln verarbeitet. An den Maschinen stehen die Produktionsmitarbeiter, die das Unternehmen eingestellt hat, und bedienen die Maschinen.
Ein Produktionsprozess kann in mehreren Schritten ablaufen. So werden z.B. in einem Bereich der Vorproduktion nur Bauteile oder Module hergestellt. Diese sind für sich genommen nicht zum Verkauf bestimmt, sondern gehen selbst wieder in andere Bauteile oder Endprodukte ein. Aus den Komponenten und Modulen wird in der Endmontage das verkaufsfähige Produkt zusammengesetzt. Anschließend wird es verpackt und wieder eingelagert.
Auch in einem Dienstleistungsunternehmen findet eine Leistungserstellung statt. Nur wird hier kein physisches Produkt in einer Fabrik hergestellt, sondern eine Dienstleistung erbracht.
Gerade bei Dienstleistungsunternehmen, wie z.B. einem Friseursalon oder einer Anwaltskanzlei, spielen die Mitarbeiter und deren Qualifikation sowie Erfahrung eine entscheidende Rolle. Die Qualität der erbrachten Dienstleistung hängt stark von der Qualität und Motivation der Mitarbeiter ab.
Das Unternehmen auf dem Absatzmarkt
Einkauf und Leistungserstellung allein reichen jedoch nicht aus. Das Unternehmen muss Abnehmer für seine Produkte und Dienstleistungen finden. Denn ohne Kunden gibt es keinen Umsatz. Und ohne Umsatz kann ein Unternehmen seine Kosten für Materialeinkauf, sonstige laufende Kosten und Investitionen nicht tragen.
Unternehmen wenden sich daher dem Absatzmarkt zu. Auf den Absatzmärkten treffen Unternehmen auf andere Teilnehmer am Wirtschaftskreislauf. Diese treten als Nachfrager und Käufer mit dem Unternehmen in Kontakt.
Die Aktivitäten eines Unternehmens auf dem Absatzmarkt lassen sich grob in zwei Bereiche unterteilen: Die Marketingaktivitäten zielen darauf ab, Interessenten für die Angebote des Unternehmens zu gewinnen. Dies geschieht durch Werbung, Kommunikation, Produktgestaltung und andere verkaufsfördernde Maßnahmen.
Aus den Marketingaktivitäten gehen Interessenten und potenzielle Kunden hervor. Diese werden wiederum vom Vertrieb des Unternehmens übernommen. Im Austausch mit dem Kunden ermittelt der Vertrieb, welche Bedürfnisse der Kunde hat und welche Leistungen des Unternehmens zur Befriedigung dieser Bedürfnisse geeignet sind.
Am Ende dieses Austausches unterbreitet das Unternehmen dem Interessenten ein Angebot, das dieser annehmen oder ablehnen kann. Sind sich Unternehmen und Interessent einig, kommt das Geschäft zustande. Ein produzierendes Unternehmen liefert seine Produkte an den Kunden aus. Ein Dienstleistungsunternehmen erbringt seine Dienstleistung.
Das Unternehmen und der Staat
Neben der eigentlichen Leistungserstellung steht das Unternehmen in weiteren Beziehungen zu seiner Umwelt. Auch diese Beziehungen spiegeln sich über Geschäftsvorfälle in den Zahlen des betrieblichen Rechnungswesens wider.
Ein Beispiel hierfür sind die Beziehungen des Unternehmens zu verschiedenen öffentlichen Stellen. Dazu gehören z.B. Kommunen, Finanzämter oder andere staatliche Stellen.
Gerade zu den Finanzämtern hat ein Unternehmen eine dauerhafte Beziehung. Denn wie jeder andere Akteur in unserer Gesellschaft müssen auch Unternehmen Steuern bezahlen.
Aber auch die öffentliche Hand erbringt Leistungen, die sich unter anderem an Unternehmen richten. Darüber hinaus unterstützen Ämter und Ministerien förderungswürdige Initiativen.
Für Unternehmen gibt es zahlreiche Förderprogramme, um Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zu motivieren oder die Transformation der Wirtschaft hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise voranzutreiben. Aus solchen Programmen können Unternehmen Förderleistungen erhalten, um sich bei entsprechenden Vorhaben durch die öffentliche Hand unterstützen zu lassen. Auch diese Unterstützungsleistungen schlagen sich in den Zahlen eines Unternehmens nieder.
Das Unternehmen auf den Kapitalmärkten
Eine weitere Kategorie von Beziehungen unterhält das Unternehmen zu den Kapitalmärkten. Die verschiedenen Aktivitäten eines Unternehmens erfordern Kapital. Dieses Kapital kann ein Unternehmen aus eigener Kraft erwirtschaften, indem es seine Leistungen gewinnbringend verkauft. Größere Vorhaben wie der Eintritt in neue Märkte, der Bau einer neuen Fabrik oder ein Transformationsprogramm hin zu mehr Nachhaltigkeit erfordern jedoch häufig größere Investitionssummen.
Dieses Kapital beschafft sich ein Unternehmen meistens von externen Investoren. Dies können neue oder bestehende Eigentümer sein, aber auch Banken stellen Unternehmen das benötigte Kapital über Kredite zur Verfügung.
Abbildung 1.1: Das Unternehmen in seiner Umwelt
1.2 Aufgaben des betrieblichen Rechnungswesens
Wie wir noch sehen werden, besteht das betriebliche Rechnungswesen aus verschiedenen Teilbereichen. Jeder dieser Teilbereiche verfügt über eigene Instrumente, um die Aufgaben des betrieblichen Rechnungswesens zu erfüllen. Zu den wichtigsten und zentralen Aufgaben des Rechnungswesens gehören:
□ Dokumentationsfunktion
□ Informationsfunktion
□ Planungsfunktion
□ Kontrollfunktion
□ Zahlungsbemessungsfunktion
1.2.1 Dokumentationsfunktion
Eine der wichtigsten Aufgaben des betrieblichen Rechnungswesens ist die Dokumentation. Jeder Geschäftsvorfall, der sich im Zahlenwerk des Unternehmens niederschlägt, muss lückenlos dokumentiert werden.
Die Dokumentation ermöglicht es, die Entwicklung des Unternehmens nachzuvollziehen. Auch Jahre später müssen Unternehmen in der Lage sein, jeden Geschäftsvorfall erklären zu können. Dies ist beispielsweise im Rahmen von Betriebsprüfungen relevant. Die Dokumentation des Unternehmens muss so gestaltet sein, dass sich ein sachverständiger Dritter in angemessener Zeit in die Geschäftsvorfälle einarbeiten und diese nachvollziehen kann.
1.2.2 Informationsfunktion
Eine weitere wichtige Aufgabe des betrieblichen Rechnungswesens ist die Informationsfunktion. Interessierte Außenstehende sollen durch die veröffentlichten Zahlen eines Unternehmens in die Lage versetzt werden, sich ein Bild über die Lage und Entwicklung des Unternehmens zu machen.
Sie nutzen diese Informationen, um eigene Entscheidungen in Bezug auf das Unternehmen zu treffen. Beispielsweise interessieren sich die Aktionäre eines Unternehmens für die Lage ihrer Investition. Sie nutzen die Informationen, um zu entscheiden, ob sie weiterhin im Unternehmen investiert sein wollen.
1.2.3 Planungsfunktion
Die Informationen des Rechnungswesens sind eine wichtige Informationsquelle für die verantwortliche Unternehmensführung. Mithilfe der Zahlen und weiterer Inputs entwickelt sie eine Planung für die kurz- und mittelfristige Zukunft. Diese Planung wird mit konkreten Maßnahmen unterlegt, die es ermöglichen sollen, die Planung Wirklichkeit werden zu lassen.
Das betriebliche Rechnungswesen dient somit auch der Steuerung eines Unternehmens. Nur wenn das Management detaillierte und aktuelle Informationen über den Zustand des Unternehmens hat, kann es konkrete Maßnahmen ergreifen, um das Unternehmen zum Erfolg zu führen.
1.2.4 Kontrollfunktion
Das Rechnungswesen dient auch der Kontrolle des Unternehmens und seiner Entwicklung. Dabei geht es vor allem darum, die Erwartungen mit der tatsächlichen Entwicklung zu vergleichen. Bei Abweichungen kann man der Sache auf den Grund gehen und versuchen, die Ursachen für die unterschiedliche Entwicklung zu verstehen. Aus den so gewonnenen Erkenntnissen können Rückschlüsse auf die mögliche zukünftige Entwicklung des Unternehmens gezogen werden.
An der Kontrolle des Unternehmens sind sowohl interne als auch externe Parteien interessiert. Das Management eines Unternehmens hat ein großes Interesse daran, die von der ursprünglichen Planung abweichende Entwicklung des Unternehmens nachvollziehen zu können. Eine solche Analyse ermöglicht es dem Management, Maßnahmen zu ergreifen, um die Entwicklung in die gewünschte Richtung zu lenken.
Aber auch Externe wollen verstehen, warum sich ein Unternehmen so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Beispielsweise haben die Lieferanten eines Unternehmens ein großes Interesse an der Geschäftsbeziehung zum Unternehmen. Sie wollen wissen, ob das Unternehmen auch in Zukunft ein zuverlässiger Geschäftspartner sein wird oder ob in absehbarer Zeit mit Zahlungsausfällen zu rechnen ist.
1.2.5 Zahlungsbemessungsfunktion
Auf Basis der Informationen aus dem Rechnungswesen werden verschiedene Zahlungsverpflichtungen des Unternehmens ermittelt. Gegenüber dem Fiskus schuldet das Unternehmen diverse Steuerzahlungen, die vom Unternehmenserfolg abhängen. Aber auch die Höhe möglicher Gewinnausschüttungen des Unternehmens an seine Eigentümer wird mithilfe der Zahlen des Rechnungswesens ermittelt.
1.3 Adressaten von Finanzinformationen
An Informationen über das Unternehmen ist eine Vielzahl unterschiedlichster Parteien interessiert. Diese lassen sich in zwei Gruppen einteilen: Interne Interessenten sind im Unternehmen tätig und haben daher tiefere und detailliertere Einblicke in das Unternehmen. Daneben gibt es auch externe Interessenten, die außerhalb des Unternehmens stehen und sich ebenfalls für seine Lage interessieren.
Beide Gruppen werden auch als »Stakeholder« (Anspruchsgruppen) bezeichnet.
Zu den wichtigsten internen Stakeholdern zählen:
□ Eigentümer
□ Management
Die zentralen externen Stakeholder eines Unternehmens sind:
□ Mitarbeiter
□ Kunden
□ Lieferanten
□ der Staat
□ die Öffentlichkeit
Sehen wir uns die verschiedenen Stakeholder eines Unternehmens einmal im Detail an.
1.3.1 Interne Stakeholder
Eigentümer
Die Eigentümer eines Unternehmens haben ein großes Interesse am Erfolg »ihres« Unternehmens. Sie sind an Informationen über die aktuelle Situation und dem erzielten Erfolg interessiert. Sie wollen informiert sein und auf dieser Basis entscheiden, ob sie an ihrer Investition festhalten wollen.
Je nach Größe eines Unternehmens, seiner Rechtsform und seiner Nähe zum Kapitalmarkt können die Eigentümer sehr unterschiedlich sein. Bei sehr großen börsennotierten Unternehmen gibt es eine sehr große Anzahl von Eigentümern. Jeder, der mindestens eine einzelne Aktie des Unternehmens besitzt, ist Eigentümer. Allerdings besitzt er dann auch nur einen sehr kleinen Anteil am Unternehmen.
Daneben gibt es aber vor allem bei kleineren Unternehmen die Situation, dass die Eigentümer gleichzeitig selbst im Unternehmen tätig sind. Insbesondere bei sehr kleinen, aber auch bei größeren mittelständischen Unternehmen ist dies die Regel.
Management
Das Management eines Unternehmens kann, muss aber nicht gleichzeitig Eigentümer des Unternehmens sein. Bei größeren Unternehmen ist es eher die Regel, dass Eigentum und Management voneinander getrennt sind. In diesen Fällen handelt das Management im Auftrag der Eigentümer mit dem Ziel, das Unternehmen so erfolgreich wie möglich zu führen.
Zur Erfüllung dieser Führungsaufgabe nutzt das Management die Informationen des Unternehmens. Im Tagesgeschäft treten regelmäßig kleinere und größere Probleme auf, die mithilfe von Informationen aus dem Rechnungswesen gelöst werden können.
1.3.2 Externe Stakeholder
Mitarbeiter
Die Mitarbeiter des Unternehmens werden in der Regel als externe Stakeholder betrachtet, obwohl sie im Unternehmen tätig sind. Dies liegt daran, dass sie im Regelfall keinen umfassenden Einblick in alle Details des Unternehmens haben. Meist beschränkt sich das interne Wissen auf einen sehr kleinen Bereich, in dem der Mitarbeiter tätig ist.
Dennoch sind die Mitarbeiter eines Unternehmens an der Situation ihres Arbeitgebers interessiert. Denn von der Entwicklung des Unternehmens hängt auch die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes ab. Geht es dem Unternehmen schlecht, ist auch der Arbeitsplatz und damit die Existenzgrundlage der Mitarbeiter in Gefahr. Gut qualifizierte Mitarbeiter werden sich in solchen Fällen nach einem neuen Arbeitsplatz umsehen.
Kunden
Auch die Kunden eines Unternehmens sind an dessen Entwicklung interessiert. Gerade in einer Kunden-Lieferanten-Beziehung zwischen zwei Unternehmen ist eine langfristige Zusammenarbeit oft die Regel. Ein Kunde, der das Unternehmen als langfristigen und strategisch wichtigen Lieferanten ausgewählt hat, möchte diese wichtige Beziehung sorgfältig überwachen. Geht es dem Unternehmen schlecht, ist auch eine für den Kunden wichtige Lieferantenbeziehung gefährdet.
Aus diesem Grund werden die Volumina der gemeinsamen Geschäfte auf beiden Seiten kontinuierlich überwacht. Übersteigt das Volumen ein Maß, bei dem sich einer der beiden Partner unwohl fühlt, werden Gespräche aufgenommen, um die Sicherheit zu erhöhen.
Lieferanten
Auf der anderen Seite unterhält jedes Unternehmen auch Beziehungen zu seinen eigenen Lieferanten. Und auch für diese ist es interessant zu wissen, wie es dem Unternehmen geht. Denn viele Lieferanten gehen zunächst in Vorleistung. Sie liefern ihre Produkte und stellen diese dann in Rechnung.
Die Bezahlung für die erbrachte Leistung erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt. Das liegt daran, dass im Rahmen der Kunden-Lieferanten-Beziehung feste Zahlungsbedingungen vereinbart werden. Für den Lieferanten besteht somit immer das Risiko, dass er seine Leistung zwar erbringt, aber im Falle einer Insolvenz seines Kunden auf einen Teil oder sogar die gesamte Forderung verzichten muss.
Lieferanten werden daher das Unternehmen und dessen Zahlungsverhalten genau beobachten, insbesondere wenn es sich um einen großen und wichtigen Kunden handelt.
Staat
Auch die verschiedenen Institutionen des Staates interessieren sich für die Zahlen des Unternehmens. Unternehmen sind neben den Privatpersonen eine wichtige Finanzierungsquelle für den Staat. Deshalb müssen auch Unternehmen Steuern zahlen.
Damit die zu zahlenden Steuern ermittelt werden können, müssen Unternehmen wie Privatpersonen Steuererklärungen abgeben. Die Zahlen in den Steuererklärungen ergeben sich aus den Aufzeichnungen des betrieblichen Rechnungswesens.
Darüber hinaus finden regelmäßig Betriebsprüfungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten in den Unternehmen statt. Betriebsprüfer der Finanzämter nehmen das Zahlenmaterial genau unter die Lupe und beurteilen, ob alle Geschäftsvorfälle steuerlich korrekt abgewickelt wurden.
Öffentlichkeit
Nicht zuletzt interessiert sich auch die Öffentlichkeit für die Situation eines Unternehmens. Unternehmen sind selbstverständlich auch Teil des öffentlichen Lebens. Sie treten als Sponsoren auf. Sie fördern lokale Projekte. Und sie sorgen für einen regionalen Arbeitsmarkt und können größere Infrastrukturprojekte anstoßen.
Ein Unternehmen beeinflusst auch die ökologische Situation einer Region. Die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit nimmt auch Unternehmen in die Pflicht. Nicht nur Gesetze sind zu beachten, auch der Druck der Öffentlichkeit kann das Verhalten von Unternehmen beeinflussen und so für mehr Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft sorgen.
1.4 Internes und externes Rechnungswesen
Betrachten wir nun die Struktur des betrieblichen Rechnungswesens. Es lässt sich in ein internes und ein externes Rechnungswesen unterteilen. Beide Bereiche richten sich an unterschiedliche Adressaten, haben unterschiedliche Kerninstrumente und verfolgen unterschiedliche Ziele. Darüber hinaus bestehen Unterschiede in der rechtlichen Ausgestaltung der beiden Bereiche des Rechnungswesens.
Tabelle 1.1: Überblick über das interne und externe Rechnungswesen
1.4.1 Internes Rechnungswesen
Das interne Rechnungswesen ist ein Teilbereich des betrieblichen Rechnungswesens, der sich in erster Linie an unternehmensinterne Adressaten richtet. Zu den wichtigsten internen Adressaten gehört die Unternehmensleitung.
Darüber hinaus kann sich das interne Rechnungswesen insbesondere bei kleineren Unternehmen auch an die Gesellschafter richten. Auch Aufsichtsgremien wie der Aufsichtsrat oder ein Beirat können durch die Zahlen und Instrumente des internen Rechnungswesens informiert werden.
Der Hauptzweck des internen Rechnungswesens ist die Steuerung des Unternehmens. Das Ziel ist es, die Verantwortlichen zeitnah und detailliert über die Entwicklung des Unternehmens zu informieren. Darüber hinaus sollen entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung gestellt werden.
Zu diesem Zweck wurden verschiedene Instrumente entwickelt:
□ Kosten- und Leistungsrechnung
□ Investitionsrechnung
□ Finanzrechnung
□ Management-Reporting
Kosten- und Leistungsrechnung
Bei der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) geht es darum, die Kosten der betrieblichen Tätigkeit zu erfassen und auf die Leistungen des Unternehmens zu verteilen. Dadurch weiß ein Unternehmen genau, welche Produkte und Dienstleistungen welche Kosten verursachen.
Diese Informationen können genutzt werden, um Preise festzulegen und die Rentabilität einzelner Leistungen zu überwachen und zu optimieren. Gleichzeitig ermöglicht die Kosten- und Leistungsrechnung die Erstellung interner Erfolgsrechnungen für einzelne Unternehmensteile und damit eine bessere Steuerung der Geschäftsbereiche.
Investitionsrechnung
Auf die Investitionsrechnung wird später noch im Rahmen des Investitionsmanagements näher eingegangen (siehe Kapitel 3.5). Ihre Aufgabe ist es, dem Management objektive Informationen darüber zu liefern, welche Investitionen welchen Einfluss auf den Unternehmenswert haben können. Diese Transparenz soll das Management in die Lage versetzen, ein Investitionsprogramm aufzustellen und sich zwischen alternativen Investitionsmöglichkeiten zu entscheiden.
Finanzrechnung
Bei der Finanzrechnung geht es einerseits um die Finanzierung des Unternehmens und andererseits um die Steuerung der Liquidität. Jedes Unternehmen benötigt Kapital, um arbeiten zu können. Außerdem müssen die Zahlungsströme aufeinander abgestimmt werden, um nicht in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten. Bei beiden Aufgaben hilft das Instrument der Finanzrechnung.
Management Reporting
Ganz allgemein gehört zum Aufgabenbereich des internen Rechnungswesens auch die Versorgung des Managements mit den notwendigen Informationen, damit dieses seine Aufgaben wahrnehmen kann. Diese sehr breit angelegte Informationsversorgung wird als »Management Reporting« bezeichnet. In vielen Unternehmen werden sehr unterschiedliche Berichte erstellt, die alle das Ziel haben, entscheidungs- und steuerungsrelevante Informationen für alle Ebenen der Unternehmensführung bereitzustellen.