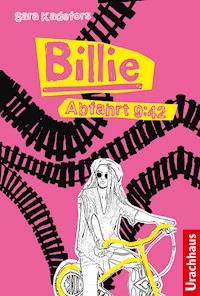Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Urachhaus
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Billie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Billie ist fröhlich wie eh und je. Und sie ist verliebt! Aber zu viel Nähe macht ihr Angst. Wie kann sie mit jemandem zusammen und zugleich unabhängig sein? Ihre Pflegeeltern sind derzeit ein schlechtes Beispiel. Nach außen hin das perfekte Paar, nach innen mit starken Prinzipien und klaren Regeln – und dann steht plötzlich das Thema Scheidung im Raum. Das gefährdet Billies Aufenthalt bei den Perssons in Bokarp … Fragen und Zweifel wirft auch Billies erster Wochenend-Besuch bei der kranken Mutter und den alten Freunden in Stockholm auf. Was ist von ihrem alten Leben übrig? Und wohin gehört sie nun eigentlich? Nach Stockholm, nach Bokarp? Oder muss sie weiterziehen? Hellhörig und authentisch schildert Sara Kadefors das Alltagsleben der Jugendlichen mit einem besonderen Fokus auf zwischenmenschliche Beziehungen. Billies starker und fröhlicher Charakter sowie ihr Nonkonformismus machen sie zu einer Heldin mit außergewöhnlicher Strahlkraft für Jugendliche von heute.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Sara Kadefors
Billie
alle zusammen
Aus dem Schwedischen von Lotta Rüegger
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Die Autorin
1
Ich denke daran, wie es früher war. Damals wusste ich nicht, dass es ein braunes Haus in einem Ort namens Bokarp gibt, einen Jungen namens Alvar, der Tonklumpen in Kunst verwandeln kann, und ein Mädchen namens Tea, das Schminkvideos hinter verschlossener Tür dreht. Ich hatte noch nie etwas von ihrer Mutter gehört, einer Pfarrerin namens Petra, die man mag und auch wieder nicht, oder von ihrem Vater Mange, der mit fröhlicher Stimme spricht, selbst wenn er gar nicht froh ist. Ich wusste auch nicht, dass sie früher einmal einen kleinen Jungen hatten, der auf die Straße rannte und starb. Und ich wusste nichts davon, wie still es danach in dem braunen Haus wurde. Nichts wusste ich. Ich bin da einfach hereingeplatzt, und plötzlich war das alles mein Leben. Die Straßen waren meine Straßen. Das hässliche Haus war mein Zuhause, die komische Familie war meine Familie. – Da gewöhn ich mich nie dran. Aber es funktioniert trotzdem.
Ich singe, so laut es nur geht, ohne darüber nachzudenken, dass die anderen ganz leise reden. Ich renne die Treppe hinunter, obwohl man stolpern und sich verletzen kann. Ich mische mich in Gespräche, obwohl man warten soll, bis man an der Reihe ist, nehme mir Nachschlag, ohne um Erlaubnis zu bitten, mache Flecken auf das hellgelbe Handtuch, kleckere Marmelade auf das Tischtuch, kaufe Süßigkeiten an einem ganz normalen Dienstag, tanze, bis die Wohnzimmerlampe von der Decke fällt, widerspreche, protestiere, hinterfrage, will über Abtreibung, Pädophilie oder Terrorismus diskutieren. Ich mache ihnen das Leben schwer. Aber sobald sie mich sehen, erhellen sich ihre Gesichter. Wenn ich mein Zimmer verlasse, geht sofort irgendwo eine Tür auf, und es kommt jemand angerannt. Sie fragen, ob ich dieses oder jenes mit ihnen unternehmen möchte. Sie wollen mir Sachen zeigen, Geheimnisse anvertrauen oder mich irgendwohin mitnehmen.
Ausflüge mit dem Auto gehören zu jenen Dingen, die in meinen ersten zwölf Lebensjahren nicht stattfanden. Mama hatte nie ein Auto und ist am liebsten zu Hause. Im Leben der Familie Persson sind mindestens zwei Ausflüge monatlich angesagt.
Heute fährt die ganze Familie in die Stadt, um »zwei Fliegen mit einer Klappe« zu schlagen, nämlich mir eine Jacke zu kaufen und dann ins Café zu gehen. Seit ich meine alte Winterjacke aus einem Stockholmer Secondhandladen aus dem Schrank geholt habe, betrachtet mich Petra mit besorgtem Blick. Ich habe ihr schon tausend Mal erklärt, dass die Jacke warm ist und jetzt perfekt passt, weil sie letztes Jahr zu groß war, aber es ist zwecklos. Also spiele ich mit und setze eine fröhliche Miene auf. Mir ist es weniger wichtig, gegen eine neue Jacke zu sein, als ihnen, für eine solche zu sein.
Im Auto herrscht gedrückte Stimmung. Alle schauen missmutig zum Fenster hinaus. Als wären sie nur dabei, weil sie müssten. Um das Schweigen zu brechen, schlage ich vor, ein Lied zu singen, das wir grade im Chor einüben. Petra findet die Idee gut. Ich versuche mit möglichst viel Gefühl zu singen. »Soon and very soon we are going to see the King, soon and very soon we are going to see the King …«
Tea weist darauf hin, dass ich meinen Ton nicht halte – nicht, um gemein zu sein, sondern nur zur Information.
»Vielleicht macht es ja Billie traurig, wenn du das so sagst«, meint Petra.
»Ich bin nicht traurig«, erwidere ich. »Bevor ich im Chor angefangen habe, habe ich noch nie Gotteslieder gesungen, also wäre es komisch, wenn ich das jetzt schon so gut könnte.«
Die »Stadt« besteht aus einer Fußgängerzone mit quadratischen Pflastersteinen. Die wenigen Läden, die dort sind, gibt es zu Hause in Stockholm millionenfach. Es ist zwar erst November, aber ein eisiger Wind fährt uns unter die Kleider. Die Erwachsenen hatten recht, eigentlich bräuchte ich Handschuhe. Aber kann ich was dafür, dass ich mich wie in einem Käfig fühle, wenn ich Mütze und Handschuhe trage?
Wir bewegen uns als lockerer Trupp vorwärts. Alvar und Tea wollen entweder voraus- oder hinterhergehen, als wäre es ihnen unangenehm, mit den Eltern zusammen gesehen zu werden. Also springe ich ein und gehe neben Petra und Mange, damit sie sich nicht wie komplette Versager fühlen. Glücklicherweise gibt es nur zwei Kleiderläden für Leute in meinem Alter. Sobald ich etwas anprobiere, wollen alle ihre Meinung sagen. Mange findet, dass ich die bequemste Jacke nehmen soll, Petra sagt, je länger die Jacke, desto besser, Alvar meint, dass mir Rot steht, und Tea findet die hüftkurze am coolsten. Ich merke, dass jetzt richtig miese Stimmung aufkommt – und alles nur, weil ich eine Jacke kaufen soll, die ich nicht brauche.
»Warum ist es so wichtig, wie ich aussehe?«, frage ich.
»Es ist nicht wichtig«, sagt Petra und klappt meine dicke Kapuze hoch.
»Aber dann kann ich doch die alte tragen.«
»Wir wollen doch bloß, dass du dir gefällst«, antwortet sie.
»Aber ich gefalle mir ja«, erwidere ich. »Gefalle ich euch nicht?«
»Doch«, sagt Mange. »Natürlich gefällst du uns.«
»Aber dann brauche ich doch keine neue Jacke.«
»Wir wollen euch nicht ungleich behandeln«, sagt Petra.
»Du sollst genauso hübsche Sachen haben wie Alvar und Tea.«
»Ihr wollt einfach nicht, dass ich wie ein armes Pflegekind aussehe. Ist das der Grund?«
Petra sieht sich nervös um.
»Jetzt kaufen wir eine Jacke, ob du willst oder nicht.«
Da kapiere ich’s endlich. Es geht gar nicht um mich, sondern darum, was andere über sie denken. Damit bloß niemand glaubt, dass sie ihre eigenen Kinder verwöhnt und mich vernachlässigt. Das würde ja bedeuten, dass sie ein schlechter Mensch wäre, und nichts läge ihr ferner.
»Okay, dann nehme ich die teuerste.«
Petra geht mit der Daunenjacke unter dem Arm lächelnd zur Kasse. Ich folge ihr.
»Und ich musste von meinem Ersparten dazulegen, als ich eine teure Jacke wollte«, murmelt Tea.
»Moment mal …« Ich bleibe stehen. »Soll ich auch noch bessere Sachen als Tea und Alvar haben? Außerdem will ich echt nicht wie ein verzogenes Gör vom Stureplan aussehen.«
»Stureplan?«, fragt Tea.
»Was machst du da drüben?« Petra winkt Mange zu, der in einiger Entfernung auf seinem Handy rumtippt. »Merkst du gar nicht, dass hier totales Chaos herrscht?«
»Nein«, sagt er.
Um die Stimmung zu heben, erzähle ich, wie das »totale Chaos« in meiner Welt aussieht. Als meine Mutter beispielsweise im Blumenladen in eine Glasvitrine fiel. Dabei warf sie alle Blumenvasen um und zerschmetterte das Glas, sodass die Scherben wie ein Glitzerregen auf die Blumen rieselten. Der Blumenhändler rief die Polizei, und ich musste immer wieder von Neuem erklären, dass Mama nicht blau war, sondern ihren Körper wegen ihrer Krankheit nicht so ganz im Griff hat. Als dann schließlich die Polizei auftauchte, lag Mama kichernd auf dem Boden, während der Blumenhändler und ich die Scherben aufsammelten.
Ich lache beim Erzählen, aber die Familie Persson steht wie festgewurzelt da und starrt mich an. Sie haben wirklich keinen Humor.
»Triffst du deine Mutter bald mal wieder?«, erkundigt sich Tea vorsichtig.
»An Weihnachten«, antworte ich.
Alvar wirft Petra einen beunruhigten Blick zu. Und dann mir. »Ja, feierst du denn nicht mit uns?«
»Nein, an Weihnachten bin ich bei Mama. Jetzt aber weg hier. Sonst sterbe ich vor Langeweile.«
Einige Zeit später betrete ich die alte Konditorei – ohne eine neue Winterjacke, aber mit ein paar neuen, festeren Sneakers in einer Tüte. Sie sind verdammt schick, aber nicht so warm wie diese Gore-Tex-Stiefel, die mir Petra und Mange gerne gekauft hätten. Tea hat mir »Hass auf Gore-Tex« ins Ohr gezischt. Ich habe ihr einen High Five gegeben.
Wir dürfen nehmen, was wir wollen, nur nicht Torte. Alvar kann sich nicht entscheiden, wählt zuerst ein Marzipanteilchen und wenige Sekunden später stattdessen einen Kopenhagener. Ich nehme so ein Plundergebäck mit gelber Creme in der Mitte, das meine Mutter »Omas Husten« nennt, was ich den Perssons natürlich nicht erzähle, weil sie das vermutlich eklig fänden.
Wir setzen uns an einen Tisch am Fenster. Alles wirkt ziemlich altmodisch, vielleicht weil auf unserem Tisch eine Vase mit einer rosa Plastikblume steht. Mange schwafelt darüber, welche Limosorten ihm als Kind am besten geschmeckt haben. Petra scheint mit ihren Gedanken woanders zu sein. Als sie nach ihrem Marzipanteilchen greift, streift sie Manges Hand. Mir kommt es vor, als wäre sie zusammengezuckt, aber ich bin mir nicht sicher. Man kann doch nicht ewig sauer sein.
Tea erkundigt sich nach dem Stureplan. Ich weiß eigentlich auch nur, dass an diesem Platz viele teure Läden und Restaurants liegen und dass die jungen Frauen da Handtaschen mit sich rumtragen, die circa dreißigtausend Kronen kosten. Tea möchte wissen, wo alle die Knete herhaben, und ich antworte, vielleicht von den Eltern, oder sie besitzen eine Firma. Tea sagt, dass sie später einmal auch am Stureplan abhängen wird.
»Und was willst du da machen?«
»Einfach nur chillen«, antwortet Tea und lehnt sich zurück.
Sie legt zwei Finger an die Lippen und tut, als würde sie ganz cool an einer Zigarette ziehen.
Mange lacht, klingt dabei aber nicht froh.
»Und warum glaubst du, dass es denen so viel besser geht als uns?«, erkundigt sich Petra.
»Aber Mama, warum glaubst du denn, dass es uns so viel besser geht? In Bokarp?«
»Geld macht auch nicht glücklicher«, sagt Mange mit Überzeugung. Er schaut zu Petra hinüber, ob er auch das Richtige gesagt hat. Aber sie scheint ihn nicht gehört zu haben.
»Eine Familie zu haben, die einen liebt, macht glücklich«, fügt er hinzu und tupft mit der Serviette einen Kaffeefleck weg.
»Leute mit Knete können aber auch geliebt werden«, wende ich ein. »Geht es denen dann nicht besser als solchen, die geliebt werden und kein Geld haben?«
Obwohl ich ganz offensichtlich recht habe, weigern sie sich, mir zuzustimmen. Mange und Petra beginnen eine Diskussion darüber, was einen Menschen glücklich macht. Ich verstehe nicht ganz, warum sie so verärgert klingen, obwohl sie eigentlich einer Meinung sind. Petra entscheidet, dass man nicht festlegen kann, was einen Menschen glücklich macht, weil das »individuell« sei.
Mange erhebt sich und sagt, dass er noch einige Dinge erledigen muss. Er küsst Petra hastig auf die Wange. Sie sieht ihn erstaunt an. Dann macht er sich mit einem Grinsen auf den Weg, aber als ich ihn durchs Fenster auf der Straße sehe, ist das Grinsen weg.
Tea trinkt ihre Cola aus, dann fällt ihr ein, dass sie sich noch in einem Laden in der Nähe Handyschalen anschauen will. Petra bricht gleichzeitig auf, um noch schnell »etwas« zu erledigen. Alvar und ich bleiben alleine zurück. Haben sie plötzlich ihren Grundsatz vergessen, dass man als Familie zusammenhalten soll?
Wir schauen einander an. Alvar schiebt seine Hand in die Hosentasche und zieht einen Hunderter hervor. Der reicht für zwei Teilchen und eine gemeinsame Limo.
2
Der Kunstunterricht war noch nie mein Ding. Meine Hand verwandelt sich in einen starren Klumpen, sobald sie etwas zeichnen soll. Ich schiele zu den anderen hinüber und versuche, sie nachzuahmen, aber ich begreife einfach nicht, wie sie’s machen. Mein Selbstporträt gleicht einem verrückten Troll.
»Ich habe null Talent. Kommt her! Schaut euch das an!«
Meine Mitschüler scharen sich um mich und biegen sich vor Lachen. Evin verkündet, dass sie meine Zeichnung kopieren und dann in der Schule verteilen wird, damit die anderen auch ihren Spaß haben. Unser Kunstlehrer Alf versucht, Positives an meiner schrecklich lausigen Zeichnung zu entdecken. Er legt sein Gesicht in Falten und kratzt sich mit seinem Bleistift am Kopf.
»Es ist … wie soll ich sagen … schön, dass du …«
»Es ist scheußlich! Warum sagen Sie’s nicht einfach?«
»Hier geht es nicht um gut oder schlecht, Billie.«
»Aber das sieht ja aus wie von einer Dreijährigen!«
Alf hat keine Lust, mir zuzustimmen. In irgendwelchen Vorschriften steht bestimmt, dass die Lehrer ihren Schülern Mut machen sollen. »Du könntest sicher noch mehr daran arbeiten, aber ich finde trotzdem, dass du da einer Sache auf der Spur bist.«
Er dreht sich zur Seite und schaut Alvar über die Schulter. Sein Atem beschleunigt sich, und ich befürchte schon, dass er einen Krampf bekommt.
»Aber das hier … Alvar … ist ja ganz …«
Er nimmt das Blatt in die Hand, spricht über »sensible Linien« und wie er »mit recht einfachen Mitteln seinem Charakter Ausdruck verleiht«. Ich bin da vollkommen seiner Meinung. Es ist unglaublich, wie man mit so wenigen Strichen so viel Ähnlichkeit hinbekommt.
Alvar selbst ist knallrot im Gesicht. Ich finde, er sollte seine Sachen öfter zeigen. Ist das nicht überhaupt der Sinn der Kunst, dass andere Menschen sie anschauen? Will man damit nicht etwas ausdrücken? Jedenfalls habe ich mir das immer so vorgestellt.
Wir sprechen auf dem Heimweg darüber.
»Es macht mir halt einfach Spaß«, sagt er. »Einen anderen Grund gibt es nicht.«
»Ich glaube, du versteckst dich, weil du Angst hast.«
Seine Lippen machen ein Geräusch. »Ich habe keine Angst.«
»Doch, du traust dich nicht zu zeigen, wer du bist.«
»Warum sollte ich mich nicht trauen?«
»Weil du vielleicht glaubst, dass dich die Leute dann nicht mögen.«
Alvar geht schneller. Dieses Thema gefällt ihm gar nicht.
»Soll ich etwa Selfies machen oder live aus dem Gartenhäuschen senden?«, brummt er verärgert. »Und meine Sachen zur Schau stellen, damit sie von den Leuten in einer App … bewertet werden können?«
»Nein, aber man kann sich doch ab und zu klitzekleinen Herausforderungen stellen!«
Empört schüttelt er den Kopf. »Ahhh! Kapierst du nicht, dass mir Herausforderungen egal sind? Kapierst du nicht, dass wir da unterschiedlich sind?«
Aber ich bin mir nicht sicher, ob er recht hat. Manche Leute wählen immer den einfachsten Weg, um sich unangenehme Gefühle zu ersparen. Die brauchen dann vielleicht jemanden, der sie auf andere Gedanken bringt und ein bisschen Druck macht. Ich könnte locker dieser jemand sein, diese Druckmacherin. Vielleicht geschähen dann ja die fantastischsten Dinge. Es gibt nichts Besseres als fantastische Dinge.
In der nächsten Kunststunde sage ich laut und für alle hörbar, dass ich Alvar hundert Kronen gebe, wenn er mich abzeichnet. Widerstrebend nimmt er die Herausforderung an. Das Porträt wird so gut. Sein Bild enthält viel mehr von mir als ein Selfie. Ich scherze, dass seine Bilder später einmal schrecklich wertvoll sein werden und dass ich seine Zeichnung nach der Schule zu Hause gleich einrahme. Im nächsten Augenblick drängeln sich alle um Alvar und wollen ihre Bestellungen aufgeben. Er ist gleich sehr gestresst, und sein Atem beschleunigt sich, aber da fällt mir der Begriff »positiver Stress« ein. Das wird es wohl sein.
Sogar Douglas will abgezeichnet werden. Das freut mich und erstaunt Alvar. Douglas sagt zwar keine gemeinen Sachen mehr, aber ein ganz neuer Mensch ist er natürlich nicht, jedenfalls nicht in der Schule. Jetzt sitzt er vollkommen reglos vor Alvar und lässt sich abzeichnen. Seine Wangen haben kleine, weiche Härchen und seine Augen schauen so ernst, dass man sich auf ewig in ihnen ausruhen will. Seine Hände liegen entspannt nebeneinander auf seinen Knien, als könnten sie keiner Fliege etwas zuleide tun.
Am Abend kommt Larissa zu uns nach Hause, um sich abmalen zu lassen. Mange kann nicht verbergen, wie sehr ihn das freut.
»Oh, wie schön!«, ruft er und will gleich einen warmen Kakao kochen.
Ich versuche, ihm mit den Augen zu verstehen zu geben, dass er sich mal beruhigen soll. Komischerweise scheint er mich sofort zu verstehen und macht sich dünn. Ich schleiche ihm hinterher und sehe ihn ruhelos durchs Haus gehen und kleinere Dinge erledigen. Wahrscheinlich sehnt er sich nach Gesellschaft. Petra arbeitet bis spät abends, und wir anderen sind lieber miteinander als mit ihm zusammen. Ich sollte wirklich zu ihm gehen und ihm Gesellschaft leisten, statt mit Alvar und Larissa abzuhängen. Aber so lieb bin ich heute nicht.
Draußen im Gartenhäuschen holt Alvar seine Farben hervor, während ich mich auf das Stockbett lege. Dann setzt er den Stift an und betrachtet Larissa eingehend. Sein Blick macht sie verlegen, aber er merkt das gar nicht. Ihm fällt nicht auf, dass sich ihr Hals rötet und ihr Blick herumirrt. Ihm fällt auch nicht auf, dass sie ihn ganz anders anschaut als die Mädchen normalerweise. Sie hält sich die Hand vor den Mund.
»Tut mir leid! Ich kann einfach nicht still sitzen. Dabei ist das doch … also eigentlich … keine Kunst.«
Eine Stunde später hält Larissa ein wunderbares Porträt in der Hand. Ich könnte kaum stolzer sein, wenn ich es selbst gemacht hätte.
»Wow«, sagt Larissa.
Alvar ist wieder ganz der Alte, der Schüchterne, der sich auf Abstand hält.
Larissa zieht einen Hunderter aus der Tasche. Er will ihn nicht annehmen und sagt mit abgewandten Augen, dass es ein Geschenk ist. Da umarmt sie ihn ungelenk. »Danke«, sagt sie zu seinem Genick. Ich komme mir vor wie eine Spionin.
Mit hochrotem Gesicht räumt Alvar seine Farben weg. Larissa starrt wie verhext seinen Rücken an. Sie sieht aus, als wollte sie mehr von ihm, viel mehr. Das ist erst der Anfang, das spüre ich ganz deutlich.
3
Manchmal ist Douglas in dem braunen Haus zu Besuch. Vielleicht wünscht er sich ja, es wäre wie früher, als das Haus sein zweites Zuhause war. Aber Petra wirkt immer noch nicht ganz natürlich, wenn sie mit ihm spricht. Vielleicht fällt es ihr schwer, so zu tun, als hätte sie sich nie mit Douglas’ Vater, ihrem Bruder, zerstritten. Vielleicht brauchen sie einfach noch mehr Zeit, um wieder Freunde zu werden. Fanny aus meiner alten Klasse war ein halbes Jahr lang sauer auf Nadja, weil Nadja sie einmal bezüglich ihrer Wochenendpläne belogen hatte.