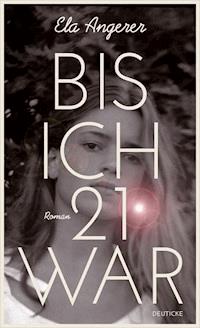
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Mutter, die lieber am anderen Ende der Welt mit Omar Sharif Bridge spielt. Ein Vater, der seine Tochter zu hässlich findet, um sich mit ihr auf der Straße zu zeigen. Das ist die Situation der Ich-Erzählerin, und die verschärft sich noch, als die Mutter den Vater für einen Multimillionär verlässt. Die Eltern sind abwesend, das Personal hilflos. Mit dreizehn beginnt das Mädchen eine Affäre mit einer jungen Krankenschwester und nimmt Drogen. Das fällt sogar den Eltern auf – die Tochter kommt ins Internat und lernt dort, dass es das Böse wirklich gibt. Ela Angerer erzählt in ihrem autobiographischen Roman vom Ungeheuerlichen, das einem Kind widerfahren kann, schonungslos, offen und eindringlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Deuticke E-Book
Ela Angerer
BIS ICH 21 WAR
Roman | Deuticke
ISBN 978-3-552-06266-5
Alle Rechte vorbehalten
© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2014
Umschlag: Lowlypaper/Marion Blomeyer unter
Verwendung eines Fotos von Michael Barnay
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
IT’S A SIN.
Pet Shop Boys
1
Dass meine Nase heute auf keinem Foto stört, hat wahrscheinlich mit den Gesprächen zu tun, die unsere Mutter mit mir schon in meiner Kindergartenzeit führte. Der Satz, der mir immer am meisten Angst einjagte:
»Sobald du achtzehn bist, wirst du dir deine Nase operieren lassen.«
»Aber was ist, wenn ich das nicht will, weil ich mich davor fürchte?«
»Nun, dann solltest du auf jeden Fall, sooft du nur kannst, den Nasenrücken mit Daumen und Zeigefinger zusammendrücken. Du bist noch im Wachstum, und wenn du Glück hast, hilft auch das.«
Von diesem Glück erhoffte ich mir viel und presste deshalb über Jahre hinweg meine Nase, wann immer ich mich unbeobachtet fühlte, mit aller Kraft zusammen. Mein Glaubenssatz lautete: Erst wenn es wehtut, wird es wirken. Ich musste dem Schicksal beweisen, wie sehr ich es wollte, und mit aller Kraft zudrücken.
Genau so machte ich es auch mit den Ohren, obwohl davon in den Unterhaltungen mit meiner Mutter nie die Rede war, aber ich hatte in den Gesprächen der Erwachsenen immer wieder von Männern und Frauen gehört, die sich ihre Ohren operativ anlegen lassen mussten, weil sie nicht weiter als Witzfigur durchs Leben gehen wollten. Also leistete ich auch hier ganze Arbeit. Mehrmals am Tag presste ich nach der Nasenbehandlung beide Handflächen so fest ich nur konnte gegen meine Ohren. Mehrmals am Tag tat mir danach der ganze Kopf weh.
Wenn ich an unsere Eltern vor meiner Zeit denke, sehe ich alles in analogen Schwarzweißabzügen, mit harten Kontrasten und gelegentlichen Lichtpunkten. Meine Mutter, die mit ihrer weißen Blumenhaube auf dem Standesamt aussieht wie Liz Taylor. Tatsächlich hatte Liz Taylor, als sie Richard Burton zum ersten Mal heiratete, genau so einen Hut getragen, und meine Mutter hatte diesen Hut, den man sich wie eine seidene Badehaube vorstellen kann, bei der Schneiderin kopieren lassen. Mein Vater im dunklen Anzug mit schmaler Krawatte, so wie es zu dieser Zeit Mode ist. Beide haben auffallend große Nasen, sie könnten Griechen, Römer oder Aserbaidschaner sein. Mein Bruder und meine Schwester werden später genau so große Nasen bekommen, nur nicht so schmal und elegant. Meine wird man im Vergleich dazu einmal als klassisch bezeichnen, was bei dieser Erbmasse an ein Wunder grenzt.
In der Schwarzweiß-Welt gibt es Partys, Ausflüge mit dem Auto, Verwandte, die sich lachend übers Geländer einer Bergstation lehnen.
Erst die Bilder, die ich mir von meiner Geburt mache, sind in wenige gebrochene Farben getaucht, die Wände der Spitalsstation in Senf, die medizinischen Geräte in hellem Grün gehalten. In leichter Unschärfe sehe ich, wie der Arzt meiner Mutter den geputzten und eingewickelten Säugling überreicht, wie meine Mutter einen Schrei loslässt, so erschrocken sei sie gewesen, wie hässlich ich war, wird sie später immer wieder erzählen, und der Arzt, ganz Gentleman, sagt:
»Wenn Sie wollen, gnädige Frau, können Sie mir das Baby zurückgeben, und ich schenke Ihnen stattdessen ein Stofftier.«
Der Kinderwagen ist himmelblau. Mein Vater lacht. »Die sieht aus wie ein Affe. Mit der sollten wir lieber nicht spazieren gehen.«
Mein erstes Bett ist kalkweiß, die Schürze der Frau, die als Haushaltshilfe und Kinderfrau bei uns arbeitet, ist mit zimtfarbenen Kreisen bedruckt. Meine Mutter trägt auf allen Fotos nur Schwarz oder Mitternachtsblau, drei Jahre lang, dann wird sie wieder ihr altes Gewicht haben.
Was es auf den Bildern nicht gibt: das ständige Geschirrklappern in der Küche, das das ganze Haus durchdringt, die halblauten Stimmen der Erwachsenen. Immer wieder hatten sie Geheimnisvolles zu besprechen, das wir nicht hören sollten. Doch wir strengten uns an, um die Vorgänge rund um uns besser verstehen zu können. Andächtig atmeten wir die geflüsterten Satzfetzen ein.
»Bevor die Kinderfrau den Dienst bei uns angetreten hat«, hörte ich meine Mutter sagen, während sie sich im Vorzimmer den Mantel anzog, »ist sie von einem Lastwagenfahrer vergewaltigt worden. Jetzt hat ihr der Hausarzt wegen Depressionen ein Zehnervalium am Tag verschrieben. Sie muss es gleich nach dem Aufstehen nehmen.«
Wenn Erwachsene einsam oder unglücklich sind, ziehen sie sich ganz in sich selbst zurück und betreuen einen wie ein Möbelstück, das entrümpelt werden muss. In überraschenden Momenten kann es allerdings passieren, dass sie sich einem in ihrer Not anvertrauen. Als Kind nimmt man alles, was man an Zuwendung bekommen kann, und hört geduldig zu. Ja, man bemüht sich sogar, mit den richtigen Zwischenfragen und guten Ratschlägen etwas Frohsinn in die schweren Köpfe dieser Menschen zu bringen.
Mir erzählte man von Anfang an viel. Mit fünf wusste ich, dass meine Mutter keine Kinder bekommen hatte wollen, mein Vater dies aber zur Bedingung ihrer Ehe gemacht hatte. Aus vielen einzelnen Bemerkungen webte ich mir eine Vorstellung unserer Wirklichkeit: Meine Mutter hatte meinen Vater aus Langeweile geheiratet, weil sie keine bessere Idee hatte, wie sie ihrem Leben eine Wendung hätte geben können. Innerhalb von drei Jahren kamen drei Säuglinge. Jetzt saß sie fest.
Obwohl es vielversprechende Augenblicke gegeben hatte, Augenblicke mit der Aussicht auf ein Leben in Freiheit, zerknitterte Schwarzweißabzüge aus ihrer Wiener Zeit zeugen davon: meine Mutter, lachend mit Freunden in der Ade-Bar. Meine Mutter, mit Turban und geliehenem Pelzmantel auf der Kärntner Straße. Wahrscheinlich hätte sie auch Hotelmanagerin werden oder nach Amerika gehen können.
Stattdessen läutete mein kleiner Affenkörper das Ende der gebrochenen Farben ein. Wieder ein Spitalsaufenthalt, diesmal mehrere Wochen lang. Bewegungslos lag ich, von den Füßen bis zum Bauchnabel eingegipst, auf weißen Laken. Irgendetwas stimmte mit meinen Knochen nicht, eine Fehlstellung. Dass etwas in mir falsch war, erstaunte mich nicht. Auf der Krankenstation gab es helle Steinböden und hohe Wände, die bis zur Hälfte in einem öligen Eierschalenton gestrichen waren. Dazu graue Vorhänge und Schwestern in grauer Ordenstracht, die durch lange Gänge schwebten. Manchmal saßen sie wie staubige Vogelwesen an meinem Bett und beteten. Die Luft zwischen allem sah aus wie kalter Rauch.
Einmal in der Woche war Besuchstag. Am Nachmittag kamen die Eltern und setzten sich an die Betten ihrer Kinder. Meine Mutter strich mir mit unruhiger Hand über den Kopf und sagte:
»Weine nicht, sonst muss ich auch weinen.«
Auch der Rest unseres Geredes passte nicht zu den hohen Wänden. Nur die Stille, die hinterher wieder einsetzte, schien wirklich. Streng und mächtig fraß sie sich wie erster Frost durch das weitläufige Areal, erstickte jeden Vogellaut und jedes Geflüster. Sie wirkte wie eine gerechte Strafe für mein ganzes Sein.
Der Gips, in dem mein Körper steckte, musste regelmäßig gewechselt werden. Zweimal schnitt der Arzt beim Aufbrechen der Schale in mein Fleisch. Purpurfarbener Regen fiel durch den leeren Raum.
»Warum zappelt sie auch so viel«, sagte er und ging zum Waschbecken. Mein Blut an seinen Händen floss durch den Ausguss ab.
Der Körperpanzer blieb auch noch dran, nachdem man mich wieder nach Hause geholt hatte. Monatelang saß ich tagsüber auf einem Holzschemel fest und spielte mit meinen Händen.
Die Stille war mit mir mitgekommen. In guten Stunden vergesse ich sie für die Dauer eines Augenblicks, doch sie begleitet mich bis zum heutigen Tag. Es ist eine schattenhafte Stille, die sich zwischen mich und die äußere Welt schiebt und dabei allen Gefühlen ihre Stimme nimmt. Als der Gips endgültig abgenommen wurde, lernte ich mit zwei Jahren Verspätung gehen.
Was man bald versteht: Die meisten Erwachsenen werden von düsteren Gefühlen getrieben, die sich wie schwarze Tinte in ihre Tage mischen.
Eines Nachts wachte ich im Doppelbett neben meiner Mutter auf und sah, dass ihr Kopf in einer großen dunklen Pfütze lag. Immer, wenn mein Vater auf Geschäftsreise war, durfte ich auf seiner Seite des Bettes schlafen. Jetzt lag ich da und betrachtete meine Mutter, die leise vor sich hin wimmerte.
Aus dieser Zeit habe ich keine einzige Fotografie im Kopf, aber anhand der vielen eigenartigen Worte, die sie später mir gegenüber fallenließ, konnte ich mir Folgendes zusammenreimen: Weil mein Vater ständig unterwegs und angeblich auch ein miserabler Liebhaber war, begann sich meine Mutter mit einem verheirateten Mann zu treffen, der in einer Villa auf einem Berg wohnte. Als dieser Mann einmal verreist war, lud dessen Frau meine Mutter in die Villa auf eine Party ein. Was mich schon damals im Alter von fünf Jahren wunderte, war, dass meine Mutter hinging. Wie später noch oft konnte ich in den Handlungen der Erwachsenen keine Logik erkennen.
Oben auf dem Hügel stellte sich heraus, dass meine Mutter neben einem Mann, der an einem Flügel saß und Cole-Porter-Songs spielte, der einzige Gast war. Der Mann war der Liebhaber der Frau auf dem Hügel. Die Gastgeberin, die angeblich seit Jahr und Tag ein Alkohol- und Drogenproblem hatte, reichte meiner Mutter ein großes Glas Rotwein. In dem waren, wie meine Mutter später glaubte, irgendwelche Tabletten drin, denn ihr wurde schlagartig so elend, dass sie ins Badezimmer wankte und dort das dringende Bedürfnis verspürte, mehrere Male hintereinander ihren Kopf gegen das Waschbecken zu schlagen. Dabei brach sie sich selbst die Nase und flüchtete danach mit letzter Kraft über die Terrassentür. Sie stolperte durch den Garten und über den Hügel hinunter zurück in die Stadt. Jetzt lag sie benommen neben mir im Bett und stöhnte.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte sie immer wieder.
Das Leintuch unter ihrem Kopf glänzte dunkelrot.
Zu jener Zeit gab es in der Welt meiner Eltern keine Psychologen, sondern nur Psychiater, deren Behandlungen ausschließlich für die Insassen von Irrenanstalten oder Patienten, die bald dort sein würden, reserviert zu sein schienen. Es ist daher schwer zu sagen, wie ich als Kind auf so eine Geschichte reagierte. Vor allem, da es mir später nie wieder erlaubt war, darüber zu sprechen. Man durfte die Erwachsenen nicht an das Dunkle erinnern, so lautete das unausgesprochene Gesetz, sonst bekamen sie schlechte Laune. Dann ignorierten sie einen unter Umständen einen ganzen Tag lang, ja manchmal sogar mehrere Tage hintereinander.
Mit mir hörte man sehr oft zu sprechen auf. Obwohl ich nie genau wusste, warum, so war ich doch überzeugt, für die dicke Luft bei uns zu Hause verantwortlich zu sein. Eine Art Grundschuld schien mich zu umgeben. Ich war, so meine Überzeugung, ein schlechtes Kind, falsch und verlogen. Verlogen deshalb, weil ich die Erwachsenen beobachtete und alles tat, um ihnen zu gefallen. Um gemocht zu werden, sagte ich, was sie hören wollten, und gab das perfekte Mädchen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich je besonders herumtollte oder mich schmutzig machte. Bereitwillig ließ ich mir dunkelblaue Samtkleider, weiße Strumpfhosen und schwarze Lackschuhe anziehen und saß damit artig in Esszimmern, Wohnzimmern und später dann in Salons (die größere und elegantere Version des Wohnzimmers) herum. Das war langweilig, aber ich wusste, dass es sie freute, und ich mochte es, wenn sie mich anlächelten und mit der Hand über meinen Kopf streichelten.
Trotzdem unterliefen mir immer wieder neue Fehler. Fehler, von denen ich nichts wusste, die aber der Auslöser dafür zu sein schienen, dass man mich ignorierte oder unter vorwurfsvollen Blicken nur das Allernötigste mit mir sprach. Dabei saß ich auch an normalen Tagen stundenlang in unserem Spielzimmer oder am Küchentisch und zeichnete bewusst nur die Guten unter den Märchenfiguren. Einmal setzte sich meine Mutter zu mir und malte eine Nonne, der Tränen über das Gesicht liefen.
»Ich wollte eigentlich Künstlerin werden«, sagte sie.
Ich schaute auf das Blatt Papier und war mir insgeheim nicht sicher, ob das eine gute Idee gewesen wäre. Trotzdem war die Nachricht natürlich verstörend. Meine Mutter wäre lieber etwas anderes geworden als unsere Mutter.
In meinem fünfjährigen Kopf ergab das folgende Schlussrechnung: Meine Mutter war unsere Mutter, weil es für sie irgendwie dumm gelaufen war.
Es ist eigenartig, wenn man es mit Erwachsenen zu tun hat, die lieber jemand anderer wären, in einem ganz anderen Leben. Mir sollten solche Leute im Laufe der Zeit noch oft unterkommen. Während man abends noch ein Kuscheltuch zum Einschlafen braucht, denkt man bereits über die vielen Männer und Frauen mit ihren verkehrten Biografien nach und fragt sich, wie man seine eigene Situation einschätzen würde, wenn man die Wahl hätte. Aber noch hat man ja keine.
Meine Mutter benutzte den Partyunfall, um ihre alte Nase loszuwerden. Eines Tages trat sie mit einem riesigen Verband im Gesicht durch unsere Haustür, und als sie ihn nach einiger Zeit abnahm, kam darunter eine kleine Stupsnase zum Vorschein, die aussah wie das Standardmodell meiner Spielzeugpuppen. Wochenlang wartete ich darauf, dass sich ihr Gesicht wieder in das alte, vertraute zurückverwandeln würde. Doch nichts geschah. Mit der Auslöschung ihrer alten Nase ging auch die Auslöschung ihrer bisherigen Persönlichkeit einher. Mehr und mehr wurde diese Frau, die bis dahin immer unglücklich und unzufrieden war, zu einer Art Passepartout, das sich an all die glamourösen Situationen, die in ihrem Leben noch folgen sollten, perfekt anpassen konnte.
Es sollte nicht ihre letzte Operation bleiben. Während ich mit pochendem Herzen zweimal jährlich zur verordneten Knochenuntersuchung auf der Chirurgiestation antreten musste, begann meine Mutter mehr und mehr, sich für ihre Körperoptimierung zu engagieren. In einem Alter, in dem andere Frauen gerade einmal beginnen, richtig erwachsen zu werden, unterzog sie sich einer ersten Gesamtstraffung ihrer Gesichtshaut. Perfektion wirkt auf Fotografien gottgleich und erhaben, in natura hingegen kalt und angsteinflößend. Jetzt glänzten ihre Wangen im Licht wie poliertes Elfenbein, und ihre schwarzen Augen wirkten so starr, dass nichts mehr die Macht hatte, ihren Blick zu trüben.
Mit dem Beginn der Farben in unseren Fotoalben wurden auch die Verhältnisse komplizierter, vor allem die der Frauen. Mit ihnen hatten die Hausärzte alle Hände voll zu tun. Überall, wohin man meine Geschwister und mich mitnahm – es waren dies ausnahmslos Adressen mit großen Gärten und dunklen Limousinen vor der Tür –, befanden sich Hausapotheken, voll mit Schachteln und kleinen verschlossenen Gläsern. Die Pillen darin waren bunt wie Smarties. Ihr fröhliches Aussehen versprach neue und bessere Zusammenhänge. Anhand einzelner Bemerkungen, die wir da und dort aufschnappten, begriffen wir, dass diese Pillen dazu da waren, das Leben der Frauen in diesen Häusern leichter zu machen.
Es war, als würde im Laufe der Zeit die ganze Welt um uns herum die Buntheit dieser Pillen annehmen. Die Frauen kleideten sich farbiger, die Autos wurden farbiger, die Vorhänge, die Tapeten, ja sogar die Rosenbeete in den Gärten.
Viel später, als das Leuchten immer öfter ungefiltert auf unsere Netzhaut auftraf, stöberten wir als Teenager in den Apartments und Villen heimlich die Hausapotheken durch und entschieden uns jeden Tag für eine neue Farbe. Wir testeten sie so lange, bis wir die richtige Pille für die Verbindung der vielen Gedanken in unseren Köpfen gefunden hatten. Das klappte oft großartig, und manchmal ging es schief.
Doch zuerst: blassblaue Himmel, vanillemilchgelbe Sonnenstrahlen, Kleider in ausgewaschenen Grün-, Pink- und Orangetönen.
Auf mehreren Fotografien sehe ich mich im Badeanzug neben einem blonden Mädchen auf einem Boot stehen, der Badeanzug ist hellrosa und an den Rändern von einem meerblauen Band eingefasst. Neben uns steht eine Frau mit großen Sonnenbrillen, sie lacht gekonnt in die Kamera, ihre blonden Haare verfangen sich im Wind. Meine Eltern haben nie ein Boot besessen. Die Szene auf dem Foto sieht nach Glück aus. Nach dem Glück fremder Leute, bei denen wir zu Gast sind.
Was meinen Tagen zu jener Zeit Kraft verlieh, waren die Glaubenssätze und Prüfungen, mit denen ich sie anfüllte. Es waren dies keine Regeln, die ich mir selbst ausgedacht hatte, sondern Befehle, die mir von meinem Kopf diktiert wurden. Sie waren lange vor mir da und wurden unablässig gesendet, um meine Existenz durch eine höhere Ordnung zu verwalten.
Linker Fuß auf helle Fläche!
Rechter Fuß auf Linie treten!
Kurz nachdem ich endlich zu gehen gelernt hatte, begann sich die Welt unter meinen Füßen in helle und dunkle Flächen und in Linien aufzuteilen. Es ging um Ausgleich und Symmetrie: Wenn der linke Fuß beim Gehen auf etwas Helles stieg, so musste auch der rechte Fuß auf etwas Helles treten, danach konnten beide auf dunklen Flächen gehen. Wenn der linke Fuß auf eine Linie kam, also auf den Zwischenraum zwischen zwei Holzdielen, Steinplatten oder Kacheln, so musste beim nächsten Schritt auch unter meinem rechten Fuß die Linie sein. Alle Linien liefen das jeweilige Bein hinauf. Das Helle machte meinen ganzen Körper leicht, das Dunkle ließ ihn schwer und langsam werden.
Die Herausforderung war, das Zweitakt-Gesetz unter allen Umständen einzuhalten, was den ganzen Tag über zu absurden Bewegungen führte. Ich zappelte an der Hand meiner Mutter über Einkaufsstraßen, tänzelte in den Häusern von Verwandten oder elterlichen Geschäftsfreunden in kleinen Zickzackschritten vom Wohnzimmer zur Toilette. Im Kindergarten musste ich meiner Konzentration zuliebe immer wieder Spiele mit anderen Kindern unterbrechen, denn das Nichteinhalten der Regeln wurde umgehend mit einem unangenehmen Kribbeln, manchmal sogar mit pochenden Schmerzen in der jeweiligen Körperhälfte bestraft. Jedes Mal, wenn ich darauf vergessen hatte, geriet alles aus dem Gleichgewicht.
Sosehr es mich auch belastete – ich konnte mich niemandem anvertrauen. Ich war mir sicher, dass diese Verordnung von höchster Stelle nur an mich erteilt worden war. Andere Menschen würden mein komplexes Harmoniesystem nicht verstehen.
Unser Kindermädchen putzte das Silber. Im Radio sang Heintje; sie sang laut mit. Ich beobachtete sie durch das Netz, das das Gesetz der Ausgewogenheit über mich geworfen hatte.
Mein erstes Geheimnis um das lex aequilibritas, dem ich mich über Jahre wie eine Soldatin verpflichtet fühlte, war anstrengend. Das zweite Geheimnis war ein Wunder.
Schon immer tat ich mir schwer beim Einschlafen. Sobald das Licht ausgelöscht wurde, lag ich in meinem Bett und wartete auf das Unvermeidliche. Wenig später fingen sich die Schatten und Umrisse aller Gegenstände im Zimmer zu bewegen an. Kommoden und Schränke blähten sich zu überdimensionaler Größe auf und schrumpften wieder zusammen, so, als würden sie tief ein- und ausatmen. Noch schlimmer war es mit den Dingen, die sich darauf befanden: Vasen, Bücher, Puppen und Bären tanzten, zuerst langsam, dann immer wilder, bis sich alles zu einem Höllenspektakel steigerte. Ich zog die Decke über den Kopf und versuchte, so wenig wie möglich von der bösen Luft einzuatmen. Doch meine Angst schien sie geradezu anzufeuern. Spielsachen und Büchsen fielen hinunter. Sie rollten über den Fußboden, um sich von dort aus noch lauter und gehässiger über mich lustig zu machen.
Jahrelang ging das so, bis eines Nachts das Wunder geschah. Ich lag auf dem Rücken im Bett, die Hände zu Fäusten geballt und eng an meine Hüften gepresst, zwei Koffer und ein Plüschhund setzten gerade zu ersten polternden Tanzschritten an, als plötzlich ganze Ströme von winzigen Farbpunkten durch die schwarze Luft flogen. In Wellen schwebten sie auf mich zu. Gelbe, orange, rosa, grüne und blaue Lichtpunkte, immer in großen Farbgruppen zusammengefasst, umspielten mein Gesicht, um dann im Nichts zu verschwinden. Es war wie eine Sinfonie ohne hörbare Töne, wie ein Wind, der alles reinigt und mit neuer Energie auflädt.
Zuerst glaubte ich, etwas zu sehen, das es gar nicht gab, kniff die Augen zusammen und machte sie wieder auf, überzeugt, dass der Spuk sich wieder gelegt haben würde. Doch die Farbpunkte hüpften in dieser und in allen weiteren Nächten durch die Luft und funkelten mich an. Sie schienen vor lauter Glück und Freude aus sich selbst heraus zu leuchten. In meiner Erinnerung liege ich stundenlang wach und lasse mich davon anstecken.
Zu jener Zeit waren meine Eltern mit vielen anderen Ehepaaren innerhalb ihrer Einkommensklasse befreundet. Man traf sich auf Partys, beim Tennis und im Bridge-Club. Während ich jeden Morgen allein in den Kindergarten ging und mich dort den Rest des Tages abwechselnd fast zu Tode langweilte und der Einhaltung meiner Regeln widmete, schliefen sie mit den jeweiligen Partnern ihrer besten Freundinnen und Freunde. Die Väter, allesamt Geschäftsmänner mit persönlicher Sekretärin, betrachteten es als Kavaliersdelikt, auch einmal bei jeder anderen Ehefrau vorstellig zu werden. Die eigenen Frauen wussten das und ließen sich von ihrer Wut darüber zumindest für wenige Augenblicke in die verbotenen Arme der anderen Männer treiben. Man küsste sich auf abgelegenen Parkplätzen oder fuhr gemeinsam in den Wald. Manchmal, wenn der eigene Mann auf Geschäftsreise war, konnte ein anderer auch einfach ein paar Tennisbälle ausborgen kommen oder dergleichen.
Meine Mutter vertraute sich mir schon früh an, deshalb wusste ich über alles recht gut Bescheid. Einmal rief die Polizei bei uns an, weil die Geldbörse meines Vaters auf einem Getreidefeld außerhalb der Stadt gefunden worden war.
Über Politik oder Kunst wurde nie gesprochen, dafür umso mehr über Sex, Sportwagen, Kreuzfahrten, Uhren und Schmuck.
Man hatte Personal und noch keinen Krebs. Wer etwas auf sich hielt, ließ sich in seinem Garten einen Swimmingpool bauen. So sahen die siebziger Jahre in den jungen, aufstrebenden Haushalten aus.
Auf dem Höhepunkt der blassen Sommerfarben kam es zwischen meinen Eltern zu Wortgefechten. Ich sah, wie mein Vater mit einem Sessel nach meiner Mutter warf. Danach zog er aus dem gemeinsamen Wohnbereich aus und übersiedelte auf den Dachboden.
Das hatte für mich den Vorteil, dass ich mit meinem Vater zum ersten Mal so etwas wie eine Unterhaltung führte. Jedes Mal, wenn er von einer seiner Reisen zurückgekehrt war, durfte ich allein die Treppen zu seiner Kammer hinaufsteigen.
»Weißt du denn schon, wo du später einmal leben möchtest?«, fragte er mich.
»Wo könnte ich denn leben?«
»Überall und nirgends«, sagte er. Dabei lachte er laut auf, so als hätte er einen wirklich komischen Witz gemacht, brach eine dicke Rippe von einer jener übergroßen Schokoladentafeln ab, wie es sie damals nur in der Schweiz zu kaufen gab, und reichte sie mir.
Ich fand es interessant, wie sehr dieser Mensch, der mein Vater war, unter Hochspannung stand. Obwohl diese Begriffe damals noch nicht in meinem Wortschatz vorkamen, speicherte ich seine zuckenden Mundwinkel und seine abrupten Umarmungen unter »leidenschaftlich« und »explizit männlich« ab.
Zwei Stunden später hielt ein schwarzglänzender Cadillac vor unserem Haus. Meine Mutter nahm uns Kinder bei der Hand und schob uns auf die Rückbank des Wagens. Hinter dem Lenkrad saß ein großer Mann in einem Anzug, der sehr nobel aussah. Auch von ihm bekamen wir Schokolade. Er reichte uns goldene, in Zellophan verpackte Schokotaler nach hinten, während meine Mutter vorne mit fahrigen Handbewegungen ihre Frisur zurechtzupfte. Mein Kleid war voll mit schwarzen Tintenflecken, weil ich vorher heimlich an ihrem Schreibtisch gewesen war. Der Mann ließ während der ganzen Zeit den Motor laufen.
Danach kam es in unserem Speisezimmer noch einmal zu einer Szene, in der mein Vater eine Tischlampe nach meiner Mutter warf. Am nächsten Tag zogen wir aus. Das heißt, meine Mutter zog mit meiner Schwester und mir in ein Apartment, das dem Mann mit dem Cadillac gehörte. Meinen Bruder, der nur ein Jahr jünger war als ich und bis dahin mein Spielgefährte und Verbündeter gewesen war, ließ sie bei meinem Vater zurück.
»Ich fürchte, drei kleine Kinder sind ihm zu viel«, erklärte sie uns. »Zwei süße Mädchen kann ein Mann leichter verdauen als einen Buben, der seinem Vater noch dazu wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlich sieht.«
Mein Vater nahm einen Posten in London an, und wir sahen uns nur mehr zweimal im Jahr, im Sommer und rund um Weihnachten. Das böse Mädchen, das ich ja nun einmal war, konnte auch diese Hürde nehmen. Als mein Bruder einige Monate später zum ersten Mal vor unserer neuen Haustür abgesetzt wurde und mit einem kleinen braunen Koffer in der Hand hereinkam, spürte ich kurz einen brennenden Stich in der Brust. Gleich darauf ignorierte ich meinen alten Komplizen und sah mit erhobenem Kopf durch ihn hindurch, als wäre er Luft.
»Schau mal, wer da ist«, sagte meine Mutter.
»Aha.«
»Sie war schon immer so herzlos«, hörte ich sie zu meiner Schwester sagen, während ich mich umdrehte und zurück in mein Zimmer ging.
Am Nachmittag saßen meine Geschwister und ich mit meiner Mutter in zwei Sesselreihen vor unserem ersten Farbfernsehgerät. Es war erst vor wenigen Tagen geliefert worden. Der Film, der gerade lief, war trotzdem in Schwarzweiß. Die junge Nadja Tiller gab eine schöne Frau ohne Skrupel in der Hauptrolle. Während ich ihr kaltes Gesicht beobachtete, drehte sie sich meine Mutter kurz zu mir um und sagte:
»Genau wie du.«
Der Cadillacfahrer war der Mann aus der Villa auf dem Hügel. Weil es ihr Elternhaus war, wohnte dort jetzt nur mehr seine geschiedene Frau. Wir hingegen übersiedelten nach dem Neuanfang im Apartment noch mehrere Male. Die letzte Volksschulklasse besuchte ich in einer Kleinstadt namens Fretting, wo wir in einem hässlichen Einfamilienhaus mit Garten wohnten.
»Diese Adresse entspricht nicht unserem Standard, aber bis auf weiteres haben wir keine andere Möglichkeit«, sagte meine Mutter.
Der Cadillacfahrer war zwar sehr reich, hatte aber, was die Finanzen betraf, großen Streit mit seiner Exfrau.





























