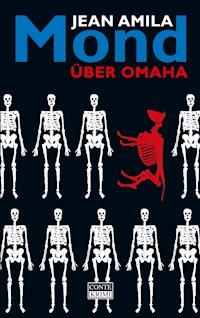Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Conte Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Es riecht nach Calvados. In dem kleinen Ort Nomville in der Normandie scheint sprichwörtlich alles am Alkohol zu hängen. Schon die Kinder in der Schule haben eine Schnapsfahne, vom Pfarrer ganz zu schweigen. Schwarzbrennerei erweitert das Bruttosozialprodukt. Das »Fräulein«, Marie Anne, als Grundschullehrerin zu ihrer ersten Anstellung hierher versetzt, nimmt den Kampf gegen den Alkohol auf. Dass ihr der junge Pierrot nicht aus dem Kopf geht, macht die Sache nicht leichter. Denn Pierrot strebt eine Karriere als Fahrer von Schmuggel-LKWs an. Jean Amila entfaltet bei seinem Ausflug ins ländliche Nordfrankreich ein Bouquet voll Witz, Gefühl und wilden Verfolgungsjagden: Action pur in der Provinz, na denn Prost. »Lesen wie Gott in Frankreich: Conte hat den Klassiker Jean Amila entdeckt.« Ulrich Noller, WDR
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marie-Anne gewöhnte sich an den langsamen Rhythmus des im glänzenden Geschirr laufenden Kutschtiers.
Sie konnte sehen, wie der Rücken der Stute regelmäßig bei jedem Schritt wippte und das Fell im Abendlicht von Zeit zu Zeit leicht rötlich aufleuchtete.
Der alte Pfarrer, der neben ihr in einem schmalen Bottich saß, hatte schon seit einer ganzen Weile nichts mehr gesagt. Er hielt die Leinen kaum fest und wirkte verloren wie in einem fernen Tagtraum.
War er etwa verärgert?
Marie-Anne sagte sich, dass es vielleicht trotz der Strapazen der Reise an ihr sei, ein bisschen Konversation zu machen; denn dieser Priester war sowohl wegen seines Alters als auch wegen seines Standes eine Respektsperson. Außerdem hatte er sich die Mühe gemacht, sie am Bahnhof von Domfront abzuholen und sich während der ersten Stunde unterwegs auch sehr liebenswürdig verhalten.
Der Weg stieg jetzt unmerklich an. Ringsum erstreckten sich die von schlehenbewachsenen Hecken gesäumten, fetten Weiden der Normandie mit ihren Kühen und den Apfelbäumen, die sich unter dem Gewicht ihrer roten Früchte bogen.
»Ich bin sicher, dass es mir hier gefallen wird«, sagte sie etwas zu betont.
Weil die Antwort nicht sofort kam, drehte sie sich um und sah, dass der Pfarrer von Nomville schlief.
Pfarrer Hulin schlief den Schlaf der Gerechten. Aus seinem offenen Mund lief ihm ein Speichelfaden, der an der Spitze seines schlecht rasierten Kinns wie ein Tropfstein herabhing.
Marie-Anne leuchtete jetzt erst ein, wofür der »Schalensitz« – ein ungewöhnlicher Luxus – und die Gurte, mit denen der Geistliche sich vor der Abfahrt in Domfront wie für einen Abflug in einem Linienflugzeug angeschnallt hatte, gut waren. Nein, der alte Mann schien sich nicht auf große Geschwindigkeit, sondern auf unbezwingbaren Schlaf eingerichtet zu haben.
Dem würdevollen Pfarrer wuchsen die Haare zu den Ohren heraus; weiße, ja schmutzigweiße Haare, genau wie diejenigen, die der ehrwürdige heilige Mann, dessen violettes, aufgedunsenes Gesicht wie ein glasierter Dachziegel aussah, auf dem Kopf hatte.
Er schnarchte. Nur, war dies überhaupt ein Schnarchen oder nicht eher schon ein Röcheln? Schlief er friedlich oder gab er etwa gerade den Geist auf?
Marie-Anne bekam es plötzlich mit der Angst zu tun. Sie beugte sich hinüber, um ihm beizustehen, sein hin und her wackelndes Haupt aufzurichten und diesem dumpfen Röcheln, das sich wie ein Todeskampf anhörte, ein Ende zu bereiten.
Da erst stieg ihr der Geruch von Schnaps in die Nase; oder aber wagte sie vielmehr, diesem diffusen Geruch einen Namen zu geben, der sie seit der Abfahrt umwehte und von dem sie nicht wusste, ob er zu dem Mann oder zur Kutsche gehörte.
Sie wollte mehrmals sagen: »Das riecht nach Land … das riecht nach Bauernhof, das riecht nach Most … das riecht nach Schnaps …« Aber ja, natürlich, es roch nach Schnaps. Pfarrer Hulin stank nach Alkohol wie ein ganzer Schnapsladen. Der alte Mann schlief selig seinen Rausch aus, er ließ die Leinen durchhängen und vertraute sich Coquette an, die den Weg kannte und ja nur Wasser trank.
Marie-Anne lachte kurz auf und murmelte vor sich hin: »Das ist aber lustig!«
Sie war zwanzig Jahre alt und nicht hässlich mit ihrem entschlossenen, ein wenig ernsten Blick und ihrem kleinen, eigensinnigen Kinn, das ihr dieses gewisse Aussehen verlieh, das die Leute – ohne sie zu kennen – dazu brachte, sie für eine Krankenschwester, Lehrerin oder Sozialarbeiterin zu halten.
Ohne sich zu zieren, nahm sie den Platz des schwachen, alten Mannes ein, nahm ihm die Zügel ab und trieb Coquette in demselben normannischen Dialekt an, den sie kurz zuvor gehört hatte.
»Geh los Cotschette! Geh!«
*
Als sie endlich hinter einer Kurve des Wegs den Kirchturm von Nomville sah, zog sich der Himmel zu.
Der Rand der Talmulde, auf deren Grund das Dorf lag, war bereits in einen staubfeinen Nebel aus Sprühregen gehüllt. Es herrschte Schmuddelwetter, normannisches Wetter. Die Herbststürme waren vorbei: Der Oktober brachte kurze Tage und Holzfeuer in den Kaminen.
Das Verdeck aus grauem Leinen war schon auf die Überrollbügel gespannt. Mit seinen goldglänzenden gebogenen Kupferhaken und seinen Reflektoren sah es wie eine mollige Haube aus, und die Rückseite war mit Leder ausgeschlagen: eine gute Sattlerarbeit, die wohl um die zwanzig Jahre alt sein musste. Da konnte der Regen ruhig kommen!
Rechts und links der Straße führten feste Wege durch die Weiden zu den Bauernhöfen. Zu den Holztoren hingegen, die die Einfahrten zu den Weiden verschlossen, führten verschlammte Pfade. Es stank da nach Kuhfladen und beißendem Mist; hier gab es nur mit hohen Gummistiefeln ein Durchkommen.
Marie-Anne sah einen Seevogel dahingleiten; es mochte eine Graumöwe oder ein Brachvogel sein. Wie er da so majestätisch kreiste und einen spitzen Schrei ausstieß, glich er eher einem Raubvogel.
Sie glaubte, hinter der Kutsche jemanden rufen zu hören, verwarf diesen Gedanken jedoch, bis sie erneut hörte, wie jemand »Herr Pfarrer!« rief.
Sie beugte sich also hinaus und sah sogleich einen kleinen Jungen, der auf die Kutsche zulief. Sie packte die Fahrleinen und sagte: »Brr! Cotschette!« – aber Coquette lief einfach weiter.
Der Ausruf hatte zum Glück den alten Geistlichen aufgeweckt, der mit ruhiger Stimme feststellte: »Ich bin eingeschlafen«, und dann die Leinen wieder in die Hand nahm. Als hinter ihnen erneut gerufen wurde, hielt er das Tier mit einem einfachen Zungenschnalzen an.
Der Junge kam ganz außer Atem bei ihnen an. Seine schwarzen Augen waren weit aufgerissen, sein sonnengebräuntes Gesicht war vom schnellen Laufen hochrot.
»Sie werden gebraucht, Herr Pfarrer!«, begann er ohne Umschweife. »Françoise ist in den Teich gefallen. Sie müssen kommen!«
Pfarrer Hulin schien angestrengt in seinem Gedächtnis zu kramen.
»Françoise? … Françoise?«
Dann begriff er plötzlich, was für ein Unglück geschehen war, und wurde aufmerksamer.
»Ist sie ?«
»Sie ist ertrunken!«, bekräftigte der kleine Junge.
Der alte Geistliche sah nun ernsthaft betroffen drein und bekreuzigte sich. Das Kind und dann, mit einem unmerklichen Zögern, Marie-Anne, die sich keine Blöße geben wollte, taten es ihm nach.
Plötzlich schüttete es wie aus Eimern. Das Kind auf dem Weg trug keine Kopfbedeckung; es hatte nur einen geflickten Pulli übergeworfen.
»Steig auf, Jacquot!«, sagte der Geistliche.
»Michel!«, korrigierte ihn der Junge.
Er kletterte aufs Trittbrett, wo er einen Moment innehielt, eingeschüchtert von Marie-Annes Gegenwart. Diese musste zur Seite rutschen, um ihm Platz zu machen.
Der Geistliche hatte sein Tier nun wieder halb gewendet, es zu leichtem Trott veranlasst und bog auch schon in einen Hohlweg ein.
Das Herbstlaub bildete ein Gewölbe, das noch so dicht war, dass der Regen es nicht durchdringen konnte; so war das Geräusch dumpfer als vorher, als das Wasser unmittelbar aufs Dach geprasselt war.
Der alte Geistliche sagte nichts und Marie-Anne wagte nicht, weitere Fragen zu stellen. Wer war bloß diese Françoise, die in einem Teich ertrunken war? Vielleicht gar die Schwester dieses Jungen? Sie fragte ihn halblaut, sehr behutsam, da sie keinesfalls mit der Tür ins Haus fallen wollte:
»Handelt es sich um einen Unfall?«
Der Junge sah ihr gerade, fast feindselig in die Augen.
»Natürlich, klar!«
Da verstand sie, dass es kein Unfall gewesen war. Sie verspürte einen Brechreiz. Es war, als ob der Schnapsgeruch, der von dem alten Mann ausging, sich verzehnfacht, ja verhundertfacht hätte; ein dichter, hartnäckiger, fruchtiger Geruch, der sich überall festsetzte.
Der alte Geistliche bemerkte es selbst. Er sog die Luft ein, schnupperte und fand die natürliche und logische Erklärung dafür.
»Na«, sagte er zu dem Jungen, »die sind wohl grad am was?«
»Ja«, sagte Michel, fast ein bisschen starrsinnig, »das könnte schon sein.«
»Oh!«, meinte der Pfarrer nur.
Sein Gesicht nahm plötzlich einen besorgten Ausdruck an, während er verstohlen zu Marie-Anne hinübersah. In den vom Alkohol glasigen Blick des guten, alten Mannes mischte sich eine naive Listigkeit. Er hielt das Tier an.
»Ein Trauerfall muss ja nun auch nicht das Erste sein, mit dem Sie es hier zu tun kriegen«, sagte er. »Sie warten hier auf mich. Ich brauch nicht lang.«
In weniger als hundert Metern Entfernung konnte man hinter dem Regenschleier den Bauernhof erkennen. Marie-Anne verstand, dass sie dort unerwünscht sein würde. Sie erhob sich, um abzusteigen, aber der alte Mann begann bereits, sich abzuschnallen.
»Aber, aber! Sie bleiben natürlich hier im Trockenen!«, meinte er leicht vorwurfsvoll, als hätte man ihn für einen Rüpel gehalten.
Er stieg ohne große Geschmeidigkeit, dafür aber mit vollendetem Geschick, ohne zu springen von der Kutsche, indem er das Rad als Trittbrett benutzte, was ihm eine sanfte Landung ermöglichte. Wahrscheinlich war er voll wie eine Haubitze, aber er war noch einigermaßen klar, sehr würdevoll und immer noch Herr seiner Bewegungen.
Er band Coquette an einen Baum, entschuldigte sich noch einmal mit einem Lächeln und folgte dem Jungen, der schon vorausgelaufen war.
Marie-Anne fühlte sich plötzlich ganz allein, wie in einem fremden Land. Es würde bald dunkel werden, und sie war müde und fror. Sie sah, wie die beiden Silhouetten immer kleiner wurden, dann ließ sie das Geräusch eines Schüreisens und menschlicher Stimmen den Kopf nach links drehen.
Hinter einer Hecke sah sie einen verrosteten Blechschuppen, in dem weißer Rauch waberte, der aus einer Art verkupfertem Doppelkessel aufstieg.
Dort machten sich einige Männer zu schaffen, die man hinter der Regenwand aber nur erahnen konnte. Jemand öffnete den Ofen und legte Holz nach. Das Licht im Schuppen leuchtete für einen Moment rot auf: Da verwandelten das Licht, der Kessel, der beißende Gestank und der allgegenwärtige Rauch das Ganze in eine Hexenküche: Hier also wurde »geköchelt«!
Marie-Anne kauerte sich zusammen und fröstelte innerlich, als wäre sie gerade um fünf Jahrhunderte in die Vergangenheit zurückversetzt worden.
*
Als der Pfarrer das Leichentuch an einer Ecke anhob, konnte er das verquollene, unkenntliche Gesicht des Mädchens sehen.
Er grübelte immer noch darüber nach, was das wohl für eine Françoise war.
Schließlich glaubte er, sie erkannt zu haben.
»Ist das Ihre kleine Nichte?«
»Ja, mit Ihrer gütigen Erlaubnis. – Sie war noch nicht mal zwanzig Jahre alt! Hätte sie das denn nicht woanders machen können? Oder an einem anderen Tag?«, meinte die Bäuerin ohne auch nur die Andeutung einer Träne.
Die Leiche war alterslos. Das Mädchen konnte nicht sonderlich hübsch gewesen sein. Selbst im toten Zustand sah es mit seinen karottenroten Haaren, seinen Sommersprossen und seiner langen, alles andere als anmutigen Nase noch wie ein Schmutzfink aus.
Man hatte sie nicht auf einem Bett, sondern auf einem Tisch aufgebahrt; und sie stank nach Morast.
»Wie lang ist es her?«, fragte der Pfarrer.
»Wir haben sie gegen Mittag gefunden, kopfüber im Teich.«
»War die Polizei schon da?«
Frau Soulage blickte plötzlich verschreckt drein.
»Was denken Sie denn, Herr Pfarrer. Das Ganze macht uns doch auch so schon genug Ärger. Die holen wir, sobald wir mit dem Köcheln fertig sind.«
Der alte Pfarrer schien das Für und Wider abzuwägen; das Argument erschien ihm durchaus nachvollziehbar.
»Warten Sie aber ja nicht zu lange«, sagte er vorsichtig.
Er hob die Hand über die Leiche, um sie zu segnen. Die Bäuerin stieß daraufhin mit dumpfem Groll hervor:
»Sie ist in Sünde gestorben; ich sags Ihnen lieber gleich.«
»Was wissen wir denn schon davon?«, erwiderte der Pfarrer sanft.
»Ich habs Ihnen gesagt«, unterstrich sie nochmals.
Dann kam Soulage ins Zimmer: Eine Schnapswolke umgab ihn. Er war ein Mann in den Sechzigern, mit rotem Gesicht und einem Schnurrbart, der so rot war, als ob er in Flammen stünde. Er schüttelte dem Pfarrer die Hand und fragte misstrauisch:
»Wer ist die Person da, die Sie mitgebracht haben?«
»In der Kutsche? Das ist das neue Fräulein«, sagte der Pfarrer.
»Das Schulfräulein?«
»Ja.«
»Aber! – Das wär ja noch schöner, wenn man sie einfach draußen lassen würde! Was denken Sie sich denn, Herr Pfarrer!«, meinte Frau Soulage entsetzt.
Dieser breitete ausweichend die Arme aus.
»Wegen der Umstände dachte ich, dass es nicht angemessen wäre.«
»Wir werden sie doch nicht in diesen Raum hier bitten!«
Der alte Pfarrer schüttelte den Kopf.
»Darum gehts gar nicht. Es ist wegen des Kessels. Sie ist zwar ein nettes Fräulein, aber eine Fremde hier. Können wir denn wissen, was sie sich bei all dem so denkt?«
»Na ja, wenn sies auch nicht sieht, so wird sies auf jeden Fall riechen! Geh sie holen, Germaine. Vielleicht bringen wir sie ja dazu, dass sie Geschmack dran findet«, meinte Soulage.
Das leuchtete ein; Frau Soulage ging also hinaus.
Soulage zeigte auf die Leiche.
»Sind Sie mit dieser Schlampe fertig? – Denken Sie bloß! Das muss sie uns ausgerechnet heute antun!«
»Vergib ihnen ihre Sünden. Warum hat sie sich ersäuft? War sie betrunken?«, fragte der Priester.
»Klar!«, höhnte Soulage. »Ich möchte Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber gucken Sie sich doch mal ihre Figur an! Glauben Sie mir, das ist nicht alles nur Wasser! Ich weiß nicht, wo sie sich das eingefangen hat. Wir haben sie vorgestern drauf angesprochen. Und sehn Sie, was diese verstockte Lügnerin uns dann angetan hat. Sie ist ins Wasser gegangen! Ausgerechnet an dem Tag, an dem wir brennen! – Das hat sie bloß gemacht, um uns zu ärgern, so viel ist jedenfalls sicher!«
Der alte Pfarrer war weit weg, in Gedanken verloren.
»Wart mal. Ja, das ist es. Es war mir doch so, als hätt ich noch was vergessen: Das Fräulein ist eine Verwandte von – wart, wie war noch mal sein Name? – Ojemine! Mein Gedächtnis! – Es ist aber ein Großer, Dünner: Heißt er nicht Langevin?«
»Der Stellmacher aus Saint-Front?«
»Aber nein! Der Junge da, der immer so übereifrig ist. – So hilf mir doch! – Ach der, der Matthias mit seinen zwei Fässern erwischt hat!«
»Augereau?«
»Ja, genau!«
»Die Steuerfahndung!«
»So ist es. Das Fräulein hats mir grad vor einer Stunde auf dem Weg erzählt. Es ist ihr Cousin!«
Der alte Soulage lief violett an.
»Aber Pfarrer! Hätten Sie mir das nicht früher sagen können?«
Der alte Pfarrer jedoch drehte sich friedlich und keiner Schuld bewusst zur Leiche um, breitete die Hand aus und segnete sie:
»«
»«, schloss der Bauer, um sogleich wütend hinzuzufügen: »Aber verdient hat sies nicht!«
*
Marie-Anne war mit dem Menschengeschlecht versöhnt, als sie die Bäuerin kommen sah. Man ließ sie nicht vor der Tür stehen; diese Leute hatten also doch einen Rest von Anstand.
Die Bäuerin war untersetzt und hatte einen harten Blick. Mehr als ein eigentlich an die Adresse Pfarrer Hulins gerichtetes »Meine Arme« konnte sie sich an Höflichkeit allerdings nicht abringen.
»Meine Arme«, wiederholte sie, »Sie kommen uns ja ganz ungelegen! Das Mädchen ist uns nämlich grad abgekratzt. Aber das ist ja kein Grund, Sie draußen stehn zu lassen, nicht wahr?«
Marie-Anne war ihr mit einer gewissen Zurückhaltung gefolgt. Sie hatte es eilig, den Ort kennenzulernen, an dem sie während eines langen Schuljahres leben und arbeiten würde.
»Sie sind also das neue Fräulein. Ich will ja nicht indiskret sein, aber wo genau kommen Sie her?«
»Aus Paris. Aber ich habe auch in der Normandie Wurzeln; meine Mutter kommt aus Rouen«, gab Marie-Anne Auskunft.
»Je nun, hier ist natürlich nicht Rouen! Rouen ist auch eine Stadt, wie Paris! Wir sind hier dagegen auf dem Land. Meinen Sie, dass Sie hier zufrieden sein werden?«, fragte die Bäuerin.
»Das hab ich mir fest vorgenommen«, sagte Marie-Anne lächelnd.
Ohne es zu wollen, sah sie zum Schuppen hinüber, von wo zwei Männer spöttisch zu ihr herüberstarrten. Der eine sah wie ein alter, zerlumpter Säufer aus; der andere war jung und sah sie sich ungeniert von oben bis unten an.
Er war es auch, der fragte:
»Wer ist der Besuch?«
»Das ist das neue Fräulein!«, gab Frau Soulage Auskunft.
Der junge Mann kam näher und meinte ein bisschen großspurig: »Seh ich selbst, dass es kein Feuerwehrhauptmann ist.«
Er hatte dieselben schwarzen Augen wie der kleine Junge. Gerade vom Militärdienst entlassen, befand er sich in der Blüte seiner Jugend; er sah pfiffig aus. Im Gegensatz zu dem alten Mann, der schwankend neben dem Destillierapparat stehen geblieben war, schien er weder dumm noch betrunken zu sein.
»Sie sind also die neue Lehrerin?«, fragte er und streckte die Hand aus.
»Ja, das bin ich.«
»Machen Sie nur das Beste draus, solange Sie noch nicht in der Kaserne sind! Sind Sie mit dem Pfarrer gekommen?«
»Ja.«
»Ach! Der ist okay. Aber Fräulein Dhozier, die Direktorin, das ist eine alte Kuh!«
»Pierrot!«, protestierte die Bäuerin.
Aber Pierrot lachte laut los.
»Sie könnens ihr ruhig erzählen, ich steh zu meiner Meinung.«
Man hörte den Destillierapparat auf Hochtouren arbeiten. Marie-Anne betrachtete ihn fasziniert von der Seite. Pierrot fasste sie am Arm und ermunterte sie vertraulich: »Kommen Sie, probieren Sie einen Schluck. Der ist ganz frisch!«
»Danke, ich hab keinen Durst«, sagte sie.
»Keinen Durst?«
Er brach in Gelächter aus; als hätte sie einen Witz erzählt.
»Wir kochen gerade unsere zehn Liter steuerfrei«, gab er kund.
Er ließ seinen Blick über drei Fässer à zweihundertzwanzig Liter gleiten und fügte witzelnd und komplizenhaft hinzu: »Zehn Liter – na gut, zehneinhalb!«
Marie-Anne zuckte zusammen, als sie hinter sich eine tiefe Männerstimme verärgert lospoltern hörte: »Hältst du wohl deinen Mund!«
Es war Soulage, dem Pfarrer Hulin folgte. Mit abweisendem Gesichtsausdruck baute er sich vor der jungen Frau auf: »Hören Sie mir mal gut zu, mein kleines Fräulein. In diesem Schuppen ist nichts und niemand! Verstanden?«
»Aber …«
»Selbst wenn Ihr Cousin Augereau Sie danach fragt, auch dann müssen Sie ihm genau das erzählen! Nichts und niemand! So!«
Pierrot und Frau Soulage sahen die junge Frau auf einmal mit einem veränderten Gesichtsausdruck an. Es war zwar keine Feindseligkeit, aber misstrauisches und verschlagenes Erstaunen.
»Und dann gibts hier ja auch nichts zu gucken«, kam es schließlich von der Bäuerin. »Wir reinigen nur gerade unsre Fässer, um Cidre zu machen; das ist alles!«
»Aber«, sagte Marie-Anne, als ob sie sich entschuldigen müsse. »Sie sind hier doch zu Hause und können natürlich machen, was Sie wollen!«
Soulage schien die Bemerkung zu gefallen. Er nickte zustimmend.
»Das stimmt!«, pflichtete er ihr bei. »So haben Sie zu reden, mein kleines Fräulein. Die sollen uns bloß keinen Ärger machen; wir machen andern schließlich auch keinen.«
Der alte Mann neben dem Destillierapparat schwankte zwar, hatte aber ein gutes Gehör. Er zeigte mit dem Finger auf die junge Frau, machte frech »Hehe!« und fügte abschließend hinzu: »Augereau ist ein Faulenzer!«
»Halts Maul!«, unterbrach ihn Pierrot.
Sein Lächeln wirkte jetzt leicht beunruhigt und bedeutungsschwer; ganz wie im Kino der selbstbeherrschte knallharteHeld. Er hatte sich zu Marie-Anne umgedreht.
»… Er meinte Beamter. Sehen Sie, bei uns macht man da keinen großen Unterschied.«
Marie-Anne hielt seinem Blick stand. Dem jungen Mann schien etwas verspätet aufzugehen, dass er sie gerade beleidigt hatte.
»Es gibt gute und weniger gute Beamte«, fügte er da hinzu. »Aber wie würden Sie jemanden nennen, der dafür bezahlt wird, anderen Leuten das Leben schwer zu machen?«
»Ich bin nicht hier, um mich dazu zu äußern«, sagte die junge Frau. »Ich habe dazu keine Meinung.«
Pierrots Lächeln wurde breiter; er kam näher.
»Na, dann müssen Sie sich aber schnell mal eine Meinung zulegen. Bei uns ist man entweder dafür oder dagegen. Man kann nicht gleichzeitig auf zwei Pferde setzen.«
»Danke für den Tipp«, meinte sie. »Aber ich bin nicht hierher gekommen, um mich um Erwachsene, sondern um Kinder zu kümmern.«
Ein halbes Jahrhundert Amtszeit hatte Pfarrer Hulin die Fähigkeit verliehen, eine Situation mit einem lauten, geschickt platzierten Lachen, einer einstudierten Bemerkung oder einer Mahnung zur Ernsthaftigkeit zu entschärfen.
»Was die arme Françoise da betrifft«, warf er ein. »Die Beerdigung würde mir gut übermorgen passen.«
»Das wird gehen«, unterstützte ihn Mutter Soulage. »Zu dieser Zeit im Jahr muss man erst mal ein Dienstmädchen finden. Sie hat das absichtlich gemacht, dieses Miststück!«
Sie bekreuzigte sich.
»Mit dem Federvieh konnte sie immerhin gut umgehen«, räumte sie ein. »Ich möcht ja nichts Schlechtes über sie sagen. Glauben Sie, dass die Beerdigung überhaupt in der Kirche stattfinden kann?«
»Der liebe Gott erkennt die Seinen«, sagte der Pfarrer.
Soulage hatte ein Glas direkt vom Destillierkolben genommen.
»Probieren Sie den, Pfarrer! Das ist Selbstgebrannter!«
Hulin nahm das Glas, roch daran und ließ sich genügend Zeit, um es in drei Schlucken leer zu trinken.
»Der ist noch gut«, lobte er. »Aber es geht doch langsam dem Ende zu. Was sagst du dazu, Gustave?«
Der Alte neben dem Destillierapparat trank mit glasigen Augen einen kleinen Schluck, rülpste und schnalzte dann mit der Zunge.
»Der schmeckt noch gut! Aber nicht mehr lang.«
Er schielte immer noch anzüglich zu Marie-Anne herüber: ein scheußlicher, nichtswürdiger, verschwitzter alter Trunkenbold, voll übelster Gewohnheiten.
»Hehe!«
Marie-Anne fühlte sich unwohl und beschmutzt; sie wandte sich ab.
»Also wegen Françoise, wir konnten hier ja nicht alles verrammeln. Und vielleicht wars ja gar kein junger Mann, ders gewesen ist.«
Der alte Pfarrer betrachtete den Trunkenbold mit trauriger Sanftmut.
»Jaja. Vielleicht macht der liebe Gott seine Sache ja doch gut! – Wer weiß, was draus geworden wär!«
»Was können wir schon wissen«, meinte Soulage schulmeisterlich. »Wir machen auf jeden Fall erst mal diesen Kessel fertig. Die Gendarmen hol ich heut Abend. Dann erst beginnt das Trauern für uns, Pfarrer!«
*
Pfarrer Hulin hatte sich für den letzten Kilometer nicht mehr angeschnallt. In der Abenddämmerung sah er traurig aus, wie ein Mann, der zu viel erlebt hat.
Marie-Anne saß sehr aufrecht und angespannt auf ihrem Platz. In einem bewusst neutralen Ton, als ob sie keine Antwort erwartete, fragte sie:
»Kommen hier in dieser Gegend öfter Selbstmorde vor?«
»Ach was!«, entgegnete der Pfarrer. »Auch nicht öfter als irgendwo anders. Ich bin jetzt schon seit dreißig Jahren in diesem Pfarrbezirk, und das war erst der fünfzehnte oder sechzehnte.«
»Aber das ist doch ziemlich viel!«, gab Marie-Anne zurück.
»Fast immer sinds Mädchen«, sagte der Pfarrer, als hätte er sie nicht gehört. »Sie erhängen oder ersäufen sich. Ich finds besser, wenn sie sich ersäufen. Wenn sie sich erhängen, wirds nämlich schwierig, die Erlaubnis von Seiner Eminenz für eine kirchliche Beisetzung zu bekommen.«
»Aber man ertrinkt doch nicht einfach so in einem Teich. Man hat doch einen Überlebenswillen; man wehrt sich doch«, empörte sich Marie-Anne.
Sie kamen ins Dorf und konnten sehen, wie sich die Kirche aus Granit neben dem Friedhof vor dem Abendhimmel abhob.
»Ach!«, sagte der Pfarrer. »Sie wehren sich eigentlich nicht. Sie knien sich in den Teich, tauchen den Kopf ins Wasser und bewegen sich nicht mehr.«
»Das kann nicht sein!«, sagte Marie-Anne, der ein eiskalter Schauer den Rücken hinunterlief. »Dazu bräuchte man einen übermenschlichen Willen.«
»Übermenschlich?«
Der Pfarrer schaute mit der traurigen Sanftmut eines alten Mannes zu ihr hinüber.
»Versuchen Sies doch mal: Trinken Sie drei, vier Gläser Schnaps in einem Zug und halten dann den Kopf in Ihre Waschschüssel. Bin sicher, dass Sie auch ersaufenwie die anderen.«
Das Hufgeklapper von Coquette änderte plötzlich die Tonlage, es wurde dumpfer: Die Kutsche passierte ein Vordach und sie fuhren in einen gepflasterten Hof.
»Fräulein Dhozier, die Direktorin, ist eine bemerkenswerte Person!«, sagte der Pfarrer. »Zwar ein bisschen barsch, passt aber ausgezeichnet hierher.«
Der viereckige Hof war von zwei strengen, im rechten Winkel zueinander stehenden Gebäuden umgeben; drei, vier Kastanienbäume verbreiteten den herben Duft von welken Blättern: Das war der Schulhof. Marie-Anne begriff, dass sie angekommen war.
Nur im Erdgeschoss brannte ein Licht, und eine alte Frau mit Schultertuch erschien auf der Schwelle. Marie-Anne hielt sie zunächst für das Dienstmädchen, aber sobald die Frau den Mund aufmachte und lostrompetete, zweifelte sie nicht mehr daran, dass es sich um Fräulein Dhozier handelte.
»Der Zug hatte also Verspätung? – Charlotte, nimm die Sachen des Fräuleins! Sie müssen ganz schön geschafft sein, meine arme, gute Frau! Kommen Sie schnell herein und ruhen Sie sich aus.«
Der Raum war geräumig und komplett mit Fliesen ausgelegt. Der Tisch war gedeckt; er stand unter einer Glühlampe, die an den Holzbalken hing. Ihr Licht war sehr schwach und wurde noch von einem Lampenschirm aus einem alten Wallfahrtsalmanach gedämpft.
Schon am Eingang schlug ihnen ein Geruch entgegen, der nach einer Mischung aus Kompott, Sakristeihinterzimmer, Bienenwachs, muffigem Trödelkram, Holzfeuer und auch – nein, das war doch nicht möglich!
Aber sicher, ja, das wars! Schwitzend stand der altehrwürdige Krug auf dem Tisch; neben ihm warteten die Tässchen, die kleinen irdenen Schälchen aus Quimper, in Reih und Glied.
Fräulein Dhozier, die vor Gastfreundschaft nur so sprühte, war schon beim Eingießen.
»Hier, meine arme, gute Frau! Das wird Ihnen gut tun!«
Und der klare Schnaps stieg in dem kleinen Schälchen immer höher. Marie-Anne unterdrückte einen Brechreiz. Natürlich, man wollte nur ihr Bestes. Das alte Fräulein Dhozier hatte das Gesicht einer Hexe, das des alten Pfarrers Hulin war blaurot angelaufen und das junge Dienstmädchen, das noch nicht einmal sechzehn Jahre alt war, hatte bereits die Statur eines normannischen Schranks, mit allerdings völlig stumpfsinnigem Gesichtsausdruck. Alle drei empfingen sie wohlwollend, voll Herzlichkeit und menschlicher Wärme.
»Und trotzdem«, dachte sie, »gießen sie mir da Gift ein!«
Sie war fast so weit, aus Höflichkeit zu akzeptieren, aber die Abneigung überwog. Seit mehr als zwei Stunden hatte sie den Geruch des alten Mannes und dann den des Destillierapparats einatmen müssen; sie hatte genug davon.
Sie lächelte bedauernd, um ihre Ablehnung zu kaschieren.
»Ich habe keinen Hunger«, sagte sie. »Die Reise …«
»Klar, Mensch«, meinte Fräulein Dhozier voller Mitgefühl, »Ihnen gehts jetzt nicht so gut, das ist verständlich. – Trinken Sie erst mal das! Damit Sie wieder zu Kräften kommen!«
Das Schälchen voller Schnaps befand sich dreißig Zentimeter vor ihrer Nase. Marie-Anne spürte, wie sie erbleichte.
»Ich hab auch keinen Durst«, entschuldigte sie sich.
Mit einem Mal herrschte eine gespannte Stille.
»Aber«, sagte die Direktorin, »dafür braucht man doch nicht durstig sein. Das ist ein Guter! Dann sind Sie gleich wieder auf dem Damm!«
Sie hatte das kleine Schälchen Marie-Anne in die Hand gedrückt. Die stellte es entschieden wieder zurück auf den Tisch.
»Ich trinke überhaupt keinen Alkohol!«, betonte sie.
»Aber«, die Direktorin war ein wenig fassungslos, »das ist doch kein Alkohol wie in der Stadt, meine Arme! Der ist nicht gepanscht! Das ist ein Naturprodukt vom lieben Gott für uns Christenleut, das wir nicht die Bohne verdienen!«
Marie-Anne schluckte und stellte sich der Konfrontation.
»Ich trinke nur Wasser, müssen Sie wissen.«
»Wasser?«
Höfliches Erstaunen machte sich breit. Drei Personen starrten sie verständnislos an. Fräulein Dhozier hatte eine trotzige Haltung eingenommen. Dann überwog jedoch ihre Gastfreundschaft. Sie drehte sich zum Dienstmädchen und meinte umgänglich, aber mit einer Spur Ironie in der Stimme: »Na, hol Wasser, Charlotte!«
Sie gab ihr Marie-Annes Schälchen, betonte jedoch extra: »Das wird aber nicht weggeschüttet!«
Die drei Normannen sahen einander an und tranken dann schweigend.
*
Brigadier Vandamme nahm gerade den Hörer ab, als der Gendarm Letellier ihm ankündigte: »Ein Selbstmord, Chef!«
Gleichzeitig las er die kurze Notiz, die ihm sein Untergebener auf den Tisch legte … »Nomville … Soulage-Hof … Françoise … im Teich ertrunken …«
»Hallo, wer ist dran?«, fragte er.
»Hier Pierre Soulage.«
»Von wo rufen Sie an?«
»Von Noirterre, dem Laden mit Imbiss in Saint-Fraimbault.«
»Wann haben Sie die Leiche entdeckt?«
»Vor vielleicht einer Stunde.«
»Haben Sie alles so gelassen, wie Sie es vorgefunden haben?«
»Nein, wir haben sie ins Haus gebracht. Es war eine Verwandte von uns.«
Der Brigadier zuckte mit den Schultern.
»Gut. Wir werden es uns ansehen.«
Er legte auf. Er musste die Untersuchung einleiten; als Polizeibeamter im mittleren Dienst war das schließlich sein Beruf. Er schien besorgt zu sein; Letellier interpretierte dies falsch: »Glauben Sie, dass es sich um ein Verbrechen handelt?«
»Das würde mich überraschen«, sagte Vandamme. »Aber Pierre Soulage ist ein Kerl, der so langsam von sich reden macht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es sich um ein Ablenkungsmanöver handelt, um zu versuchen, Schnaps wegzukarren.«
Er nahm wieder den Hörer ab und wählte.
»Gendarmerie!«, meldete er sich. »Geben Sie mir die 7-22 in Saint-Fraimbault.«
Fast sofort wurde die Verbindung hergestellt.
»Hallo? Café Noirterre? – Herr Noirterre? – Sagen Sie, jemand hat mich angeblich gerade von Ihnen angerufen. Stimmt das? – Pierre Soulage? – Vielen Dank. – Ist er gleich wieder gegangen? Das macht nichts, danke.«
Er legte auf.
»Das scheint in Ordnung zu sein«, meinte er. »Aber rufen Sie doch sicherheitshalber noch mal Augereau an und fragen ihn, ob er daran interessiert ist, eine kleine Spritztour zu machen.«
*
Sofort nach dem Bahnübergang wurde Pierre Soulage hellhörig. Er saß am Steuer des Lieferwagens, ein Peugeot 203; sein Vater befand sich neben ihm. Irgendetwas schien ihm im hinteren Teil nicht gut verstaut zu sein; es rumpelte.
»Da hinten rumpelt es«, sagte er. »Hör doch mal!«
Aber sein Vater wollte nur möglichst schnell ans Ziel kommen.
»Fahr einfach weiter!«
Es war schon fast dunkel, und dennoch fuhr Pierrot immer noch ohne Licht. Er beschleunigte im dritten Gang, bremste ab und ließ den Wagen dann ausrollen.
Es war jetzt ganz deutlich zu hören, dass hinter ihnen die Fässer gegeneinander stießen. Wütend hielt er am Straßenrand an.
»Ich hätt es ahnen müssen! Ihr habt die Fässer einfach nur reingestellt. Was ist, wenn wir volles Tempo fahren müssen! Weißt du, was dann passiert? Sechshundert Liter würden dann in der Gegend rumlaufen!«
»Fahr doch zu!«, meinte sein Vater. »Wir brauchen ja nicht volles Tempo fahren.«
»Entweder macht man eine Sache richtig«, sagte Pierrot, »oder man lässts gleich ganz bleiben!«
Mit diesen energischen Worten stieg er aus, nahm ein Hanfseil und begann, die drei Fässer festzubinden.
»Wegen dir kommen wir noch zu spät!«, brauste sein Vater auf.
»Okay«, entgegnete Pierrot, »aber wir leben hier doch fast wie im Krieg! Und ich komm da schließlich grad her. Weißt du überhaupt, was wir riskieren? Wenn sie uns erwischen, sind sechs Millionen Bußgeld fällig! – Selbst mit dem Geld aus diesem Geschäft hätten wir daran ganz schön zu knabbern!«
»Gut!«, sagte sein Vater gereizt. »Machs fest, aber komm in die Hufe! Wenn wir heute Nacht je fällig sind, dann ändern deine Schnüre auch nichts dran.«
Im Dunkeln befestigte Pierrot die Fässer akribisch an den Eisenträgern, als handelte es sich um Flugfracht.
»Hör zu, Papa«, sagte er. »Wenn man gefasst wird, so hat man das immer sich selber zuzuschreiben. In den letzten zwei Jahren hab ich dreimal mehr Touren gemacht als du in deinem ganzen Leben. Mir ist nie was passiert. Ich hab die Ware der anderen immer ohne einen einzigen Tropfen Verlust geliefert. – Also werde ich ihnen heut, wo wir unsere eigene Ware transportieren, auch nicht ein Löffelchen davon überlassen!«
Als er mit dem Festbinden fertig war, setzte er sich wieder ans Steuer. Der alte Soulage schüttelte den Kopf.
»Wir hätten gar nicht erst losfahren dürfen!«, meinte er. »Der Ärger, den Françoise uns damit gemacht hat, ins Wasser zu gehen, das ist kein gutes Zeichen! Wer weiß, ob der liebe Gott uns damit vielleicht nicht sagen will, dass wir nicht losfahren sollen – denk ich mir halt.«
»Also, ich sag dir mal was, Papa. Der liebe Gott, das sind die Reflexe! – Wenn du schnellere Reflexe hast als der Typ dir gegenüber, dann kannst du dir den lieben Gott schenken.«
Dann legte er den Gang ein.
*
Der uralte Vedette wurde vor der Kreuzung langsamer und hielt dann an.
Carbonnier betrachtete die Karte im Licht seiner Taschenlampe.
»Wenn er aus Saint-Fraimbault kommt«, sagte er, »dann muss er zwangsläufig hier lang kommen. An deiner Stelle, Augereau, würde ich auf der Kreuzung warten.«
Augereau war vielleicht dreißig Jahre alt. Er hatte eine klaren Blick, eine eigensinnige Stirn und eine Falte im Mundwinkel, von der man nicht genau sagen konnte, ob sie ein Zeichen von Ironie oder von Verbitterung war.
»Wir machen die ganze Zeit nichts anderes, als zu warten!«, sagte er. »Aber meiner Ansicht nach haben wir auf jeden Fall fünf Minuten Verspätung, auch wenn der Tipp gut ist.«
Zur Beruhigung seines Gewissens schaltete er die rote Leuchtschrift »STOPP POLIZEI« an, um zu überprüfen, ob sie auch funktionierte. Er machte sie wieder aus. Dann dachte er nach, legte den Gang ein, fuhr über die Kreuzung und parkte am Eingang der kleinen schmalen Straße.
»So hat er keine Chance«, sagte er. »Hier kann man nicht wenden.«
Aber seine Stimme klang desillusioniert.
»Du scheinst ja nicht besonders dran zu glauben!«, kam es prompt von Carbonnier.
»Wir werden dafür bezahlt, dran zu glauben«, sagte Augereau. »Aber wenn er das Café Noirterre um achtzehn Uhr siebzehn verlassen hat, sind wir nicht mehr in der Zeit. – Höchstens er hat ein Schäferstündchen eingelegt!«
Er zuckte resigniert mit den Schultern und hielt seinem Kollegen ein Päckchen Zigaretten hin.
Die Nacht brach herein. Der Regen hatte aufgehört, aber die kleine Nebenstraße glänzte noch feucht.
Da hörte Augereau, wie sich das Motorengeräusch eines Lieferwagens näherte.
»Hör dir das an!«, flüsterte er.
Alle Sinne der beiden Männer waren plötzlich hellwach; ihre Aufmerksamkeit war zum Zerreißen gespannt.
*
Pierrot fuhr ziemlich schnell.
Er kannte die kleine kurvenreiche Straße aus dem Effeff; gleich würde er an ihrer Kreuzung mit der Departementsstraße 19 nach Domfront sein.
Schon als er in die letzte Kurve fuhr, erahnte er den hundert Meter entfernt in der hereinbrechenden Nacht wartenden Vedette. In Vorausahnung hob er den Fuß. Eine Sekunde später leuchtete das rote Warnlicht auf und versperrte die Straße.
Sein Vater verzog das Gesicht und schluckte plötzlich wie ein Boxer, der einen Schlag auf die Leber bekommt.
»Da haben wir den Salat!«, murmelte er.
Pierrot war voll aufs Bremspedal getreten.
Blitzschnell hatte er die Situation eingeschätzt; sie war nicht gerade günstig.
Durchbrechen? – Aber sie hatten den Vedette etwas quer gestellt; er blockierte fast die ganze Straße.
Umdrehen? Das war wegen der Enge der Straße nicht möglich. Rechts und links versperrten zudem noch undurchdringliche Wände aus Sträuchern, deren ineinander verschlungenes Wurzelwerk sich in der Böschung festgekrallt hatte, den Weg.
Er machte eine Vollbremsung, während Soulage sich verzweifelt auf den Armaturen abstützte. Hinter sich hörten sie die Seile unter dem Gewicht der sechshundert Liter Alkohol knarren.
Pierrot legte den Rückwärtsgang ein und gab Vollgas. Hinter sich konnte er überhaupt nichts sehen; so musste er den Kopf zur Orientierung aus dem heruntergekurbelten Fenster stecken. Aufs Gradewohl fuhr er mit aufheulendem Motor schon fast vierzig.
Er versuchte, schnell zu denken. Der erste Querweg war mehr als vierhundert Meter entfernt; er durfte nicht darauf hoffen, ihn zu erreichen.
Seine prompte Reaktion hatte es ihm ermöglicht, den anderen hinter sich zu lassen, aber er konnte deswegen keine Atempause einlegen. Sollte er einfach weiter auf dem Gas bleiben und darauf hoffen, dass der andere Probleme mit dem Anlasser hatte?
Als dessen Scheinwerfer angingen, sah er, dass diese letzte Hoffnung vergebens gewesen war.
»Da haben wir den …«, sagte nochmals sein Vater.
Um dann angsterfüllt plappernd fortzufahren: »Halt an! Du siehst doch, dass hier nichts mehr läuft!«
Aber Pierrot sah in der Situation auch eine sportliche Herausforderung. Hinter ihm erhellte grelles Scheinwerferlicht die Straße. Kaum hatte er das Wiesenstück, das den Graben überspannte, die Einfahrt zur Weide und ein geschlossenes Holztor gesehen, da ersann er auch schon das Manöver und führte es praktisch im selben Moment aus.
Ohne seine Fahrt zu verlangsamen, bog er plötzlich links ab. Sein Heck raste in das Tor aus drei Rundstämmen und durchbrach es. In diesem Moment trat er jedoch schon auf die Bremse, steuerte gegen und schaltete gleichzeitig in den ersten Gang.
Zu spät! Seine Verfolger waren bereits da und stoppten genau vor ihm mit quietschenden Reifen, um ihm den Weg zu versperren.
Fast eine Sekunde lang herrschte eine bedeutungsschwere Stille. Dann erhob Augereau seine Stimme: »Komm schon, Soulage, du bist geliefert! Bleib ruhig!«
»Da haben …«, murmelte noch einmal sein Vater.
Aber der Sohn schüttelte eigensinnig verneinend den Kopf. Es lag ihm nicht, auf freiem Feld aufzugeben; er wollte bis zum Schluss kämpfen.
Er legte erneut den Rückwärtsgang ein und raste blindlings los. Wo war er? Trotz seiner ausgeprägten Ortskenntnisse schaffte er es nicht, sich zurechtzufinden. War diese Wiese eine Sackgasse oder hatte sie noch einen anderen Ausgang?
Er drehte sich um einen Viertelkreis und schoss nach vorne. Er musste jetzt aufs Ganze gehen: Er blendete auf.
Gerade in diesem Moment kamen die anderen auf die Wiese gerast. Und dort, wo sich ihre Scheinwerferbündel trafen, konnten alle das Tor am Ende der Wiese, in ungefähr hundert Metern Entfernung, sehen.
Jetzt begann ein wahres Katz-und-Maus-Spiel.
Sie waren auf einer großen Wiese, auf der hundertjährige dickstämmige Apfelbäume standen, die sich unter der Last ihrer Früchte bogen. Sie schienen von unten absolut geradlinig zugeschnitten worden zu sein. Kühe waren die Ursache dieser Uniformierungsmaßnahmen.
In der hereinbrechenden Nacht sah das Ganze ein bisschen wie ein riesiger gewölbter Saal mit unzähligen Pfeilern aus. Die Situation wurde aber noch dadurch verkompliziert, dass immer wieder Kühe plötzlich zwischen den Pfeilern auftauchten, aufsprangen und erschreckt muhend herumtobten.
Pierrot raste zunächst in Richtung des anderen Ausgangs, aber Augereau hatte dieselbe Idee gehabt, besaß jedoch den Vorteil, einfach nur geradeaus fahren zu müssen.