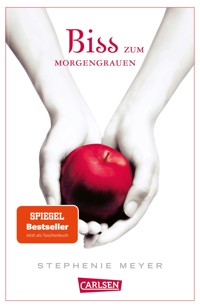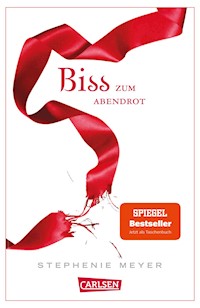Biss: Band 1-4 der paranormalen Twilight-Saga im Sammelband! (Bella und Edward) E-Book
Stephenie Meyer
15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
4 Bände der weltweit erfolgreichen Twilight-Serie von Spiegel-Bestseller-Autorin Stephenie Meyer in einer E-Box! Mit Romantik oder gar Leidenschaft hätte Isabella Swan ihren Umzug in die langweilige, verregnete Kleinstadt Forks kaum in Verbindung gebracht. Bis sie den undurchschaubaren und unwiderstehlichen Edward kennenlernt. Mit aller Macht fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Und riskiert dabei mehr als ihr Leben … So beginnt die Liebesgeschichte des Jahrtausends. Bella und Edward entführen uns in eine fantastische Welt voller eiskalter Vampire und heißer Werwölfe – für den Kampf um die ewige Liebe! Dieser Sammelband enthält vier Bände der »Biss«-Saga: Biss zum Morgengrauen Biss zur Mittagsstunde Biss zum Abendrot Biss zum Ende der Nacht Außerdem in der Reihe erschienen: Biss zu Mitternachtssonne Biss zum ersten Sonnenstrahl – Das kurze zweite Leben der Bree Tanner Seit August 2020 gibt es auch Band 5 der weltweit geliebten Fantasy-Romance-Serie: »Biss zur Mitternachtssonne« und endlich erfahren wir die Geschichte aus Edwards Sicht!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 3085
Ähnliche
Stephenie Meyer: Bella und Edward
Mit Romantik oder gar Leidenschaft hätte Isabella Swan ihren Umzug in die langweilige, verregnete Kleinstadt Forks kaum in Verbindung gebracht. Bis sie den undurchschaubaren und unwiderstehlichen Edward kennenlernt. Mit aller Macht fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Und riskiert dabei mehr als ihr Leben …
So beginnt die Liebesgeschichte des Jahrtausends. Bella und Edward entführen uns in eine fantastische Welt voller eiskalter Vampire und heißer Werwölfe – für den Kampf um die ewige Liebe!
Diese Gesamtausgabe enthält alle vier Bände der Bestsellerserie: Biss zum Morgengrauen Biss zur Mittagsstunde Biss zum Abendrot Biss zum Ende der Nacht
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Biss zum Morgengrauen
Biss zur Mittagsstunde
Biss zum Abendrot
Biss zum Ende der Nacht
Vita
Leseprobe
Nur von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, von dem darfst du nicht essen; denn sobald du davon issest, musst du sterben.
Vorwort
Ich hatte mir nie viele Gedanken darüber gemacht, wie ich sterben würde, obwohl ich in den vergangenen Monaten allen Grund dazu gehabt hätte. Und wenn, wäre meine Vorstellung ohnehin eine andere gewesen.
Mein Blick war auf die dunklen Augen des Jägers geheftet, der am anderen Ende des langgezogenen Raumes stand und mich freundlich betrachtete. Ich atmete nicht.
Es war ganz sicher eine gute Art zu sterben – an Stelle eines anderen, eines geliebten Menschen. Es war sogar edel. Das musste etwas wert sein.
Wäre ich nicht nach Forks gegangen, würde ich jetzt nicht dem Tod ins Auge blicken, das stand fest. Doch trotz meiner Angst konnte ich mich nicht dazu bringen, die Entscheidung zu bereuen. Wenn einem das Leben einen Traum beschert, der jede Erwartung so weit übersteigt wie dieser, dann ist es sinnlos zu trauern, wenn er zu Ende geht.
Der Jäger lächelte und kam ohne Eile auf mich zu, um mich zu töten.
Auf den ersten Blick
Meine Mutter fuhr mich mit heruntergelassenen Scheiben zum Flughafen. Es war warm in Phoenix, 24 Grad, und über uns spannte sich ein makellos blauer, wolkenloser Himmel. Ich hatte meine Lieblingsbluse an, ärmellos, mit weißer Lochspitze – es war eine Art Abschiedsgeste. Mein Handgepäck bestand aus einem Parka.
Auf der Halbinsel Olympic im Nordwesten von Washington State liegt unter einer selten aufreißenden Wolkendecke eine bedeutungslose, kleine Stadt namens Forks. In ihr regnet es mehr als in jedem anderen Ort der Vereinigten Staaten von Amerika. Von dort – fort aus dem ewig trüben Dämmerlicht – floh meine Mutter mit mir, als ich gerade mal ein paar Monate alt war. Dort hatte ich Jahr für Jahr einen Monat meiner Sommerferien verbringen müssen, bis ich vierzehn wurde – dann setzte ich mich endlich durch, und in den vergangenen drei Jahren machte Charlie, mein Vater, stattdessen zwei Wochen Urlaub in Kalifornien mit mir.
Dorthin, nach Forks, ging ich jetzt ins Exil, und zwar mit Schrecken. Ich hasste Forks.
Und ich liebte Phoenix. Ich liebte die Sonne und die glühende Hitze. Ich liebte die betriebsame, schier endlos wuchernde Stadt.
»Bella«, sagte meine Mom, bevor ich durch die Absperrung ging, zum hundertsten und letzten Mal – »du musst nicht, wenn du nicht willst.«
Meine Mom sieht genauso aus wie ich, nur mit kurzen Haaren und Lachfalten. Ich spürte, wie mich die Panik durchzuckte, als ich in ihre großen, kindlichen Augen schaute. Meine liebevolle, unberechenbare, durchgeknallte Mutter – wie konnte ich sie nur sich selbst überlassen? Klar, sie hatte jetzt Phil, also würden die Rechnungen wohl bezahlt werden, es würde was zu essen im Kühlschrank sein und Benzin im Tank. Und es gab jemanden, den sie anrufen konnte, wenn sie sich verirrte. Trotzdem …
»Ich will aber«, beteuerte ich. Ich war immer eine miserable Lügnerin gewesen, doch diesen Satz hatte ich in letzter Zeit so häufig wiederholt, dass er mittlerweile beinahe überzeugend klang.
»Grüß Charlie von mir«, sagte sie resignierend.
»Mach ich«, antwortete ich.
»Wir sehen uns bald«, beteuerte sie. »Du kannst immer nach Hause kommen – ich bin hier, wenn du mich brauchst.«
Aber in ihren Augen konnte ich sehen, welches Opfer sie dieses Versprechen kostete.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte ich bestimmt. »Das wird super. Ich liebe dich, Mom.«
Sie hielt mich eine Weile fest umarmt, dann ging ich weg und sie war verschwunden.
Der Flug von Phoenix nach Seattle dauert vier Stunden, dann geht es noch mal eine Stunde in einem kleinen Flugzeug hoch nach Port Angeles, und eine weitere Stunde mit dem Auto runter nach Forks. Das Fliegen machte mir nichts aus, aber vor der Fahrt mit Charlie hatte ich ein bisschen Bammel.
Charlie hatte ziemlich gut reagiert auf die ganze Geschichte. Er schien sich wirklich zu freuen, dass ich zum ersten Mal halbwegs langfristig bei ihm wohnen würde, hatte mich schon in der Schule angemeldet und wollte mir dabei behilflich sein, ein Auto zu finden.
Das Problem war, dass es nicht viel gab, worüber wir reden konnten; wir waren beide keine großen Plaudertaschen. Ich wusste, dass ihn meine Entscheidung enorm verwirrte – wie meine Mutter hatte ich nie einen Hehl aus meiner Abneigung gegen Forks gemacht.
Bei der Landung in Port Angeles regnete es. Ich nahm es nicht als ein böses Omen, sondern schlicht als unvermeidlich. Von der Sonne hatte ich mich bereits verabschiedet.
Charlie kam mich mit dem Streifenwagen abholen. Auch damit hatte ich gerechnet. Die braven Bürger von Forks kennen Charlie nämlich als Chief Swan, den örtlichen Hüter des Gesetzes. Deswegen wollte ich unbedingt mein eigenes Auto, obwohl ich knapp bei Kasse war: Ich hatte keine Lust, in einem Wagen mit roten und blauen Lichtern auf dem Dach durch die Stadt chauffiert zu werden. Nichts hält den Verkehr so sehr auf wie ein Polizist.
Ich stolperte aus dem Flugzeug, und Charlie drückte mich unbeholfen mit einem Arm an sich.
»Schön, dich zu sehen, Bells«, sagte er lächelnd, während er mich mit einer automatischen Bewegung auffing und stützte. »Du hast dich kaum verändert. Wie geht’s Renée?«
»Mom geht’s gut. Ich freu mich auch, dich zu sehen, Dad.« Er wollte nicht, dass ich ihn Charlie nenne.
Und damit war unser Gespräch auch schon fast wieder beendet. Ich hatte nur ein paar Taschen dabei. Die meisten meiner Arizona-Klamotten waren untauglich für Washington – nicht wasserfest. Mom und ich hatten unser Geld zusammengelegt, um meine Wintergarderobe aufzustocken, aber sie war trotzdem noch dürftig. Es passte alles problemlos in den Kofferraum des Streifenwagens.
»Ich hab ein gutes Auto für dich bekommen, ganz billig«, verkündete er, als wir angeschnallt waren.
»Was denn für eins?« Ich war misstrauisch, weil er »ein gutes Auto für dich« gesagt hatte anstatt nur »ein gutes Auto«.
»Genauer gesagt, einen Transporter – einen Chevy.«
»Woher hast du den?«
»Erinnerst du dich noch an Billy Black aus La Push?« La Push ist das winzige Indianerreservat an der Küste.
»Nein.«
»Er war im Sommer immer mit uns angeln«, versuchte mir Charlie auf die Sprünge zu helfen.
Das würde erklären, warum ich mich nicht an ihn erinnerte. Wenn es darum geht, schmerzhafte Erinnerungen aus meinem Gedächtnis zu streichen, bin ich echt gut.
»Er sitzt jetzt im Rollstuhl«, fuhr Charlie fort, als ich nicht reagierte. »Er kann nicht mehr Auto fahren, also hat er mir ein gutes Angebot gemacht.«
»Welches Baujahr?« Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, war das die Frage, von der er gehofft hatte, ich würde sie nicht stellen.
»Billy hat ’ne Menge am Motor rumgebastelt – er ist eigentlich nur ein paar Jahre alt.«
»Wann hat er ihn denn gekauft?« Er glaubte doch wohl nicht, dass ich so schnell aufgab.
»Gekauft hat er ihn, glaub ich, 1984.«
»Neu?«
»Das nicht. Neu war er Anfang der Sechziger, würde ich sagen – oder frühestens in den späten Fünfzigern«, gab er verlegen zu.
»Aber Dad, ich hab nicht die geringste Ahnung von Autos. Wenn was kaputtgeht – ich krieg das nie wieder hin, und eine Reparatur kann ich mir nicht leisten …«
»Ehrlich, Bella, das Ding läuft wie geschmiert. So was wird heute gar nicht mehr gebaut.«
Das Ding. Das ist doch was, dachte ich mir – einen Namen hatte es schon mal.
»Was verstehst du denn unter billig?« Um mal zu dem Punkt zu kommen, bei dem ich keine Kompromisse machen konnte.
»Also, eigentlich hab ich ihn dir schon gekauft. Als Begrüßungsgeschenk.« Charlie warf mir einen hoffnungsvollen Seitenblick zu.
Wow. Umsonst.
»Dad, das war doch nicht nötig. Ich hätte mir doch selber ein Auto gekauft.«
»Ist schon okay. Ich will, dass du hier glücklich bist.« Sein Blick war nach vorn auf die Straße gerichtet, als er das sagte. Charlie fiel es nicht leicht, seine Gefühle in Worte zu fassen. Und weil ich das von ihm hatte, schaute ich ebenfalls nach vorn, als ich ihm antwortete.
»Das ist echt lieb von dir, Dad. Danke, ich freu mich wirklich.« Ich musste ihm ja nicht unbedingt verraten, dass ich unmöglich in Forks glücklich sein konnte. Und einem geschenkten Transporter schaut man nicht ins Maul – oder unter die Motorhaube.
»Ach was, keine Ursache«, murmelte er verschämt.
Wir wechselten noch ein paar Sätze über das ewige Regenwetter, und das war’s dann. Schweigend blickten wir nach draußen.
Es war tatsächlich schön hier, gar keine Frage. So grün alles: die Bäume, deren Stämme mit Moos überwachsen waren und deren Äste und Blätter ein Dach bildeten. Der Boden war von Farnen bedeckt, und selbst das Licht, das durch das Laub fiel, war grünlich.
Es war zu grün. Ein fremder Planet.
Dann waren wir endlich bei Charlie. Er wohnte noch immer in dem kleinen Haus mit den drei Zimmern plus Küche, das er und meine Mutter am Anfang ihrer Ehe gekauft hatten. Mehr als den Anfang hatte es nicht gegeben in ihrer Ehe. Und dort, an der Straße vor dem immergleichen Haus, stand mein neuer – na ja, neu für mich – Transporter. Sein roter Lack war ausgeblichen, er hatte große, abgerundete Kotflügel und ein knollenförmiges Fahrerhaus. Zu meiner großen Überraschung fand ich ihn super. Ich wusste zwar nicht, ob er fahrtüchtig war, aber ich fand, er passte zu mir. Außerdem war das eines dieser robusten, eisernen Vehikel, die praktisch unzerstörbar sind und Unfälle immer ohne jeden Kratzer überstehen, während ringsumher die Einzelteile irgendeines ausländischen Fabrikats verstreut liegen.
»Wow, Dad, der ist ja großartig! Danke!« Der schreckliche nächste Tag erschien mir auf einmal sehr viel weniger furchteinflößend. Zumindest stand ich nicht vor der Entscheidung, entweder drei Kilometer durch den Regen zu laufen oder im Streifenwagen des Polizeichefs bei der Schule vorzufahren.
»Freut mich, dass er dir gefällt«, grummelte Charlie, dem so viel Begeisterung schon wieder peinlich war.
Wir mussten nur einmal laufen, um mein ganzes Zeug nach oben zu bringen. Ich bekam das vordere Zimmer, das schon immer meins gewesen war. Der Dielenboden, die hellblauen Wände, die schräge Decke, die vergilbten Spitzengardinen an den Fenstern – das alles war Teil meiner Kindheit. Charlie hatte seit meiner Geburt genau zwei Veränderungen vorgenommen: Er hatte die Babykrippe gegen ein Bett ausgewechselt und, als ich etwas älter war, einen Schreibtisch angeschafft. Auf dem stand jetzt ein gebrauchter Computer, und über den Boden verlief ein festgetackertes Modemkabel zur nächsten Telefonbuchse. Das war eine Bedingung meiner Mutter gewesen, damit wir in Verbindung bleiben konnten. Selbst der alte Schaukelstuhl stand noch in der Ecke.
Es gab nur ein kleines Badezimmer im Haus, oben neben der Treppe, das würde ich mir mit Charlie teilen müssen. Ich versuchte, nicht zu intensiv darüber nachzudenken.
Eine von Charlies besten Eigenschaften ist, dass er einen in Ruhe lassen kann. Er zog sich zurück, damit ich ankommen und auspacken konnte, was bei meiner Mutter absolut undenkbar gewesen wäre. Es tat gut, allein zu sein, nicht lächeln und ein zufriedenes Gesicht machen zu müssen, sondern einfach nur deprimiert in den strömenden Regen da draußen zu schauen und ein paar Tränen zu verdrücken. Um richtig zu weinen, war ich nicht in Stimmung. Das hob ich mir besser für später auf, fürs Einschlafen, wenn die Gedanken an den nächsten Tag kommen würden.
Forks High School hatte die beängstigende Gesamtzahl von 357 Schülern – mit mir 358; zu Hause waren wir allein in meinem Jahrgang mehr als 700 gewesen. Alle hier waren zusammen aufgewachsen, schon ihre Großeltern kannten sich aus dem Sandkasten. Ich würde die Neue aus der großen Stadt sein, eine wandelnde Kuriosität, ein Freak.
Wenn ich wenigstens wirklich so aussehen würde wie ein Mädchen aus Phoenix, dann könnte ich daraus vielleicht Profit schlagen. Aber rein äußerlich würde ich nie irgendwo reinpassen. Eigentlich sollte ich sonnengebräunt, sportlich und blond sein – eine Volleyballspielerin oder ein Cheerleader, wie sich das gehört für eine Bewohnerin des »Valley of the Sun«.
Stattdessen hatte ich elfenbeinfarbene Haut und noch nicht mal die Ausrede blauer Augen oder roter Haare. Ich war schon immer schlank, aber nie muskulös gewesen, eher irgendwie weich – niemand würde mich für eine Athletin halten. Ich war rein motorisch einfach nicht in der Lage, Sport zu treiben, ohne mich zu demütigen und sowohl mich als auch sämtliche Umstehende zu gefährden.
Als ich meine Sachen im alten Kleiderschrank aus Kiefernholz verstaut hatte, nahm ich Zahnpasta, Shampoo und was ich sonst noch so brauchte, und ging ins Bad, um den Reisetag von meinem Körper zu waschen. Während ich meine strubbeligen feuchten Haare durchbürstete, betrachtete ich mein Gesicht im Spiegel. Vielleicht lag es am Licht, aber ich sah schon jetzt käsig aus, ungesund. Meine Haut war sehr rein und beinahe durchsichtig – mit ein bisschen Farbe konnte sie durchaus hübsch aussehen. Hier in Forks hatte sie keine.
Ich betrachtete mein blasses Spiegelbild und musste mir eingestehen, dass ich mir etwas vormachte. Nicht nur äußerlich würde ich nie irgendwo reinpassen. Und wenn es mir nicht gelungen war, in einer Schule mit 3000 Leuten meine Nische zu finden, wie standen dann wohl meine Chancen hier?
Ich kam nicht gut klar mit Leuten meines Alters. Und vielleicht kam ich in Wahrheit mit Leuten generell nicht gut klar. Selbst mit meiner Mutter, der ich mich näher fühlte als irgendwem sonst auf diesem Planeten, war das so – es war, als würden wir im selben Buch lesen, aber immer gerade auf verschiedenen Seiten. Manchmal fragte ich mich, ob ich mit meinen Augen dieselben Dinge sah wie der Rest der Welt. Möglicherweise funktionierte ja mein Gehirn nicht richtig.
Aber die Ursache war egal – alles, was zählte, war die Wirkung. Und der nächste Tag war erst der Anfang.
Ich schlief nicht gut in dieser Nacht, selbst nicht nachdem ich ausgiebig geweint hatte. Das unaufhörliche Rauschen des Regens und des Windes auf dem Dach wollte einfach nicht zum Hintergrundgeräusch verklingen. Ich zog mir die verschlissene alte Bettdecke über den Kopf, und später noch das Kissen, trotzdem schlief ich erst nach Mitternacht ein, als der Regen endlich nachließ und zu einem leisen Tröpfeln wurde.
Als ich am Morgen aus dem Fenster schaute, sah ich nichts als dichten Nebel. Nie konnte man hier den Himmel sehen, es war wie in einem Käfig.
Das Frühstück mit Charlie verlief still. Er wünschte mir viel Glück in der Schule. Ich bedankte mich, aber ich wusste, dass er vergeblich hoffte – das Glück machte normalerweise einen Bogen um mich. Charlie fuhr los zum Polizeirevier, das ihm Frau und Familie ersetzte; mir blieb noch etwas Zeit. Nachdem er weg war, saß ich auf einem der drei bunt zusammengewürfelten Stühle an dem alten, quadratischen Eichentisch und betrachtete die kleine Küche: die dunkel getäfelten Wände, die leuchtend gelben Schränke, das weiße Linoleum. Alles war wie immer. Die Schränke hatte meine Mutter vor achtzehn Jahren gestrichen, um etwas Sonne ins Haus zu bringen. Nebenan, im winzigen Wohnzimmer, hingen ein paar Bilder über dem kleinen Kamin. Ein Hochzeitsfoto von Charlie und meiner Mom, aufgenommen in Las Vegas, daneben eines von uns dreien im Krankenhaus, nach meiner Geburt, und schließlich, in einer Reihe, meine Schulfotos bis zu diesem Jahr. Die waren mir peinlich – vielleicht ließ sich Charlie ja überzeugen, sie abzuhängen, zumindest solange ich hier war.
Hier im Haus war es unmöglich zu übersehen, dass Charlie die Trennung von meiner Mutter nie verwunden hatte. Der Gedanke bereitete mir Unbehagen.
Ich wollte nicht zu früh in der Schule sein, aber hier drinnen hielt ich es auch nicht länger aus. Ich zog mir meine Jacke über – sie fühlte sich an wie ein Astronautenanzug – und ging raus in den Regen.
Noch immer nieselte es nur, also blieb ich verhältnismäßig trocken, als ich vor der Tür den Schlüssel aus seinem gewohnten Versteck unter dem Dachvorsprung nahm und abschloss. Das platschende Geräusch meiner neuen wasserfesten Stiefel war irritierend – ich vermisste das vertraute Knirschen von Kies unter meinen Sohlen. Ich hätte ja liebend gern ein bisschen meinen neuen Transporter bewundert, aber ich wollte raus aus der nebligen Nässe, die meinen Kopf umschwirrte und sich unter der Kapuze auf meine Haare legte.
Im Fahrerhaus war es gemütlich und trocken. Irgendjemand, Billy oder Charlie, hatte hier drinnen sauber gemacht, doch die hellbraunen Sitzpolster rochen immer noch leicht nach Tabak, Benzin und Pfefferminze. Zu meiner Erleichterung sprang der Motor gleich an, allerdings mit ohrenbetäubender Lautstärke. Er heulte auf und behielt den Lärmpegel selbst im Leerlauf bei. Aber irgendeine Macke musste ein Auto dieses Alters ja haben. Dafür funktionierte überraschenderweise das prähistorische Radio.
Ich kannte zwar den Weg nicht, hatte aber keine Probleme, die Schule zu finden. Sie war, wie fast alles in dieser Stadt, nur einen Steinwurf vom Highway entfernt. Sie sah überhaupt nicht aus wie eine Schule, sondern wie eine Ansammlung identischer Bauten aus rotbraunen Ziegeln; ich hielt nur an, weil ich das Schild sah: Forks High School. Es standen so viele Bäume da, dass ich zuerst gar nicht bemerkte, wie groß das Gelände war. Wo war bloß das vertraute Anstaltsgefühl?, dachte ich nostalgisch. Wo waren der Maschendrahtzaun und die Metalldetektoren?
Ich parkte gleich vor dem ersten Gebäude, an dem ein kleines Schild mit der Aufschrift »Verwaltung« angebracht war. Außer mir parkte hier niemand, wahrscheinlich war es untersagt; aber bevor ich wie ein Idiot Runde um Runde im Regen drehte, erkundigte ich mich lieber. Widerwillig kletterte ich aus dem mollig warmen Fahrerhaus und ging auf einem schmalen gepflasterten Weg, der von dunklen Hecken gesäumt war, zum Eingang. Dann holte ich tief Luft und öffnete die Tür.
Drinnen war es hell erleuchtet und wärmer, als ich gehofft hatte. Das Sekretariat war klein; es gab einen winzigen Wartebereich mit gepolsterten Klappstühlen, der Boden war mit orangefarben gesprenkelter Büro-Auslegeware bedeckt, an den Wänden hingen Mitteilungen, Auszeichnungen und eine laut tickende Uhr. Und als wäre es draußen noch nicht grün genug, standen überall große Plastiktöpfe mit Zimmerpflanzen. Mitten durch den Raum ging ein langer Empfangstresen, der mit Formularablagen zugestellt war; an seiner Vorderseite klebten lauter bunte Infozettel. Hinter dem Empfangstresen standen drei Schreibtische, und an einem saß eine große, rothaarige Frau mit Brille. Sie trug ein lilafarbenes T-Shirt, bei dessen Anblick ich mir sofort overdressed vorkam.
Die Rothaarige blickte auf. »Kann ich dir helfen?«
»Ich bin Isabella Swan«, teilte ich ihr mit und sah ihrem Blick an, dass sie sofort Bescheid wusste. Mit Sicherheit hatten sie hier schon gespannt gewartet und sich die Mäuler zerrissen. Die Tochter der flatterhaften Exfrau vom Polizeichef. Wieder zu Hause, nach so langer Zeit.
»Ja, richtig«, sagte sie und kramte in einem wackligen Stapel Unterlagen herum, bis sie gefunden hatte, wonach sie suchte. »Voilà – hier haben wir deinen Stundenplan, und hier ist eine Übersichtskarte des Schulgeländes.« Sie kam mit mehreren Blättern Papier zum Empfangstresen.
Sie ging mit mir meinen Stundenplan durch, zeichnete auf der Karte die kürzesten Wege zwischen den verschiedenen Räumen nach und gab mir einen Zettel, den ich von allen Lehrern unterschreiben lassen und am Ende des Unterrichts wieder bei ihr abgeben sollte. Dann lächelte sie und sagte, sie hoffte, es würde mir in Forks gefallen. Genau wie Charlie. Ich erwiderte ihr Lächeln so überzeugend wie möglich.
Als ich zurück zu meinem Transporter ging, trudelten so langsam die anderen Schüler ein. Ich fuhr um die Gebäude herum, immer ihren Autos nach. Ich war froh, dass die meisten ältere Baujahre waren, so wie meins, nichts Schickes. Zu Hause hatte ich in einem der wenigen einkommensschwachen Viertel des Paradise Valley District gewohnt; dort war ein fabrikneuer Mercedes oder Porsche auf dem Schülerparkplatz ganz normal. Hier war das schönste Auto ein blitzender Volvo, und der stach so richtig heraus. Um nicht gleich alle Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, stellte ich den donnernden Motor ab, sobald ich eingeparkt hatte.
Ich schaute mir noch einmal die Karte an und versuchte sie mir einzuprägen – ich hatte keine Lust, den ganzen Tag mit einem Stück Papier vorm Gesicht herumzulaufen. Dann stopfte ich alles in meine Tasche, warf mir den Trageriemen über die Schulter und atmete tief ein. Ich schaff das, redete ich mir ohne große Überzeugung ein. Es würde mich schon niemand beißen. Schließlich stieg ich aus.
Ich verbarg mein Gesicht unter der Kapuze und mischte mich unter die übrigen Schüler. In meiner schlichten schwarzen Jacke fiel ich nicht auf, wie ich erleichtert feststellte.
Nachdem ich an der Cafeteria vorbei war, war Haus drei nicht zu verfehlen: Auf ein weißes Quadrat am östlichen Rand des Gebäudes war eine große schwarze 3 gepinselt. Je näher ich dem Eingang kam, desto hektischer ging mein Atem. Ich versuchte die Luft anzuhalten und betrat hinter zwei Unisex-Regenjacken das Gebäude.
Das Klassenzimmer war klein. Die beiden vor mir hängten ihre Jacken an eine lange Reihe von Kleiderhaken gleich neben der Tür. Ich hängte meine daneben. Es waren zwei Mädchen; die eine hatte porzellanfarbene Haut und blonde Haare, die andere war ein gleichfalls blasser Typ mit hellbraunen Haaren. Wenigstens mein Teint würde hier nicht herausstechen.
Ich ging mit meinem Laufzettel zum Lehrer, einem großen, nahezu kahlköpfigen Mann, dessen Namensschild ihn als Mr Mason auswies. Er sah meinen Namen und glotzte mich an – keine besonders ermutigende Reaktion. Natürlich lief ich puterrot an. Aber wenigstens schickte er mich zu einem freien Tisch in der letzten Reihe, ohne mich der Klasse vorzustellen. Der Platz ganz hinten erschwerte es meinen neuen Mitschülern, mich anzustarren, aber irgendwie schafften sie es trotzdem. Ich hob meinen Blick nicht von der Leseliste, die der Lehrer mir gegeben hatte. Ziemlich elementare Sachen: Brontë, Shakespeare, Chaucer, Faulkner. Hatte ich alles schon gelesen, was beruhigend war … und langweilig. Ich überlegte, ob Mom sich wohl einverstanden erklären würde, mir den Ordner mit meinen alten Essays zu schicken – oder würde sie das für Betrug halten? Ich diskutierte in Gedanken verschiedene Streitpunkte mit ihr durch, während der Lehrer vorne weiterschwafelte.
Als es klingelte – es war eher eine Art nasales Surren –, lehnte sich ein schlaksiger Junge mit Problemhaut und öligen Haaren über den Gang zu mir rüber.
»Du bist Isabella Swan, oder?«, sprach er mich an. Dem Aussehen nach war er einer dieser übertrieben hilfsbereiten Jungs, die ihre Nachmittage im Schachklub verbrachten.
»Bella«, berichtigte ich ihn. Alle im Radius von drei Tischen drehten sich in meine Richtung.
»Was hast du als Nächstes?«, fragte er.
Ich musste in meiner Tasche nachsehen. »Äh, Politik, bei Jefferson, Haus sechs.«
Egal, wohin ich schaute: neugierige Blicke.
»Ich muss zu Haus vier, ich könnte dir den Weg zeigen.« Übertrieben hilfsbereit, ohne jede Frage. »Ich bin Eric«, fügte er hinzu.
Ich lächelte verkrampft. »Danke.«
Wir holten unsere Jacken und gingen raus in den Regen, der stärker geworden war. Ich hätte schwören können, dass ein paar Leute dicht genug hinter uns liefen, um mithören zu können. Hoffentlich werde ich nicht paranoid, dachte ich.
»Ein ganz schöner Unterschied zu Phoenix, was?«, fragte er.
»Ziemlich.«
»Dort regnet es eher selten, oder?«
»Drei- oder viermal im Jahr.«
»Wow, wie das wohl ist?«, sinnierte er.
»Sonnig«, sagte ich ihm.
»Du bist nicht sonderlich braun.«
»Meine Mutter ist zur Hälfte Albino.«
Er musterte mich besorgt, und ich seufzte. Viele Wolken und ein Sinn für Humor vertrugen sich offenbar nicht so gut. Ein paar Monate hier, dann würde ich vergessen haben, was Sarkasmus ist.
Wir gingen wieder an der Cafeteria vorbei, zu den Gebäuden auf dem südlichen Teil des Geländes, neben der Turnhalle. Eric brachte mich bis zur Tür, auch wenn sie nicht zu übersehen war.
»Viel Glück«, sagte er, als ich nach der Klinke griff. »Vielleicht haben wir ja noch andere Fächer zusammen.« Es klang hoffnungsvoll.
Ich lächelte unbestimmt und ging hinein.
Der Rest des Vormittags verlief auf dieselbe Weise. Mr Varner, mein Mathelehrer, den ich allein schon seines Faches wegen gehasst hätte, war der Einzige, der mich dazu zwang, mich der Klasse vorzustellen. Ich stammelte, lief rot an und stolperte auf dem Weg zu meinem Platz über meine eigenen Stiefel.
Von der dritten Stunde an erkannte ich in jedem neuen Kurs ein paar Gesichter wieder. Jedes Mal gab es einen, der mutiger war als die anderen, sich vorstellte und mich fragte, wie es mir in Forks gefiel. Ich versuchte diplomatisch zu sein, aber hauptsächlich log ich. Wenigstens kam ich ohne die Karte aus.
Ein Mädchen saß sowohl in Mathe als auch in Spanisch neben mir und begleitete mich in der Mittagspause zur Cafeteria. Sie war winzig, ein ganzes Stück kleiner als meine ein Meter sechzig, aber ihre wilden dunklen Locken machten unseren Größenunterschied fast wieder wett. Ich hatte ihren Namen vergessen, also lächelte ich und nickte, während sie über Lehrer und Fächer schnatterte. Ich versuchte erst gar nicht, mir alles zu merken.
Wir setzten uns ans Ende eines vollbesetzten Tisches zu einigen ihrer Freunde. Sie stellten sich der Reihe nach vor, aber kaum, dass sie mir ihre Namen gesagt hatten, vergaß ich sie wieder. Eric, der Junge aus Englisch, winkte mir quer durch den Raum zu.
Und als ich dort saß und versuchte mich mit sieben neugierigen Fremden zu unterhalten, sah ich sie zum ersten Mal.
Sie saßen an einem Tisch in einer entfernten Ecke der Cafeteria, so weit weg von unserem Tisch, wie es in dem langen Raum möglich war. Sie waren zu fünft. Sie redeten nicht und sie aßen nicht, obwohl vor allen ein Tablett mit unberührtem Essen stand. Im Gegensatz zu den meisten anderen glotzten sie mich nicht an, so dass ich sie meinerseits betrachten konnte, ohne fürchten zu müssen, exzessiv interessierten Blicken zu begegnen. Doch all das war es nicht, was meine Aufmerksamkeit erregte – und fesselte.
Sie sahen einander überhaupt nicht ähnlich. Von den drei Jungs war einer ausgesprochen kräftig – er hatte dunkle Locken und Muskeln wie ein aktiver Gewichtheber. Ein zweiter, mit blonden Haaren, war größer und schlanker, aber trotzdem noch muskulös. Der dritte war schlaksig, weniger wuchtig; er hatte verwuschelte bronzefarbene Haare und wirkte jungenhafter als die beiden anderen, die dem Aussehen nach durchaus Collegestudenten hätten sein können, oder sogar Lehrer.
Die Mädchen waren vom Typ her genau gegensätzlich. Die Größere der beiden war eine klassische Schönheit. Sie hatte eine Figur, wie man sie sonst nur auf dem Cover der Bademodenausgabe von Sports Illustrated sah – die Art von Figur, die dem Selbstbewusstsein jedes Mädchens, das sich zufällig im gleichen Raum aufhielt, einen Schlag versetzte. Ihre Haare waren goldblond und flossen in sanften Wellen bis zur Mitte ihres Rückens hinab. Das kleine Mädchen war elfenhaft, extrem dünn und hatte zarte Gesichtszüge. Ihre Haare waren tiefschwarz, kurz und standen in alle Richtungen ab.
Und dennoch glichen sie einander wie ein Ei dem anderen. Sie waren allesamt kreidebleich – die blassesten Schüler dieser sonnenlosen Stadt. Sogar blasser als ich, das Albino-Mädchen. Trotz ihrer verschiedenen Haarfarben hatten sie alle sehr dunkle Augen. Und darunter dunkle Schatten – violett, wie von einem Bluterguss. Sie sahen aus, als hätten sie samt und sonders eine schlaflose Nacht oder einen noch nicht ganz verheilten Nasenbruch hinter sich. Obwohl ihre Nasen andererseits, wie alle ihre Gesichtszüge, gerade und perfekt geformt waren.
Aber auch das war nicht der Grund, warum ich meinen Blick nicht abwenden konnte.
Ich starrte sie an, weil ihre so verschiedenen und doch gleichen Gesichter umwerfend und überirdisch schön waren. Es waren Gesichter, die man normalerweise nur auf den Hochglanzseiten von Modemagazinen zu sehen erwartete. Oder auf den Gemälden alter Meister, als Engelsgesichter. Schwer zu sagen, wer am schönsten war – vielleicht das blonde Mädchen, vielleicht auch der Junge mit den bronzefarbenen Haaren.
Alle schauten in verschiedene Richtungen, ohne jedoch, soweit ich das beurteilen konnte, irgendwas Bestimmtes ins Auge zu fassen. Während ich in ihren Anblick versunken war, erhob sich das kleinere Mädchen mit seinem Tablett – sein Getränk war ungeöffnet, sein Apfel unberührt – und ging mit langen, schnellen und eleganten Schritten davon, als wäre die Cafeteria ein Laufsteg. Es waren die geschmeidigen Schritte einer Tänzerin. Ich folgte ihr mit den Augen, bis sie ihr Tablett abstellte und mit einer Geschwindigkeit zur Hintertür hinausglitt, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Mein Blick schnellte zurück zu ihren Tischgenossen, die so reglos dasaßen wie vorher.
»Wer sind denn die dort?«, fragte ich das Mädchen aus meinem Spanischkurs, dessen Namen ich vergessen hatte.
Obwohl sie es an meinem Tonfall wahrscheinlich schon gehört hatte, blickte sie auf, um zu sehen, wen ich meinte; im gleichen Moment schaute sie einer von ihnen plötzlich an – der Dünne, der Jungenhafte, der vielleicht Jüngste. Für Bruchteile einer Sekunde lag der Blick seiner dunklen Augen auf ihr, dann huschte er weiter zu mir.
Er schaute schnell wieder weg, viel schneller, als ich es konnte, obwohl ich sofort verlegen meine Augen niederschlug. In seinem kurzen Blick lag keinerlei Interesse – es war, als hätte sie seinen Namen gerufen und er hätte unwillkürlich aufgeschaut, ohne die Absicht, eine Antwort zu geben.
Meine Nachbarin kicherte verschämt und guckte auf die Tischplatte, genau wie ich.
»Das sind Edward und Emmett Cullen, und Rosalie und Jasper Hale«, flüsterte sie. »Das Mädchen, das gegangen ist, war Alice Cullen; sie leben alle bei Dr. Cullen und seiner Frau.«
Aus den Augenwinkeln betrachtete ich weiter den schönen Jungen, der seinen Blick jetzt auf das Tablett gesenkt hatte und mit langen blassen Fingern einen Bagel zerrupfte. Seine perfekten Lippen waren kaum geöffnet, doch zugleich bewegte sich sein Mund sehr schnell. Und obwohl die drei anderen ihn nicht anschauten, hatte ich das Gefühl, als würde er leise auf sie einreden.
Seltsame Namen, dachte ich. Namen von Außenseitern. Von Großeltern. Aber vielleicht waren die hier beliebt? Kleinstadtnamen? Mir fiel endlich wieder ein, wie meine Tischnachbarin hieß: Jessica. Ein ganz normaler Name. In meinem Geschichtskurs zu Hause hatte es zwei Jessicas gegeben.
»Sie sind … sehr hübsch.« Ich rang mit dem offensichtlichen Understatement.
»Ja, nicht?!«, stimmte Jessica zu und kicherte erneut. »Sie sind aber alle zusammen – ich meine, Emmett und Rosalie, und Jasper und Alice. Und sie wohnen zusammen.« Die ganze Entrüstung der Kleinstadtbewohner klang darin mit, dachte ich missbilligend. Aber wenn ich ehrlich war – selbst in Phoenix würden die Leute darüber tratschen.
»Welche sind die Cullens?«, fragte ich. »Sie sehen sich gar nicht ähnlich …«
»Sie sind auch nicht wirklich verwandt. Dr. Cullen ist selber noch ganz jung, Ende zwanzig oder Anfang dreißig. Sie sind alle adoptiert. Die Hales – die beiden Blonden – sind tatsächlich Geschwister, Zwillinge. Sie sind Pflegekinder.«
»Sie sehen ein bisschen alt aus dafür.«
»Mittlerweile schon, Jasper und Rosalie sind beide achtzehn, aber sie sind schon bei Mrs Cullen, seit sie acht waren. Sie ist ihre Tante oder so ähnlich.«
»Das ist wirklich nett von ihnen. Ich meine, die ganzen Kinder aufzunehmen, wenn sie selber noch so jung sind.«
»Ja, klar«, stimmte Jessica widerwillig zu, und ich hatte das Gefühl, dass sie den Doktor und seine Frau aus irgendeinem Grund nicht mochte. Den Blicken nach zu urteilen, die sie den vieren am Tisch zuwarf, war es Eifersucht. »Aber ich glaub, Mrs Cullen kann selber keine Kinder bekommen«, fügte sie hinzu, als wäre es deshalb weniger wert.
Währenddessen huschte mein Blick immer wieder zu dieser sonderbaren Familie. Sie betrachteten weiter die Wand und aßen nichts.
»Wohnen sie schon immer in Forks?«, fragte ich. Ich war mir sicher, dass sie mir in einem meiner Sommer hier aufgefallen wären.
»Nein«, sagte sie in einem Tonfall, als müsste das selbst einem Neuankömmling wie mir klar sein. »Sie sind erst vor zwei Jahren hergezogen, von irgendwo in Alaska.«
Ich spürte Mitleid in mir aufsteigen. Und Erleichterung. Mitleid, weil sie, Schönheit hin oder her, Außenseiter waren und spürbar nicht akzeptiert wurden. Erleichterung, weil ich nicht der einzige Neuling war und – nach allen denkbaren Maßstäben – ganz sicher nicht der interessanteste.
Während ich sie musterte, schaute der Jüngste, einer der Cullens, plötzlich auf und begegnete meinem Blick, dieses Mal mit spürbarer Neugierde. Ich schaute augenblicklich weg, doch es kam mir so vor, als hätte ich in seinem Blick eine Art unbefriedigter Erwartung gesehen.
»Wer ist der Junge mit den rötlich braunen Haaren?«, fragte ich. Ich lugte aus den Augenwinkeln zu ihm rüber und sah, dass er mich immer noch anschaute – allerdings gaffte er nicht wie die anderen Schüler, sondern hatte eher einen leicht frustrierten Ausdruck. Erneut senkte ich meinen Blick.
»Das ist Edward. Er ist supersüß, klar, aber mach dir keine Hoffnungen. Er ist an Mädchen nicht interessiert, zumindest nicht an den Mädchen hier. Scheinbar ist ihm keines hübsch genug.« Sie rümpfte die Nase – ein klarer Fall von verletzter Eitelkeit. Ich fragte mich, wie lange es wohl her war, seit sie abgeblitzt war.
Ich biss mir auf die Lippen, um mein Lächeln zu verbergen. Dann wagte ich einen weiteren Blick. Sein Gesicht war abgewandt, aber es sah so aus, als zuckte seine Wange ein wenig – als müsste er ebenfalls lachen.
Ein paar Minuten später standen die vier gemeinsam auf und gingen. Ihre Bewegungen waren auffallend elegant, selbst die des großen, kräftigen Jungen. Ein verstörender Anblick. Der, dessen Name Edward war, schaute nicht mehr zu mir.
Ich blieb länger sitzen, als ich es getan hätte, wenn ich allein gewesen wäre. Ich wollte am ersten Tag auf keinen Fall zu spät zum Unterricht kommen. Eine meiner neuen Bekannten, die mich netterweise daran erinnerte, dass sie Angela hieß, hatte als Nächstes gemeinsam mit mir Biologie II. Schweigend liefen wir zum Klassenzimmer. Sie war auch schüchtern.
Als wir den Raum betraten, ging Angela zu einem der schwarz beschichteten Labortische, die ich von zu Hause kannte, und setzte sich neben einen Jungen. Auch alle anderen Tische waren schon voll besetzt, bis auf einen. Am Mittelgang, gut erkennbar an seiner ungewöhnlichen Haarfarbe, saß Edward Cullen, und neben ihm war der einzige freie Platz.
Während ich durch den Gang nach vorne ging, um mich beim Lehrer vorzustellen und seine Unterschrift abzuholen, beobachtete ich ihn heimlich. Dann, als ich direkt neben ihm war, zuckte er zusammen und versteifte sich auf seinem Stuhl. Wieder schaute er mich an, dieses Mal mit einem seltsam feindseligen, wütenden Ausdruck. Erschrocken schaute ich weg und wurde schon wieder rot. Ich stolperte über ein am Boden liegendes Buch und musste mich an einer Tischkante festhalten. Das Mädchen, das dort saß, kicherte.
Ich hatte die Farbe seiner Augen gesehen – sie waren schwarz. Kohlrabenschwarz.
Mr Banner unterschrieb meinen Zettel, reichte mir ein Buch und verzichtete auf den Vorstellungsquatsch. Ich hatte das Gefühl, wir würden gut miteinander klarkommen. Er hatte natürlich keine andere Möglichkeit, als mich zu dem einzigen freien Platz in der Mitte des Raumes zu schicken. Mit gesenkten Augen ging ich und setzte mich neben ihn, immer noch erschrocken von seinem feindseligen Blick.
Er schaute nicht auf, als ich meine Bücher ablegte und mich hinsetzte, doch aus den Augenwinkeln konnte ich sehen, dass er sich von mir weglehnte, auf der äußersten Kante seines Stuhles saß und sein Gesicht abwandte, als würde es plötzlich schlecht riechen. Ich schnupperte unauffällig an meinen Haaren. Sie rochen nach meinem Lieblingsshampoo: Erdbeeren – ein unschuldiger Duft, sollte man meinen. Ich ließ die Haare über meine rechte Schulter fallen und schuf so einen dunklen Vorhang zwischen uns. Dann versuchte ich mich auf den Unterricht zu konzentrieren.
Es ging um den Aufbau von Zellen, das hatte ich schon gehabt. Trotzdem schrieb ich sorgfältig – und ohne aufzublicken – mit.
Hin und wieder jedoch hielt ich es nicht aus und warf durch den Vorhang meiner Haare einen Blick auf den eigenartigen Jungen neben mir. Während der gesamten Stunde behielt er seine steife Position auf der Stuhlkante bei und saß so weit von mir entfernt wie möglich. Ich sah, dass er die Hand auf seinem linken Oberschenkel zur Faust geballt hatte, sah die Sehnen unter seiner blassen Haut hervortreten. Nicht ein einziges Mal entspannte er sie. Er hatte die Ärmel seines weißen Hemdes bis zu den Ellenbogen hochgekrempelt; sein Unterarm war überraschend hart und muskulös. Er war nicht annähernd so zierlich, wie er neben seinem bulligen Bruder gewirkt hatte.
Die Stunde schien sich länger hinzuziehen als die anderen. Lag es daran, dass ich erschöpft war vom ersten Tag in der neuen Schule? Oder war es das Warten darauf, dass sich die Anspannung seiner Faust löste? Doch es passierte nicht; er saß weiter so reglos da, als würde er nicht einmal atmen. Was hatte er bloß? War das sein übliches Verhalten? Ich war mir nicht mehr so sicher, ob mein Urteil über Jessicas verbitterte Bemerkung gerecht gewesen war. Möglicherweise lag darin weniger verletzte Eitelkeit, als ich gedacht hatte.
Mit mir konnte es jedenfalls nichts zu tun haben – er kannte mich überhaupt nicht!
Noch einmal wagte ich einen Blick in seine Richtung und bereute es sofort. Wieder funkelte er mich wütend an, wieder war der Blick seiner schwarzen Augen voller Abscheu. Ich wich so weit zurück, wie es mein Stuhl zuließ. Wenn Blicke töten könnten, schoss es mir durch den Kopf.
In diesem Moment passierten zwei Dinge gleichzeitig: Es klingelte so laut, dass ich erschreckt zusammenfuhr, und Edward Cullen schoss mit einer einzigen geschmeidigen Bewegung – er war viel größer, als ich vermutet hatte – von seinem Platz hoch und war im Gang verschwunden, bevor irgendjemand sonst überhaupt aufstehen konnte.
Ich saß verdattert auf meinem Stuhl und schaute ihm mit leerem Blick nach. Wie gemein! Langsam klaubte ich meine Sachen zusammen und bemühte mich, die Wut zu unterdrücken, die in mir hochstieg – ich hatte Angst, in Tränen auszubrechen. Aus irgendeinem Grund musste ich nämlich immer weinen, wenn ich wütend war, eine entwürdigende Eigenschaft.
»Bist du nicht Isabella Swan?«, hörte ich jemanden fragen.
Ich hob meinen Blick; vor mir stand ein hübscher, milchgesichtiger Junge, der seine blonden Haare mit viel Sorgfalt und Gel zu Stacheln aufgestellt hatte. Er lächelte freundlich. Offensichtlich fand er nicht, dass ich schlecht roch.
»Bella«, verbesserte ich ihn und lächelte.
»Ich bin Mike.«
»Hi, Mike.«
»Wo musst du als Nächstes hin? Soll ich dir den Weg zeigen?«
»Ich muss zur Turnhalle, ich glaub, die finde ich.«
»Da muss ich auch hin.« Er schien ganz aus dem Häuschen zu sein, obwohl das in einer Schule dieser Größe kaum ein bemerkenswerter Zufall war.
Also gingen wir gemeinsam; er war eine Quasselstrippe und übernahm den Großteil der Konversation, so dass ich eigentlich nur zuhören musste. Bis er zehn war, hatte er in Kalifornien gewohnt, er wusste also, wie ich mich fühlte ohne Sonne. Er war auch in meinem Englischkurs, wie sich herausstellte. Und der netteste Mensch, der mir an diesem Tag begegnet war.
Doch dann, als wir die Turnhalle betraten, fragte er: »Sag mal, hast du Edward Cullen eigentlich deinen Stift zwischen die Rippen gebohrt oder was? Ich hab ihn noch nie so gesehen wie heute.«
Ich zuckte zusammen. Es war also nicht nur mir aufgefallen. Und es war anscheinend nicht Edward Cullens übliches Verhalten. Ich stellte mich dumm.
»War das der Junge, der neben mir in Bio saß?«, fragte ich arglos.
»Genau der. Er sah aus, als täte ihm etwas weh oder so.«
»Keine Ahnung«, erwiderte ich. »Wir haben nicht miteinander gesprochen.«
»Er ist ein komischer Typ.« Mike blieb stehen. »Wenn ich das Glück hätte, neben dir zu sitzen, würde ich mit dir sprechen.«
Ich lächelte und ging in den Umkleideraum der Mädchen. Er war nett und offensichtlich an mir interessiert, doch das änderte nichts an meiner schlechten Stimmung.
Coach Clapp, der Sportlehrer, suchte eine Garnitur Sportsachen für mich raus, bestand aber nicht darauf, dass ich mich gleich umzog und mitmachte. Zu Hause war Sport nur zwei Jahre lang Pflichtfach gewesen, hier stand es die ganzen vier Jahre auf dem Programm. Forks war buchstäblich meine persönliche Hölle auf Erden.
Ich schaute bei vier gleichzeitig stattfindenden Volleyballspielen zu und dachte daran, wie viele Verletzungen ich mir und anderen beim Volleyball zugefügt hatte. Mir wurde ein wenig schwindlig bei dem Gedanken.
Endlich war auch die letzte Stunde vorbei. Langsam ging ich zum Büro, um meine Unterlagen abzugeben. Der Regen hatte nachgelassen, doch der Wind war stärker und kälter geworden. Ich schlang meine Arme um meinen Oberkörper.
Als ich das warme Sekretariat betrat, hätte ich fast wieder kehrtgemacht.
Vor mir am Tresen stand, unverkennbar mit seinem verwuschelten Schopf bronzefarbener Haare, Edward Cullen. Er schien mein Eintreten nicht zu registrieren. Ich stellte mich an die hintere Wand und wartete, bis die Sekretärin für mich Zeit hatte.
Er diskutierte mit ihr mit leiser, angenehmer Stimme. Ich merkte schnell, worum es ging: Er versuchte seinen Biologiekurs auf eine andere Stunde zu legen – egal, welche.
Ich konnte einfach nicht glauben, dass es dabei um mich gehen sollte. Es musste etwas anderes sein, etwas, das passiert war, bevor ich den Bioraum betreten hatte. Sein Gesichtsausdruck vorhin war durch meine bloße Anwesenheit nicht zu erklären. Es war unmöglich, dass dieser Fremde eine derart plötzliche und intensive Abneigung gegen mich hegte.
Auf einmal öffnete sich die Tür; ein kalter Windstoß fegte durch den Raum, brachte die Papiere auf dem Tresen zum Rascheln und fuhr mir in die Haare. Ein Mädchen kam herein, ging zum Tresen, legte einen Zettel in eine Ablage und verschwand wieder nach draußen. Edward Cullen versteifte sich; langsam drehte er sich um und starrte mich wütend an. Sein Gesicht war fast überirdisch schön, doch sein Blick war stechend und hasserfüllt. Panik durchfuhr mich; die Haare auf meinen Armen stellten sich auf. Sein Blick währte nur eine Sekunde, doch er brachte mich stärker zum Frösteln als der kalte Wind. Dann wandte er sich wieder der Sekretärin zu.
»Okay«, sagte er hastig und mit samtener Stimme. »Ich verstehe, dass es unmöglich ist. Haben Sie vielen Dank für Ihre Mühe.« Dann machte er kehrt und verschwand nach draußen, ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen.
Ich ging eingeschüchtert zum Tresen und reichte der Sekretärin den Zettel mit den Unterschriften. Mein Gesicht war ausnahmsweise mal nicht gerötet, sondern kreidebleich.
»Na, Isabella, wie lief dein erster Tag?«, fragte sie mütterlich.
»Gut«, log ich mit schwacher Stimme. Sie sah nicht überzeugt aus.
Mein Transporter war fast das letzte Auto auf dem Parkplatz. Er war meine einzige Rettung – das, was einem Zuhause am nächsten kam in diesem nassen grünen Kaff. Eine Zeit lang saß ich nur da und starrte ausdruckslos nach draußen. Doch dann wurde es schnell so kühl, dass ich die Heizung brauchte, also drehte ich den Schlüssel im Zündschloss und ließ den Motor anspringen. Den ganzen Weg zurück zu Charlies Haus kämpfte ich mit den Tränen.
Wie ein offenes Buch
Der nächste Tag war besser … und schlimmer.
Er war besser, weil es nicht regnete, zumindest nicht gleich morgens, obwohl die Wolken dicht und trüb am Himmel hingen. Und einfacher, weil ich wusste, was mich erwartete. Mike setzte sich in Englisch zu mir und begleitete mich unter den feindseligen Blicken von Schachklub-Eric zu meinem nächsten Kurs; das war doch immerhin schmeichelhaft. Ich wurde nicht mehr ständig angestarrt wie am Vortag. Ich saß mit einer großen Gruppe von Leuten beim Mittagessen, darunter Mike, Eric, Jessica und einige andere, deren Gesichter und Namen ich mir mittlerweile merken konnte. Ich bekam das Gefühl, langsam schwimmen zu lernen, anstatt nur hilflos mit den Armen zu rudern.
Er war schlimmer, weil ich müde war; ich konnte noch immer nicht schlafen, weil der Wind um das Haus heulte. Er war schlimmer, weil mich Mr Varner in Mathe aufrief, obwohl ich mich nicht gemeldet hatte, und meine Antwort falsch war. Er wurde richtig schlimm, als ich Volleyball spielen musste und den Ball beim einzigen Mal, als ich ihm nicht auswich, einer Mannschaftskameradin an den Kopf schoss. Vor allem aber war der zweite Tag deshalb schlimmer als der erste, weil Edward Cullen nicht in der Schule war.
Den ganzen Vormittag über graute mir bei dem Gedanken an die Mittagspause und seine unerklärlichen, hasserfüllten Blicke. Ein Teil von mir wollte zu ihm gehen und eine Erklärung verlangen. Nachts, als ich im Bett lag und nicht schlafen konnte, hatte ich mir sogar überlegt, was ich sagen würde. Doch ich kannte mich gut genug, um zu wissen, dass ich nicht den nötigen Mumm dafür hatte. Verglichen mit mir war der feige Löwe aus Der Zauberer von Oz ein Superheld.
Als ich dann mit Jessica die Cafeteria betrat und vergeblich versuchte, nicht den ganzen Saal mit den Augen nach ihm abzusuchen, sah ich seine vier Quasi-Geschwister gemeinsam am gleichen Tisch sitzen wie tags zuvor – er jedoch war nirgends zu sehen.
Mike fing uns ab und brachte uns zu seinem Tisch. Jessica schien seine Aufmerksamkeit in Hochstimmung zu versetzen, und ihre Freundinnen und Freunde gesellten sich schnell zu uns. Ich versuchte ihrem ungezwungenen Geplauder zu folgen, doch mir war überhaupt nicht wohl dabei – nervös wartete ich auf seine Ankunft und hoffte nur, dass er mich ignorieren und damit meine Befürchtungen widerlegen würde.
Er kam nicht, und ich wurde immer angespannter.
Als er bis zum Ende der Pause nicht aufgetaucht war, ging ich etwas mutiger zu Biologie. Mike entwickelte immer mehr die Verhaltensweisen eines Golden Retriever und wich den ganzen Weg nicht von meiner Seite. Als wir den Raum betraten, hielt ich die Luft an, doch auch hier war nichts von Edward Cullen zu sehen. Erleichtert atmete ich aus und ging zu meinem Platz. Mike folgte mir und erzählte von einem geplanten Ausflug zum Strand. Er blieb bei meinem Tisch, bis es klingelte, dann lächelte er wehmütig und setzte sich neben ein Mädchen mit Zahnspange und missratener Dauerwelle. Ich musste mir etwas einfallen lassen, was Mike anging, doch es würde nicht einfach werden. In einer Stadt wie dieser, in der alle aufeinanderhockten, war Diplomatie gefragt. Ich war aber noch nie sonderlich taktvoll gewesen und hatte keinerlei Erfahrung im Umgang mit allzu freundlichen Jungs.
Ich war froh, dass Edward nicht da war und ich den Tisch für mich allein hatte. Das redete ich mir zumindest ein, immer wieder, ohne jedoch den schleichenden Verdacht loszuwerden, dass ich der Grund für seine Abwesenheit war. Es war natürlich völlig albern und egozentrisch, mir einzubilden, dass ich jemanden so stark beeinflussen könnte. Es war unmöglich. Und doch konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass es stimmte.
Als der Schultag endlich geschafft und das Blut nach dem Zwischenfall beim Volleyball wieder aus meinen Wangen gewichen war, zog ich mir schnell meine Jeans und meinen marineblauen Pullover an. Ich hatte es eilig, den Umkleideraum zu verlassen, und war froh, als ich sah, dass ich meinem Freund, dem Golden Retriever, für den Moment entkommen war. Rasch lief ich zum Parkplatz, der von flüchtenden Schülern bevölkert war, stieg in meinen Transporter und kramte in meiner Tasche, um sicherzugehen, dass ich alles Nötige eingepackt hatte.
Am Abend zuvor hatte ich nämlich entdeckt, dass Charlies Kochkünste nicht über Spiegeleier mit Speck hinausgingen, und für die Dauer meines Aufenthaltes das Küchenkommando beansprucht. Charlie war einverstanden gewesen. Außerdem hatte ich herausgefunden, dass nichts Essbares im Haus war, weshalb ich mich jetzt mit meiner Liste und ein paar Scheinen aus einer Dose mit der Aufschrift »Einkaufsgeld« auf den Weg zu Thriftway machte.
Ich ließ meinen lärmenden Motor aufheulen, ignorierte die Leute, die sich nach mir umdrehten, legte den Rückwärtsgang ein und reihte mich vorsichtig in die Schlange der Fahrzeuge ein, die den Parkplatz verlassen wollten. Während ich wartete und so tat, als käme das ohrenbetäubende Dröhnen von einem anderen Auto, sah ich die beiden Cullens und die Hale-Zwillinge in ihren Wagen steigen. Es war der blitzende neue Volvo – natürlich. Bisher hatten mich ihre Gesichter zu sehr gefesselt, als dass ich auf ihre Kleidung geachtet hätte, doch jetzt sah ich, dass sie allesamt außerordentlich gut gekleidet waren: Sie trugen schlichte Sachen, die subtil auf ihre Designer-Herkunft schließen ließen. Dabei hätten sie bei ihrem Aussehen und der Art und Weise ihres Auftretens genauso gut in Lumpen gehen können. War es nicht zu viel des Guten, nicht nur blendend auszusehen, sondern auch noch Geld zu haben? Doch soweit ich das beurteilen konnte, war es meistens so im Leben. Auch wenn es ihnen hier in Forks anscheinend keine Anerkennung verschaffte.
Obwohl, so richtig glaubte ich das nicht. Ihre Isolation musste von ihnen gewollt sein – ich konnte mir nicht vorstellen, dass solcher Schönheit irgendwelche Türen verschlossen blieben.
Als ich an ihnen vorbeifuhr, betrachteten sie meinen lärmenden Transporter, genau wie alle anderen. Ich schaute stur geradeaus und war froh, als ich endlich vom Schulgelände runter war.
Thriftway befand sich ganz in der Nähe der Schule, nur ein paar Straßen weiter südlich. Es war angenehm, in einem Supermarkt zu sein, es gab mir ein Gefühl der Normalität. Zu Hause hatte ich auch die Einkäufe erledigt und war froh über die vertraute Aufgabe. Das Gebäude war groß genug, dass man in seinen Gängen das Tröpfeln des Regens auf dem Dach nicht hörte – ich konnte für eine Weile vergessen, wo ich mich befand.
Als ich zum Haus kam, packte ich die Einkäufe aus und verstaute sie überall, wo Platz war. Charlie hatte hoffentlich nichts dagegen. Dann wickelte ich Kartoffeln in Folie ein und legte sie zum Backen in den Ofen, marinierte ein Steak und platzierte es vorsichtig auf einer Packung Eier im Kühlschrank.
Als ich damit fertig war, nahm ich meine Tasche und ging nach oben. Bevor ich mit den Hausaufgaben anfing, zog ich mir eine trockene Jogginghose an, band meine feuchten Haare zu einem Zopf zusammen und schaute zum ersten Mal nach meinen E-Mails. Ich hatte drei Nachrichten.
»Bella«, schrieb meine Mom.
Schreib mir, sobald du ankommst. Wie war Dein Flug? Regnet es? Ich vermisse Dich jetzt schon. Ich hab fast alles gepackt für Florida, aber ich finde meine rosafarbene Bluse nicht. Weißt Du, wo ich die hingetan hab? Grüße von Phil.
Mom
Ich seufzte und öffnete die nächste Nachricht. Sie war acht Stunden nach der ersten abgeschickt worden.
»Bella«, schrieb sie.
Warum antwortest Du mir nicht? Worauf wartest Du?
Mom
Die letzte war an diesem Vormittag gekommen.
Isabella,
wenn ich bis heute Abend halb sechs nichts von Dir gehört habe, ruf ich Charlie an.
Ich schaute auf die Uhr. Ich hatte noch eine Stunde, aber Mom war für ihre vorschnellen Aktionen bekannt.
Mom,
beruhige Dich. Ich bin gerade dabei, Dir zu schreiben. Kein Grund zur Panik.
Ich schickte die Nachricht ab und fing von vorne an.
Mom,
alles ist super. Natürlich regnet es. Ich wollte warten, bis was Spannendes passiert. Schule ist okay, nur ein bisschen langweilig. Ich hab ein paar nette Leute kennengelernt, mit denen ich jeden Tag zusammen Mittag esse.
Deine Bluse ist in der Reinigung – Du solltest sie letzten Freitag abholen.
Charlie hat mir einen Transporter gekauft, was sagst Du dazu? Er ist toll – alt, aber echt robust, also genau das Richtige für mich.
Ich vermisse Dich auch. Ich melde mich bald wieder, aber ich werde nicht alle fünf Minuten meine Mails checken. Entspann Dich, atme tief durch. Ich liebe Dich.
Bella
Als Charlie heimkam, war ich gerade in Sturmhöhe versunken. Den Roman nahmen sie hier gerade in Englisch durch; ich kannte ihn zwar schon, hatte aber Lust, ihn noch mal zu lesen. Mir war nicht aufgefallen, dass es schon so spät war, also rannte ich jetzt die Treppe runter, um die Kartoffeln aus dem Ofen zu nehmen und das Steak zu braten.
»Bella?«, rief mein Vater, als er mich die Treppe herunterpoltern hörte.
Wer sonst?, dachte ich.
»Hey, Dad, willkommen zu Hause.«
»Danke.« Er hängte seinen Pistolengurt an den Haken und zog sich die Stiefel aus; ich wuselte in der Küche herum. Soviel ich wusste, hatte er im Dienst noch nie einen Schuss abgegeben. Aber seine Waffe war geladen. Wenn ich ihn als Kind besucht hatte, nahm er immer als Erstes die Patronen heraus, wenn er nach Hause kam. Wahrscheinlich hielt er mich mittlerweile für alt genug, mich nicht versehentlich zu erschießen, und nicht für depressiv genug, um es absichtlich zu tun.
»Was gibt’s zu essen?«, fragte er vorsichtig. Meine Mutter war eine fantasievolle Köchin, aber ihre Experimente waren nicht immer essbar. Es überraschte mich, dass er sich an etwas erinnerte, das so weit zurücklag. Und es machte mich traurig.
»Steak mit Kartoffeln«, antwortete ich. Er sah erleichtert aus.
Er schien sich nicht wohl dabei zu fühlen, untätig in der Küche herumzustehen, und stapfte schwerfällig ins Wohnzimmer, um fernzusehen, solange ich zu tun hatte. Das ersparte uns beiden die Verlegenheit, uns unterhalten zu müssen. Ich machte einen Salat, während das Steak in der Pfanne briet, und deckte den Tisch.
Als ich fertig war, rief ich ihn, und er schnupperte anerkennend, als er hereinkam.
»Riecht gut, Bell.«
»Danke.«
Ein paar Minuten lang aßen wir schweigend, doch es war nicht unangenehm. Keinen von uns störte die Stille. Was das anging, waren wir fürs Zusammenleben wie geschaffen.
»Und, wie findest du’s in der Schule? Schon Freunde gefunden?«, fragte er, während er sich mehr auftat.
»Ich hab ein paar Fächer zusammen mit einer Jessica, mit ihr und ihren Freunden esse ich auch immer zusammen. Und dann gibt’s noch einen Jungen, Mike, der ist sehr sympathisch. Alle scheinen ziemlich nett zu sein.« Mit einer Ausnahme.
»Das muss Mike Newton sein. Netter Junge – nette Familie. Seinem Dad gehört das Sportgeschäft außerhalb der Stadt. Er verdient ganz gut an den Rucksacktouristen, die hier vorbeikommen.«
»Kennst du die Cullens?«, fragte ich zögerlich.
»Die Familie von Dr. Cullen? Klar. Dr. Cullen ist großartig.«
»Sie … also seine Kinder … sie wirken irgendwie anders. Sie scheinen nicht so richtig reinzupassen in die Schule.«
Charlie überraschte mich mit einem verärgerten Blick.
»Diese Leute hier«, murmelte er. »Dr. Cullen ist ein brillanter Chirurg, der wahrscheinlich in jedem Krankenhaus der Welt arbeiten und zehnmal so viel verdienen könnte wie hier«, fuhr er fort und wurde immer lauter. »Wir können froh sein, dass wir ihn haben – dass seine Frau in einer Stadt wie dieser wohnen wollte. Er ist ein Gewinn für die Gemeinde, und die Kinder sind wohlerzogen und höflich. Als sie herzogen, hatte ich so meine Bedenken. Lauter adoptierte Teenager – ich dachte, das könnte problematisch werden. Aber sie sind alle sehr reif. Keiner von ihnen hat mir je irgendwelche Probleme bereitet, was ich von den Kindern der alteingesessenen Familien nicht so ohne weiteres behaupten kann. Und sie halten zusammen, wie sich das gehört für eine Familie, unternehmen Sachen, alle paar Wochen einen Campingausflug … Nur weil sie neu hier sind, reden die Leute.«
Es war die längste Rede, die ich je aus Charlies Mund gehört hatte. Offensichtlich ärgerte er sich sehr über das Gerede der Leute.
Ich ruderte zurück. »Ich hatte ja auch das Gefühl, dass sie ganz nett sind. Mir ist nur aufgefallen, dass sie unter sich bleiben. Und dass sie alle ziemlich gut aussehen«, fügte ich hinzu, um noch was Positives zu sagen.
»Da solltest du mal den Doktor sehen«, sagte Charlie und lachte. »Nur gut, dass er glücklich verheiratet ist. Etliche der Schwestern im Krankenhaus haben Schwierigkeiten, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren, wenn er in der Nähe ist.«
Wir beendeten das Essen so schweigend, wie wir es begonnen hatten. Hinterher räumte er den Tisch ab und ich machte mich an den Abwasch – von Hand, Charlie hatte keinen Geschirrspüler. Dann zog er sich wieder vor den Fernseher zurück, während ich lustlos nach oben ging, um meine Mathehausaufgaben zu erledigen. Der Ablauf hatte das Zeug zum abendlichen Ritual.
In dieser Nacht war es endlich still. Ich schlief schnell ein, vollkommen erschöpft.
Der Rest der Woche verlief ereignislos. Mein Stundenplan wurde zur Routine, und spätestens am Freitag kannte ich fast alle Schüler vom Sehen, wenn auch noch nicht beim Namen. Meine Mannschaftskameraden beim Volleyball gewöhnten sich daran, mir nicht den Ball zuzuspielen und sich vor mich zu stellen, sobald jemand vom gegnerischen Team meine Schwäche ausnutzen wollte. Und ich hatte nicht das Geringste dagegen, aus der Schusslinie zu treten.
Edward Cullen kam die ganze Woche nicht wieder zur Schule.
Jeden Tag wartete ich voller Anspannung, bis ich die vier Cullens ohne ihn die Cafeteria betreten sah. Dann erst konnte ich mich entspannen und mit den anderen unterhalten. Meistens drehte es sich um einen Ausflug zum La Push Ocean Park in zwei Wochen, den Mike organisierte. Ich war eingeladen und hatte zugesagt, wenn auch vor allem aus Höflichkeit. Die Strände, nach denen ich mich sehnte, waren heiß und trocken.
Am Ende der Woche fiel es mir leicht, den Biologieraum zu betreten – ich machte mir keine Sorgen mehr, dass Edward auftauchen könnte. Für mich sah es so aus, als hätte er die Schule verlassen. Ich versuchte nicht an ihn zu denken, konnte aber das quälende Gefühl, dass ich der Grund für seine anhaltende Abwesenheit war, nicht völlig unterdrücken, so lächerlich es mir auch erschien.
Mein erstes Wochenende in Forks verlief ohne Zwischenfall. Charlie, daran gewöhnt, wenig Zeit in einem Haus zu verbringen, das normalerweise leer war, arbeitete auch an den freien Tagen. Ich machte sauber, erledigte meine Hausaufgaben und schrieb noch ein paar betont fröhliche Mails an Mom. Am Samstag fuhr ich zur Bibliothek, aber sie war so schlecht bestückt, dass ich mir nicht einmal eine Mitgliedskarte geben ließ; ich nahm mir vor, für die nächste Zeit einen Besuch in Olympia oder Seattle einzuplanen und mir dort einen guten Buchladen zu suchen. Wie viel Sprit der Transporter wohl verbrauchte? Lieber nicht darüber nachdenken, dachte ich mit Schrecken.
Der Regen blieb das Wochenende über schwach und leise genug, dass ich gut schlafen konnte.
Als ich am Montagmorgen auf dem Schulparkplatz ankam, wurde ich von allen Seiten begrüßt; ich kannte noch nicht alle Namen, winkte aber zurück und lächelte. Es war kälter als an den Tagen davor, aber zum Glück regnete es nicht. In Englisch setzte sich Mike auf seinen gewohnten Platz neben mir. Wir schrieben einen unangekündigten Test über Sturmhöhe, aber der war zum Glück sehr einfach. Alles in allem fühlte ich mich sehr viel wohler, als ich erwartet hatte. Wohler, als ich erwartet hatte, mich je hier zu fühlen.
Als wir nach Englisch vor die Tür traten, wirbelten lauter weiße Fusseln durch die Luft. Schüler schrien aufgeregt durcheinander. Der Wind schnitt mir in Nase und Wangen.
»Wow«, sagte Mike. »Es schneit.«
Ich betrachtete die kleinen wolligen Bausche, die sich am Boden aufschichteten und mir wild ums Gesicht wehten.
»Uh.« Schnee. Das war’s dann wohl mit meinem guten Tag.
Er sah überrascht aus. »Magst du keinen Schnee?«
»Nein. Schnee bedeutet, es ist zu kalt für Regen.« Logisch. »Außerdem dachte ich, es schneit in Flocken – jede einzigartig und so. Die hier sehen aus wie die Enden von Wattestäbchen.«
»Sag bloß, du hast noch nie Schnee fallen sehen«, sagte er ungläubig.
»Doch, na klar« – ich machte eine Pause. »Im Fernsehen.«
Mike lachte. Im nächsten Augenblick traf ihn ein großer, matschiger, tropfender Schneeball am Hinterkopf. Wir drehten uns beide herum, um zu sehen, woher der gekommen war. Mein Verdacht fiel auf Eric, der gerade in die andere Richtung davonging, obwohl er denselben Weg hatte wie wir. Mike hatte offensichtlich den gleichen Gedanken; er hockte sich hin und begann weißen Matsch zusammenzukratzen.
»Wir sehen uns beim Essen, okay?«, sagte ich, ohne stehen zu bleiben. »Wenn Leute anfangen, nasses Zeug durch die Gegend zu werfen, weiß ich, es ist Zeit zu verschwinden.«
Er nickte nur; seine ganze Aufmerksamkeit galt Eric, der sich unauffällig aus dem Staub zu machen versuchte.
Den ganzen Vormittag war der Schnee das einzige Thema; offensichtlich war es der erste in diesem Jahr. Ich sagte dazu nichts. Schnee war vielleicht trockener als Regen, aber nur, bis er einem in den Socken schmolz.
In erhöhter Alarmbereitschaft lief ich nach Spanisch mit Jessica zur Cafeteria. Von überall kamen die Bälle geflogen. Ich hielt einen Ordner in den Händen, um ihn im Fall der Fälle als Schutzschild zu benutzen. Jessica fand das irre komisch, aber irgendwas in meinem Gesichtsausdruck hielt sie davon ab, selbst einen Schneeball nach mir zu werfen.
An der Tür holte uns Mike ein, dessen stachlige Frisur vom Schnee ganz aufgeweicht war. Als wir uns an der Essensausgabe anstellten, unterhielten sich die beiden aufgekratzt über die Schneeballschlacht. Ich warf aus reiner Gewohnheit einen Blick zum Tisch in der Ecke. Und blieb wie vom Schlag getroffen stehen. Dort saßen fünf Personen.