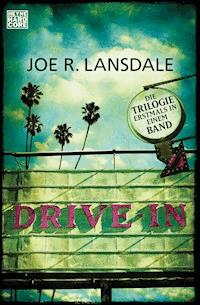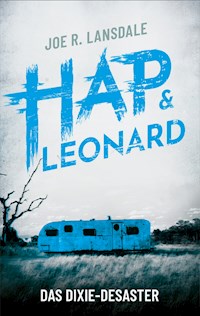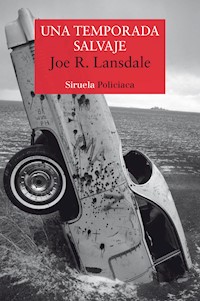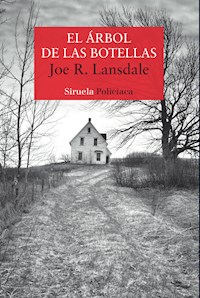Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Golkonda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hap & Leonard
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Ein junger schwarzer Mann, von den Cops ermordet. Ein geheimer Zirkel, in dem Nachwuchsboxer – mehr oder weniger freiwillig – ausgebildet werden. Mit einer rostroten Schicht überzogene, in einem verlassenen Brunnen verscharrte Hundekadaver. Und ein verschollener Geheimvorrat von Vanillekeksen. Hap Collins hat nach einer lebensgefährlichen Schussverletzung gerade das Krankenhaus verlassen, als ihn Louise Elton im Büro besucht. Diese will zwar lieber mit Leonard sprechen – schließlich vertraut sie nur ihren Brüdern und Schwestern –, doch Haps Überredungskünste und die Zwangslage – Leonard ist unterwegs – bringen sie dazu, sich dem White-Trash-Rebell anzuvertrauen: Ihr Sohn Jamar sei von den Cops umgebracht worden. Und das ohne Grund. Und nicht nachweisbar. Immerhin war er doch ein fleißiger Schüler, dem alle Türen offenstanden. Doch scheinbar hat er seine Nase in zu viele Angelegenheiten reingesteckt, die ihn nichts angehen, vor allem nachdem er erfuhr, dass die Cops aus dem Nachbarort seine kleine Schwester Charm belästigt haben ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel Rusty Puppy bei Mulholland Books,
einem Imprint von Hodder & Stoughton, Teil der Hachette UK Company, Großbritannien.
© 2017 by Joe R. Lansdale
Mit freundlicher Genehmigung des Autors,
c/o Baror International Inc., Armonk, New York, USA
Deutsche Erstausgabe
© 2018 der deutschsprachigen Ausgabe Golkonda Verlags GmbH & Co. KG, München ∙ Berlin
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Sämtliche, auch auszugsweise Verwertungen bleiben vorbehalten.
Umschlaggestaltung: © s.BENeš [http://benswerk.wordpress.com]
Lektorat: Dirk Grosser
Korrektorat: Matthias Warkus
E-Book-Erstellung: Hardy Kettlitz
Druck: Pustet, Regensburg
ISBN: 978-3-946503-39-2 (Buchausgabe)
ISBN: 978-3-946503-40-8 (E-Book)
Alle Rechte vorbehalten.
www.golkonda-verlag.de
www.facebook.com/Golkonda.Verlag/
www.instagram.com/golkonda.verlag/
Gewidmet meinem
Literaturagenten Danny Baror
und meinem Filmagenten Brian Lipson;
beide erleichtern mir das Leben,
und ich bin ihnen zutiefst verbunden
für ihr unablässiges Vorantreiben meiner Karriere,
was an sich schon ein Full-Time-Job wäre,
und für ihre Freundschaft.
Danke, Leute!
Außerdem danke ich meinem Freund Jim Mickle für die
gute Regiearbeit bei der TV-Verfilmung meiner Werke,
und meinem Bruder Nick Damici
für die liebevolle und sorgfältige
TV-Adaption dieser Romane.
Wenn du mal gestorben bist
und dem Tod dann doch noch von der Schippe springst,
weil irgendjemand dir eine Herzmassage verpasst
und du plötzlich wieder schnaufst
und erst mal ordentlich in die Hosen scheißt,
dann wirst du manches etwas anders sehen.
Wie auch immer,
solange ich nicht im Krankenhaus liege
oder zu weit ab vom Schuss bin,
lasse ich mir das Dienstagabend-Chili
nie und nimmer entgehen.
– Jim Bob Luke
KAPITEL 1
Ich war immer noch nicht so ganz von den Toten wieder auferstanden, und ich kann euch sagen, so ein Comeback hat’s in sich.
Nachdem ich niedergestochen worden war, hatte ich im Krankenhaus zweimal bereits den Löffel abgegeben. Meine letzte Erinnerung aus der Zeit vor dem endgültigen Wiedererwachen war Leonard, wie er bei mir sitzt und Vanillekekse in sich hineinstopft und darauf wartet, dass ich wieder aufwache. Da war ich zwar eigentlich schon wach, konnte meine Augen aber kaum weit genug öffnen, um ihn wahrzunehmen. Immer wieder überkam mich das Gefühl, ganz langsam auf einem Boot ins Nichts davonzutreiben, mit einem Stöckchen in meinem Schwanz. Später stellte sich raus, dass es ein Katheter war, aber es hatte sich wie ein Stöckchen angefühlt. Oder eher wie ein Stock.
Die Ärzte und Krankenschwestern bewahrten mich vor dem endgültigen Absprung in die Nacht, und dafür bedankte ich mich nicht bei unserm Herrn Jesus, als ich wieder unter den Lebenden war. Ich dankte dem überaus fähigen Krankenhauspersonal mit seiner gründlichen Ausbildung und langjährigen Erfahrung. Ich stellte mir immer vor, wenn ich als Arzt einem Menschen das Leben gerettet hätte und derjenige käme wieder zu sich und würde als Erstes so was wie »Jesus, ich danke dir« von sich geben, dann würde ich ihm wohl am liebsten eine OP-Zange in den Arsch schieben wollen und ihm sagen, jetzt sieh mal zu, wie dein Herr Jesus die wieder rauskriegt.
Jedenfalls weilte ich wieder unter den Lebenden. Brauchte zwar ein paar Monate, um wieder richtig auf die Beine zu kommen, aber irgendwann kam ich wieder ganz gut alleine zurecht. Und so saß ich eines Tages mal wieder ganz alleine im Büro. Dank meiner Schlauch-in-der-Speiseröhre-Diät war ich nun ein paar Kilo leichter (und nein, es war nicht derselbe Schlauch wie in meinem Schwanz), trotzdem war ich recht schnell wieder bei Kräften. Und fühlte mich inzwischen kräftig genug, 125 Kilo beim Bankdrücken zu stemmen oder einen wütenden Gorilla zu vermöbeln, wenn auch vielleicht nicht in einem fairen Kampf.
Andererseits gab es aber auch Tage, an denen ich plötzlich vor mich hin heulte oder meine fünf Sinne nicht besser beisammen hatte als ein Eichhörnchen. Die Ärzte hatten mich davor gewarnt, es würde solche Tage geben, an denen mir meine Sterblichkeit allzu klar vor Augen stünde, und dass mich das dann womöglich einfach umhaute. Dann schaute ich mir Trickfilme an, das half. Ich kam eigentlich schnell über alles hinweg, ohne posttraumatische Stresssymptome, worüber die Ärzte staunten. Ich hielt den Mund und dachte mir: Nein, die hab ich nur, wenn ich jemanden umgebracht hab, und mit dieser Art Stress konnte ich umgehen wie mit einem treuen Begleiter, der gelegentlich nervt. Da hatte ich Übung, schließlich war ich schon den Großteil meines Lebens mit Leonard befreundet. Körperlich hatte ich mich jedenfalls schon immer schnell regeneriert. Meine Selbstheilungskräfte und mein harter Schädel hatten mir stets geholfen.
Es ging mir also wieder besser, ich arbeitete und fühlte mich ziemlich normal, und das Einzige, was mich gelegentlich kümmerte, waren die Stippvisiten der Sterblichkeitsfee sowie der unvermeidliche Hitzetod unseres Planetensystems, wenn dereinst die Sonne explodierte. Ich bin wohl eher ein Kümmerer als ein Krieger.
An diesem Tag saß ich also nun im Büro von Brett Sawyer Investigations, der Detektei meiner Freundin Brett, für die ich zusammen mit meinem besten Freund Leonard arbeitete. Meine Füße lagen auf dem Schreibtisch, mir fiel auf, dass meine Socken nicht zusammenpassten, und ich kam mir vor wie der klassische Privatdetektiv, obwohl meine detektivischen Fähigkeiten in etwa so ausgeprägt waren wie meine mathematischen – was im Klartext bedeutet, dass Sie Ihre Steuererklärung besser von jemand anderem machen lassen sollten. Aber ich bin hartnäckig. Ein weiterer vorteilhafter Charakterzug, neben schneller Selbstheilung und hartem Schädel. Mit sechzehn hatte mir mein Dad mal einen Job bei einem Kerl verschafft, der Gestrüpp rodete und alte Häuser abriss und das Ganze dann als Brennholz verkaufte. Am ersten Arbeitstag sagte mein Dad zu ihm: »Er baut vielleicht öfter mal Scheiße, aber er gibt nie auf.«
Das klang ungefähr nach meinem Lebensmotto.
Alleine im Büro war ich, weil sonst an dem Vormittag alle weg waren. Leonard in Houston, wo er Sex mit jemandem hatte, den er übers Internet kennengelernt hatte, weswegen ich mir Sorgen machte. Um beide wohlgemerkt. Und Brett kurierte eine Erkältung aus, gemeinsam mit einer jungen Frau namens Chance, die, wie sich herausgestellt hatte, meine Tochter war. Das hatte ein DNA-Test ergeben, und ich war verdammt froh über dieses Ergebnis; zwar kannten wir uns erst seit Kurzem, doch passte sie so wunderbar zum Rest meiner Familie, Brett und Leonard und unserem Hündchen Buffy, als hätte sie schon immer mit uns zusammengelebt.
Chance wohnte bei uns und arbeitete Teilzeit bei einem Lokalblatt als Korrekturleserin, während sie sich nach einem Vollzeitjob umsah. Sie besaß einen Abschluss in Publizistik, womit man ungefähr so viel anfangen kann wie mit dem Großen Latinum. Nämlich so gut wie gar nichts.
Ebenso wie Brett blieb Chance wegen ihrer Erkältung zu Hause, hütete die Couch, und mich würden sie wohl auch bald anstecken, aber noch fühlte ich mich topfit. Nachdem ich abgestochen worden und fast gestorben war, konnte mich das bisschen Husten und Schnupfen mal.
Buffy, die Deutsche Schäferhündin, die Leonard einem Arschloch von Tierquäler abgenommen hatte, lag bei mir im Büro auf dem Sofa. Sie zeigte bemerkenswert gute Manieren und war stubenreiner als ich. Fragen Sie Brett, die kann ein Lied davon singen.
Es war ein gemütlicher Vormittag im Büro. Ich trug Jeans, in die laut Brett mein Arsch jetzt endlich richtig reinpasste, ein Paar neue hellbraune Schuhe, an denen Buffy bisher kaum rumgekaut hatte, und ein schönes grünes Polohemd ohne Fettflecken vom Essen. Selbst meine Unterwäsche war sauber. Mein schütteres Haar hatte ich gekämmt, und vor mir stand eine Tasse Kaffee mit echter Sahne drin und einer Portion Süßstoff. Außerdem eine offene Packung von Leonards Vanillekeksen, die er hinter dem Bürokühlschrank versteckt hatte, und die schmeckten herrlich. Nicht nur, weil sie eben gut schmeckten, sondern weil Leonard gedacht hatte, er hätte sie gut genug versteckt. Ich nahm mir vor, sie alle aufzuessen und die leere Packung dann wieder hinter den Kühlschrank zu stecken. Vielleicht würde ich ihm sogar einen Zettel hineinlegen: Schöne Grüße von der Keksfee. Leck mich! Im Krankenhaus hast du auch nicht geteilt.
So saß ich da, sinnierte über meine Rückkehr aus dem Reich der Toten und näherte mich wahrscheinlich gerade einer fundamentalen Einsicht in die Natur des großen Ganzen, des Universums, stand bestimmt kurz vor einer genialen Erleuchtung, die es verdient gehabt hätte, in einem philosophischen Essay niedergeschrieben zu werden, als die Tür aufging und eine schwarze Lady reinkam.
Gepflegt, übergewichtig, rote Stretchhose und weites grünes Top und lila Hausschuhe. Fehlte nur noch ein Sonntagshut wie für den Kirchgang, mit einem Angelköder und einem Golfball zur Zierde oben drauf. Ihre Handtasche war so groß, als wäre sämtliches Gepäck für eine Übernachtung drin. Ich schätzte sie auf vierzig. Vielleicht auch fünfzig. Auf alle Fälle wirkte sie erschöpft.
Ich nahm die Füße von der Tischplatte.
»Sonst niemand hier?«, fragte sie.
»So ist es, Ma’am.«
»Wo ist dieser Schwarze?«
»Leonard oder Marvin?«
Marvin arbeitete nicht mehr hier. Er hatte seine Detektei an Brett verkauft, aber ich hielt es für möglich, dass sie ihn meinte.
»Sind die schwarz?«, fragte sie.
»Ja, Ma’am. Durch und durch.«
»Und die arbeiten beide hier?«
»Nein, nur einer. Der ist eine fleißige Biene wie ich.«
»Welcher von den beiden Schwarzen sieht aus, als wär er sauer?«
»Wahrscheinlich beide. Der eine ist stämmig und geht manchmal an einer Krücke und ist so fünf oder sechs Jahre älter als ich. Der arbeitet nicht mehr hier. Der andere ist muskulös und in meinem Alter und steht auf Vanillekekse. Solche wie die hier.«
Ich tippte auf die Packung.
»Dann hab ich wohl den Muskulösen gesehen.«
»Wenn ich’s recht bedenke, sind beide muskulös. Aber der eine ist älter und schwergewichtiger, so wie ein Bär, dem man Klamotten angezogen hat.«
Sie betrachtete mich kritisch.
»Wie Sie sehen«, sagte ich, »bin ich keiner von den beiden Schwarzen.«
»Mir ging grad durch den Kopf, dass ich gar nicht beurteilen kann, wie alt Sie sind. Bei Weißen ist das schwer. Darf ich mir einen Keks nehmen?«
»Nehmen Sie gleich zwei. Kaffee dazu?«
»Haben Sie ’ne saubere Tasse?«
»Aber sicher doch.«
Sie sagte mir, wie sie ihn trank. Ich stand auf und schenkte ihr eine Tasse ein. Kein Süßstoff, stattdessen nahm sie vier Tütchen Zucker, rührte ihn mit einem unserer Plastiklöffel um, probierte, bat um ein weiteres Tütchen, das ich ihr reichte. Sie trank den Kaffee und tunkte einen ihrer Kekse hinein und knabberte daran herum. Sie wusste, was gut ist.
»Vermutlich ist es egal, welcher von den beiden. Ich hab ihn auf der Treppe hoch und runter gehen sehen, deshalb hab ich gedacht, er arbeitet hier, und weil er schwarz ist, wollte ich mit ihm reden.«
»Manche von uns Weißen können auch reden und sind ziemlich gute Ermittler.«
»Glaub ich.«
»Wie kam’s, dass Sie ihn gesehen haben?«
»Wie meinen Sie das?«
»Den Schwarzen, Leonard. Ich nehme mal an, dass Sie nicht mit einem Fernglas im Baum neben dem Parkplatz gehockt haben.«
»Wollen Sie mich verscheißern?«
»Nur ein kleines bisschen.«
»Ich wohne gegenüber, Sie Meisterdetektiv. Deshalb hab ich noch die Hausschuhe an. Ich hab einfach das nächstbeste Paar angezogen.«
»Hab ich mir schon gedacht.«
»Nein, haben Sie nicht«, sagte sie.
»Also gut, hab ich nicht.«
»Ich hab ein bisschen Geld. Ich will nix umsonst.«
»Ich hab Ihnen auch nix umsonst angeboten.«
»Aha«, sagte sie. Sie zog einen kleinen Geldbeutel aus ihrer übergroßen Handtasche, in der ein ganzes Paralleluniversum Platz gehabt hätte, und kramte dann in der Tasche herum wie auf der Suche nach König Salomons Schatz. Schließlich förderte sie einen Packen Geldscheine zutage, der einem Dinosaurier im Hals stecken geblieben wäre, klatschte ihn auf den Schreibtisch und häufte noch einige Münzen obendrauf.
Sie sah mich an. Ich streckte mich und zog das Geld zu mir her und zählte es. Es war ein fetter Batzen, aber überwiegend in kleinen Scheinen. Vierzig Einer, ein Fünfer, ein eselsohriger Zwanziger mit einem gänzlich abgekauten Eck, vielleicht ja von einem Esel. Achtundzwanzig Cent Kleingeld, ein kleines Häufchen Fusseln und eine runde Stange Pfefferminz in einer Plastikhülle. Sie nahm die Pfefferminzstange wieder an sich und ließ sie in ihre Tasche fallen. Wo sie vermutlich immer noch fällt.
»Was krieg ich dafür?«, fragte sie.
»Im Ernst? Eine Tasse Kaffee, ein paar von diesen Keksen, und vielleicht gehen wir dann noch ins Kino.«
»Ich geh nicht mit Weißen aus.«
»Ich weiß, wie man einer Dame einen netten Abend macht.«
»Ich hab keine Vorurteile, nur damit Sie’s wissen. Ich möchte nur nicht mehr als unbedingt nötig mit Weißen zu tun haben.«
»Genau das versteht man gemeinhin unter Vorurteilen.«
»Also kann ich mir dafür nix kaufen?«
»Erzählen Sie mir, was los ist, und vielleicht kann ich Ihnen dann sagen, ob ich was für Sie tun kann. Vielleicht ist es ja eine ganz einfache Sache, die schnell erledigt ist.«
»Ich möchte, dass Sie mit einem bestimmten Mann reden.«
»Vermutlich über was ganz Bestimmtes?«
»Wie meinen Sie das?«
»Dass Sie was ganz Bestimmtes im Sinn haben. Sie möchten, dass ich – oder mein schwarzer Kollege – mit dem Betreffenden über was ganz Bestimmtes redet, oder?«
»So könnte man’s ausdrücken«, sagte sie. »Ich glaube, dass mein Sohn umgebracht wurde.«
»Oh«, sagte ich.
Mein Interesse war geweckt. Ich hatte so etwas befürchtet wie die Suche nach einer verlorenen Katze, und obwohl ich nichts dagegen hatte, Leute wieder mit ihrem Haustier zu vereinen, ist es doch so, dass eine Katze meistens von alleine wieder nach Hause kommt.
»Ich wollte den Schwarzen beauftragen, weil er eben schwarz ist.«
»Würde das irgendwie helfen?«
»Sie würden da nicht hinpassen, in die Projects in Camp Rapture.«
Ich nickte. »Da ist was dran. Hört sich eher nach einem Fall für die Polizei an. Ich kenne einen guten Polizisten, der Ihnen helfen kann.«
»Bei denen war ich schon. Die meinen, ich brauch Beweise.«
»Ja. So läuft das normalerweise.«
»Besonders in Camp Rapture«, sagte sie.
»Tja«, sagte ich. »Ein Kaff.«
»Drecksloch trifft es besser.«
»Der Cop, den ich vorhin meinte, das ist einer der beiden Schwarzen, die Sie hier gesehen haben. Marvin Hanson. Er ist Polizist in LaBorde, nicht in Camp Rapture.«
»Dann lieber der andere. Der Schwarze, der hier arbeitet, soll mir Beweise beschaffen. Wenn ich mit Cops zu tun hab, krieg ich’s nur an den Nerven. Die kriegen doch sowieso nichts gebacken.«
»Wenn ich nicht grad Säcke schleppe oder Baumwolle zupfe für die guten alten weißen Herrschaften, dann arbeite ich ebenfalls hier. Und ich hab Ihnen was von den Vanillekeksen abgegeben. Glauben Sie mir, der schwarze Kollege hätte Ihnen nicht mal die letzten Krümel in der Packung überlassen.«
»Sie haben nie im Leben Baumwolle gezupft.«
»Genauso wenig wie Sie. Die einzige Baumwolle hier in der Gegend in den letzten fünfzig Jahren findet man in Aspirinflaschen.«
Das brachte sie zum Grinsen.
»Immerhin hab ich auf den Feldern gearbeitet«, sagte ich. »Auf Rosenfeldern. Und in einer Aluminiumstuhlfabrik, und eine nicht so glückliche Zeit lang in der Hühnerfabrik …«
»Da haben Sie mal gearbeitet?«
»Hab mich da aber nie so richtig wohl gefühlt. Das war gewissermaßen eine weniger erfolgreiche Periode in meinem Lebenslauf.«
»Ich hab dort gearbeitet.«
»Wann?«
Sie sagte es mir.
»Zu der Zeit war ich auch dort«, erwiderte ich.
»Wirklich?«
»Wirklich.«
»Erinnern Sie sich, wie da mal eine Frau auf der anderen Seite vom Zaun angegriffen wurde und ein weißer Bursche rübergeklettert ist und sie gerettet hat?«
»Das war ich.«
»Ach was, das waren nicht Sie.«
»Doch, war ich wohl.«
»Das waren Sie … aber Sie waren damals schlanker, oder?«
»Danke, dass Sie mich drauf hinweisen.«
Gerade hatte ich mich noch beglückwünscht, wie viele Pfunde ich doch abgenommen hatte, und nun hielt sie mir vor, ich wäre damals schlanker gewesen. Na ja, fitter auf alle Fälle.
»Ich war da in der Zuschauermenge«, sagte sie. »Hab gar nicht gewusst, dass Sie das waren.«
»Tja. Der Boss hat mir dafür einen Urlaub spendiert. Der war aber nicht so erholsam, wie ich’s mir vorgestellt hatte. Aber das ist eine andere Geschichte.«
Ich verschwieg ihr, dass der Schwarze, den sie zu engagieren gedachte, Schuld daran gewesen war, dass ein Kreuzfahrtschiff uns an Land zurückgelassen hatte, wo wir dann am Strand von Räubern angegriffen wurden und Leonard infolgedessen die ganze Zeit nicht nur mit einem peinlichen Hut herumlief, sondern auch mit einer schweren Verletzung. Wir wurden oft verletzt. Wir legten uns oft mit Leuten an.
»Okay«, sagte sie. »Okay. Also gut. Sie waren das, also ist es okay. Das haben Sie gut gemacht, wie Sie dem Mädchen geholfen haben. Sie haben sie gerettet. Ich engagiere Sie.«
»Bedenken Sie, dass ich für so wenig Geld auch nur entsprechend wenig für Sie tun kann.«
»Reden Sie mit dem Kerl, der den Mord beobachtet hat, mehr will ich nicht. Das als Erstes.«
»In Ordnung. Erzählen Sie mir, worüber genau ich mit dem Kerl reden soll. Außer dem Mord. Ich brauche Einzelheiten. Ich möchte mich auch mit den Cops unterhalten.«
Sie schüttelte den Kopf. »Lieber nicht. Ich hab doch gesagt, ich hab mit denen geredet. Scheiße. Ich bin ziemlich sicher, dass die ihn umgebracht haben.«
KAPITEL 2
Sie hieß Louise Elton und sie hatte eine wirklich höllische Geschichte auf Lager, die sie mir in allen Einzelheiten erzählte. Danach rief ich Leonard an. Er ging nicht ran, also hinterließ ich ihm eine Nachricht. Ich hoffte, dass er inzwischen wieder zurück in der Stadt wäre, konnte aber nicht damit rechnen. Er war mit seinem langjährigen Lover John immer noch zerstritten, sie stritten sich ungefähr so regelmäßig, wie Kühe auf die Weide gehen, und Leonard wollte sich mal anderweitig umsehen. Und nun hatte er eben diesen Typen im Internet kennengelernt.
Louises Sohn hieß Jamar. Es gab keinerlei Beweise, dass die Cops ihn umgebracht hatten, abgesehen von einem angeblichen Augenzeugen. Aber mit dessen Aussage schien etwas nicht zu stimmen, zumindest nach Meinung der Cops. Louise dagegen war überzeugt, dass er mir nützliche Informationen geben könnte.
Schadete bestimmt nicht, wenn ich ihm mal auf den Zahn fühlte. Er hieß Timpson Weed und wohnte in Camp Rapture; seine Heimat waren die Projects, wenn man die so nennen konnte. Nicht gerade ein gemütliches Viertel, die Weißen betrachtete man dort schlichtweg als Feinde. Andererseits war mir langweilig, Leonard war nicht greifbar, und ich hatte ja die Nummer des Apartments.
Ich aß zu Mittag, eine echt üble Suppe aus der Büromikrowelle, tätschelte Buffy kurz, schnappte mir meinen Mantel und fuhr rüber nach Camp Rapture. Kein weiter Weg, von LaBorde aus, und schon bald sah ich die Projects – ein Ort, wo Träume hinziehen, um sich die Kugel zu geben, und wo die Hoffnung sich selber in den Arsch fickt.
Es war ein kalter Tag, und beim Aussteigen atmete ich weißen Dunst aus. Ich zog meinen Mantel enger um mich und marschierte über den rissigen Gehweg in Richtung einer Reihe von Apartments. Sie wirkten mitgenommen. Angeschlagene Ziegel, die Wände voller Graffiti, nette kleine Botschaften wie HAB DEINE MUTTER GEFICKT UND IHRE PUSSY STINKT.
Ähnliche Sprüche fand man immer wieder, außerdem Namen mit Symbolen, laut Polizei Markierungszeichen von Straßengangs. Die gleichen Zeichen konnten in einer Unterführung allerdings auch angeblich von Satanisten stammen. Man machte es sich gerne einfach; die Zeichen bedeuteten eben, was immer die Cops wollten.
In letzter Zeit hatte sich der Ruf der Polizei von Camp Rapture deutlich verschlechtert. Noch mehr verschlechtert als ohnehin schon, und an ihrem schlechten Ruf musste was dran sein. Vor einem knappen halben Jahr hatten die dortigen Cops einen Autodieb im Straßengraben ganz in der Nähe des gestohlenen Fahrzeugs »entdeckt«, und zwar mit fünf Einschusslöchern im Hinterkopf. Offizielle Todesursache: Selbstmord. Damit kamen sie natürlich nicht durch, aber dass sie überhaupt auf diese Idee gekommen waren, gibt einem schon eine gewisse Ahnung von ihrer Berufsauffassung.
Ein Grüppchen junger Schwarzer setzte sich in Bewegung, mir entgegen. Alle so um die zwanzig. Mit diesem demonstrativen Harte-Jungs-Schlendern, bei dem ein Bein das andere hinter sich herzuschleifen scheint. Hände in den Taschen, vielleicht auch noch etwas anderes in den Taschen. Ich war unbewaffnet, hatte ja nicht gleich mit einer Schießerei gerechnet. Ihre Situation war zum Kotzen, klar, junge Männer ohne Jobs und so gut wie ohne Perspektive, aber noch mehr zum Kotzen fand ich, dass sie fünf gegen einen waren – gegen mich.
»Na, wie geht’s, meine Herren?«, sagte ich, als sie mich umzingelten.
»Uns geht’s prima«, sagte einer. Ein schlaksiger Typ, lange sehnige Muskeln, rote Duschhaube auf dem Kopf. Ein modisches Statement, das ich nie kapiert habe – aber wenn es regnete oder er schnell mal unter die Dusche wollte, war er gerüstet.
»Was willst du?«, fragte der mit der Duschhaube.
»Geld und Ruhm, was sonst.«
»Ach, bist du ’n Klugscheißer?«, sagte Duschhaube. Diese Frage hörte ich tatsächlich öfter.
»Ja.«
»Du stehst gleich ziemlich dumm da, wenn deine Zähne auf ’n Boden purzeln und wir dir den Arsch aufreißen.«
»Da würd ich wirklich dumm dastehen, und das würd mir gar nicht gefallen«, sagte ich. »Ich suche jemanden. Vielleicht ein Kumpel von euch. Ich hab seine Apartmentnummer.«
»Wenn wir ihn kennen, dann kannst du deinen weißen Arsch drauf verwetten, dass du von uns keinen Hinweis kriegst«, sagte Duschhaube.
»Meinen weißen Arsch will ich nicht verwetten, also dann, besten Dank für eure Zeit«, sagte ich.
Ich schritt durch eine Lücke in dem engen Kreis, den sie um mich gebildet hatten, und setzte meinen Weg fort ohne zurückzublicken. Gegenüber Jungs, die nichts zu tun haben und gern einen Streit vom Zaun brechen, verhält man sich am besten so wie gegenüber scharfen Wachhunden. Keine Furcht zeigen, nicht in die Augen schauen, gemächlich davonspazieren und hoffen, dass sie dich nicht in den Arsch beißen.
Ich schlug die Richtung ein, wo ich das Apartment vermutete, landete aber bei einer anderen Nummer. Die einzelnen Zahlen hingen nur noch lose an der Tür. Ich ging am anderen Ende des Apartments um die Ecke. Dort spielten ein paar Kinder, Jungen und Mädchen, vielleicht elf Jahre alt oder so; sie kickten einen Ball hin und her.
Als ich um die Ecke kam, hielten sie inne. Weiße bekam man hier offenbar so selten zu Gesicht wie Bigfoot. Eines der Mädchen sagte: »Was suchen Sie hier?«
Freches Gesicht, die Haare zu Cornrows geflochten, und Kleider wie von jemand Größerem zum Auftragen überlassen. Sie trug lila Tennisschuhe mit schmutzigen weißen Schnürsenkeln und ein übergroßes T-Shirt mit der Aufschrift MEIN ARSCH PASST ZU DEINEM GESICHT.
Bezaubernd.
»Vielleicht such ich hier jemanden?«, sagte ich.
»Sind Sie von ’er Popelei?«
»Nee, keine Popelei. Müsstet ihr nicht eigentlich in der Schule sein? Oder vielleicht irgendwo irgendwas anzünden?«
»Heut ist Samstag, Blödmann«, sagte das Mädchen.
»Weißt du was«, sagte ich, »da hast du recht.«
»Natürlich hab ich recht, und morgen ist Sonntag, und übermorgen Montag.«
»Du hast bestimmt lauter Einser in der Schule.«
»Nee, gar nicht.«
»Aber deine Betragen-Note ist bestimmt gut, oder?«
»Meine was?«
»Nichts, vergiss es. Ich suche einen Mann namens Timpson Weed. Wer mir als Erstes zeigt, wo er wohnt, kriegt fünf Dollar. Und wenn er wirklich dort wohnt, gibt’s noch mal fünf Dollar, wenn ich mich mit ihm unterhalten habe.«
Das fraß schon einen Gutteil meines Vorschusses in diesem Fall auf.
Die Kleine beäugte mich misstrauisch, als würde ein Bankangestellter meine Kreditwürdigkeit prüfen. »Zeigen Sie mir das Geld.«
Ich holte einen Fünfdollarschein aus meiner Brieftasche und hielt ihn zwischen den Fingern.
»Direkt da oben«, sagte sie und deutete auf eine Tür am Treppenabsatz über uns.
»Man hat mir aber gesagt, es wäre Apartment 905, nicht 605.«
»Wenn Sie’s so genau wissen, warum fragen Sie dann?«
»Gutes Argument.«
Ich hatte gefragt, weil die Lady, die mich engagiert hatte, sich nicht genau erinnern konnte, ob die erste Zahl eine 9 war oder eine 6. Nun wusste ich es also. Oder ich war gerade um fünf Dollar beschissen worden.
Ich gab ihr den Schein, ging die Treppe hinauf und weiter zu der Tür. Durch den unteren Türspalt waberte Essensduft heraus, Hühnerfleisch und Knödel und jede Menge Zwiebeln. Auch ein Fernseher war zu hören, irgendeine Quizshow. Ich klopfte an. Mehrere Eiszeiten später öffnete sich die Tür.
Vor mir stand eine kleine Frau im geblümten Morgenmantel, Mitte dreißig, kurz geschnittenes Haar, ein bisschen dick, mit Brüsten, die sich woanders vielleicht wohler gefühlt hätten als in dem viel zu engen Morgenmantel. An den Füßen trug sie flauschige lila Hausschuhe, ein neueres Paar als das von Mrs Elton; die mussten gerade in Mode sein. Vorne waren sie offen, und ihre Zehen lugten heraus, mit silbern lackierten Zehennägeln. Ihre Fingernägel hatte sie anders lackiert. Rot.
»Was wollen Sie?«
»Ihnen auch einen schönen Nachmittag.«
»Scheiße, was wollen Sie? Ich hab zu tun.«
»Ich habe gehört, hier an dieser Adresse wäre eine Benimmschule.«
»Eine was?«
Ich benahm mich wie ein arrogantes Arschloch, aber bis jetzt hatte ich mir bei meinen Bemühungen, Louises Sohn zu seinem Recht zu verhelfen, nichts als Scheißdreck anhören müssen, von allerlei Leuten ab elf Jahren aufwärts. Soviel ich wusste, konnte Louises Sohn Jamar ein übler Typ gewesen und bei irgendeiner krummen Sache umgekommen sein, aber ich sollte eben die Wahrheit herausfinden, und bisher war das Ergebnis null. Andererseits, wenn ich mir so manche Zustände in Camp Rapture vor Augen hielt, dann wäre ich auch auf der Hut, besonders gegenüber jemandem, der nach Polizei roch.
»Wer ist da an der Tür?« Eine Stimme in der Wohnung.
Ich versuchte hineinzuspähen, an der Frau in der Tür vorbei, aber keine Chance. Sie versperrte mir immer wieder die Sicht. Kurz darauf kam ein großer Schwarzer mit nacktem Oberkörper an die Tür und schob sie sacht beiseite.
»Was soll der Aufruhr?«, sagte er.
»Der Weißarsch da stellt komische Fragen«, sagte die Frau.
»Geh zurück in die Küche und pass auf den Herd auf. Und verdammt noch mal, Mensch, zieh dir den Morgenmantel besser zusammen.«
Sie bedachte mich mit einem letzten Blick, der mich fast rückwärts über das Treppengeländer geworfen hätte, und verschwand in der Wohnung, um sich wieder dem Essen auf dem Herd zu widmen.
»Was wollen Sie?«, fragte der große Mann. Er war echt groß. Hochgewachsen, breit, und unter seinem Bauchansatz bewegte sich nicht bloß Fett. Sondern auch einiges an Bauchmuskulatur, die mir vielleicht gern mal gezeigt hätte, wie straff sie noch war und wie wenig mit Fett durchsetzt.
»Sind Sie Timpson Weed?«
»Und wenn, was dann?«
»Louise Elton hat mich hergeschickt.«
»Echt? Immer noch wegen der Sache mit Jamar?«
»Ja, immer noch.«
»Der Nigger ist so tot wie nur was. Da ändert sich nichts mehr dran.«
»Ich bin Privatermittler, und sie hat mich engagiert, damit ich seinen Tod mal unter die Lupe nehme. Ob vielleicht mehr dahinter steckt, als die Polizei so erzählt.«
»Klar steckt da mehr dahinter. Wie immer.«
»Den Cops geht’s nicht immer darum, Sie aufs Kreuz zu legen«, sagte ich. »Ich kenne ein paar anständige.«
»Leben Sie mal einen Tag lang als Nigger.«
»Ich rede von einem schwarzen Cop.«
»Ja, dann ist er doch bloß außen schwarz und innen weiß. Ich hab da so meine Erfahrungen.«
Darüber wollte ich nicht mit ihm streiten.
»Ich versuche bloß, ihr zu helfen«, sagte ich.
»Ihr Geld abzuknöpfen, meinen Sie wohl.«
»Viel ist es nicht.«
Er taxierte mich eine Weile. »Ich hab dazu nicht viel zu sagen.«
»Erzählen Sie mir das Wenige, das Sie wissen?«
Er war immer leiser geworden, als säße unten jemand im Gebüsch und würde uns belauschen.
»Weiß nicht.«
»Sie tun ihr damit einen Gefallen. Auch wenn dabei nicht das rauskommt, was sie hören will, ist es immer noch besser, wenn sie erfährt, was wirklich passiert ist.«
»Wissen Sie was, geben Sie mir ein Bier aus.«
»Wo?«
»Die Kneipe grad außerhalb am Stadtrand. Um sieben.«
»Heißt die Kneipe irgendwie?«
Er lachte. »Ist ’n einprägsamer Name. Einfach The Joint.«
»Um sieben, heute Abend. Ich werd’s schon finden.«
»Vielleicht bringen Sie besser ’n Rasiermesser und ’n Gummiknüppel mit. Da geht’s noch etwas altmodisch zu.«
»Und was heißt das?«
»Die Leute da mögen keine Weißen. Verdammt, die mögen nicht mal sich selber.«
KAPITEL 3
Als ich wieder die Treppe runter war und unterwegs zu meinem Auto, kamen prompt wieder diese jungen Typen daher, Rote Duschhaube vorneweg, alle mit diesem schleifenden Gang. Mir schwante, dass sie wohl beschlossen hatten, mich ein bisschen aufzumischen, nur um dem Milchgesicht zu zeigen, wer hier das Sagen hatte. Von mir aus durften sie hier gerne das Sagen haben.
Ich sah mich nach einem anderen Weg zu meinem Auto um, doch rechter Hand lag nur eine Brachfläche und linker Hand die Projects. Das leere Gelände war mit vertrocknetem Gras überwuchert und mit Flaschenscherben und allem Möglichen zugemüllt. Jenseits davon standen weitere Sozialbauten. Für so einen Umweg, nur um dem Ärger auszuweichen, hätte ich eine Campingausrüstung und Proviant gebraucht. So oder so hätte ich besser einen Umweg in Kauf nehmen sollen, doch das ließ mein Stolz nicht zu. Oder, ehrlich gesagt, ich war einfach zu faul dazu.
Das Mädchen, dem ich die fünf Dollar gegeben hatte, trat aus einer offenen Tür und rief: »Haben Sie ihn gefunden?«
Ich blieb stehen, behielt die Typen im Auge, die immer noch auf mich zu schlenderten, und sagte: »Ja, hab ich.«
»Dann schulden Sie mir noch fünf Dollar, stimmt’s?«
»Ja, glaub schon.«
»Hat nichts mit glauben zu tun.«
Ich zog fünf Dollar aus meiner Brieftasche, stets die jungen Männer im Blick. Sie waren stehen geblieben und traten von einem Bein aufs andere, als würden sie auf mich warten. Hinter ihnen sah ich auf dem Gehweg Leonard herankommen. Er hatte meine Nachricht erhalten, war also bei meinem Anruf bereits auf dem Heimweg gewesen. Auf seine typische Art kam er daherstolziert, mit hoch erhobenem Kopf; sogar von Weitem wirkten seine Augen wie zwei harte Steinkohlekugeln. Er trug einen pechschwarzen Fedora, seine neueste Errungenschaft, und schien sich für eine Art schwarzen Humphrey Bogart zu halten – mit einem Doppelpaar Eiern in der Hose.
»Die Jungs da stehen nicht auf Sie«, sagte die Kleine und blickte in deren Richtung.
»Ich kenn die überhaupt nicht.«
»Eben deswegen ja.«
»Ich hab nicht vor, sie zu provozieren.«
»Die sind sowieso immer provoziert. Der Große, in dem blauen Shirt, das ist Laron. Der reißt gern jemand den Arsch auf.«
»Hast ja ’n ganz schön loses Mundwerk.«
»Sollten erst mal meine Mama hören.«
»Und der mit der Duschhaube?«
»Genauso übel wie Laron. Nur redet Laron nicht viel, aber Tuboy, der redet gern, und der verarscht einen. Hinter seinem Rücken, da hat er ein Rasiermesser unterm Shirt.«
»Danke für den Hinweis.«
»Nützt Ihnen ja doch nichts.«
Die Jungs setzten sich wieder in Bewegung, in meine Richtung.
»Die werden die Scheiße aus Ihnen rausprügeln, nur so zum Spaß.«
»Aber vielleicht geht die Prügelei ja anders aus, als sie sich das vorstellen.«
»Wieso? Verwandeln Sie sich in ’ne ganze Gang von lauter weißen Jungs? Sind Sie so ’n Superheld?«
»Meine geheime Superkraft ist ein Freund zur rechten Zeit am rechten Ort.« Ich begann ihnen entgegenzugehen.
Leonard hatte inzwischen von hinten zu ihnen aufgeschlossen. Er hatte die Situation bereits erfasst, und da er seinen Knallharter-Typ-Hut trug, legte er gleich mit großen Sprüchen los.
»Aus dem Weg, verdammt noch mal«, hörte ich ihn sagen, und sie wichen ihm aus wie einem Schwerlaster. Leonard ist kein Winzling, aber ein Riese ist er auch nicht gerade. Er wirkt bloß immer so groß, durch sein Auftreten und seine Art zu quatschen. Zeigt jedem gleich seinen Schwanz, wie es mal ein alter Mann im Kampfkunsttraining mit uns ausdrückte.
»He, Alter«, sagte der Große, Laron. »Was zur Hölle soll die Scheiße? Meinst du, du kannst hier einfach so auftauchen?«
Leonard verpasste ihm einen Schwinger an den Kopf, der ihn zu Boden streckte. Da blieb Laron schön ruhig liegen, entweder bewusstlos oder in dem Bewusstsein, dass gleich wieder aufzustehen nicht das Schlaueste wäre.
Rote Duschhaube alias Tuboy griff hinter seinen Rücken und brachte die Hand wieder nach vorne. Kurz sah ich ein aufklappendes Rasiermesser. Ich rannte los.
Leonard trat auf Tuboy zu und haute ihm direkt was aufs Maul, während der noch seine Messerhand nach vorne brachte. Tuboy fiel auf die Knie und ließ das Rasiermesser fallen. Er schwankte hin und her.
Einer der anderen schien das Rasiermesser vom Boden aufklauben zu wollen.
»Muss euch Arschlöcher hier wohl aufeinanderstapeln«, sagte Leonard und drehte seinen Kopf hin und her, blickte vom einen zum andern.
Sie zogen sich zurück.
Genau als ich ankam.
»Toll«, sagte Leonard. »Bist du auch endlich da? Warst du unterwegs ’n Chili essen?«
»Hab mich beeilt, aber an dem Chili kam ich nicht vorbei.«
Leonard langte zu Tuboy hinüber, zog ihm die Duschhaube vom Kopf und schmiss sie beiseite. Zum Vorschein kam eine verfilzte, fusselige Cornrow-Frisur.
»Was trägst du so ’n blödes Ding, kleines Arschgesicht?«, sagte Leonard. Er schaute die anderen Pfeifen an: »Ich sollte euch die Scheiße aus dem Leib prügeln. Ihr haust hier wie die Kakerlaken, und dann noch ’ne verdammte Duschhaube auf ’m Kopf. Was seid ihr denn, blöde Tiere?«
Tiere tragen Duschhauben?, dachte ich bei mir.
»Du hast kein Recht, so mit uns zu reden, Bruder«, sagte einer der jungen Männer.
»Ich bin nicht euer beschissener Bruder. Macht euch vom Acker, und nehmt die beiden blöden Säcke mit. Die Duschhaube behalt ich. Da werd ich reinscheißen.«
Sie stoben davon wie Gänse. Kümmerten sich nicht um Laron oder Tuboy. Jeder Arsch war sich selbst der nächste. Tuboy kniete immer noch, mit leerem Blick. Wahrscheinlich sah er kleine blaue Zwerge auf Einhörnern reiten.
»Der ist fertig, Leonard«, sagte ich.
Leonard schubste ihn mit der Handfläche, und Tuboy stöhnte leise, fiel in sich zusammen und blieb auf der Seite liegen.
Das Mädchen trat an unsere Seite. »Glaubst wohl, du bist ’n harter Typ, was?« Sie meinte Leonard.
»Das glaub ich nicht nur, kleines Mädchen, das weiß ich genau.«
»Die Jungs vergessen so was nie«, sagte sie.
»Tatsache? Da werd ich aber schlaflose Nächte haben. Wer zum Teufel bist du überhaupt?«
»Reba. So hat nämlich eine weiße Sängerin geheißen.«
»So so«, sagte Leonard.
»Mama stand auf so ’n Weißbrotmist. Ich nicht. Ich steh auf richtige Musik. Und die meisten nennen mich Little Woman.«
»Das hast du dir grad ausgedacht«, sagte Leonard.
»Na, dann eben ab jetzt.«
»Reba gefällt mir«, sagte Leonard. »Die Sängerin, wenn wir beide dieselbe meinen. Du gefällst mir kein bisschen, du stupsnasiges Häufchen Rattenscheiße.«
»Leonard«, sagte ich. »Das ist ein Kind.«
»Das ist kein Kind. Das ist ein vierhundert Jahre alter verdammter Vampirzwerg.«
»Leck mich am Arsch«, sagte Reba.
»Gleichfalls«, erwiderte Leonard.
»Bist du überhaupt ein Schwarzer?«
»Was soll ich denn sonst sein? Sieht das für dich etwa aus wie Schuhwichse?«
»Du bist ’n Onkel Tom.«
»Ja, gut, wenn du in den verfluchten Projects bleiben willst, mit deiner eigenen Duschhaube auf ’m Kopf und Hausschuhen an und drüber jammern, dass die Weißen dich kurzhalten, dann mach nur weiter so. Ich, ich spuck dem weißen Mann in die Fresse und erzähl ihm, das ist ’ne Gesichtslotion, und die muss er eben mögen.«
»Hoffentlich wirst du von ’nem Tiger gefressen«, sagte sie und stapfte davon.
»Wohl kaum«, sagte Leonard.
»Leonard, echt jetzt? Du streitest dich mit ’nem Kind rum?«
»Sie hat angefangen. Dieser uralte beschissene zwergwüchsige Vampir.« Er rief ihr hinterher: »Hoffentlich hat dein blödes Dreirad ’n Platten!«
Sie setzte einfach ihren Weg fort, ohne einen Blick zurück, reckte ihre Faust in die Höhe und zeigte ihm den Mittelfinger.
KAPITEL 4
Leonard trug die rote Duschhaube zu seinem Pick-up, als wäre sie ein Skalp aus einem Gemetzel. Er öffnete die Fahrertür und warf sie hinein.
»Ist das zu glauben? Der bescheuerte Kerl läuft mit ’ner scheiß Duschhaube auf ’m Kopf rum und hat nicht mal frisch gewaschene Haare drunter, die trocknen müssen, sondern bloß so ’ne verfusselte Birne. Was soll die Kacke?«
»Leonard, du bist kein netter Mensch.«
Wir stiegen in unsere Karren und fuhren nach LaBorde zurück. Leonard überholte mich, mit offenem Seitenfenster, winkte herüber und grinste übers ganze Gesicht. Er hatte seinen Fedora durch die rote Duschhaube ersetzt.
Daheim in LaBorde fuhren wir zum Büro, gingen dort die Treppe hoch, Leonard inzwischen wieder mit Hut. An der Tür begrüßte uns Buffy, mit der ich gleich mal Gassi ging, damit sie ihr Geschäft verrichten konnte. Danach entsorgte ich den Plastikbeutel mit Hundekot im Müll, ging wieder nach oben und wusch mir die Hände. Währenddessen drückte Leonard Buffy an sich. Er hatte sie gerettet, und ich hatte sie bei mir aufgenommen. »Komm schon«, sagte er, »raus damit, mach deine üblichen blöden Bemerkungen über meinen Hut.«
»Er gefällt mir.«
»Was? Hör ich schlecht?«
»Er gefällt mir.«
»Ich krieg gleich ’n Herzkasper.«
»Echt. Der Fedora passt. Der einzige Hut, der je zu dir gepasst hat, außer dem Cowboyhut. Obwohl ich zugeben muss, diese Duschhaube, die bringt’s. Entspricht eher deinem wahren Wesen.«
»Leck mich doch. Was hattest du überhaupt in den Projects zu suchen? Aus deiner Nachricht bin ich nicht so recht schlau geworden. Bist eigentlich alt genug um zu wissen, dass du in den Projects nichts verloren hast. Könnte nämlich passieren, dass du plötzlich am Boden liegst und laut jammerst: Ich kann nicht mehr aufstehen, weil eine Bande Nigger auf mir rumtrampelt!«
»Hab doch alles im Griff gehabt«, sagte ich. »Seit wann machen mir so ein paar kleine Spinner Angst?«
»Da kannst du recht haben, aber das war ein Job für zwei. Du Weißbrot alleine da in der Gegend, und willst mit meinen Leuten reden, ohne Rückendeckung. Das war keine gute Idee, Hap. Wenn wir irgendwo hingehen, wo’s von beschissenen Rednecks wimmelt, dann nehm ich dich schließlich auch mit, also hättest du lieber auf mich warten sollen.«
»Ich verstehe, was du meinst.«
»Jetzt schon, hm?«
»Ja. Aber das sind nicht deine Leute, Leonard. Außer mir und Brett und deinem eigenen Spiegelbild gehört kaum jemand wirklich zu deinen Leuten. Und du würdest mit Sicherheit auch nicht auf mich warten, wenn du Hummeln im Hintern hast, Rednecks hin oder her.«
»Stimmt. Aber da in den Projects, da kannst du leicht draufgehen. Da wohnen keine guten Menschen.«
»Aber auch nicht nur schlechte Menschen.«
»Ja, aber einige schlechte sind schlimm genug, die stechen dich ab und die guten schauen zu. Da gehört eigentlich mal richtig aufgeräumt, so wie’s da zugeht.«
»Leicht gesagt, so von außen.«
»Ach Quatsch, Mann«, sagte Leonard, »wenn du an ’ner Bruchbude von ’nem White-Trash-Arsch vorbeifährst, wo eine Waschmaschine und alte Autoreifen im Vorgarten vergammeln, denkst du, das ist halt ein stinkfauler weißer Sack. Aber wenn Schwarze wie die Schweine leben, dann packst du deine scheißlinken Parolen aus, wie unterdrückt die sind.«
»Sind sie doch auch. Solltest du wissen.«
»Ist mir klar, dass Schwarzen ein Haufen Dreck in den Weg gelegt wird, aber was ihnen genauso im Weg steht, ist ihr eigenes Selbstmitleid. Mir hat man beigebracht, dass man eben arbeiten muss.«
»Dafür braucht’s erst mal einen Job, zum Arbeiten«, sagte ich.
»Müssen eben mal den Finger aus ’m Arsch nehmen und sich Arbeit suchen. Genau wie die ganzen White-Trash-Trottel, die sind nämlich bestimmt nicht solche Heulsusen. So wie ich das sehe, hat Hautfarbe rein gar nichts zu tun mit dieser Lahmarschigkeit. Du gehst dir Arbeit suchen, oder eben nicht. Klar gibt’s nicht besonders viele Möglichkeiten für Schwarze, die gab’s noch nie, aber noch weniger gibt’s die, wenn du dich nur in deinem beschissenen Loch direkt neben irgendeiner Crackbude verkriechst und von der Sozialhilfe lebst.«
»Wow. ’ne Menge Klischees, Leonard. Schau lieber nicht so oft Fox News und hör dir nicht dauernd das weiße Gelaber im Radio an. Und sag nicht so oft Nigger.«
»Verdammt, das Ganze hat doch überhaupt nichts mit schwarz oder weiß zu tun.«
Ich wusste, wir würden uns da nie und nimmer einig werden, also berichtete ich ihm, was Louise Elton mir erzählt hatte.
»Sie hält Cops für die Mörder ihres Sohns, und der Typ, mit dem du gesprochen hast, hat’s gesehen, will aber nicht in den Projects mit dir drüber reden?«
»Ja, so ungefähr.«
»Der will nur ein paar Gratis-Drinks, Hap. Dem spendierst du ein Bier, und er erzählt dir, er hat einen Alien gesehen, der vor seinem Scheiß-Wohnzimmerfenster gelandet ist und ’nem toten Hund grünen Käse aus dem Arsch gefressen hat.«
»Dir fehlt ein bisschen der Glaube an das Gute im Menschen«, sagte ich. »Na ja, mir genauso. Aber im Einzelfall hoffe ich doch mal das Beste. Verdammt, er ist schließlich zur Polizei gegangen und hat dort Louise zuliebe eine Aussage gemacht. Die haben sie ihm nicht geglaubt, oder wollten sie nicht glauben. Außerdem ist die Vorgeschichte noch etwas komplizierter.«
»Welche Vorgeschichte?«
»Von Louise. Von ihr hab ich noch ein paar Hintergrundinformationen.«
»Gib mir mal ’n Keks. – Moment mal, was zum Teufel? Das sind ja meine Kekse. Was machen die hier auf dem Schreibtisch?«
»Louise war hier zu Besuch. Ich hab ihr höflich welche angeboten.«
»Louise kann mich mal. Die Kekse waren versteckt.«
»In einem lausigen Versteck.«
»Verdammt noch mal, die Packung ist fast leer.«
»Sie hat sie mit Vorliebe in ihren Kaffee getunkt.«
»Da war sie bestimmt nicht die Einzige.«
Er schnappte sich die Packung, schob sich den Fedora aus der Stirn und fing an, die restlichen Kekse zu vertilgen. Dauerte nicht allzu lange.
Und während er grimmig aß, erzählte ich ihm alles, was Louise mir erzählt hatte.
KAPITEL 5