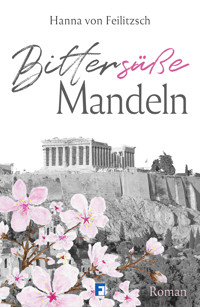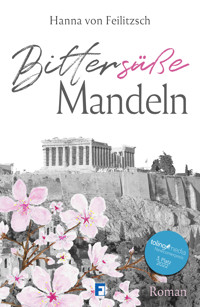
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Feilitzsch-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Während Stella um das Leben der Mutter bangt, trifft sie in der Athener Klinik ihre Verwandtschaft wieder. Oddy, der Bruder der Mutter, erzählt die Geschichte der Familie, angefangen mit der Flucht der Großmutter. Er entführt Stella in eine fremde Welt, in der andere Regeln gelten, Moral und Ehre die tragenden Pfeiler sind, und das "Böse" eine nicht greifbare Rolle spielt. Doch auch die archaische Gesellschaft ist im Wandel. Immer tiefer wird Stella in den Strudel der Erzählung gezogen, bis sie erkennt, dass sie ein Teil davon ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Hanna von Feilitzsch
Bittersüße Mandeln
Roman
Feilitzsch Verlag
1. Auflage 2021
© Feilitzsch Verlag, Rottach-Egern
© Hanna von Feilitzsch
Überfahrtstr. 2
83700 Rottach-Egern
Coverdesign: Irene Repp
https://daylinart.webnode.com/
Illustration: © Nathalie Waldschmidt
Bildrechte: © Annuta – adobestock.com
Absatztrenner: © Sophia von Feilitzsch
Satz: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Gesetzt aus der ITC Legacy Serif
ISBN 978-3-930931-08-8
www.Feilitzsch-Verlag.com
Instagram: @feilitzschverlag
@hannafeilitzsch
Das Flugzeug setzte mit einem Ruck auf der Rollbahn des Athener Flughafens auf. Stella griff nach dem Handgepäck. Seit dem Anruf hatte sich alles überschlagen. Oddy, Mutters Bruder, war am Apparat gewesen.
»Deine Mutter liegt im Krankenhaus. Sie hatte einen Schlaganfall.«
Es war keine Frage für Stella, dass ihre Mutter so schnell wie möglich nach Deutschland verlegt werden musste. Das griechische Gesundheitssystem war seit der Krise häufig mit negativen Berichten in der Presse gewesen. Durch jahrelange Sparmaßnahmen hatte es Federn lassen müssen, und in vielen staatlichen Kliniken fehlte es am Nötigsten. Stellas Bruder Georg, den sie nach zahlreichen Wählversuchen endlich in seinem brasilianischen Forschungscamp ans Feldtelefon bekommen hatte, schloss sich ihrer Meinung an. Er hatte angeboten, sofort nach Europa zu fliegen, um die Schwester in der schwierigen Situation zu unterstützen. Stella hatte ihn beruhigt und versichert, sie könne Mutters Rücktransport und alles Weitere ohne Probleme alleine organisieren, wusste sie doch, wie abgelegen seine Station an dem Nebenfluss des Amazonas war.
Stella hatte schnell festgestellt, dass ihr Vorhaben nicht einfach umzusetzen war, und vor allem von Deutschland aus nicht zu arrangieren. Die Dame des Verbands, den Stella umgehend wegen des Rücktransports kontaktiert hatte, und die ihr versichert hatte, sie solle sich keine Gedanken machen, es handle sich nur um eine Formsache, die Mutter läge in Kürze in einem Ambulanzjet, schließlich befände sich die Patientin nicht auf einer Südseeinsel, sondern mitten in Europa. Diese Dame war bald eines Besseren belehrt worden.
Das Taxi brauchte eine halbe Stunde, um Stella vom Flughafen in die Innenstadt zu bringen. Die Athener Straßen waren zu dieser späten Abendstunde fast leer. Wahrscheinlich hatte der Nieselregen die Fußgänger von den Straßen gefegt, dachte Stella. Das Licht der Straßenlaternen spiegelte sich im Asphalt. Als der Fahrer vor dem Krankenhaus anhielt, hörte der Regen auf. Stella bezahlte das Taxi, stieg aus und blieb einen Moment lang auf dem Gehweg stehen. Sie ließ den Blick über den mehrstöckigen Bau der Klinik gleiten, die hinter einem zwei Meter hohen Zaun lag. Trotz der Dunkelheit konnte Stella die Löcher in der Fassade erkennen, sogar einige Risse im Mauerwerk. Sie zog ihren Poncho enger um die Schultern und hoffte, dass das Innere des Gebäudes vertrauenserweckender wäre.
Neben der Einfahrt stand ein quadratischer Glaskasten, aus dem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die nächtlichen Besucher kontrollierten. Bereitwillig ließ der Angestellte Stella durchs Tor treten. Im Hof saßen zwei Dutzend Patienten auf Bänken. Die meisten von ihnen hingen am Tropf, rauchend und diskutierend. Ihre abgetragene Kleidung ließ ahnen, dass sie zu den Ärmsten der Gesellschaft gehörten. Die Wirtschaftskrise hatte viele Menschen an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Auch wenn der Großteil der Experten meinte, es ginge bergauf mit der Wirtschaft, zeigte dieser Anblick Stella, dass der Aufschwung nicht bei der gesamten Bevölkerung angekommen war.
Sie folgte der Beschilderung zu den Fahrstühlen, vorbei an einer plastikverhangenen Baustelle, deren rot-weißes Absperrband leuchtete. Was würde sie erwarten? Sie tastete nach den Familienfotos in der Tasche. Stella hatte nicht mit leeren Händen kommen wollen und dachte das wäre eine gute Idee. Im Laufe des Tages hatte sie von Oddy erfahren, dass auf den Röntgenaufnahmen vom Kopf der Mutter, die der Arzt angeordnet hatte, der Schlaganfall nicht sichtbar war. Der Onkel und Stella wussten nicht, ob es sich dabei um ein gutes Zeichen handelte. Ein merkwürdiges Gefühl, mit Oddy über derart private Dinge zu sprechen. Das letzte Mal hatte sie ihn als Kind getroffen. Er lebte in Amerika, hatte dort eine beachtliche Karriere gemacht. Erst bei einem Radiosender, dann beim Fernsehen. Sie hatte ihm am Telefon für die Zeit gedankt, die er sich für ihre Mutter nahm. Er hatte entgegnet, dass dies eine Selbstverständlichkeit wäre, schließlich sei sie nicht nur ihre Mutter, sondern auch seine Schwester.
Der Fahrstuhl hielt mit heftigem Ruck im dritten Stock. Die Schlaganfallpatienten waren auf einer Station im rechten Flügel untergebracht. Die Schwester, die nach mehrmaligem Klingeln die Eingangstür aufsperrte, wies ihr den Weg, vorbei an offenstehenden Türen, die die Sicht frei gaben auf geräumige Vierbettzimmer. Wände und Boden waren in einem Kreideton gehalten, die Krankenbetten Zeugen schweren Leids.
Stella stand in der Tür. Hatte sich die Schwester in der Zimmernummer geirrt? Keine der Frauen in diesem Raum hatte im Entferntesten Ähnlichkeit mit ihrer Mutter. Ausnahmslos Greise schienen unter den Laken zu liegen. Neben jeder Patientin saßen Angehörige, die jetzt alle Stella anstarrten. Groß, blond, wie ein Paradiesvogel, der sich verirrt hatte, traute sich Stella kaum einzutreten. Da erhob sich plötzlich ein Mann von einem Stuhl am Fenster.
War das Oddy?, fragte sich Stella. Mit raschem Schritt kam er auf sie zu, wobei er sein rechtes Bein leicht nachzog. Trotz seiner offensichtlichen Müdigkeit sah er gut aus, groß und athletisch, was ihn deutlich jünger wirken ließ, als er sein musste. Seine hellblauen Augen, die Stella an die ihrer Mutter erinnerten, leuchteten unter den dunklen Brauen. Sein Mund verzog sich zu einem Lächeln, als er vor der Nichte stand. Jetzt lächelte auch sie für einen Moment.
»Wo liegt sie?«, fragte Stella leise, und ließ dabei den Blick über die Patienten schweifen. Oddy machte ein Zeichen in Richtung Fenster. Obwohl Stella dagegen ankämpfte, füllten sich ihre Augen mit Tränen. Langsam ging sie auf das Bett zu. Oddy richtete die Mutter auf, wobei er sagte, wie sehr sie sich auf ihren Besuch gefreut, ja, wie sehr sie gewartet habe. Stella schloss die Mutter vorsichtig in die Arme, die sie seltsam leer ansah. Ihre Pupillen waren von der Farbe einer schlammigen Pfütze, und ihr Gesicht zeigte keine Gefühlsregung. Ihre Mutter war um dreißig Jahre gealtert, seit Stella sie das letzte Mal gesehen hatte. Der Kopf war verschoben und auf eine merkwürdige Art aufgedunsen, die Haut bleich. Ihr Körper schien unter der Decke seltsam gekrümmt.
»Sie kann nichts mehr sagen. Gestern hat sie noch gesprochen, Worte, Sätze, abgehackt, kaum verständlich«, flüsterte Oddy. »Ich glaube, meine Schwester wollte mir sagen, dass sie nach Hause möchte.«
Jetzt flackerten nur noch ihre Augenlider im Licht der Neonröhren, und der linke Arm führte unkoordinierte Bewegungen aus.
»Wir müssen sie schnell nach München bringen.« Sein Deutsch war erstaunlich gut, fast akzentfrei.
Während Stella den diensthabenden Arzt aufsuchte, war eine Frau in Schwesterntracht, wie Stella sie aus alten Filmen kannte, am Bett der Mutter aufgetaucht.
»Ich habe eine Pflegerin für die Nacht engagiert. Wir können sie nicht alleine lassen.« Laut Oddy kam der Sicherheitsdienst um elf Uhr, und dann mussten alle Angehörigen bis auf eine Person pro Patienten die Klinik verlassen. Stella beobachtete Elpida, so stellte sich die Griechin albanischen Ursprungs vor, wie sie der Mutter mit geübten Handgriffen die Stirn abwischte, Laken und Kissen gerade zog, und den Tropf kontrollierte. Sie fühlte ihre Körpertemperatur, zog ihr dicke Socken an, und holte eine weitere Decke aus dem Schrank.
»Ich bleibe bis morgen früh um neun Uhr. Ich passe gut auf die Arme auf«, kündigte die stämmige Frau an, als ein blau gekleideter Sheriff mit Waffe am Gürtel erschien. Er trieb die Anwesenden an, sich von den Angehörigen zu verabschieden.
Das zaghafte Murren, das erklang, begleitete Stella bis in ihre Träume. Ebenso der Anblick der Mutter, die vor einer Woche aufgebrochen war, um sich nach etlichen Jahren mit den Geschwistern in Athen zu treffen, damit das Erbe der Eltern endlich aufgeteilt werden konnte. Ein Punkt, der seit Jahren anstand und vor dem sich alle Beteiligten gescheut hatten. Zu viele Emotionen standen im Raum, der Graben tief, der sich zwischen einzelnen Familienmitgliedern gebildet hatte. Dann kamen Bilder auf, von der Frau im Krankenbett, die Mutter vertraut und doch anders. Zaghaft hatte sie nach den Fotos gegriffen, die Stella ihr mitgebracht hatte, als ob sie sich daran festhalten wollte, an einer Welt, die nah und gleichzeitig fern lag. Eines der Fotos, das Stella ihr falsch herum gereicht hatte, drehte sie mit einer einzigen Bewegung um, bis sich die einzelnen Bilder in einem endlosen Meer von kleinen und großen Seifenblasen auflösten.
Am nächsten Morgen stand Stella um Viertel vor zehn Uhr in einer langen Schlange, die sich vor den Fahrstuhltüren gebildet hatte. Die Menschen redeten durcheinander, lachten, jammerten, bekreuzigten sich immer wieder. Weitere Besucher schienen in den Gang zu drängen. Die Klinik glich einer Versammlungshalle, die aus allen Nähten zu platzen schien. Stella fühlte sich alleine, ängstlich und müde. Obwohl es ihrem Wesen entsprach, zuversichtlich zu sein, wusste sie nicht, wie sie die Aufgabe bewerkstelligen sollte, die Mutter nach Deutschland zu verlegen. Der Assistenzarzt hatte ihr in einem Gespräch gestern Nacht keine allzu großen Hoffnungen gemacht. Dabei ging es nicht um den Gesundheitszustand der Mutter, der schien auf eine merkwürdige Art nebensächlich geworden zu sein, einzig und alleine die Verlegung nach Deutschland stand im Focus. Der Arzt hatte Stella mitgeteilt, sie hätten Regeln, an die sich die Klinik halten musste. Dazu gehöre, am Telefon keinerlei Auskünfte zu geben, und falls das notwendig war, um einen Transport ins Ausland zu organisieren, könne er ihr nicht helfen. Der Chefarzt müsse entscheiden, ob eine Ausnahme gemacht werden könnte. Seine Stimme hatte ernst geklungen, als er ihr mitteilte, es handle sich schließlich um ein Politikum. Er hatte ihr angeboten, gleich morgens beim Primar einen Termin zu vereinbaren. Stella hatte auf den Arzt eingeredet, erst freundlich, dann forsch, dass sie keine Zeit verlieren dürften, dass sie sofort einen Verantwortlichen sprechen müsste, aber er hatte den Kopf geschüttelt.
»Sie müssen sich gedulden«, hatte er bestimmt gesagt, »so einen Fall hatten wir noch nie. Soweit ich weiß, wollte bisher aus diesem Krankenhaus noch nie ein Patient ins Ausland gebracht werden. Es ist eine der besten Kliniken des Landes.«
Mittlerweile war Stella fast an die Fahrstuhltüren herangerückt. Als der Aufzug anhielt, wollte sie sich mit einer Gruppe Besucher in die Kabine drängen. Geschrei ertönte, sie wurde zurückgeschoben. Sie verstand die Aufregung nicht. Was hätte sie in diesem Moment darum gegeben, die Sprache ihrer Mutter zu beherrschen. So verwies sie hilflos mit ein paar englischen Worten auf das Messingschild, das sie am Lift entdeckt hatte, auf dem in mehreren Sprachen 12 Personen zu lesen stand.
Nach einem weiteren Anlauf schaffte Stella es in den dritten Stock. Als die junge Frau durch die Tür trat, erkannte sie, dass Oddy bereits am Bett der Mutter saß. Er hielt die Hand seiner Schwester und redete ihr mit leisen Worten zu. Oddy war der einzige Angehörige, der sich zu dieser frühen Uhrzeit im Krankenzimmer aufhielt. Stella zog einen Stuhl ans Bett. Ihre Mutter hatte für ein paar Sekunden die Augen aufgemacht, als die Tochter sie mit einem Kuss begrüßte, und Stella meinte, ein Lächeln bemerkt zu haben. Dann war die Mutter in einen ruhigen Schlaf gefallen, dämmerte vor sich hin, wie die anderen Patienten auch. Stella sah den Onkel, der weiterhin die Hand ihrer Mutter hielt, neugierig von der Seite an. Sie war etwa zehn Jahre alt gewesen, als sie ihn das letzte Mal gesehen hatte. Oddy war zum Begräbnis seiner Mutter ins Elternhaus gekommen genau wie alle anderen Geschwister auch. Sie konnte sich an diese Tage erinnern, als ob es erst gestern gewesen wäre. Es war bitterkalt, im Januar auf der Peloponnes, der Wind pfiff nachts mit Geheule um die Häuser. Sie hatte Angst gehabt und war zu ihrem Bruder Georg ins Bett geschlüpft. Am Tag der Beerdigung begrüßte sie der Himmel blau und klar, und die Sonne schien. Sie stand an der Hand der Mutter am Grab, abseits von den vielen Menschen, die den Sarg der Großmutter begleitet hatten. Oddy war nach der Beerdigung zu ihnen gekommen und hatte ihr rot-weiße Zuckerstangen geschenkt.
»Hast du gut geschlafen?«, eröffnete Oddy das Gespräch. Stella strich sich eine Strähne aus der Stirn. Ihre Haare waren nachlässig zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie fing zu erzählen an, von dem morgendlichen Telefonat mit dem Rückholdienst, davon, dass heute eine Entscheidung gefällt werden musste. Beide wussten, dass es um Leben oder Tod ging. Die Nichte berichtete weiter, dass sie, bevor sie ins Zimmer gekommen war, an der Tür des Arztzimmers geklopft hatte und weggeschickt worden war. Die Krankenschwester meinte, sie solle sich bis zur Visite gedulden, sie würde die ganze Station in Aufregung versetzen mit ihren Forderungen.
»Wir schaffen das«, sagte Oddy. »Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um zu helfen.«
Ein dankbares Lächeln überzog Stellas Gesicht. Auf ihre Frage, ob er nicht zurück in die Staaten müsste, schüttelte er den Kopf. Er hatte den Rückflug bereits verschoben. Stella konnte sich denken, dass sein Terminkalender dicht gefüllt war, in einem anderen Land, in einer anderen Zeitzone. Als sie noch ein Kind war, hatte sie die Mutter gelegentlich nach der Herkunftsfamilie gefragt und ausweichende Antworten bekommen. Irgendwann, in den Anfangszeiten des Internets, hatte Stella ihre Angehörigen gegoogelt, war auf Spurensuche gegangen. Von Oddy gab es zahlreiche Meldungen. In Amerika war er ein Star, hatte seit vielen Jahren eine eigene Fernsehsendung. Er war zwar nicht so populär wie die Mitwirkenden der großen Serien, deren Einschaltquoten alle Rekorde brachen, und manche YouTuber hatten ihn lange überrundet. Er sprach ein spezielles Publikum an und nach seinen Followern auf den Social Media Plattformen zu urteilen hatte er eine riesige Fangemeinde.
Langsam füllte sich das Zimmer. Angehörige schwirrten herein, nahmen neben den Patienten Platz oder standen herum. Die Menschen schienen sich alle zu kennen, tauschten Neuigkeiten aus, sprachen über Befunde und Therapien, spendeten sich gegenseitig Trost. Der Geräuschpegel nahm zu, was die Kranken in den Betten nicht zu beeinträchtigen schien. Ganz selbstverständlich wurden Oddy und sie in die Gespräche miteinbezogen, Fragen wurden gestellt, Informationen über den Ablauf auf der Station ausgetauscht. Irgendwann war Alles besprochen und ein jeder Besucher konzentrierte sich auf den eigenen Angehörigen.
»Takis und seine Frau werden am Nachmittag kommen. Sie sind beim Anwalt«, sagte Oddy, und fügte erklärend hinzu: »Wegen des Hausverkaufs.«
Nach einer Stunde betrat der Klinikchef mit einem Team das Zimmer. Eine Aura umgab ihn, die Stella den Atem stocken ließ. Der weißhaarige Leiter des Krankenhauses machte eine unmissverständliche Geste, und alle mussten den Raum verlassen. Im Hinausgehen versuchte Stella vergeblich, Gehör zu finden. Auch aus allen anderen Zimmern strömten Besucher, angetrieben vom Personal, in einen Gang, da die gesamte Station während der Visite geschlossen wurde.
Oddy und Stella setzten sich in ein Café, das in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses lag. Die Sonne strahlte zum Fenster herein und brachte etwas von einem unbeschwerten Sommertag in den Raum. Der Kaffee schmeckte süß, und die Cremeschnitten, die sie bestellt hatten, erinnerten Stella an die Kuchen aus ihrer Kindheit. Oddy hatte Hunger. Während Stella den Anruf des Wohlfahrtsbunds beantwortete, hatte er den Kuchen aufgegessen. Stella stocherte in ihrem gedankenverloren herum, dann schob sie den Teller weg.
»Wenn wir bis zum Nachmittag keinen Arzt ans Telefon bekommen, dann schalten wir die Botschaft ein. Dann muss das Ambulanzflugzeug ohne Rücksprache mit einem Arzt geordert werden.« Sie schaute zum Fenster hinaus, den vorbeigehenden Passanten hinterher. Die Erde drehte sich weiter, als ob nichts geschehen wäre.
»Ich werde Georg kontaktieren. Ich möchte nicht die alleinige Verantwortung übernehmen. Der Transport stellt ein Risiko dar.« Sie seufzte. »Und Francis, den Lebensgefährten meiner Mutter. Er vergeht vor Sorge.«
Ein Schatten legte sich über Oddys Gesicht, für einen Moment verengten sich seine Pupillen.
»Natürlich«, sagte er. Er sah in Richtung Theke und hob die Augenbrauen. Stella nickte und suchte in der Handtasche nach dem Geldbeutel. Oddy winkte ab.
»Ich bin dein Onkel«, sagte er bestimmt. »Mach deine Tasche zu. Seit Beginn der Krise wimmelt es in der Stadt vor Dieben.«
Sie sah ihm nach, als er aufstand. Er erinnerte sie an jemanden, sein Gesicht, der Ausdruck, aber so sehr sie darüber nachdachte, sie konnte nicht sagen, an wen.
Während sie zurück zur Klinik gingen, fragte Oddy vorsichtig nach Stellas Leben. Erstaunt realisierte sie, dass der Onkel mehr von ihr wusste als umgekehrt. Über ihren Mann und die vier Kinder, auch über ihre Arbeit als Bildhauerin.
»Nächste Woche habe ich eine Ausstellung.« Sie blies die Wangen auf und schüttelte den Kopf. »Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll.« Stella verstummte. Sie wollte Oddy nicht mit ihren persönlichen Problemen behelligen. Weder mit ihrer Arbeit noch der Geschichte mit der Kuratorin, mit der sie sich während der Vorbereitungszeit überworfen hatte, da sie den Kern der Skulpturen nicht erfasst hatte, und auch nicht mit dem bevorstehenden achtzehnten Geburtstag ihrer ältesten Tochter, den sie womöglich verpassen würde.
Wieder standen sie vor dem Fahrstuhl. Die Zahl zwölf auf dem Messingschild war mit einem schwarzen Textmarker mit einer großen sechs übermalt worden. Während sie um einen Platz anstanden, fragte Oddy, in die Runde der Wartenden, nach dem Grund für diese Einschränkung.
»Letzte Woche ist ein Fahrstuhl in die Tiefe gestürzt«, antwortete ein alter Mann. »Es ist kein Geld da, weder für eine Reparatur noch für die Wartung der übrigen Kabinen. In diesem Haus fehlt es an vielen Stellen ebenso wie in den meisten anderen Krankenhäusern der Stadt.«
Der Tag verging mit Warten. Mehrfach lief Stella den Gang entlang, klopfte an die Tür, um die Ärzte an den Termin zu erinnern. Jedes Mal wurde sie von einer Sekretärin vertröstet, deren Miene wie aus Stein gemeißelt war. Am Nachmittag kam Onkel Takis mit seiner Frau zu Besuch. Er begrüßte Stella freudig, nahm sie in den Arm und drückte sie an sich, als ob sie ein Leben lang engen Kontakt gepflegt hätten. Dann schob er sie zu Anastasia, die Stella in die Wange kniff, und ihr Komplimente machte, über ihre Figur und ihre Kleidung, die sie wie ein junges Mädchen wirken ließen. Takis und Anastasia nahmen aufrichtig Anteil an dem Vorgefallenen.
»Deine Mutter hätte sofort auf eine Schlaganfalleinheit gebracht werden müssen. Aber wir wussten nicht …«, sagte Takis entschuldigend, der seine Schwester im Krankenwagen begleitet hatte. Takis sprach von einem rollierenden System, bei dem an jedem Tag ein anderes Krankenhaus in der Innenstadt angefahren wurde. Stella sah, wie ihre Mutter immer wieder die Augen öffnete, die Iris von fiebrigem Glanz überzogen. Die Krankenschwester, die in regelmäßigen Abständen im Zimmer auftauchte, maß Blutdruck und Temperatur, trug dann die Werte in Tabellen ein, kontrollierte den Tropf, der die Mutter mit Flüssigkeit versorgte, und attestierte, dass alles in Ordnung wäre. Stella fühlte Ohnmacht. Die Mutter lag vor ihr, an der Schwelle zum Tod.
Sie saßen beisammen, nur auf sich konzentriert. Eine Insel in dem großen Zimmer, das mittlerweile mit weiteren Besuchern gefüllt war. Stella hatte Takis ebenfalls bei der Beerdigung ihrer Großmutter das letzte Mal gesehen, seine Frau hingegen noch nie. Vor langer Zeit hatte sie ein Hochzeitsfoto gefunden. Das zeigte Takis in einem altmodisch geschnittenen Wollanzug, und seine Braut mit akkurat geföhnten Haaren. Sie wirkten verliebt und glücklich. Das Paar hatte sich im Laufe ihres gemeinsamen Lebens einander angeglichen. Fast sahen sie wie Geschwister aus, mit ihren kurzen, grauen Haaren, demselben herzlichen Lachen, synchron wirkenden Gesten, und ihrem breiten Englisch. Sie trugen rote Windjacken zu dunklen Jeans und weißen Hemden, was sie im Licht des Krankenzimmers wie Fremdkörper wirken ließ. Takis war hilflos beim Anblick des Leids der Schwester. Er wusste nicht, was er sagen oder tun sollte, Anastasia hingegen hatte keine Berührungsängste. Sie griff nach einem Lappen und wischte die schweißnasse Stirn der Schwägerin ab.
»Sie hat Fieber«, stellte sie fest.
Besorgt schaute Stella auf die Uhr. Bald würde der medizinische Dienst die Deutsche Botschaft einschalten. Sie wollte nicht an das Ende denken, das ihnen hier bevorstehen könnte. Noch bevor sie sich auf den Weg zum Chefarzt machte, stand er in der Tür, hinter sich zwei junge Assistenzärzte. Unerwartet freundlich trat er auf Stella zu, beantwortete geduldig ihre Fragen. In hervorragendem Englisch erklärte er, wie leid ihm der Zustand der Mutter täte, und sie alles Mögliche in Bewegung setzen würden, um ihr zu helfen, gesund zu werden. Er selbst verbürgte sich dafür, dass sie bis an ihre Grenzen gehen würden. Er schien nicht zu verstehen, warum Stella ihrer Mutter den Transport zumuten wollte.
Stella setzte ihr freundlichstes Lächeln auf. Mit blumigen Worten dankte sie ihm für die hervorragende Betreuung. Sie wisse ihre Mutter in besten Händen, nirgendwo auf der Welt würden sie eine adäquatere Behandlung bekommen, nur der Umstand, dass ihre gesamte Familie in Deutschland war, sei der Grund für die gewünschte Verlegung.
»Sie muss nach Hause«, sagte Stella. »Ich danke Ihnen aufrichtig für alles, was Sie für meine Mutter getan haben.« Der Arzt fühlte den Puls der Patientin, las in den Tabellen. Stella sagte mit sanfter Stimme: »Bitte sprechen Sie mit dem Ambulanzteam.«
Der Arzt legte die Stirn in Falten und sagte: »Ich darf keine Informationen herausgeben. Erst, wenn sie entlassen ist, bekommen Sie die Dokumentation. Das sind die Regeln.« Stella nahm ihr Handy aus der Handtasche. »Bitte«, sagte sie eindringlich, »bitte bestätigen Sie, dass meine Mutter transportfähig ist. Stellen Sie sich vor, es wäre Ihre Mutter.«
Jetzt nickte der Chefarzt verhalten und ließ sich das Telefon geben.
Mit Einbruch der Dämmerung war es im Krankenzimmer ruhiger geworden. Das Kommen und Gehen von Pflegern und Krankenschwestern unterschiedlichster Nationalitäten, die Werbung für die eigene Person machten, um sich für einen oder mehrere Tage eine Arbeit zu ergattern, hatte aufgehört. In Griechenland wurde der Patient nicht allein gelassen. Entweder saß ein Familienmitglied an seinem Bett oder eine andere Person, die sich damit Geld verdiente. Der Großteil der Besucher hatte sich verabschiedet. Nur ein oder zwei Angehörige saßen neben den einzelnen Bettstätten.
Stella hatte Oddy gefragt, ob er nicht nach Hause gehen wollte, um Kraft zu schöpfen. Er hatte verneint, dann gelächelt: »Ich habe meine Schwester so viele Jahre nicht gesehen. Wenn es für dich in Ordnung ist, bleibe ich eine Weile länger. Wenn ich an damals denke …« Seine Gedanken schienen sich in der Vergangenheit zu verlieren. Stella hatte genickt und ihrerseits die Gedanken schweifen lassen. Im Laufe der Jahre hatte sie viele Facetten ihrer Mutter kennengelernt. Sie konnte liebevoll, manchmal zärtlich sein, ihren Kindern zugewandt und grenzenlose Geduld aufbringend. In den Abendstunden arbeitend für das Geschäft, das sie sich mühevoll aufgebaut hatte. Stella sah die Mutter vor sich, wie sie beharrlich an einem Schnittmuster tüftelte, damit das Ergebnis perfekt war, und ihre Kundin in dem von ihr entworfenen Kleid eine gute Figur machte, all die Anstrengung, um ihren Kindern ein Minimum an Wohlstand zu bieten. Sogar in den schwierigen Pubertätsjahren Verständnis aufbringend, und ihrem Bruder und ihr manchen Wunsch erfüllend, wenn sie gute Zensuren nach Hause brachten, damit sie eines Tages ein leichteres Leben haben würden. Stella sah die Mutter ausgelassen auf ihrer Hochzeit, stolz auf den Schwiegersohn, den aufstrebenden Architekten, der ihre Tochter glücklich machte. Mutter tanzte mit ihrem Partner Francis, der sie begleitete, soweit Stella zurückdenken konnte. Sie dachte an Mutters Strahlen, als sie ihr erstes Enkelkind in den Armen hielt, dann umringt von weiteren Enkelkindern. In ihren Gedanken tauchte die Mutter auf, verunsichert und verstört, als Georg ihr vor zwei Jahren mitteilte, er hätte einen Forschungsauftrag angenommen, der ihn bis in die Tiefen des Amazonasgebiets führte. Sie war unermüdlich für sie da gewesen, hatte wie eine Löwin für das Wohl ihrer Kinder gekämpft. Nun lag sie hier, ein Schatten ihrer selbst. Jetzt würde Stella für die Mutter kämpfen.
Oddy stand auf. »Ich muss mich etwas bewegen. Mein Bein …«, sagte er leise. Stella blickte ihm nach, wie er aus dem Zimmer ging. Dabei setzte er sein rechtes Bein mit einer schleppenden Verzögerung auf, der Spezialschuh, der manchmal unter dem Hosenbein herausblitzte, der linke Arm, der ihm Halt zu geben schien. Als er wenige Minuten später zurückkam, wirkte Oddy dynamischer, kraftvoller. Er hatte ein verbindliches Lächeln auf dem Gesicht. Jetzt erinnerte sein Anblick an die Bilder auf seiner Fanpage. Sie musste sein Lächeln unwillkürlich erwidern. Sie war in diesem Moment unbeschreiblich froh, nicht allein hier zu sein. Oddy war bei der Erledigung der Formalitäten eine große Hilfe gewesen. Stella bereute, dass sie den Griechischunterricht häufig geschwänzt hatte und deshalb nur über Grundkenntnisse verfügte. Des Onkels bloße Anwesenheit in der für sie fremden Welt wirkte beruhigend. Es hatte sich eine unerklärliche Vertrautheit eingestellt. Seit Stunden saß sie mit einem Mann zusammen, von dem sie kaum etwas wusste, und trotzdem bestand ein Band zwischen ihnen, das sie nicht erfassen konnte. Oddy nahm wieder an der Seite seiner Schwester Platz und griff schweigsam nach ihrer Hand.
Mit zunehmender Dämmerung breitete sich die Stille weiter aus, ergriff Besitz von ihnen. Irgendwann fing Oddy zu reden an, leise, langsam.
»Stella«, sagte er, »ich bin froh, dass ich deine Mutter und dich in diesen schweren Momenten begleiten kann.« Er schien ihre Gedanken lesen zu können. Bevor Stella ihm eine Antwort geben konnte, fuhr er fort: »Es hat sich unbemerkt entwickelt. Deine Mutter wollte sich schützen. Sie hat das Band zur Familie gelockert, und irgendwann die Verbindung gekappt, um eine Freiheit zu spüren, die sie vorher nie kannte. Sie wollte sich von allen Einflüssen befreien … in eine neue Welt tauchen.«
Stella nickte. »Das mag sein. Für meinen Bruder und mich war das nicht einfach. Wurzeln haben wir nie kennengelernt. Manchmal hatte ich als Kind das Gefühl, nicht im Boden verankert zu sein.« Sie sah ihr Leben wie durch einen Nebel, der sich verdichtete und wieder auflöste, und einen Blick auf die Tage ihrer Kindheit freigab.
»Das Leben ist dazu da, die eigene Existenz in eine höhere einzuordnen und zu begreifen. Das ist kaum möglich, wenn man in der Leere verhaftet bleibt«, sagte Stella.
Oddy zog die Nase kraus. Im schwachen Licht des Zimmers wirkte er kaum älter als sie. Seine Sommersprossen verliehen ihm ein lausbubenhaftes Aussehen und die Augen waren wach. Die Aufnahmen auf seiner Fanpage schoben sich über die Realität.
»Das Verhalten deiner Mutter wirkt auf den ersten Blick egoistisch. Aber du würdest sie verstehen, wenn du ihre Geschichte kennen würdest. Vielleicht uns alle. Wir haben diesen Zustand zugelassen«, sagte er leise. »Es waren vollkommen andere Zeiten. Sie war jung. Sie musste sich irgendwann befreien. Sonst wäre sie eingegangen, wie eine Pflanze ohne Wasser.« Stellas Miene verdüsterte sich unwillkürlich.
»Ich werde ein bisschen herumlaufen. Es ist nicht immer einfach.« Oddy stand auf.
Stella wusste nicht, was er mit der Aussage meinte, als er mit schleppendem Schritt aus dem Zimmer hinausging. Das Sitzen oder die Vergangenheit?
Oddy kam mit zwei Bechern Kaffee und Sandwiches zurück. Hungrig griff Stella zu. Stunden waren vergangen, seit sie das letzte Mal etwas gegessen hatte. Bis jetzt war es ihr nicht aufgefallen. Nicht einmal, als sie auf der Straße neben der Bäckerei stand, und mit Georg über den Heimtransport gesprochen hatte, und danach Francis angerufen hatte, um seinen Segen für ihr Vorgehen zu bekommen, war ihr in den Sinn gekommen, dass ihr Körper nach Nahrung verlangen könnte. Nachdem sie sich gestärkt hatten, sagte Oddy: »Vielleicht ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich dir die Geschichte erzählen sollte, die deiner Mutter, die auch gleichzeitig die unserer Familie ist.« Er rückte näher ans Bett. Vorsichtig fuhr er über die Wange seiner Schwester, strich ihr die Haare aus der Stirne.
»Ich werde an dem Punkt anfangen, an dem die Weichen neu gestellt wurden.« Er lächelte. »Unsere Mutter, deine Großmutter, war eine mutige Frau. Sie hat damals unser Schicksal in die Hand genommen.«
Stella sah zum Fenster hinaus, das den Blick auf einen mit Müllcontainern vollgestellten Hinterhof freigab. Es war ein Anblick unbeschreiblicher Tristesse.
»Ob ich das gerade jetzt verkrafte?«
Oddy nickte und musste unwillkürlich lachen.
»Wo denkst du denn hin? Es ist keine traurige Geschichte. Es ist eine Geschichte prall voll mit Leben.«
Stella löste den Blick von den Männern, die in einem der Container nach etwas Brauchbarem wühlten. Als Stella gestern Nacht das Krankenhaus verlassen hatte, hatte sie an vielen Orten der Stadt Menschen gesehen, meist mit dunkler Hautfarbe, die sich nicht anders zu helfen wussten. Flüchtlinge waren in diesem Land besonders arm dran.
»Ob Mutter möchte, dass du mir die Geschichte erzählst?«, fragte sie. Ein weiteres Lachen ließ Oddys Grübchen am Kinn hüpfen. »Bestimmt hätte sie das gewollt. Das ist alles so lange her. Letzte Woche, als wir Geschwister beieinandersaßen, hat sie von dir und deinem Bruder erzählt. Davon, wie stolz sie auf euch ist. Sie wollte ein Treffen organisieren …« Er zog die Decke hinauf bis zum Hals und fühlte ihre Stirn.
»Sie erscheint mir nicht mehr so warm.« Er blickte auf die Armbanduhr. »In zwei Stunden kommt Elpida für die Nachtschicht. Bis dahin haben wir Zeit.« Er nahm einen Schluck aus dem Kaffeebecher.
»Ich habe im Laufe des Lebens eine Vorliebe für Philosophie entwickelt. Einer unserer größten Philosophen, Sokrates, hat einmal gesagt: Die Geschichte endet nicht mit uns. Unsere Großeltern wussten das so gut wie meine Generation. So geht es immer weiter.«
Ohne auf Stellas Antwort zu warten, fing er mit ruhiger Stimme zu erzählen an. Es kam ihr vor, als ob sie bereits bei seinen ersten Worten in eine andere Welt eintauchte, weit weg von der Farblosigkeit dieses Zimmers. Ein Strudel, der sie erfasste und in eine Welt zog, die bunt war, voll vertrauter, längst verloren geglaubter Empfindungen.
Ein rettender Besuch
PELOPONNES, AUGUST 1944
Das Bergdorf Mikro Chorio lag einsam und verlassen in der gleißenden Mittagshitze. Kein menschlicher Laut durchzog die Stille, so als ob alle Bewohner, die von unzähligen blühenden Kakteen und Feigenbäumen überwucherte Talmulde verlassen hätten. Düster ragte ein halbes Dutzend Wehrtürme über der Ebene auf, einer höher als der andere. Schattenlos standen sie in der prallen Sonne, grau wie das Gestein der umliegenden Berge, aus denen sie erbaut worden waren.
Manolis war den weiten Weg aus dem Gebirge heruntergekommen, fast zwei Tage durch Schluchten und Täler geklettert, seiner Familie entgegen, die er seit mehreren Monaten nicht mehr gesehen hatte. Er hatte diese Strapazen auf sich genommen, immer auf der Hut vor den deutschen Besatzern und vor den rivalisierenden Banden, die in den Bergen, seitdem der Bürgerkrieg im Lande schwelte, ihre Lager aufgebaut hatten. Das alles hatte er getan, um den fünfzehnten August, der einer der höchsten Feiertage war, mit seiner Frau und den Kindern feiern zu können.
Manolis hatte seinen Besuch durch niemanden ankündigen lassen, und so war die Überraschung umso größer, als Anna während der Mittagsruhe seinen wohlbekannten Pfiff hörte. Schnell sprang sie die Leitern nach unten. Dann schaute sie mit einem kurzen Blick aus dem schmalen, langen Fenster, das die Form einer Schießscharte hatte, um sich zu vergewissern, dass sie nicht nur geträumt hatte. Als sie ihren Mann im Schatten des großen Maulbeerbaums vor dem Eingangstor erkannte, machte ihr Herz einen Freudensprung. Manolis. Er war am Leben. Seit er zu den Partisanen gegangen war, betete sie darum, dass der liebe Gott ihn verschonen mochte. In manch langer Nacht hatte sie sich den Kopf zermartert, sich gefragt, ob sie ihren Mann überhaupt jemals wiedersehen würde, oder ob sie als Witwe mit vier unmündigen Kindern durchs Leben gehen müsste. Anna hatte nicht damit gerechnet, dass Manolis am Tag der »Panagia« der Heiligen Mutter Gottes, den beschwerlichen und vor allem gefährlichen Weg aus dem Gebirge herabsteigen würde, um ihn nach wenigen Stunden zurückzugehen. Manolis war stets auf Sicherheit bedacht; nie würde er sich leichtfertig einer Gefahr aussetzen, wenn es dafür keinen ernsthaften Grund gab. Und der konnte nicht nur der Feiertag sein, auch wenn er das immer wieder beteuerte, als er sie stürmisch an sich drückte.
Das Dorf war mittlerweile fast leer. Wenige Frauen hielten die Stellung – wenn sie nicht ebenfalls in die Berge, wie der Widerstand im Volksmund genannt wurde, gegangen waren. Der Hass auf die Fremdherrscher und die Politik der letzten Jahre waren schuld an diesem Leben. Die Zeiten, als die Besatzer im Lande weilten, waren unermesslich hart gewesen, aber nichts im Vergleich zu dem, was die Menschen nun erleben mussten: Rivalisierende Partisanenverbände kämpften mit Leib und Seele für ein besseres Griechenland. Die Volksbefreiungsarmee, ELAS genannt, war ein Sammelbecken der Kommunisten, Sozialisten und Liberalen auf der einen Seite, die EDES, die Nationale Republikanische Liga, die deutliche republikanische Züge aufwies, auf der anderen Seite, und gegen die Deutschen aber auch gegen jedwede Einmischung, und letztendlich sogar gegeneinander.
Der Widerstand der Bevölkerung war in Folge einer Hungersnot angestachelt worden, auf Grund der weit mehr als einhunderttausend Menschen zu Tode gekommen waren. Die beispiellose Ausbeutung des Landes durch die Italiener und Deutschen, und die Seeblockade der Alliierten, allen voran der britischen Streitkräfte, hatten die Einfuhr des dringend benötigten Getreides verhindert, in der Annahme, dass, je größer der Hunger, desto größer der Widerstand gegen die Besatzer wäre. Als die Stimmung im Lande aufgewühlter wurde, hatte Manolis sein Bündel gepackt und sich den ELAS Truppen angeschlossen. Er konnte nicht tatenlos dasitzen und die anderen alleine für ihre Freiheit kämpfen lassen. So ließ er seine junge hübsche Frau Anna mit ihren Kindern in Mikro Chorio zurück, dem Ort, an dem seine Familie seit hunderten von Jahren heimisch war. Er hatte Anna sanft übers Haar gestrichen, und gemeint, sie würde das schon schaffen: »Ich muss unser Land retten.« Anna hatte ihn zweifelnd angesehen und war aus dem Zimmer gegangen. Er sollte ihre Tränen nicht sehen. Sie wollte vor ihm keine Schwäche zeigen. Dabei hatte sie überhaupt keine Ahnung, wie sie die nächsten Monate mit den Kindern überleben sollte. Die Speisekammer war leer und die Felder verwüstet. Kalliopi, ihre Größte, war erst sechs, dann folgten Sophia mit fünf und Ioannis mit einem Jahr. Zudem war sie zu diesem Zeitpunkt hochschwanger mit Takis gewesen. Ihre kleine Tochter Voula war wenige Wochen vor Manolis’ Ankündigung mit noch nicht einmal drei Jahren in ihrem Gitterbett verstorben. Eigentlich konnte man sagen, dass auch sie ein Opfer der Hungersnot war, aber Manolis und sie beteuerten, sie wäre an einer harten Brotrinde erstickt. Anna wollte nicht an diesen traurigen Tag zurückdenken. Allein der Gedanke daran raubte ihr die Luft zum Atmen, schien jeglichen Lebenswillen in ihr abzutöten. Aber was sollte sie tun? Es musste weitergehen. Sie musste an die anderen Kinder denken. Vielleicht war dieser Vorfall neben der allgemeinen politischen Lage der eigentliche Auslöser für Manolis’ Fortgehen gewesen. Er wollte die Lebensumstände ändern, wollte verhindern, dass das Hungern weiterging und noch mehr Familien in den Abgrund riss. Sie hatten darüber gesprochen, ob sie mit ihm zusammen in die Berge gehen und die Kinder bei Verwandten lassen sollte, aber Anna hatte keine Andartissa werden wollen, wie viele der anderen Frauen. Sie hatte sich entschieden, alleine zurückzubleiben und die Familie zusammenzuhalten. »Du bist eine starke Frau«, hatte Manolis ihr beim Abschied ins Ohr geflüstert und die Tür ins Schloss gezogen.
Angst dominierte von da an Annas Leben. Nicht mehr die Blutfehden der alten Tage machten den Alltag gefährlich, Anna machte hastig ein Kreuzzeichen beim Gedanken an diesen unseligen Brauch, der auch ihr Leben über Jahre hinweg mit unglaublicher Furcht erfüllt hatte, es war noch viel schlimmer gekommen. Die deutsche Wehrmacht hatte Zeichen gesetzt, oft an Orten, wo heftiger Widerstand geleistet wurde, hatte sie die Zivilbevölkerung ausgerottet und ganze Siedlungen zerstört. Orte wie Viannos im Süden auf der Insel Kreta, Komeno im Epiros, Distomo und Kalavrita gab es nicht mehr. Sogar vor dem Kloster Agia Lávra hatten sie nicht haltgemacht. Der Pope im Dorf hatte Anna aus einer Zeitung vorgelesen, dass auch Klisoura betroffen war, der Ort ihrer Vorfahren mütterlicherseits. Manchmal wünschte sich Anna, dass sie selbst die Buchstaben aneinanderreihen und so den Sinn der auf das Papier gedruckten Worte verstehen könnte. Im Winter des vergangenen Jahres war es zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen den beiden rivalisierenden Partisanenorganisationen gekommen, man hörte von schrecklichen Übergriffen und Hinterhalten. Anna betete jeden Tag aufs Neue zu Gott, dass sie alle diese harte Zeit gesund überstehen und Manolis eines Tages heil zu ihnen zurückkommen würde.
Anna freute sich, dass sie ihn jetzt gesund und munter im Arm halten konnte. Sie hatte zur Feier des Tages ein kleines Lamm gegrillt. Seit Wochen hatte sie es ganz hinten im Stall versteckt, und die Kinder durften das süße Tier nicht einmal für ein paar Minuten aus seinem Verschlag zum Spielen holen. Fleisch war Gold wert, und man musste ständig mit einem Diebstahl rechnen. Während Manolis auf seiner Strohmatratze schlief, er war nach seiner Ankunft wie ein Stein auf das Lager gefallen, war Anna zu den Kindern gegangen, die sich nach der Mittagsruhe in den schattigen Innenhof verzogen hatten, um dort mit steinernen Murmeln zu spielen. Sie nahm ihnen das Versprechen ab, ganz ruhig zu bleiben. Aufruhr war das Letzte, was sie brauchen konnten. Wenn ein andersdenkender Nachbar mitbekommen würde, dass sich Manolis bei ihnen aufhielt, dann könnte das die allerhöchste Gefahr für sie bedeuten. Mit den Republikanern war nicht zu spaßen, natürlich nur dann, wenn man selbst der ELAS angehörte. Sonst konnten die Nachbarn die nettesten Menschen sein, wie vor dem Krieg auch. In ihren Adern floss dasselbe Blut, und mit vielen von ihnen waren sie verschwistert oder verschwägert. Aber im Moment spielte das keine Rolle. »Euer Vater ist hier«, flüsterte sie. Die Kinder blieben sitzen, den Mund offen vor Staunen. Nur Kalliopi sprang auf, warf vor Aufregung die langen Zöpfe in die Luft und hüpfte von einem Bein auf das andere.
»Bleibt er jetzt wieder für immer bei uns?« Sie dachte an die Zeiten, als das Familienoberhaupt bei ihnen gelebt und dafür gesorgt hatte, dass die Töpfe gefüllt waren. Unermüdlich war er auf die Jagd gegangen, und hatte Wachteln und Hasen mit nach Hause gebracht, oder Oktopusse oder gar Schildkröten aus dem Meer gefischt. Jetzt ging sie fast täglich mit knurrendem Magen ins Bett, da der eingeweichte Zwieback, mit dem sie sich häufig über Tage hinweg begnügen musste, nicht richtig satt machte. Anna sah die Enttäuschung, die sich in Kalliopis Augen spiegelte, als sie hörte, dass ihr Vater schon morgen zurück in sein Lager musste. Sie zog den Mund zu einer Schnute und erklärte der Mutter altklug, dass es so nicht mehr weitergehen könne. »Wir werden noch alle verhungern. Wie unsere kleine Voula.« Noch während sie auf die Mutter einredete, war der Vater in der Tür erschienen. Mit einer Größe von einemmeterachtundneunzig stieß er fast am Türrahmen an. Er war der größte Grieche, den Anna jemals gesehen hatte, und auch der Schönste mit seinen blonden Locken, den hellen, ausdrucksvollen Augen und seinem markanten Gesicht. Sie musste unweigerlich an ihre Hochzeit denken. An diesem Tag hatte sie Manolis das erste Mal von Angesicht zu Angesicht gesehen. Sie war sehr aufgewühlt gewesen, als sie neben diesem baumlangen Kerl, dem sie gerade bis zur Brust reichte, um den Altar ging. Als sie dann vor dem Priester standen, schaute sie ungläubig nach oben. Neugierig und keck, ohne versteckte Scham, die den Griechinnen oft zu eigen war, zu diesem Riesen hinauf, der ihr vor Gott angetrauter Ehemann werden sollte; bis sich endlich ein Hochzeitsgast erbarmte, einen Schemel holte, und die Braut kurzerhand auf diesen hob, so dass sie die fast zwei Stunden dauernde Litanei auf einer Höhe mit ihrem Bräutigam verfolgen konnte. Nun betrachtete sie ihn auf Augenhöhe, frei und stolz. Und auch er sah sie an, mit seinem geraden, strahlenden Blick unter den dunkelbraunen Brauen, den sie mittlerweile so sehr liebte. Als sie an jenem sonnigen Tag an seiner Seite aus der Kirche trat und sie gemeinsam die Koufeta, die Hochzeitsmandeln, verteilten, hatte sie sich glücklich und dann aufgeregt gefragt, was das Leben für sie an seiner Seite bereithielt. Auch er war mit der Wahl zufrieden, die seine Eltern für ihn getroffen hatten, mit diesem Mädchen aus dem Landesinneren, fast vier Tagesreisen von ihrem Dorf entfernt. Er hatte die Leute oft von Annas Schönheit und Anmut reden hören, und die Geschichten waren wahrlich nicht übertrieben gewesen. Unter dem zarten Schleier umschmeichelten ihre langen braunen Haare das feine Gesicht mit den leuchtend blauen Augen, in denen sich das Meer widerzuspiegeln schien, die kleine, gerade Nase und ihren vollen Mund, der rot war wie eine Blüte im Sommer. Ihre Figur war zierlich und schlank, mit einer Taille, die er, wie ihm schien, mit einer Hand umfassen konnte. Höchstens einen Meter fünfundfünfzig groß, jedoch gut proportioniert, und in ihrem langen, spitzenüberzogenen Hochzeitskleid wie eine edle Porzellanpuppe anzusehen. Darüber hatten sie oft in den letzten Jahren gesprochen. Anna schüttelte den Kopf, als wollte sie damit die Gedanken an die Vergangenheit loslassen.
Kalliopi, Sophia und Ioannis fielen dem Vater in die Arme. »Du darfst nie mehr weggehen«, murmelte Sophia. Manolis war ein lieber Vater, immer zu einem Spaß aufgelegt und nicht schnell verärgert. Er suchte die Nähe der Kinder und hielt sie nicht auf Distanz, wie es sonst in vielen griechischen Familien üblich war. Seine Frau und die Kinder waren sein Ein und Alles. Anna merkte, wie ergriffen er jetzt war. Aber trotzdem konnte er ihnen den Gefallen nicht tun. Das Wohl seines Landes stand im Moment im Vordergrund. Nur wenn er und ebenso viele andere Mitbürger für die Freiheit kämpften, konnten seine Kinder eines Tages ein sorgenfreies Leben führen.
Sie gingen hinter das Haus, zu der Feuerstelle, auf der das Lämmchen an einem Spieß über der Flamme schmorte. Anna hatte ihren greisen Vater daneben gesetzt. Sie konnte in diesen Zeiten nicht wissen, ob der ungewohnte Duft nach Gebratenem nicht Diebe aus der Nachbarschaft anlockte. Auch in der Ansiedlung mit gerade einmal achtzig Einwohnern, die fast alle denselben Nachnamen trugen, fühlte sich Anna nicht mehr sicher. Ihr Vater, der alte Sophokles, war eingenickt, sein Kopf war auf den aus Weidenholz geschnitzten Spazierstock gesunken, und sein Gesicht hatte einen träumerischen Ausdruck angenommen. Als die Kinder lachend das Lämmchen begutachteten, wurde er kurz wach und sackte dann gleich wieder in sich zusammen. Um seinen fünfundneunzigsten Geburtstag herum hatte er angefangen, immer mehr in seiner eigenen Welt zu leben. Dort war er glücklich und störte niemanden durch ständiges Nörgeln, das die Männer, die in die Jahre gekommen waren, manchmal an den Tag legten.
Für Anna war ihr Vater schon immer ein alter Mann gewesen. Sie war ein Nachzügler, das einzige Kind, das Sophokles mit seiner dritten und letzten Frau in die Welt gesetzt hatte. Der Vater war zum Zeitpunkt ihrer Geburt, sie war das achtzehnte und letzte seiner Kinder, siebzig Jahre alt gewesen. Ihr ältester Bruder war genau ein halbes Jahrhundert vor ihr geboren. Bereits als Kind kam Anna ihr Vater unermesslich betagt vor, obwohl er trotz seines Alters wettergegerbt und drahtig war, und stets seiner harten Arbeit nachging. Sie hatte schon in jungen Jahren angefangen, sich um ihn zu kümmern, und so war es bis heute geblieben. Vor fünf Jahren hatte sie ganz die Verantwortung für ihn übernommen und er war zu ihnen übergesiedelt.
Anna hatte sich zur Feier des Tages umgezogen. Sie trug ihre dicken Haare zu einem Zopf geflochten, den sie sich quer über die Stirn gebunden hatte. Über einem langen weißen Kleid trug sie eine reich bestickte und an den Ärmeln und der Mitte gefranste Dalmatika, die von Generation zu Generation weitergegeben worden war. Sie holte sie nur zu besonderen Gelegenheiten aus der Hochzeitstruhe, in der sie ihre gesamte Aussteuer hütete. Die mit Goldfäden verzierten Pantoffeln, die eigentlich zu der schönen Tracht gehörten, hatte sie gegen Nahrungsmittel eintauschen müssen, wie einige andere Wertgegenstände auch, um ihren Kindern das Überleben zu sichern. So steckten die Füße in einfachen Mokassins aus ungegerbtem Leder.
Es war ein heißer Abend. Die Hitze war drückend im Innenhof. Kein Lüftchen war zu spüren, und nichts erinnerte an die heftigen Winde des Winters, den Ostwind und den Tramontana, die böige Windströmung, die durch alle Ritzen pfiff, und vor der sich die Menschen furchtsam im Inneren der Türme und Häuser verschanzten. Manolis schaute Anna nachdenklich an, die eine Flasche mit selbstgebranntem Ouzo brachte und ihn vorsichtig in Gläser schenkte.
»Es ist eine heiße Nacht. Essen wir im Kühlen.« Anna nickte, drückte dem Vater ein Glas mit der durchsichtigen Flüssigkeit in die eine und eine Scheibe Lammfleisch auf einer Gabel in die andere Hand. Sophokles, sofort aus dem Schlaf erwacht, kippte den Schnaps in einem Zug hinunter, dann biss er genüsslich von dem Gebratenem ab, langsam mit seinen fünf verbliebenen Zähnen kauend. Anna stellte das Fleisch, ein paar Kartoffeln, Bohnen und Birnen, in einen Korb, legte einen großen bauchigen Kürbis voll mit Wein dazu, und hängte die Schätze an die Seilwinde. Manolis nahm eine Laterne und ging den Kindern voraus, in den Turm. Sie stiegen die steilen Leitern hinauf, Stockwerk um Stockwerk, bis sie vom Klettern außer Atem auf dem Dach angelangt waren, das von einer niedrigen, zinnenartigen Mauer umgeben war. Die Kinder strahlten. Noch nie hatten sie dort mit den Eltern essen dürfen.
»Man kann bis ans Ende der Welt sehen«, rief Sophia aufgeregt. Endlos erschien ihr der Blick in die Dunkelheit, nur unzählige Sterne und der riesige Mond waren über ihnen, und die Familie scheinbar ganz alleine auf der Erde, denn ihr Turmplateau war das Höchste der ganzen Gegend. Man musste aufstehen, um die anderen Turmkronen zu sehen, alle unbeleuchtet und leer im Mondlicht. Auch jetzt war niemand im Freien, die wenigen zurückgebliebenen Dorfbewohner hatten sich an diesem hohen Feiertag in ihre Häuser zurückgezogen. Es gab keinen Lauf durchs Dorf und auch keine Kirmes, wie sonst an diesem Tag in ganz Griechenland. Es waren seltsame Zeiten, geprägt von Hass und Fanatismus, die Freunde und Verwandte zu Feinden werden ließen.
Manolis zog den Korb mit der Seilwinde nach oben, anschließend folgten Stühle und ein kleiner Zinktisch. Kurze Rufe schallten durch die Nacht, dann drückte Anna ihren Vater auf sein Lager aus Reisig, packte den winzigen Takis an ihre Brust und stieg behände wie eine Bergziege die Leiter nach oben, dem auf einmal fröhlichem Gelächter ihrer Familie entgegen, welches sie während der letzten Monate vermisst hatte.
Als Manolis sich am nächsten Tag in der Morgendämmerung von Anna mit nicht enden wollenden Umarmungen und Liebesschwüren verabschiedete, wurde er plötzlich ernst.
»Du musst von hier weggehen, Anna. Es ist ein Angriff auf das Tal geplant. Schon in den nächsten Tagen.« Anna schaute Manolis verständnislos an. »Sie werden euch alle umbringen. Geh nach Athen. Bitte. Dort seid ihr sicher. Ich werde dich nach unserem Sieg finden.« Sie runzelte die Stirn. Er konnte doch nicht allen Ernstes annehmen, dass sie alleine mit den Kindern und dem alten Vater den weiten Weg bewältigen konnte. Sie würden Monate brauchen. Ihr Stall war leer, kein Pferd oder Esel konnte ihren Wagen ziehen, und an die Gefahren gar nicht zu denken.
»Du bist verrückt, Manolis. So weit kann keine Frau alleine mit ihren Kindern und einem Greis gehen. Und auch wenn … hier ist mein Zuhause.« Manolis nickte ernst. »Ich kann dich gut verstehen. Es ist auch mein Zuhause. Seit Generationen hat meine Familie in diesem Dorf gewohnt. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr.«
Er hatte sein Leben aufs Spiel gesetzt, um seine Familie vor dem wahrscheinlichen Tod zu bewahren. Das also war der eigentliche Grund seines Besuchs gewesen.
Warten auf den Angriff
PELEPONNES, AUGUST 1944
Die Warnung hatte Anna in Unruhe versetzt. Würden die Anhänger der EDES ihr Dorf dem Erdboden gleichmachen und Frauen, Kinder und Alte töten? Die eigenen Landsleute umbringen, weil sie einer anderen Ideologie folgten? Anna konnte und wollte sich so etwas Grausames nicht vorstellen. Das waren Griechen, ihr Volk, ihr Fleisch und Blut. Das waren keine Feinde, nicht Italiener, Deutsche oder Fremde. Anna hielt diese insgeheim für Barbaren, die sie und ihre Landsleute nicht verstanden. Manolis hatte sie unergründlich angeschaut, als sie ihn mit Fragen bestürmte, und vor sich hingemurmelt, dass das jetzt nicht mehr zählte. Und keine Partei wäre im Hinblick auf die momentan durchgeführten Übergriffe besser als die andere. Die Leute von der ELAS’ hatten vor Tagen auf der anderen Seite des Taygetosgebirges ein Dorf verwüstet. Es wurde gemunkelt, dass der Angriff eine Vergeltungsmaßnahme war. Zudem gab es Banditengruppen, die ebenfalls für Überfälle verantwortlich waren. Anna dachte an den Vater und erinnerte sich an Manolis’ Worte, kurz bevor er ging: »Beim ersten Anzeichen eines Angriffs musst du fliehen. Auf der Stelle. Du musst euch in Sicherheit bringen. Versprich es mir!«
»Und mein Vater? Ich kann ihn nicht mitnehmen.«
Manolis sagte: »Du musst ihn alleine lassen. Er hat sein Leben gelebt. Denk an unsere Söhne und Töchter.«
Wenige Stunden nachdem Manolis sich auf den Weg zurück zur Einheit gemacht hatte, kam ein Freund mit einem Eselskarren und lud den Vater aufs Gefährt, sein leises Lamentieren ignorierend. Der alte Mann verstand nicht, warum er seine gewohnte Umgebung verlassen sollte. Der Besitzer des Karrens ließ sich nicht abbringen, schließlich hatte er erst einen Teil des großzügigen Obolus für die Arbeit erhalten, den Rest würde er bei Sophokles’ Eintreffen am Ziel bekommen. Manolis hatte ihn geschickt, denn Annas Mann wusste genau, dass sie es nicht übers Herz bringen würde, den Vater zurückzulassen.
Anna drückte des Vaters Hand. Sie fühlte sich wie hauchdünnes Pergament an, unendliche Jahre alt, aus einer anderen Zeit. Jetzt lachte er sein zahnloses Lachen. Würde sie ihn jemals wiedersehen? Mit Tränen in den Augen winkte sie dem Karren hinterher, bis er nicht mehr in Sichtweite war. Ständig ging ihr der Gedanke durch den Sinn: Warum sollten die Republikaner gerade ihr Dorf angreifen? Es gab unzählige Ansammlungen von Häusern in diesem Tal. Vielleicht hatte Manolis sich getäuscht? Sie verdrängte die aufsteigende Angst. Das Leben ging weiter. Sie musste ihre hungrigen Kinder versorgen und das Verlassen der Heimat vorbereiten.
So vergingen die folgenden Tage mit schwerer Arbeit. Anna legte Birnen ein und backte Paximadi, den würzigen Zwieback, der nicht nur ihr einziges Grundnahrungsmittel geworden war, sondern sich auch zum Mitnehmen auf der Flucht eignete. Einen Sack hatte sie vollgemacht und in der Speisekammer beiseite gehängt. Das Wasser war im Hochsommer fast ganz zur Neige gegangen. Die Zisternen waren bei den hohen Temperaturen ausgetrocknet, und die Kinder verlangten weinerlich nach Flüssigkeit. Im nahen Umkreis waren alle Brunnen versiegt. Bis zu einem der kleinen Rinnsale, die im August langsam aus den Felsen plätscherten, war es ein weiter Weg. Anna wusste, dass sie eine Flucht nur mit ausreichend Wasser überleben würden.
Früh am Morgen zog sie mit ihrer Tochter Kalliopi los. Große Fässer auf dem Rücken geschultert kletterten sie über Felsbrocken, dem Gebirge entgegen. Als sie nach knapp drei Stunden an der Quelle angekommen waren, sah Anna den Bach, der träge über das Gestein lief. Nachdem sie das erste Fass in Position gebracht hatten, setzten sie sich in den Schatten der hohen Zypressenbäume. Kalliopi wollte alles über die Ziele und Pläne ihres Vaters wissen. Obwohl sie sein Ansinnen verstand, zu helfen, ihr Land für sie alle zum Besseren zu wandeln, machten ihr die Gefahren, die ihrer aller Leben verändert hatten, schwer zu schaffen. Das Mädchen seufzte tief: »Wenn Vater noch bei uns wäre, würde es uns trotz allem vielleicht besser ergehen.« Sie sah zur Mutter auf und besann sich. »Das Wohl der Allgemeinheit steht vor dem Wohl des Einzelnen«, sagte sie altklug. Diesen Satz hatte sie von klein auf in ihrem gesamten Umfeld immer wieder gehört. Laut rief sie aus: »Wenn ich alt genug bin, werde ich auch eine Andartissa. Dann werde ich in die Berge gehen, wie eine Amazone, und werde für eine gerechte Welt kämpfen. Genauso, wie das Vater macht.«
In der Ferne sah Anna bekannte Gestalten. Eleni, die Frau von Stavros, eines Cousins und Wegbegleiters ihres Mannes, kam mit ihrem Sohn Franziskus den steilen Weg zur Quelle emporgestiegen, ebenfalls mit Gefäßen auf dem Rücken. Die Familie wohnte im Nachbarort Aeropolis, der größten Stadt der westlichen Peloponnes. Auch dort war die Wasserversorgung in den Sommermonaten nicht besser als in den umliegenden Dörfern. Die Neuankömmlinge gesellten sich zu ihnen in den Schatten. Eleni machte kein Geheimnis aus ihren Sorgen, die ihr mittlerweile den Schlaf raubten. Sie hatte seit Monaten kein Lebenszeichen von ihrem Mann erhalten, der sich wie Manolis derselben Einheit der Partisanen angeschlossen hatte. Die Männer hatten von Kindesbeinen an viel Zeit miteinander verbracht, gemeinsam die Ziegen der Familien gehütet und waren tagelang umhergestromert, hatten Hasen mit der Flinte geschossen und im Meer Fische mit einem langen Speer gefangen. Als die Freunde älter wurden, hatten sie gemeinsam heimlich die erste Zigarette geraucht, und alle politischen Ereignisse, die das Land aufgewühlt hatten, lautstark diskutiert. Am Ende der heftigen Debatten waren sie immer einer Meinung gewesen. Kein Blatt passte zwischen sie, Brüder im Geiste, wie Stavros bei jeder Gelegenheit beteuerte. Die Tatsache, dass Manolis vom Vater zum Studium der Ingenieurwissenschaften ins weit entfernte Athen auf die Universität geschickt worden war, während Stavros in der Mani blieb, um weiterhin die Eltern zu unterstützen, hatte der Freundschaft keinen Abbruch getan. Nach Manolis’ Rückkehr entwickelte sich beider Leben in eine nahezu übereinstimmende Richtung. Sie hatten fast zur selben Zeit geheiratet, und die Frauen waren von einem ähnlichen Typ, die alsbald selbst Freundinnen geworden waren.
Kalliopi konnte die Neuigkeiten nicht bei sich behalten. »Vater war da. Am Tag der Panagia«, sprudelte es aus ihr heraus. Fragend schaute Eleni Anna an. Hatte Manolis wirklich den weiten und gefährlichen Weg auf sich genommen? Das Gebirgsgebiet war zwar überwiegend in der Hand der Andarten, aber sie hatten sich, so wurde gemunkelt, mittlerweile in rivalisierende Fraktionen gespalten, von denen jede die Vorherrschaft für sich beanspruchte. Anna nickte bestätigend.
»Manolis wollte mich und die Kinder sehen.«
»Hat er etwas über Stavros erzählt? Geht es ihm gut?«, fragte die Freundin aufgeregt. Anna musste sie enttäuschen. Er hatte ihn mit keiner Silbe erwähnt. Anna erzählte, dass Manolis lustig, geradezu albern mit den Kindern gewesen war, und zärtlich, wenn sie alleine waren. Doch er hatte keinerlei konkrete Informationen gegeben. Auf alle Fragen hatte er ihr seinen Finger auf die Lippen gelegt und beteuert, dass er sie nicht in Gefahr bringen wolle. Mit leiser Stimme, damit die Kinder, die lauschend neben ihnen saßen, nicht alles mitbekamen, sagte Anna weiter: »Du weißt, was das bedeutet. Es gibt nichts Neues. Sie bringen immer noch Männer nach Ägypten. Für die geplante Übergangsregierung.«
Eleni seufzte. »Dann lauern wenigstens keine unbekannten Gefahren auf sie. Auf diesen Wegen haben sie die jüdischen Flüchtlinge nach Palästina geschleust.«
Anna bekreuzigte sich hastig bei dem Gedanken. Fast alle Griechen hatten überhaupt kein Verständnis für die Judenverfolgungen der SS gehabt. Es hatte sich schnell im Land herumgesprochen, wie reibungslos grausam die Deportation der jüdischen Bevölkerung aus Thessaloniki in deutsche Vernichtungslager funktioniert hatte. Etwa fünfzigtausend Menschen waren plötzlich verschwunden. Das machte gut ein Fünftel der Bevölkerung der thessalischen Stadt aus. Die orthodoxe Kirche hatte heftig gegen dieses unglaublich barbarische Vorgehen protestiert, ebenso die Vasallenregierung in Athen, und sogar die deutsche Botschaft. Eleni bekreuzigte sich. Sie hatten alle nicht das kleinste Problem mit den Juden. Kein einziger Grieche, den sie kannten, war ein Antisemit. Viele griechische Geschäftsleute schmeichelten sich damit, sogar den geschäftstüchtigsten Juden übers Ohr zu hauen. Die Juden waren ein beliebter Teil der Bevölkerung, umgängliche, friedliche, gebildete Menschen, und Thessaloniki galt als »Mutter Israels«. Die Frauen hatten verstanden, dass die ELAS und damit ihre Männer der jüdischen Bevölkerung zur Flucht verhelfen mussten, auch wenn das ein gewisses Risiko mit sich brachte. Sie konnten schließlich nicht herzlos sein.
Anna schickte Kalliopi zur Quelle, das Fass zu wechseln. Jedes einzelne durfte nicht zu voll werden, denn sonst konnten sie die schwere Last nicht bis nach Hause tragen. Das traf vor allem für Kalliopis deutlich kleineres Behältnis zu. Eleni machte dem Sohn ein Zeichen, dass er dem Mädchen zur Hand gehen sollte. Als die Kinder außer Reichweite waren, raunte Eleni Anna zu, dass sie große Angst hätte, weil im Moment unzählige Vergeltungsschläge durchgeführt wurden.
»Die Deutschen bekämpfen die Banden und haben mehrere Dörfer dem Erdboden gleichgemacht. Und die Banden haben heftige Auseinandersetzungen. Ich weiß nicht, wer das geschürt hat.« Eleni seufzte. »Wie die Kindsköpfe. Früher waren sie Freunde, und heute gibt es Republikaner und Kommunisten … so unermesslich viel Gewalt …«
Anna gab ihr recht. Aber sie wusste, dass es um eine bessere Welt ging, Manolis hatte es ihr oft genug zu verstehen gegeben. Eleni senkte die Stimme. »Auf der anderen Seite des Taygetosgebirges haben unsere Leute ein ganzes Dorf verwüstet. Ich weiß es vom Popen … jetzt wollen sie sich rächen. Ich bete zu Gott, dass es nicht in Aeropolis ist.« Sie schloss die Augen und bekreuzigte sich dreimal.
»Das einzige Gute ist, dass Stavros in den Bergen keine Dummheiten anstellen kann.«
Anna wollte nicht wissen, was die Freundin mit der Aussage meinte. Sie hatte im Dorf allerlei Gerede gehört. Anna berichtete von Manolis’ Warnung, von der Aufforderung, sich mit den Kindern auf den Weg zu machen. Düster saßen die Frauen beisammen.
»Ich will nicht weg. Das Dorf ist meine Heimat«, sagte Anna traurig. »Was soll ich in Athen? Mikro Chorio ist mein Zuhause, auch wenn das Leben anstrengend ist.«
Eleni schüttelte den Kopf. »Das hilft alles nichts. Wir wollen nicht gehen, weil der Alltag mühsam ist. Wir gehen, wenn die Gefahr besteht, dass unsere Familien brutal ausgerottet werden.« Sie atmete tief ein. »Die Bündel sind gepackt. Ich werde flüchten, wenn die Antikommunisten vor unserer Tür stehen.«
Auf dem Weg nach Hause war Anna schweigsam. Kalliopi, die ihre Mutter nie so still erlebt hatte, bekam Angst. Hatte Eleni etwas über ihren Vater erzählt? Ist er heil zurück in sein Lager gekommen? Anna beruhigte das hochaufgeschossene, dünne Mädchen, das die schwere Last klaglos durch den heißer werdenden Vormittag trug.
»Deinem Vater geht es gut. Mach dir keine Sorgen. Es kann sein, dass wir …« Anna verstummte abrupt. Sie brachte es nicht übers Herz, die Tochter zu beunruhigen. Die Kleine hatte keine sorglose, fröhliche Kindheit gehabt, so wie Anna es sich für das Mädchen gewünscht hätte. Kalliopi war bereit zu helfen und mit ihren jungen Jahren Verantwortung zu übernehmen, war ihr selbst in der größten Not eine Stütze. Kalliopi steckte ihre Bedürfnisse zurück, damit es den jüngeren Geschwistern an nichts fehlte. Anna wollte ihr nicht zusätzlich Sorgen bereiten. Vielleicht zerschlugen sich die düsteren Prognosen, und der Angriff würde an einem anderen Ort oder womöglich gar nicht stattfinden. In Aeropolis, wie Eleni befürchtete, oder weiter entfernt. Seit Manolis’ Warnung waren drei Tage vergangen und noch war alles ruhig. Kalliopi schaute die Mutter mit großen Augen an.
»Was ist mit uns?«, fragte sie angsterfüllt. Anna redete eindringlich auf sie ein, so als ob sie sich selbst die Worte glauben machen musste.
»Mach dir keine Sorgen. Bald sind wir alle wieder zusammen und dein Vater muss nie mehr kämpfen.«
Nachdem in der Küche das Wasser in alle Krüge verteilt und der Rest in die Zisterne gekippt worden war, ging Anna ins Schlafzimmer. Sie schaute aus dem vergitterten Fenster. Friedlich lag die Ebene in der Nachmittagssonne, nur das Zirpen der Zikaden war zu hören. Einer Fata Morgana gleich lag das Meer in der Ferne, klar und doch entrückt, so, als ob Anna es niemals mehr erreichen konnte. Wie lange war es her, dass sie mit den Kindern in den Wellen gebadet hatten? Wie sehr hatten Kalliopi und Sophia gejauchzt und von dem kühlen Nass nicht genug bekommen? Damals waren die beiden Schwestern auf der Welt gewesen. Anna hatte noch nicht geahnt, wie groß die Familie werden würde. Nach jenem Sommer hatten sie nicht mehr den Mut aufgebracht, an den mehr als fünf Kilometer entfernten Strand zu gehen. Überall lauerten Gefahren, Italiener, Deutsche, Barbaren und die eigenen Landsleute. Manolis hatte recht. Sie musste sich bereitmachen. Die Sachen packen und die Kinder in Sicherheit bringen, von ihrem Zuhause flüchten, wenn die EDES-Anhänger das Dorf stürmen sollten.