
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: VAJOSH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Sie nennen mich Black Dahlia, aber wissen nicht, wer ich bin. Sie glauben, mich zu fassen, und schauen nicht richtig hin. Sie sehen nur die Toten, doch die schweigen wie ein Grab, und die Wahrheit bleibt verborgen, in dem Geheimnis, das ich hab'. Ich rieche, schmecke, spüre sie, die Angst, die sie umgibt. Und wenn sie schwarze Blüten sehen, dann ist es längst zu spät.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Aileen Dawe
BLACK DAHLIA
– WAHRHEIT IST, WAS DU GLAUBST –
Impressum
BLACK DAHLIA
– WAHRHEIT IST, WAS DU GLAUBST –
© 2025 VAJOSH Verlag GmbH
Druck und Verarbeitung:
FINIDR, s.r.o.
Lípová 1965
737 01 Český Těšín
Czech Republic
Lektorat: Sandy Brandt
Korrektorat: Désirée Kläschen und Susann Chemnitzer
Umschlaggestaltung: Stefanie Saw
Satz: VAJOSH Verlag GmbH,
unter Verwendung von Canva
VAJOSH Verlag GmbH
Carl-Wilhelm-Koch-Str. 3
08606 Oelsnitz
Teil der SCHÖCHE Verlagsgruppe
Jede Geschichte hat zwei Seiten.
Welche davon wahr ist, spielt für einen selbst oft keine Rolle.
Die Frage ist nur, welcher Seite man glaubt.
Eine Geschichte, zwei Möglichkeiten
Es gab einmal dieses Kinderbuch, bei dem ich zwischen zwei Enden entscheiden musste. Entweder wählte ich das Happy End oder die traurige Realität.
Ich stelle dich ebenfalls vor die Wahl: Willst du die Geschichte in chronologischer Reihenfolge erleben – oder wagst du es, dich auf die Reise einzulassen, die ich für dich vorgesehen habe?
Die Entscheidung liegt bei dir.
Contentnote
Dieser Roman sollte nur gelesen werden, wenn man sich emotional von folgenden Themen distanzieren kann:
Sexueller Missbrauch und Vergewaltigung.
Es gab viele Dinge, die mir nachgesagt wurden, und man hatte mir noch mehr Bezeichnungen gegeben, die ich nicht ausstehen konnte. Abschaum. Ein skrupelloses Monster, das wahllos tötete.
Aber Black Dahlia … dieser Name gefiel mir.
So schön wie eine Blume, das Herz so dunkel wie die Nacht. Schwarzes Blut, das wie Tinte durch meine Adern floss.
Zaghaft strich ich über die Blüte. Selbst durch die Handschuhe spürte ich die Weichheit, die sich gegen meine Fingerspitzen schmiegte, und ich konnte nicht widerstehen. Sanft zog ich daran, bis sich die Blüte von der Mitte löste.
Das erste Blatt kommt aufs Herz.
Ein Herz, das nicht mehr schlug. Es musste vor ein paar Minuten aufgehört haben, denn das Gift hatte nicht nur ihren Körper gelähmt, sondern auch ihr Gesicht eingefroren. Bestürzung und Schock starrten mir aus leblosen, hellblauen Augen entgegen, ein ersticktes Keuchen lag auf ihren Lippen. Auf ihrer Stirn schimmerte der kalte Schweiß, doch auch dieser würde bald auf ihrer Haut auskühlen. Versteinert in einer Ewigkeit, die ich für sie vorherbestimmt hatte.
Das zweite Blatt kommt auf den Bauch.
Ein Energiespeicher, den niemand mehr aufladen würde. Sie hatte es mir zu leicht gemacht, weil ich genau wusste, was sie mochte. Wir waren ein paarmal miteinander essen gewesen, bis sie mir sagte, dass wir nicht harmonierten.
Das dritte Blatt kommt in die Hand.
Eine Hand, die nicht mehr graben würde. Eine, die mich weggeschlagen hatte, als wäre ich eine lästige Fliege. Nur kamen Fliegen immer zurück, wenn es sich lohnte.
Und bald würde sie von ihnen umgeben sein.
Drei Blütenblätter auf dem Körper, die restlichen rundherum, summte ich und verteilte die samtenen Blätter auf der weißen Bettwäsche.
Schön. So schön.
Und so gefährlich, flüsterte sie mir zu. Die Dahlie hatte schon früh angefangen, mit mir zu reden, hatte sich von mir gewünscht, dass ich sie mir zu eigen machte.
Ja, vielleicht hatte sie sogar darum gebettelt.
Ich liebte dieses Betteln.
Behutsam zupfte ich die Decke zurecht, die ihr bis zum Kinn reichte, und nahm die nächste Dahlie zur Hand. Keine Spuren hinterlassen, bis auf die eine, die ich zog.
Eine Blüte. Zwei. Drei, vier … Zehn.
An der Kommode hielt ich inne. Das Polaroid, das dort lag, war bereits vollkommen sichtbar – und mir gefiel, was ich darauf sah.
Dich, verewigt in einem Album, mit der Erkenntnis in den Augen, dass du nicht vor deinem Schicksal fliehen konntest.
Erinnerungen, die ich brauchte, um nicht zu vergessen, warum ich tat, was ich tat.
Ich schob das Polaroid in meine Hosentasche und bahnte mir rückwärts einen Weg aus dem Schlafzimmer. Eben noch hatte ich neben ihr gelegen, aber jeder schöne Moment hatte irgendwann ein Ende. Ich hatte von Anfang an gewusst, dass ich ihres sein würde.
Töte, flüsterte die Dahlie mir immer wieder zu. Töte, und du bist frei.
Wieder strich ich über ein Blütenblatt, ehe ich einen letzten Blick auf das blonde Haar warf, das ihr Gesicht wie einen Heiligenschein umrahmte. Sie war keine Heilige.
Sie würde in der Hölle schmoren.
Gefährlich, flüsterte mir die Dahlie zu.
Ja, du bist gefährlich.
Ich riss das letzte Blütenblatt ab und ließ es auf die Schwelle fallen, ehe ich die Tür mit einem leisen Klicken schloss. Der Moment, in dem sie verstanden hatte, war der schönste von allen gewesen. Die Gewissheit, dass ihr Ende nahte, und die Resignation, weil sie sich nicht wehren konnte. Früher war ich ihre Marionette gewesen.
Ich lächelte.
Jetzt bist du meine.
Ich bin kein Mörder.
»Im Namen der Vereinigten Staaten Amerikas haben die Geschworenen entschieden.«
Ich habe sie nicht umgebracht.
»Nach genauer Untersuchung aller vorliegenden Beweise und der Zeugenaussagen wird Cyrus Whitmore …«
Genau das hätte ich sagen sollen. Hätte widersprechen und irgendetwas tun müssen, um dieses Urteil abzuwenden, das unausweichlich folgen würde.
»… in allen Anklagepunkten …«
Stattdessen saß ich dem Richter gegenüber, hörte hinter mir ein leises Wimmern, das von Mom stammen musste. Ich erkannte es an der Art, wie sie versuchte, es zurückzuhalten.
»… für schuldig befunden.«
Nicht zum ersten Mal.
Ich bin ein Wiederholungstäter.
»Die Dauer seiner Strafe beläuft sich auf hundertdreiundsechzig Jahre im Blackridge Penitentiary …«
Ein Monster.
»… und ist sofort anzutreten.«
Aber kein Mörder.
Der Hammerschlag folgte, ein lautes Schluchzen hallte durch den Gerichtssaal und Gemurmel entstand. In meinem Rücken wurde es laut, die Anwesenden standen auf und kehrten dieser Verhandlung den Rücken zu. Sie würden ihrem Alltag nachgehen, während ich –
»Mr. Whitmore«, ertönte die Stimme meines Pflichtverteidigers. »Es tut mir sehr leid, dass ich nicht mehr für Sie tun konnte.«
… einsitzen würde. In einem Hochsicherheitsgefängnis.
Früher hatte ich mich immer gefragt, was in den Menschen vorging, sobald sie so ein Urteil erhielten. Die Antwort lautete: alles und nichts auf einmal.
Eine explosive Mischung aus Wut und Unverständnis, Terror und Hilflosigkeit, die mich an eine Zukunft banden, von der ich mich nie wieder befreien könnte.
Hundertdreiundsechzig Jahre.
Wut kochte in mir hoch wie erhitztes Wasser und verdrängte alles andere, weil jeder in diesem Raum wusste, dass ich höchstens fünfzig davon absitzen würde. Gefolgt von Unverständnis, weil ich nicht glauben konnte, dass jeder nur das gehört hatte, was er hatte hören wollen, statt das zu hören, was sie hätten hören sollen. Terror, weil ich nicht zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden konnte, und Hilflosigkeit, weil …
Weil ich nichts dagegen ausrichten konnte.
Meine Zukunft lag in fremden Händen, die mich hinter Gitter zerren würden, und ich … Ich war machtlos. Meine Augen brannten, ein Kloß bildete sich in meinem Hals.
Nein.
Ich durfte nicht weinen, ich durfte nicht, durfte nicht, ich –
… bekam keine Luft.
Unsanft wurde ich auf die Beine gerissen. Ich wollte mich umdrehen, all den Anwesenden sagen, dass das nicht die Wahrheit war.
Niemand wird sie hören, denn ich bleibe stumm, werd’ niemals gestehen, was ich tat und warum.
Die scharfe Reue schnitt mir in die Haut und machte mich bewegungsunfähig.
Ich bin kein Mörder.
Ich bin kein Mörder.
Ich bin kein Mörder.
Zumindest hoffte ich das.
Mordserie erschüttert Oakshade,
New Orleans
– Black Dahlia bettet Opfer wie in einen Sarg
Die Behörden sind in Alarmbereitschaft: Eine Serie skurriler Morde in Oakshade und Umgebung hält die Polizei in Atem. Bisher wurden sechs Menschen tot in ihren Wohnungen gefunden, sorgfältig und grotesk in ihren Betten hergerichtet, als lägen sie in einem Grab.
Mysteriöse Inszenierung am Tatort
Die Details sind beunruhigend. Jedes Opfer wurde in seinem eigenen Bett gefunden, die Decken sorgsam über den Körper gelegt und Blütenblätter darauf verteilt, die auf eine bizarre Weise an Trauerkränze auf einem Grab erinnern. Ein makaberer Abschiedsgruß – oder doch ein düsterer Vorbote?
Psychologisches Profil des Täters
Aufgrund seiner Inszenierung und der wiederholten Verwendung von schwarzen Blütenblättern wird der Täter als Black Dahlia bezeichnet. Die Polizei sieht sich mit vielen offenen Fragen konfrontiert und beschreibt die Art der Bestattung als beängstigend liebevoll, fast schon wie eine Hommage an den Verstorbenen. Dennoch tappen die ermittelnden Beamten und Kriminalpsychologen bisher im Dunkeln, was das Motiv des Täters betrifft. Die Auswahl seiner Opfer erscheint willkürlich, denn es handelt sich um Männer und Frauen unterschiedlichen Alters, Standes und Berufs. Eine offensichtliche Verbindung untereinander bestünde nicht, so Michael Turner, leitender Detective der dafür eingerichteten Sonderkommission. Er gehe aber davon aus, dass der Täter einen besonders ausgeprägten Wunsch nach Kontrolle hege – im Leben und darüber hinaus. »Solche arrangierten Tatorte deuten darauf hin, dass der Täter eine tief sitzende Bindung zu seinen Opfern herstellt – oder er will uns genau das glauben lassen«, erklärt Kriminalpsychologin Dr. Laura Peterson. »Es wirkt, als wolle er diese Menschen ›zu Grabe tragen‹ und auf eine Art Abschied nehmen.«
Die Polizei arbeitet mit Hochdruck an diesen Fällen und versichert, dass der Aufklärung dieser Mordserie höchste Priorität gilt. Sie rät zur Vorsicht und bittet die Bevölkerung, verdächtige Personen oder ungewöhnliche Aktivitäten umgehend zu melden.
Ein Jahr zuvor
Black Dahlia bettet Opfer wie in einen Sarg, las ich die Schlagzeile, die fast die komplette obere Hälfte der Zeitung einnahm. Die Behörden sind in Alarmbereitschaft.
Ich unterdrückte den Drang, mir über die Stirn zu reiben und die Schläfen zu massieren. Allein die Überschrift bereitete mir Kopfschmerzen, weshalb ich gar nicht erst weiterlesen sollte. Trotzdem wusste ich, dass ich nicht aufhören würde – schließlich gehörte das in gewisser Weise zu meinem Job.
Als Bewährungshelferin musste ich nicht nur auf jedes erdenkliche Szenario vorbereitet sein, sondern die Absicht finden, die sich dahinter verbarg. Im Leben wurde man so oft vor vollendete Tatsachen gestellt, dass sich niemand mehr zu fragen traute, warum es überhaupt dazu kommen musste.
Genau dafür fühlte ich mich verantwortlich. Für das Zwischen-den-Zeilen-Lesen.
Die Details sind beunruhigend.
Ein Schatten verdeckte das Licht, so sehr, dass die kleinen Buchstaben vor meinen Augen verschwammen.
»Black Dahlia«, hauchte mir eine dunkle Stimme über die Schulter, von der ich eine Gänsehaut bekam. Der vertraute Duft nach Orangenblüte drang in meine Nase, vermischt mit einer herben Zedernholznote. »Hast du schon herausgefunden, wer das nächste Opfer sein wird?«
»Evren«, murmelte ich genervt und drehte mich weg, um den Artikel ins Licht zu halten. »Ich kann nichts sehen.«
Schon im nächsten Moment verschwand die Zeitung ganz aus meiner Hand. »Glaubst du etwa an diesen Quatsch?«
»Dieser Quatsch ist bitterer Ernst«, erwiderte ich und versuchte, ihm die Zeitung zu entwenden, doch er hielt sie absichtlich außer Reichweite.
»Oakshade liegt vor New Orleans, Nika. Die Kriminalitätsrate ist hier so hoch wie nirgendwo sonst.«
»Ein Grund mehr, um sich Sorgen zu machen.«
»Hast du Angst?« Evren legte die Zeitung zur Seite und trat näher. Bernsteinfarbene Augen verweilten einen Moment länger auf meinen Lippen, als sie sollten, und hinterließen ein Kribbeln, das ich nicht zu ignorieren schaffte.
Im Gegenteil, denn jetzt musste ich auch auf seinen Mund sehen. »Hast du keine?«
Dieser verfluchte Mund, der sich zu einem wissenden Lächeln verzog. »Nein.«
»Selbst wenn er die hätte, würde er das ganz sicher nicht zugeben«, schaltete sich Cansu ein und löschte die Glut, die sich mit nur einem einzigen Funken entfacht hatte. Meine beste Freundin stellte die Einkaufstüte auf die Kochinsel und richtete ihren hohen Zopf, aus dem sich mehrere schwarze Strähnen gelöst hatten. »Oder, Bruderherz?«
Evren grinste. »Schuldig im Sinne der Anklage.«
Cansu hob vielsagend die Brauen, was ich als ein Ich-hab’s-dir-ja-gesagt deutete, und fing an, den Einkauf auszupacken.
»Das ist doch alles nur ein Hochschaukeln der Medien. Die Polizei ist ein Witz und irgendetwas muss die Leute ja in Schach halten. Warum sonst taucht nach einem halben Jahr wieder ein Bericht in der Zeitung auf, obwohl gar nichts passiert ist?«
»Weil sechs ungeklärte Morde auch gar nichts sind«, kommentierte ich.
»Ausnahmsweise muss ich Evren zustimmen: Wir wohnen vor New Orleans, Nika. Dort wird täglich jemand auf offener Straße ermordet.«
»Bin ich wirklich die Einzige von uns dreien, die das ernst nimmt?« Ich konnte nicht glauben, dass ich diese Frage wirklich stellen musste.
»Ein bisschen zu ernst, wenn du mich fragst«, erwiderte sie. »Eigentlich müsstest du doch diejenige sein, die uns beruhigt. Du solltest abgehärtet sein, schließlich hast du täglich mit solchen Leuten zu tun.«
»Straftäter, Cansu. Solche Leute heißen Straftäter.«
»Straftäter, Kriminelle, Verbrecher – egal, wie du sie nennen möchtest, beschönigen tut das die Sache ganz sicher nicht.« Cansu klatschte eine Packung Backschokolade auf den Tisch und untermalte damit ihren Standpunkt.
»Tief sitzende Bindung«, schnaubte Evren, der die Arme auf die Kücheninsel gestützt hatte und über der Zeitung hing. Sein schwarzes Haar fiel ihm dabei in die Stirn, und obwohl er zwei Jahre älter war als seine Schwester, sah man ihre Ähnlichkeit deutlich. »Kriminalpsychologin müsste man sein.«
Cansu verzog das Gesicht. »Hast du Fieber oder redest du über deine neue Flamme?«
Doch Evren ließ sich von ihrem Kommentar nicht beirren, sondern konzentrierte sich auf den Artikel. Dabei drückte er die Zunge gegen seine Wange; das machte er immer dann, wenn er über etwas nachdachte.
»Was ist?«, wollte ich wissen.
Wie aufs Stichwort schob Evren die Zeitung weg und sah zur Seite. Zu mir. Zu meiner Hand, die in meinem Schoß ruhte, bevor sein Blick zurück zu meinem Gesicht fand. Jede Belustigung war von ihm abgefallen, Entschlossenheit dominierte stattdessen seine Züge. »Hör auf, dir Sorgen zu machen.«
»Ich mache mir immer Sorgen«, murmelte ich und wandte den Blick ab. Abwesend strich ich über meine linke Hand, über den Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger, ehe ich den Druck verstärkte. Nägel kratzten über die dort gerötete Haut, die daraufhin unangenehm brannte.
Ich kratzte weiter.
Bis eine warme Berührung mir keine andere Wahl ließ, als innezuhalten. Wie gelähmt starrte ich auf die Hand, die sich über meine gelegt hatte, auf Evrens kleinen Finger, der fast schon beiläufig über die nackte Haut meines Oberschenkels strich.
Er machte es mir unmöglich, ihn zu ignorieren. Evren hielt meinen Blick, so wie er mich hielt.
Einen Moment länger, als er sollte und ich wollte.
»Wir können das Ganze auch statistisch betrachten«, durchbrach Cansu die eingekehrte Stille. Schon ließ Evren mich los, ich ersetzte die fehlende Berührung durch meine eigene und versuchte, über die Anspannung hinwegzusehen. Die meiner geröteten Haut. Von Evrens Körper. Meiner Nerven. »Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung von New Orleans kann man davon ausgehen, dass pro hunderttausend Einwohner jährlich fünfzig Personen ermordet werden. Das hieße dann …«, Cansu rechnete lautlos vor sich hin, »dass die Wahrscheinlichkeit bei eins zu zweitausend liegt, dass es dich treffen könnte.«
»Wie beruhigend.« Das Pochen hinter meiner Stirn nahm zu. »Nimm es mir nicht übel, aber ich möchte kein Teil dieser Gleichung sein, du Mathegenie.« Seit ich Cansu kannte, lebte sie für Zahlen. Während ich in der Highschool Probleme damit hatte, die einfachsten Gleichungen zu lösen, war es ihr immer erschreckend leichtgefallen. Ein weiterer Grund, wieso wir uns so gut verstanden: Wir ergänzten uns bis ins Detail.
»Meinen neuesten Berechnungen zufolge wird es übrigens langsam Zeit, dass du mir dein Geheimnis verrätst.«
»Was genau meinst du?« Ich wusste ehrlich nicht, was sie hören wollte.
»Der Typ, mit dem du schläfst.« Das Knittern der Tüte überdeckte das Stolpern meines Herzens. »Ich will ihn endlich kennenlernen. Warum bringst du ihn nicht mal zum Essen mit?«
»Ja«, schaltete sich Evren ein. »Wieso bringst du ihn nicht mal zum Essen mit?«
»Du gehst mir gerade ziemlich auf die Nerven, Bruder.«
»Ich unterstütze dich doch nur.«
»Ihr zwei seid unglaublich«, murmelte ich.
»Was machst du eigentlich noch hier?«, fuhr Cansu Evren an. »Sobald wir von Typen reden, ist das dein Stichwort. Raus mit dir.«
»Bin schon weg.« Er schnappte sich die Zeitung und hielt sie demonstrativ hoch. »Und die nehme ich mit.«
Sein Blick wanderte erneut an mir herunter, ehe er mir zuzwinkerte und die Küche verließ.
Ich musste mich korrigieren: Evren war unschlagbar.
»Oh, nein. Nein, nein, nein.« Cansu stöhnte.
Ich geriet in Aufruhr. »Was?«
»Denk nicht mal dran.« Cansu deutete mit einem Teigschaber auf mich. »Nur weil du praktisch mit uns aufgewachsen bist, heißt das nicht, dass du dir alles von ihm gefallen lassen musst. Du brauchst seinen Segen nicht, um einen Kerl mitzubringen.«
Langsam löste ich meine verkrampften Finger, die ich in den Stoff meines Kleides gegraben hatte. »Das weiß ich.« Und reckte den Hals, um einen Eindruck zu erhalten, was Cansu heute backen wollte.
Ich würde alles tun, um irgendwie von diesem Thema abzulenken.
»Einen Kerl?«, mischte sich eine weitere Stimme ein. Kurz darauf entdeckte ich Cansus Mutter Nazan, die, genauso getrieben von Neugierde, die Zutaten beäugte. »Heißt das etwa, unsere Nika ist verliebt?«
»Mom«, tadelte Cansu. »Das versuche ich doch gerade herauszufinden.«
»Hörst du das? Sie nennt mich Mom.« Das letzte Wort betonte Nazan besonders und strich ihrer Tochter liebevoll über die Wange. »Komplett amerikanisch, mein Mädchen. Dass du mir nicht meine Küche in Brand steckst.«
»Niemals«, erwiderte Cansu und grinste. Auch ich konnte nicht anders, denn das hatten wir längst hinter uns – nur wusste Nazan bis heute nichts davon.
»Ich wollte deinem Vater nur einen Tee bringen. Lasst euch nicht von mir stören«, zwitscherte sie und wuselte genauso herum wie ihre Tochter. Zufrieden lehnte ich mich im Stuhl zurück und ließ mich von ihren Neckereien berieseln. Ich genoss es. Dieses Zu-Hause-Fühlen, obwohl dieses Haus nicht mein Zuhause war. Nicht mein richtiges.
Schon vor Jahren hatte mich Familie Yıldız mit offenen Armen empfangen, in die ich seitdem regelmäßig flüchtete. Früher hatte ich deswegen oft ein schlechtes Gewissen gehabt, weil Cansu mich wöchentlich praktisch an den Esstisch ihrer Familie geschleift hatte. Bis ich irgendwann verstanden hatte, dass nicht ich mich schlecht fühlen sollte, sondern Mom.
Sie hatte es nicht geschafft, sich so um mich zu kümmern, wie es eine Mutter eigentlich sollte. Jahrelang hatte ich den Fehler bei mir gesucht und erst durch Familie Yıldız gelernt, dass er nicht bei mir lag.
Ich trug keine Schuld, das wusste ich, aber … manchmal reichte das Wissen allein nicht aus, um mit einer Situation abschließen zu können.
»Mist«, murmelte Cansu. »Ich habe das Mandelmehl vergessen.«
»Ich schaue nach, ob noch etwas da ist.« Ich hatte schon früh gelernt, dass es besser war, Cansu in der Küche zur Seite statt im Weg zu stehen. Deshalb stand ich auf, lief an meiner Freundin vorbei und zur angrenzenden Tür, die in einen weiteren, sehr großzügig geschnittenen Raum führte. Er war randvoll mit Vorratsgläsern, Dosen und Getränken. Viel mehr, als eine vierköpfige Familie brauchte, von der die erwachsenen Kinder noch nicht einmal mehr hier lebten. Man könnte meinen, dass Cansus Eltern all das horteten, um für die Apokalypse vorbereitet zu sein, aber … sie liebten diese Vielfalt. Das Beisammensein, das sie damit in Verbindung brachten, weshalb jedes gemeinsame Essen perfekt werden sollte. Nazan kochte, Cansu backte. Jeden Samstag. Eine Tradition, in die ich irgendwann mit hineingerutscht war und auch nicht missen wollte.
Sorgfältig studierte ich die Beschriftungen der Regale. Obwohl ich diese Speisekammer schon Hunderte Male betreten hatte, musste ich immer wieder suchen, weil Nazan öfter umräumte, als für einen Vorratsraum gut sein konnte. Aber so war diese Familie nun mal.
Und obwohl sie mich behandelten, als wäre ich Teil ihres Ganzen, erinnerte mich das zeitgleich an das, was mir in meiner Kindheit gefehlt hatte.
Eine Familie. Eine Mom, die für mich da war, statt vor dem Fernseher zu hocken, zu trinken und sich eine Line nach der nächsten reinzuziehen. Zuerst hatte sie versucht, ihre Abhängigkeit vor mir geheim zu halten, bis sie es nicht mehr geschafft hatte.
Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und schob ein paar Dosen zur Seite, den Gedanken an Mom gleich mit. An sie zu denken, an ihre Entscheidungen und diese Zeit, tat weh, und diesem Schmerz wollte ich mich nicht aussetzen. Nicht hier und auch nicht jetzt. Nie wieder.
Meine Finger streiften gerade das Behältnis mit dem Mandelmehl, als ich zurückgerissen wurde. Zwei Arme schlossen sich um mich, ich zuckte zusammen. Doch der Schock verklang in dem Moment, in dem ich die Bestimmtheit seiner Berührung erkannte.
»Evren«, flüsterte ich. »Was machst du hier?«
Fordernd zog er mich an sich, vergrub die Nase in meiner Halsbeuge und küsste sich von dort bis zu meinem Ohr hinauf. Warmer Atem streifte meine Haut und machte es mir schwer, mich dieser Liebkosung zu entziehen, bei der ich jedes Mal einknickte wie ein Ast unter einem tosenden Sturm. »Du machst mich wahnsinnig in diesem Kleid.«
Eine schlichte A-Linie in einem dunklen Blauton, die zu meiner besten Kleidung zählte und ich aus diesem Grund gern an Samstagen trug. »Du hast mich schon oft darin gesehen.«
»Und ich liebe es jedes verdammte Mal, wie unschuldig du darin aussiehst.« Seine Hand fand unter den Saum und schob es in betörender Trägheit meinen Oberschenkel hoch, übte dann mit sanfter Bestimmtheit Druck auf meine Haut aus und presste mich gegen seinen Schritt. »Und das, obwohl du kein bisschen unschuldig bist.«
Ein leises Stöhnen entfuhr mir, als er sich fordernd gegen meinen Hintern drückte und seine Finger über meinen Innenschenkel glitten. Federleicht strich er über meine Haut, in derselben Sekunde hielt ich den Atem an und meine Hand schoss zu seiner.
»Hör auf.« Kopfschüttelnd drehte ich mich zu ihm um. »Cansu ist nebenan.« Was sie noch einmal bestätigte, indem sie lautstark fluchte.
»Du weißt genau, dass sie nichts merkt.« Evren umfasste mit beiden Händen meinen Hintern, markierte mich, als gehörte ich ihm. »Das hat sie nie.«
Richtig, denn zu meiner Schande war das zwischen Evren und mir keine einmalige Sache.
Ich kannte ihn schon mein halbes Leben. Wir waren zusammen aufgewachsen, aber genau aus dem Grund wusste ich auch, wie Evren drauf war. Dass er gern auf Partys ging und jedes Wochenende mit einer anderen rummachte. Schon früh hatte ich jedem Klischee alle Ehre gemacht, weil ich ausgerechnet für den großen Bruder meiner besten Freundin schwärmen musste, die davon bis zum heutigen Tag nichts ahnte. Stattdessen hatte ich ihre Schimpftiraden über Evren und seine neueste Errungenschaft still ertragen.
Bis er angefangen hatte, mich anders anzusehen. Anders als früher und trotzdem nicht genauso wie seine Bettgeschichten. Einfach … anders. Das zwischen uns basierte nicht auf Liebe, aber auf … Anziehung. Wir harmonierten im Bett, wussten, was dem anderen gefiel.
Und scheiße, Evren wusste zu gut, was mir gefiel.
Seine Hände wanderten über meinen Körper, als wäre ich sein eigen, seine Zähne gruben sich in die empfindliche Haut an meinem Hals und sein Griff verstärkte sich an genau den richtigen Stellen. Rückwärts schob er mich vor sich her, drängte mich in die Ecke, sodass ich die Tür nicht mehr sehen konnte.
Wieder fanden seine Hände unter den Saum meines Kleides, mein Höschen glitt zu Boden. Evren bückte sich danach und steckte es sich in die Tasche, ehe er mich küsste. Grob und verlangend und … so, wie ich es mochte.
»Evren«, murmelte ich zwischen zwei Küssen. »Wir müssen aufhören.«
Doch mein Widerstand bröckelte erneut, als er einen Träger über meine Schulter schob. Mein Herz schlug nicht mehr in meinem Brustkorb, sondern irgendwo in meinem Hals. Die Angst, erwischt zu werden, vermischte sich mit einem Nervenkitzel, der mich erregte.
Trotzdem wollte ich das nicht tun. Nicht in dem Haus, in dem ich mich zu Hause fühlte, und auch nicht in unmittelbarer Nähe der Menschen, die mein Zuhause waren.
Evren knöpfte seine Jeans auf. Mein Blick schoss zur Tür, hinter der ich Cansu singen hörte.
»Hör auf«, versuchte ich erneut, ihn davon abzuhalten. »Nicht.«
Doch er hob mein Bein an, forderte mich auf, es um seine Taille zu legen.
»Wir können das nicht tun, wir –«
Evren erstickte jeden Protest und drang in mich ein, legte eine Hand in meinen Nacken, die andere besitzergreifend an meine Hüfte.
Ich gab mich ihm hin, konzentrierte mich auf das, was er in mir auslöste. Auf seine Berührungen, das tonlose Stöhnen und dieses unvergleichliche Gefühl, das sich aufbaute wie eine Flutwelle. Drohend und unheilvoll.
»Du liebst diese Heimlichtuerei.« Er grub die Finger in meine Haut. »Diese Aufregung.« Markierte mich an all den Stellen, an denen er mich berührte. »Die Angst.«
In einem lautlosen Keuchen stieß ich die Hand zur Seite, Gläser klirrten gefährlich. Die Geräusche unserer Körper und die gleichmäßig unterdrückten Laute waren der einzige Hinweis, was wir hier machten. Ich vergaß, wo wir waren. Was wir zerstörten. Warum wir es verheimlichten.
»Du liebst es, dass dich jeder für unschuldig hält.« Ohne Vorwarnung glitt er aus mir heraus und ließ mich mit einer Leere zurück, von der ich dachte, sie nicht empfinden zu müssen. »Und ich liebe es, die Seite von dir zu kennen, die alles andere ist als das.«
Ich öffnete die Augen und starrte auf seine Brust, die sich deutlich hob und senkte. Reflexartig wanderte mein Blick nach unten. Evren war nicht gekommen und trotzdem knöpfte er seine Hose zu, als sei gar nichts dabei. Als koste es ihn gar keine Willenskraft, diesem natürlichen Bedürfnis zu widerstehen. Schwer atmend sah ich zu ihm auf, wusste nicht, warum er das tat.
Schon beugte er sich vor, sein Mund kurz davor, meinen zu streifen. »Bring es selbst zu Ende.«
»Was?« War das sein Ernst?
Evren entfernte sich rückwärts von mir, ein gefährliches Lächeln lag auf seinen Lippen. Er spielte mit mir.
Eine seiner Vorlieben. Nur hatte ich mich von ihm noch nie so alleingelassen gefühlt wie in diesem Moment. Zurückgelassen mit einem unbefriedigten Verlangen, das zwischen meinen Beinen pochte.
Er verharrte in der Tür, sein Blick hinterließ eine sengende Spur auf meiner Haut und verweilte auf meiner Brust.
Bring es selbst zu Ende.
Und als Evren aus meinem Sichtfeld verschwand … tat ich es.
Ich biss mir auf die Unterlippe und musste mich bemühen, um das Keuchen zurückzuhalten, das diese Gefühlsexplosion auslöste. Ein leises Wimmern kam dennoch über meine Lippen, während sich alles in mir zusammenzog, meine Atmung sich verlangsamte, mein eskalierendes Herz sich beruhigte.
Sekundenlang badete ich in dieser Wonne, in dieser schwerelosen Leere, bis mir dämmerte, was ich gerade getan hatte.
Wo ich es getan hatte.
Langsam öffnete ich die Augen, doch die erwartete Erfüllung blieb aus. Die Realität krachte mir so hart vor die Füße, dass ich erst verzögert verstand, dass etwas aus dem Regal gefallen war. Auf dem Boden verteilte sich ein weißes Puder; Mehl zusammen mit braunem Zucker. Doch selbst das konnte nicht über die Bitterkeit hinwegtäuschen, die mich überspülte.
Ich stand halb nackt in einer Vorratskammer, die Finger an Stellen, die ich nicht berühren sollte. Nicht in einem Haus, in dem Menschen wohnten, die ich liebte – und doch hatte ich mich gerade selbst befriedigt, als läge ich allein in meinem Bett. Das machte mir bewusst, wie richtig Evren lag: Ich war vieles, aber keineswegs ein unschuldiges Lamm.
Schritte ertönten. Kurz dachte ich wirklich, er wäre es, der hinter der Tür gewartet und sich gefragt hatte, ob ich seiner Forderung nachkam.
»Nika?«
Die vertraute, weibliche Stimme löste alle Warnsignale in mir aus, die ein unerträgliches Schrillen in meinen Ohren hinterließen. Ich zerrte mir das Kleid über die Brust, strich es über meinen Beinen glatt, als könnte das jetzt noch etwas besser machen.
»Wo bleibst du denn?« Cansu näherte sich. »Ist alles in Ordnung?«
Scheiße, verdammt noch mal!
»Ja.« Sofort bückte ich mich, das Gesicht von der Tür abgewandt, um meiner besten Freundin nicht in die Augen sehen zu müssen, während ich sie anlog. »Mir ist nur etwas heruntergefallen.«
Ein weiteres Mal, von dem ich wusste, dass es nicht das letzte sein würde.
Im Nachhinein wusste man es immer besser. Hätte ich vorher geahnt, was es bedeutete, mich für sie zu entscheiden, hätte ich länger über manche Entscheidungen nachgedacht. Ich hätte überlegter gehandelt und weniger impulsiv.
Was dabei herauskam, musste ich gerade am eigenen Leib erfahren. Ich saß auf dem Bett, ein Bein angewinkelt, und starrte an die Wand. Neben mir befand sich ein kleines Waschbecken, zusammen mit einer Zahnbürste, einem Notizblock und einem Bleistift darauf.
Ich hatte nichts mehr. Weder Habseligkeiten noch irgendwelche Möglichkeiten, die Zeit rumzukriegen. Mir blieb nichts anderes übrig, als Löcher in die Luft zu starren und auf etwas zu warten, von dem ich nicht wusste, ob es jemals eintreten würde. Das war das Schlimmste von allem. Diese Ungewissheit, die meine Zukunft in ein undurchdringliches, schwarzes Nichts verwandelte, zerrte an meinen Nerven, wie ich an dem Laken, das ich mit einem kräftigen Ruck zusammenzog.
Ein unentwirrbarer Knoten, genauso wie meine Gedanken.
Ständig wiederholte ich die Fragen, die mir unzählige Male gestellt worden waren. Fragen, die ich mir zu beantworten versuchte, seit ich in dieser Zelle festgehalten wurde, wie der Verbrecher, der ich war.
Wie hatte sie es gemacht?
Wie hatte sie es geschafft, mich so um den Finger zu wickeln, dass ich ihr vollkommen verfiel? Selbst jetzt konnte ich nichts dagegen ausrichten, dass mich die Erinnerung an sie wärmte. Eine Erinnerung, die ich verbissen zum Leben erwecken wollte, obwohl ich genau wusste, dass es nichts ändern würde.
Trotzdem stellte ich mir vor, sie wäre hier.
In diesem Bett.
Bei mir.
Abgeschottet von der Realität, die ich nicht ignorieren konnte.
Ich versuchte es, indem ich die Augen schloss. Gedanklich zeichnete ich die Konturen ihres herzförmigen Gesichts nach, den scharf geschnittenen Kiefer und die hohen Wangenknochen, die ihr dieses gewisse Etwas verliehen, weshalb ich sie jedes Mal etwas länger hatte ansehen müssen. Ich dachte an die vollen Lippen, nach denen ich mich sehnte. Die gerade Nase, auf der sich die Sommersprossen verteilten wie Puderzucker.
Neunundzwanzig Sommersprossen, von denen ich jede einzelne küssen wollte. Auch jetzt noch. Hier.
Immer.
Ein Immer, von dem ich wusste, dass es nie wieder eintreten würde. Nicht nach dem, was ich getan hatte.
Schwerfällig öffnete ich die Augen und starrte erneut an die kahle Wand, an der ich mittlerweile jeden Riss gefunden hatte. Alles zählen, was man sehen konnte, und alles anfassen, was nicht niet- und nagelfest war – ein ungeschriebenes Gesetz, das ich widerstandslos befolgte. Die straff gezogene Baumwolle drückte sich gegen meine Fingerspitzen und erinnerte mich an das, was mir bevorstand: ein Leben in Gefangenschaft.
Nicht schon wieder.
Nicht noch länger.
Es würde mir alles nehmen, was mir etwas bedeutete.
Das hat es doch schon längst.
Wiederholt erwischte ich mich dabei, wie ich nach einem Ausweg suchte, der mir die nächsten Jahre ersparen würde. Die ständige Beobachtung, die fehlende Entscheidungsfreiheit.
Ich kannte keinen Ausweg, der mich davor bewahren könnte. Keinen, außer dem letzten.
Langsam senkte ich den Blick auf die Schlinge, die ich aus dem Laken geknotet hatte, und entdeckte einen feinen Riss. Selbst wenn das Laken unter zu hohem Druck nicht reißen würde – in dieser Zelle gab es keinerlei Aufhängemöglichkeiten. Rein gar nichts. Noch nicht einmal die Entscheidung, mein Leben zu beenden, konnte ich für mich treffen. Die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Gefängnis waren zu hoch.
Allein mit den Geistern, die mich grausam quälen, und ihren Geschichten, die sie mir erzählen.
Tick, tack.
Schritte näherten sich auf dem Flur. Sofort schob ich die Schlinge unter das Kissen und lauschte. Je länger ich in dieser Zelle hockte, desto sensibler wurde ich für Geräusche, die der Alltag in Freiheit oft übertönte. Jetzt hörte ich das schwere Atmen eines Wärters, das klagende Reiben von Stoff, der über seinem Bauch spannte.
Das sanfte Klimpern eines Schlüssels, der in ein Schloss geschoben wurde.
Ich sah zur Tür, die Sekunden später aufschwang und die Sicht auf Officer Bradley offenbarte, dem ein leichter Schweißfilm auf der Stirn stand. »Aufstehen, Whitmore. Du wirst erwartet.«
Resigniert tat ich wie geheißen. In dieser Zelle konnte ich mich gerade einmal um mich selbst drehen, weshalb ich Bradley unaufgefordert die Hände hinstreckte, damit er mir die Handschellen anlegen konnte. Beißende Fesseln, weil sie mich als ein Risiko einstuften, das lächerlich klein gegenüber denjenigen war, die ebenfalls in diesem Flur untergebracht waren. Doch ich hatte auf schmerzhafte Weise erfahren müssen, dass jede Gegenwehr Konsequenzen haben würde. Also ließ ich mich wie ein Tier an der Leine von Bradley und einem weiteren Wärter durch die Flure führen. Vorbei an anderen Insassen, die mich mit ihrer boshaften Neugierde verfolgten wie der Schatten, der sich über mich gelegt hatte, seit sie in mein Leben getreten war.
Das Kinn starr erhoben und mit gespielter Gleichgültigkeit in der Brust, die mit jedem Pumpen meines Herzens mehr bröckelte, ging ich weiter. Bis ich auf einen Stuhl gesetzt wurde. In einem Raum, in dem nichts weiter als Trostlosigkeit herrschte, wie in jedem Zimmer dieses Gebäudes.
Officer Bradley schnaufte neben mir, etwas Feuchtes traf auf meine Wange. Speichel oder Schweiß – nichts, worüber ich nachdenken wollte.
Statt mich jedoch von den Handschellen zu befreien, schloss er sie an einen Widerhaken an, der sich auf der Tischplatte befand. »Du kennst die Regeln, Whitmore.«
Natürlich. Das hier war schließlich nicht mein erster Gefängnisaufenthalt.
Aber es würde mein letzter sein, sollte das hier nicht zu meinen Gunsten ausgehen.
Das wortlose Benimm-dich schwebte zwischen uns, ehe Bradley sich abwandte und das Zimmer verließ.
Oder den fensterlosen Kasten, der keinerlei Möglichkeit bot, auch nur an Weglaufen zu denken. Obwohl nichts darauf hindeutete, wusste ich, dass ich nicht allein war. Dass man mich von allen Seiten beobachtete wie eine Bestie im Käfig, von der erwartet wurde, dass sie jeden Moment die Kontrolle verlor.
Ich verharrte still, weil mich die uneingeschränkte Aufmerksamkeit auf dem Stuhl hielt wie Beton.
Machte das die Haft mit einem Menschen?
War eine Gefangenschaft das einzige Mittel, um ein Monster kontrollierbar zu machen?
Ich war kein Monster.
Aber ich wurde für eines gehalten.
Mein Mund fühlte sich trocken an. Vielleicht, weil ich seit Tagen schwieg. Es brachte nichts, zu reden. Es gab niemanden, der mir glaubte. Niemanden, der sich bemühte, mir zuzuhören.
Nicht so, wie sie es getan hatte.
Minutenlang starrte ich auf die Uhr, die über der Tür hing, und wartete. Das stetige Ticken die einzige Erinnerung daran, dass die Zeit lief.
Ich bin kein Monster.
Doch die leisen Zweifel krochen in mir hoch wie das Gift einer Schlange, das sich in quälender Langsamkeit in meinen Adern ausbreitete. Mich mit einer trügerischen Gewissheit lähmte, so wie ich meine Opfer gelähmt haben sollte.
Mein Hals kribbelte. Ich wagte es nicht, mir an den Kragen meines Shirts zu fassen, unter dem sich der Großteil der schwarzen Tinte befand, die sich in meine Haut geätzt hatte. Ebenso der Name, den man mir in meiner Jugend gegeben hatte.
Cyrus ›The Viper‹.
In der Vergangenheit hatte ich viele verwerfliche Dinge getan, aber war nie erwischt worden. Es gab nichts, wofür ich um Vergebung hätte bitten müssen. Ich bereute nichts und würde trotzdem alles anders machen, wenn ich nur die Chance dazu bekäme.
Alles, außer mich in sie zu verlieben.
Du bist das Gift, das mich zerstören wird, hallte ihre Stimme in mir wider, als säße sie neben mir.
Du warst mein Gift.
Die Tür öffnete sich.
Und alles, was ich sehen konnte, war sie.
Ich bin zu spät. Dafür verfluchte ich mich selbst, weil ich meinen Beruf ernst nahm und noch nie zu spät gekommen war. Dass mir das ausgerechnet gleich beim Termin mit einem neuen Klienten passieren musste, war das i-Tüpfelchen meines miserablen Morgens. Ich hatte nicht nur meinen Wecker überhört, sondern war auch mit einem Pochen hinter der Stirn aufgewacht, das mir jegliche Konzentration raubte. Nach nur zwei Stunden Schlaf wunderte es mich nicht, dass mein Körper mich warnte und Ruhe forderte. Bei allem, was gerade passierte, fand ich jedoch keine.
Mit der Akte unterm Arm hetzte ich den schmalen Flur hinunter, der mir mittlerweile genauso vertraut war wie der in meinen eigenen vier Wänden. Immerhin wusste ich, wohin ich musste.
Mein Handy gab einen kurzen, aber prägnanten Ton von sich. Im Gehen zog ich es aus meiner Jeans und entsperrte es. Nachdem ich mich am Wochenende weitestgehend darum bemüht hatte, mir nicht anmerken zu lassen, was Evren und ich im Vorratsraum getan hatten, konnte ich das Schmunzeln jetzt nicht zurückhalten, während ich die Nachricht las.
Evren: Komm heute Abend zu mir. Zieh das Kleid an.
Ihm gegenüber an einem Tisch zu sitzen und seine Blicke auf mir zu spüren, während ich so tat, als wäre nichts gewesen, verursachte auch jetzt noch eine aufgeregte Wärme in meinem Bauch. Gleichzeitig konnte ich das unangenehme Stechen nicht ignorieren, das damit einherging.
Cansu hatte neben mir gesessen, ohne etwas zu bemerken. Ich konnte gar nicht so genau sagen, wieso ich es vor ihr geheim hielt. Wir waren alle erwachsen. Trotzdem hatte ich Evren darum gebeten, Stillschweigen zu bewahren. Vielleicht, weil ich nicht nur eine weitere Trophäe sein wollte, die er sich ins Regal stellte, nur um vor anderen damit zu prahlen, ohne sie je wieder anzufassen. Vielleicht aber auch, weil ich dann mehr zugeben müsste als die Tatsache, dass ich nicht so abgeneigt von dem Draufgänger-Bruder meiner besten Freundin war, wie ich sie glauben ließ.
Mittlerweile war das Netz meiner Lügen so verworren geworden, dass ich es nicht unbeschadet herausschaffen würde, egal, wie sehr ich mich bemühte. Es war unausweichlich, dass ich etwas verlieren würde. Vorher hatte ich mir keine Gedanken darüber gemacht, jetzt tat ich es umso mehr – und das hob den Schleier langsam, den ich so sorgsam davorgeschoben hatte.
Ich hinterging nicht nur meine beste Freundin, sondern auch mich selbst, denn eigentlich kannte ich den Grund meines Schweigens: mein Gewissen.
Die Sache zwischen Evren und mir lief seit Monaten; eine unbenannte Zahl der Male, die ich Cansu angelogen und ohne ihr Wissen Misstrauen in unsere Freundschaft gesät hatte. Es ihr nach der langen Zeit zu gestehen, würde so viel mehr zerstören, als ich jemals wahrhaben wollte.
Davor hatte ich Angst.
Und das bestärkte mich nur noch mehr darin, dass ich es weiter für mich behalten musste.
Der Besprechungsraum katapultierte mich aus dem Labyrinth meiner Gedanken. Ich blieb vor der Tür stehen und tippte eine schnelle Antwort: Bis nachher.
Dann verstaute ich mein Smartphone und warf einen Blick durch den Spion, um zu prüfen, ob mein neuer Klient trotz meines verspäteten Check-ins schon hergebracht worden war. Anders als in gewöhnlichen Wohnkomplexen konnte man in diesen vier Wänden in die einzelnen Räume hineinsehen statt hinaus. Ich hatte mir angewöhnt, das auch zu nutzen, um keine Überraschungen zu erleben. Dieses Mal stellte sich jedoch ein Gefühl ein, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Eine leise Vorahnung, mehr beobachten zu können als das, was das eingeschränkte Sichtfeld preisgab. Ehe ich weiter darüber nachdenken konnte, spähte ich erneut durch das münzgroße Fenster. Ich erkannte einen Tisch, um den zwei Stühle platziert waren. Auf einem davon saß ein Mann, mit kurz geschorenem dunkelbraunem Haar, das fast als schwarz durchgehen könnte. Selbst über die Distanz und die Verzerrung des Spions erkannte ich die zusammengeschobenen Brauen, die seinen Zügen noch mehr Härte verliehen, als sie sowieso schon hatten.
Meine Wimpern strichen über einen Widerstand und ich zuckte zurück. Erst dadurch wurde mir bewusst, wie nah ich an die Tür herangerückt war, dass ich sogar auf Zehenspitzen stand und –
Scheiße, verdammt. Was tat ich hier?
Durch den Spion zu sehen war eine Routine, die sich ständig wiederholte, aber nie am selben Tag.
Bis jetzt.
Unauffällig sah ich den Flur hinunter und prüfte, ob mich jemand beobachtet hatte, wie ich ihn beobachtet hatte.
Cyrus Whitmore. Verurteilt zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe wegen schwerer Körperverletzung: eine Messerattacke auf eine unbewaffnete Person. Weil es sich bei ihm um einen Ersttäter handelte, würde er nach einem halben Jahr Haft auf Bewährung entlassen werden.
So viel wusste ich.
Reflexartig fächerte ich die Akte auf. Obwohl mein Job es vorsah, ließ ich die erste Seite mit den persönlichen Daten immer gezielt aus. Ich wollte meinen Klienten neutral gegenübertreten und sie nicht anhand ihres Aussehens verurteilen; stattdessen machte ich mir lieber mein eigenes Bild.
Doch dieses Bild war wie ein Schlüssel, der in kein Schloss passte.
Ich strich über das Papier, bis ich die matte Oberfläche der Aufnahme erreichte. Ein Foto des Mannes, den ich mit dem in Verbindung zu bringen versuchte, von dem mich nur eine Tür trennte.
Irgendetwas an dieser Situation irritierte mich.
Auf dem Foto … lächelte er.
Er lächelte darauf, als wäre es nicht für eine Häftlingsakte aufgenommen worden. Doch als ich den Raum schließlich betrat, war keine Spur dieses Lächelns zu sehen.
Unübersehbares Desinteresse festigte seinen Mund zu einer harten Linie, das dunkelbraune Haar gab die Sicht auf eine Narbe frei, die sich von seiner Schläfe bis unter das Auge zog. Kurz reizte es mich, ein weiteres Mal auf das Foto in der Akte zu sehen, weil ich mir nicht sicher war, ob er die Narbe vor seinem Gefängnisaufenthalt schon gehabt hatte.
Aber selbst das würde nichts an der Tatsache ändern, dass Cyrus Whitmore aus der Reihe tanzte, obwohl er reglos auf dem Stuhl verharrte. Cyrus hatte sein ganzes Leben vor sich und trotzdem wirkte er, als hätte er gerade lebenslänglich erhalten.
Bedächtig schloss ich die Tür. Sein Blick schoss hoch und nagelte mich mit eiserner Entschiedenheit fest, die ich überall spürte. Auf meinem Körper, in meinem Brustkorb, an meinem Herzen, und diese unverfrorene Aufmerksamkeit paralysierte mich. Verbissen kämpfte ich dagegen an, erwiderte seinen Blick stoisch und löste meine verkrampften Finger von der Klinke. Doch die brennende Spur, die auf meiner Haut entstand, kühlte sich nicht so einfach ab. Im Gegenteil, sie intensivierte sich mit jedem Schritt, den ich mich dem Mann näherte.
»Cyrus«, begrüßte ich ihn mit all der freundlichen Distanz, die ich aufbringen konnte, und zog den Stuhl zurück. Die Tatsache, dass hinter der linken Wand mindestens ein Beamter saß, der uns beobachtete, wenn nicht sogar zuhörte, gab mir Sicherheit. Mittlerweile wurde in Gefängnissen ein bestimmter Putz auf die Wand aufgetragen, der die eingelassene Scheibe von einer Seite verdeckte. So konnte man von außen in den Raum schauen und den dort Sitzenden trotzdem das Gefühl von Privatsphäre vermitteln. »Mein Name ist Nika Harlow und ich bin Ihre Bewährungshelferin.«
»Stehen Sie immer so lange vor einer Tür, um jemanden zu beobachten, Nika Harlow?«
Langsam legte ich die Akte ab. »Bitte?« Die Art, wie er meinen Namen betonte, gefiel mir nicht.
»Sie haben mich schon verstanden.«
Schon suchte ich nach dem Zeitpunkt, an dem ich mich laut verhalten hatte und er mich gehört haben konnte. Ich trug simple Chucks und keine Heels; nichts, das mich hätte verraten können. Mit einem Räuspern versuchte ich, das von ihm geschürte Unbehagen zu überspielen, und setzte mich.
»Ihre Entlassung steht kurz bevor und wir müssen ein paar Dinge besprechen, die auf Sie zukommen werden.« Ich schlug die Akte auf und überflog die Zeilen, die ich bereits auswendig kannte. »Arbeitsauflagen, Drogentests, der Zeitrahmen für regelmäßige Treffen.«
Ein leises Lachen hielt mich davon ab, mit meiner Standardrede fortzufahren.
»Sie machen Witze, oder?«
»Ganz und gar nicht«, erwiderte ich ehrlich und wartete, ob er mich an seinen Gedanken teilhaben ließ – er tat es nicht. »Die meisten möchten nicht gleich über sich selbst reden, aber wenn Ihnen das lieber ist, bin ich flexibel. Wollen wir mit Ihren Zielen anfangen?«
Cyrus sah aus, als hätte ich ihm einen Teller verdorbenen Essens vor die Nase geschoben. »Nein.«
»Okay.« Ich verschränkte die Finger auf dem Tisch ineinander. »Worüber möchten Sie dann reden?«
»Wie wäre es, wenn Sie mir etwas über sich erzählen.«
»Dafür werde ich nicht bezahlt, Mr. Whitmore.«
»Sondern dafür, mich aus diesem Knast zu holen.«
»Falsch«, korrigierte ich ihn. »Ich werde dafür bezahlt, Sie, so weit es geht, von dieser«, ich pausierte, »Unterkunft fernzuhalten und darauf zu achten, dass Sie nicht zum Wiederholungstäter werden.«
»Es ist kein Geheimnis, weshalb ich sitze.«
»Stimmt.«
»Sie dürfen es ruhig aussprechen.« Er stellte mich tatsächlich auf die Probe.
»Schwere Körperverletzung«, führte ich aus. »Sie sind mit einem Messer auf eine unbewaffnete Person losgegangen. Ihren damaligen Vorgesetzten«, ergänzte ich, bevor er erneut dazwischenreden konnte. »Und obwohl Sie ein Messer in der Hand hatten, haben Sie es losgelassen und stattdessen auf Ihre eigenen Waffen zurückgegriffen.« Seine Fäuste. »Aber das macht mir keine Angst, falls Sie darauf hinauswollten.«
Seine ungeteilte Aufmerksamkeit loderte auf mir wie Feuer auf Öl. »Worauf ich hinauswill«, sagte er leise, »ist, dass Sie und Ihr guter Wille nichts dagegen ausrichten können, sollte ich noch einmal das Bedürfnis haben, jemanden windelweich zu prügeln.«
»Oh, ich kann einiges ausrichten, Cyrus.« Ich zwang mir ein kühles Lächeln auf die Lippen. »Nur vielleicht nicht so, wie Sie es erwarten.«
Er lehnte sich vor, jede Bewegung wirkte kalkuliert. »Sie sind jung.«
»Und sehr gut in meinem Job.«
»Selbstbewusst.«
»Realistisch«, korrigierte ich ihn.
»Realistisch«, wiederholte er, als wollte er sich das Wort noch einmal auf der Zunge zergehen lassen. »Dann denken Sie, dass Sie die Richtige für mich sind?«
Der zweideutige Kontext entging mir nicht, aber ich ließ mir nichts anmerken. Ich hatte schon viele Klienten betreut, die sich an diese Grenze gewagt hatten. Jeder einzelne war daran gescheitert. Manche brauchten etwas mehr Zeit, um zu akzeptieren, dass ich ihnen zur Seite gestellt wurde, damit sie gut durch ihre Bewährung kamen. Trotzdem schaffte es nicht jeder, sie durchzustehen. Bis zu einem gewissen Punkt konnte ich meine Klienten begleiten; der restliche, entscheidende Teil lag jedoch nicht in meiner Hand.
»Ihre Ziele, Cyrus«, erinnerte ich ihn. »Haben Sie sich welche gesetzt?«
Nach kurzem Zögern deutete er mit dem Kinn auf die Akte, die aufgeschlagen vor mir lag. »Alles, was Sie über mich wissen müssen, können Sie darin nachlesen.«
Ich zog die verschränkten Finger näher an meine Brust. Zu meinem Missfallen nicht, weil ich meine Haltung bewahren wollte, sondern weil ich sein Verhalten nicht einschätzen konnte. »Ihres Lebenslaufs bin ich mir durchaus bewusst.«
Eine Pause entstand, in der er auffordernd eine Braue hob.
»Sie sind gelernter Mechatroniker«, fuhr ich fort und war kurz dankbar dafür, dass ich nie unvorbereitet in ein erstes Gespräch ging. »Haben Sie vor, diese Arbeit wiederaufzunehmen, oder möchten Sie sich anderweitig orientieren?«
Ein Schnauben ertönte. »Kennen Sie vielleicht eine Werkstatt, die einen Knasti einstellen will? Dazu auch noch einen, der wegen Körperverletzung eingebuchtet wurde?«
»Ich kenne viele Unternehmen, die unvoreingenommen sind.«
»Auch jemandem gegenüber, der seinen ehemaligen Chef angegriffen hat?« Cyrus’ Blick blieb kühl wie erkalteter Stahl. »Wäre ich an deren Stelle, würde ich niemanden mit solch einer Vorgeschichte einstellen.«
»Nun, Sie sind aber nicht an deren Stelle.« Sanft hob ich einen Mundwinkel. »Oder wollen Sie es vielleicht sein? Ihr eigener Chef?«
»Sie enttäuschen mich, Ms. Harlow.« Eisiger Spott peitschte mir entgegen wie Wind, vor dem ich mich nicht schützen konnte. »Für so naiv hätte ich Sie nicht gehalten.«
Mir klappte der Mund auf. »Ich bin nicht naiv, sondern –«
»Realistisch«, beendete er meinen Satz.
Vor den Kopf gestoßen.
Ich presste die Zähne aufeinander. »Und Sie sind sarkastisch.«
»Realistisch«, wiederholte er, aber sein Tonfall verriet, dass ich recht hatte. Nur wusste ich nicht, ob der von Höflichkeit ummantelte Hohn zu seinem Charakter gehörte oder eine Schutzhülle für seinen Gefängnisaufenthalt war. »Ich frage Sie noch einmal: Halten Sie sich wirklich für die Richtige?«
Gegen meinen Willen krümmte ich meine Finger und bohrte die kurzen Nägel in meine Haut.
Für den Bruchteil einer Sekunde glitt seine Aufmerksamkeit dorthin. Ein diebisches Grinsen schlich sich auf seinen Mund, während er sich gelassen zurücklehnte. Das leise Klimpern, das dabei entstand, rief mir meine Lage ins Bewusstsein – und seine ebenso.
»Konzentrieren wir uns auf das Wesentliche«, entschied ich und erklärte ihm ohne weitere Abweichungen seine Auflagen. Dabei wies ich ihn auf die Treffen hin, meine Erwartungen und Wünsche in Bezug auf unsere Zusammenarbeit. Cyrus hörte zu und sah mich die ganze Zeit über an. Seine Aufmerksamkeit biss sich an mir fest, wie die Narbe sich in seiner Haut verewigt hatte, und ich konnte nicht leugnen, dass mich die Intensität verunsicherte. Immer wieder riss er mich aus meiner Konzentration, und jedes Mal zeigte sich seine Genugtuung – im Zucken seines Mundwinkels, dem Senken seines Kinns, sogar beim Knacken seiner Fingerknöchel, wobei die Handschellen erneut klimperten.
Doch auch als ich endete, sagte Cyrus nichts.
Sekunden, in denen ich mir erlaubte, ihn zu betrachten. Ihn wirklich zu beobachten, denn trotz des unerschütterlichen Gleichmuts, den seine Haltung ausstrahlte, erkannte ich Anspannung in seinen Schultern. Die messerscharfe Vorsicht in seinen Augen.
Und irgendwie verstand ich ihn.
Ein halbes Jahr in einem Gefängnis zu verbringen konnte reichen, um einen Menschen von Grund auf zu verändern. Viele wurden nach diesem Aufenthalt ziellos, wussten nicht, wohin mit sich, und überspielten diese Haltlosigkeit oft mit einer Abgeklärtheit, deren Personifizierung gerade vor mir saß. Aber selbst das änderte nichts an dieser Hoffnung, die ehemalige Insassen umgab wie ein Heiligenschein. Hoffnung auf eine zweite Chance.
Bei Cyrus … sah ich das nicht.
Er wirkte alles andere als erleichtert, dass er dieses Gebäude in wenigen Tagen verlassen konnte. Unter Beobachtung, aber als freier Mann.
»Cyrus«, versuchte ich es erneut, weil er immer noch schwieg. »Sie müssen mir irgendetwas geben, womit ich arbeiten kann.« Ich hatte mich für diesen Beruf entschieden, weil ich damit helfen konnte. Ich wusste zu gut, wie es sich anfühlte, im Stich gelassen zu werden. Wenn sich jemand allerdings nicht helfen lassen wollte, dann waren die größten Bemühungen nur eins: vergebens.
Normalerweise hätte ich mehr Geduld gezeigt. Doch hinter Cyrus blitzte ein roter Punkt auf. Ein Hinweis von außen, dass sich der Termin dem Ende zuneigte. Verwundert schob ich meinen Ärmel zurück und spähte auf die Uhr. Ich war noch nicht über der Zeit. Hatte es etwas damit zu tun, dass ich zu spät aufgetaucht war, oder wollte jemand dieses Gespräch vorzeitig beenden?
»Mache ich Sie etwa so nervös, dass Sie die Flucht ergreifen wollen, oder sind Sie mit Ihrer Geduld bereits am Ende?« Gespieltes Bedauern überzog diese Frage, und ich sah hoch. Cyrus fixierte mich mit schneidender Unerbittlichkeit, eine unsichtbare Klinge, die ich an meiner Kehle spürte.
»Was veranlasst Sie dazu, das zu denken, Cyrus?«
»Sie sind nicht die Einzige, die Menschen lesen kann.« Kaum hatte er das ausgesprochen, wurde ich mir meines Fehlers bewusst. Eigentlich hatte ich auf meine Geduld angespielt, nicht auf meine Nervosität, die einen ganz anderen Ursprung hatte, als er wissen konnte. »Während Sie Ihre Vorschriften abgelesen haben, hatte ich genügend Zeit, Sie zu beobachten.«
Abgelesen?
Meine Lippen teilten sich, doch Cyrus schnitt mir die Widerworte ab, indem er ein weiteres Mal auf die Akte wies. »Wenn Sie nicht wollen, dass man Sie lesen kann, sollten Sie das unterlassen.«
»Was? Das Ablesen?«, blaffte ich und ermahnte mich im Stillen. Wir hatten Zuschauer, und ich hatte etwas zu erledigen. Einen Job, von dem ich mit jeder Sekunde mehr bereute, ihn überhaupt angenommen zu haben.
»Das Kratzen.«
Mein Blick rutschte auf meine Hände, die mitten in ihrer Bewegung eingefroren waren. Mist.
»Sie kratzen sich unentwegt an Ihrer Hand, Ihr Fuß wippt mit einem beneidenswerten Rhythmus, der darauf schließen lassen könnte, dass Sie Musik im Blut haben.« Erneut hob er eine Braue. »Spielen Sie Bass? Oder Schlagzeug? Auf jeden Fall irgendetwas Lautes.«
Es kostete mich alle Mühe, sitzen und ruhig zu bleiben. Ich hatte bereits einige Personen unterstützt, die meine Hilfe nicht wollten, aber noch nie jemanden, der mir dabei so viel Aufmerksamkeit schenkte wie Cyrus Whitmore.
Erneut wurde ich auf das rote Licht aufmerksam. Zeit, zu gehen. Also klappte ich die Akte zu und stand auf. »Weder noch«, sagte ich schließlich. »Ich bin vollkommen unmusikalisch, aber ich wollte schon immer mal Gitarre lernen. Was für ein Ziel verfolgen Sie für Ihre Zukunft?«
»Sie haben meine Akte«, betonte er, als läge darin ein versteckter Hinweis, den ich noch nicht entschlüsselt hatte. »Finden Sie es heraus.« Etwas blitzte in seinen Augen auf, das ich nicht deuten konnte und vielleicht auch nicht wollte. Ich wusste nur wenig über diesen Mann, aber genug, um sicher zu sein, dass ich vorsichtig sein musste. Die Risikoanalyse war nicht eindeutig ausgefallen, weil er im Gegensatz zu anderen vorher nie polizeilich aufgefallen war. Allein das machte es enorm schwer, ihn richtig einzuschätzen.
»Danke, aber ich habe erst mal alles, was ich brauche.« Lautstark schob ich den Stuhl an den Tisch, wodurch Cyrus’ Handschellen klimperten, weil sie daran befestigt waren. »Und nur für den Fall, dass meine Aufgabe nicht klar geworden ist: Ich bin nicht hier, um Sie erneut hinter Gittern zu bringen. Ich bin hier, um Sie davor zu bewahren.«
Kühle Berechnung strahlte mir aus gewittergrauen Augen entgegen, deren Intensität in diesem Licht fast schon unnatürlich wirkte, so silbern schimmerten sie. Oder lag doch noch ein eisiges Blau in dem Grauton?
Ich war versucht, die Distanz zu minimieren und es herauszufinden, konnte mich aber in letzter Sekunde davon abhalten. Entschieden klemmte ich mir die Akte unter den Arm. »Wir sehen uns in ein paar Tagen, wenn Sie entlassen werden.«
Mit einem Nicken verabschiedete ich mich und ging zur Tür. Cyrus’ Blick spürte ich jedoch weiterhin auf mir. Auch dann noch, als ich den Raum längst verlassen hatte. Doch selbst die räumliche Trennung konnte nichts an der Anspannung ändern, die mich seit dem Schließen der Tür beanspruchte.
Ich hatte schon mit weniger umgänglichen Menschen zu tun gehabt, und trotzdem konnte ich die leise Skepsis nicht ignorieren, die in meinem Bauch aufbegehrte. Eine ungute Vorahnung, dass es ein Fehler gewesen sein könnte, Cyrus Whitmore als neuen Klienten angenommen zu haben.
Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, bis Mr. Langford den Raum betrat und hinter sich die Tür schloss. Mein Pflichtverteidiger trug seine Aktentasche so verkrampft wie sein verhaltenes Lächeln, als er sich mir gegenüber an den Tisch setzte. »Mr. Whitmore«, begrüßte mich der grauhaarige Mann und stellte die Tasche neben sich ab. »Wie geht es Ihnen heute?«
Dass er auf den Aufenthalt im Krankenflügel anspielte, war mir bewusst. Ich hob jedoch nur die Hände, um ihm die Handschellen zu präsentieren, ohne die ich außerhalb meiner Zelle nicht herumlaufen durfte, und ließ sie wortlos wieder in den Schoß fallen.
Der Mann lächelte weiter, aber nichts daran wirkte glücklich. Eher … untröstlich. Die Sorge, die ich die ganze Zeit verdrängt hatte, überfiel mich so schnell wie ich damals meinen Chef. Gequält verzog ich das Gesicht. »Sie sind echt beschissen in Ihrem Job.«
Das entlockte Mr. Langford ein freudloses Lachen. »Ich bin bereits seit Jahren in diesem Beruf tätig, aber dieser Part wird einfach nicht leichter.«
»Sagen Sie es schon.« Ich war es leid, in Ungewissheit zu leben. »Bitte.« Und ich war müde. Nicht aufgrund fehlenden Schlafs, sondern wegen geistiger Erschöpfung. Diese verfickte Situation laugte mich so sehr aus, dass ich mich nicht mehr wie ich selbst fühlte.
»Die Anklageschrift ist da.« Mr. Langford zögerte einen Moment, in dem er einen tiefen Atemzug nahm. Die Anspannung strömte von ihm aus wie die gefährliche Strahlung eines Reaktorkerns. »Ms. Harlow war Ihre Bewährungshelferin, Cyrus.«
Ich wandte den Blick ab. Er sprach von ihr, als hätte ich vergessen, wer sie gewesen war. Dennoch gab es etwas, was er nicht wissen konnte, und das niemand erfahren durfte.
Nika war so viel mehr für mich gewesen.
»Das verschlimmert Ihre Lage erheblich«, fügte Mr. Langford hinzu. »Ms. Harlow hat im Dienst des Staates gearbeitet, was schnell als Angriff auf das Rechtssystem gesehen werden kann. In diesem Fall handelt es sich um einen verschärften Umstand. Die verbrannten Überreste –«
»Ich will es nicht hören«, unterbrach ich ihn und kniff verbittert die Augen zusammen. All die Nachweise waren mir bekannt, ich hatte sie selbst gesehen. Nur fehlte mir das entscheidende Detail, um das Puzzle zusammenzusetzen, das mir das Genick brechen würde. »Ich habe sie nicht angerührt«, beharrte ich.
Eine Pause entstand. »Die Beweislage ist erdrückend.«
»Sie meinen die falsche Fährte.« Die entsetzlicherweise geradewegs zu mir führte.
»Die Anklage will Sie hinter Gittern sehen. Endgültig.« Die Art, wie Mr. Langford mich dabei ansah, fühlte sich an wie ein Faustschlag ins Gesicht. Ich ertrug es nicht. Dieses Mitleid, dieses ehrliche Bedauern, die stumme Entschuldigung dahinter.
Doch es war die Ohnmacht, unter der ich brach, wie die Blume, die ich zertreten haben sollte. Resigniert senkte ich den Kopf und zwang mich dazu, mir endlich einzugestehen, was endgültig wirklich bedeutete.
Ich würde nie wieder auf freiem Fuß sein.
Nie wieder aus freiem Willen in ein Auto steigen und in einem Drive-in halten.
Nie wieder zusehen, wie sie einen Burger aß und mich zwang, Pommes in einen Milchshake zu tunken.
Nie wieder denken, ich hätte eine Zukunft, solange sie an meiner Seite blieb.
Nie wieder.
Denn sie war nicht mehr hier.
Ich ballte die Hände zu Fäusten, weil es die einzige Möglichkeit war, mich an irgendetwas festzuhalten. Die Unwiderruflichkeit drohte mich von den Füßen zu reißen. Das Gefühl, das Gleichgewicht zu verlieren, obwohl ich auf einem Stuhl hockte wie ein kleiner Junge, verursachte eine Übelkeit in mir, die sich in meinem Hals festsetzte.
»Ich werde mich dafür einsetzen, es Ihnen so angenehm wie möglich zu machen. Mehr kann ich nicht für Sie tun.«
Ein Versprechen, das er nicht einhalten könnte, egal, wie seine Bemühungen aussehen würden. So angenehm wie möglich war ein Luxus, den ich nie wieder würde genießen können.
Mr. Langford erhob sich und knöpfte sein Jackett zu. Ich erwartete schon, dass er sich umdrehen und gehen würde, doch zu meiner Überraschung umrundete er den Tisch, bis er neben mir stehen blieb. Zögernd legte er mir die Hand auf die Schulter, ein tröstender Beistand, der mir nichts brachte. »Es tut mir leid.«
Ergeben lehnte ich mich zurück und legte den Kopf in den Nacken. Starrte in einen Himmel, der aus einer Betondecke bestand und den ich für den Rest meines Lebens zu akzeptieren hatte.
Ich beug’ mich dem Bösen, das tief in mir wohnt, lass fahr’n alle Hoffnung, dass sie mich verschont.
Nie wieder.
Ich war kurz davor, rückfällig zu werden. Seit Stunden kreisten meine Gedanken darum, wie einfach es wäre, diesem Verlangen nachzugeben. Vor hundertneunundneunzig Tagen hatte ich entschieden, aufzuhören. Hundertneunundneunzig kräftezehrende Tage, die ich bereits gegen diesen Drang ankämpfte. Heute war es besonders schlimm, und ich kannte noch nicht einmal den Grund.
Doch. Du kennst ihn.
Selbst das Rauschen des Wassers konnte die nervtötende Stimme nicht übertönen, die mich auf das hinwies, was ich zu verdrängen versuchte.
Er war der Grund. Dieser neue Klient, den ich erst ein einziges Mal gesehen und dessen Auftreten etwas in mir zum Leben erweckt hatte, das ich mit aller Macht in den ewigen Schlaf gezwungen hatte. Es war Tage her, und trotzdem fühlte sich die Erinnerung so frisch an, als wäre es gerade erst passiert. Schlagartig sammelte sich die Säure in meinem Magen, die ein heißes Brennen in mir verursachte. Mein Griff um den Toilettenrand verstärkte sich. Mir war so verdammt übel. Ich hatte die Dusche angestellt, damit ich mich auf das beruhigende Geräusch konzentrieren konnte, auf das beständige Prasseln des Wassers. Doch mein Fokus schwankte. Ich kniff die Augen zusammen, weil ich mir nicht zu helfen wusste.
Ich wollte es schaffen, wollte ein besserer Mensch sein und den Fehler korrigieren, der zu mir gehörte. Dieses Verlangen war nichts anderes als das.
Aber kein Mensch ist fehlerfrei.
Noch eine Nacht länger, sagte ich mir. Das hatte bisher jedes Mal geholfen.
Kontrolliert atmete ich durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus. Wortlos zählte ich, wiederholte, zählte und wiederholte. Bis sich nicht nur mein Magen beruhigt hatte, sondern auch meine Gedanken. Erst dann ließ ich mich langsam zurück auf meine Fersen sinken und den Kopf hängen.
Hundertneunundneunzig Tage.
Ich würde noch eine Nacht länger durchhalten und morgen sähe alles ganz anders aus. Als ich mich wieder einigermaßen im Griff wusste, rappelte ich mich auf und war versucht, mich vollkommen bekleidet unter die Dusche zu stellen, um den letzten Funken Sehnsucht abzuwaschen. Stattdessen stellte ich das Wasser ab und beugte mich über das Waschbecken, um den Mund auszuspülen. Obwohl ich mich nicht übergeben hatte, fühlte ich mich so. Ausgelaugt und kraftlos. Während ich mir gründlich die Hände wusch, beobachtete ich das Wasser und wünschte mir, ich könnte damit mehr fortspülen als die unsichtbaren Spuren der letzten Minuten.
Auch dafür suchte ich noch eine Lösung.
Aus Gewohnheit warf ich einen Blick auf die schlichte Armbanduhr an meinem Handgelenk. Ich war bereits zwanzig Minuten hier drin, viel zu lange, um mich kurz frisch zu machen. Hastig öffnete ich die Tür und verließ das geräumige Badezimmer; dabei wäre ich fast über ein Paar Beine gestolpert, die ausgestreckt neben der Badezimmertür lagen. Im letzten Moment hielt ich mich am Türrahmen fest und starrte verwundert auf Evren, der es sich auf dem Boden gemütlich gemacht hatte. Verzögert schloss ich die Tür hinter mir. »Was machst du da?«
»Auf dich warten.«
Unwohlsein schwappte in mir hoch, das sich genauso hartnäckig meine Kehle hocharbeitete wie die Säure ein paar Minuten zuvor. »Das hättest du auch auf dem Sofa tun können. Wäre mit Sicherheit gemütlicher gewesen.«
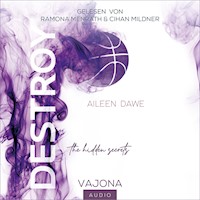
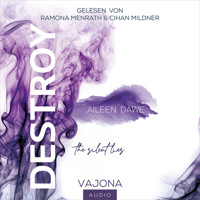

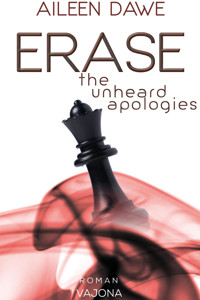













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











