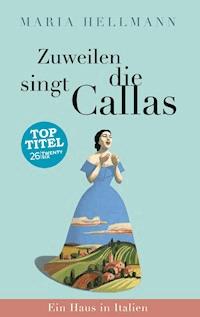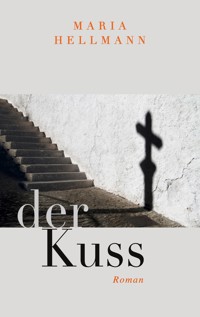Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die 60er Jahre - das Wirtschaftswunder verspricht Wohlstand für alle. Sie gehören nicht dazu. Der Vater Frührentner, die Geschwister zahlreich. Aber trotz (oder gerade wegen) Mangel ist die Kindheit eine glückliche. Maria Hellmann schaut zurück. Gedankensprünge einer Dreizehnjährigen, die sich, auch ohne Telefon, Fernseher und Auto, nicht zu den Verlierern zählt. Unterhaltsame Episoden, die Bilder hinterlassen. Ein Lesevergnügen für alle, die sich gerne erinnern, aber auch für nachfolgende Generationen, die Bonanza für eine italienische Qualitätssalami halten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für ADRIANA
und all meine anderen Enkelkinder
Matteo, Lalia, Takuya und Nele
Als ich steckenblieb, wusste ich, dass sich das mit meiner heißgeliebten Kindheit erledigt hatte. Die Rinde des alten Birnbaums scheuerte an einem Busen, der sich über die langen Wintermonate von etwas Mückenstichartigem zu zwei unübersehbaren neuen Körperteilen entwickelt hatte. Ich mochte sie nicht. Vielleicht, weil sie zu schnell ihren Raum bei mir eingenommen hatten und hinderlich waren, um mich zwischen den beiden Ästen hindurchzuzwängen, was den Aufstieg zum Gipfel ermöglichte. Ich liebte diesen Platz, auch deswegen, weil sich die wenigsten getrauten, so hoch hinaufzuklettern. Von dort oben konnte ich über das Schul-dach hinweg den Rotenfels sehen, eine Felswand aus rötlichem Rhyolit (es sind häufig die komplizierten, aber auch für mein Leben belanglosen Worte, die ich mir merken kann), die uns als außergewöhnlich gelehrt wurde, weil es sich um die höchste Steilwand zwischen den Alpen und Skandinavien handele. Ich kannte weder die Alpen noch Skandinavien, und so freute ich mich umso mehr, dass wir den Rotenfels hatten, auch wenn ich ihn nicht anfassen konnte, denn wir hatten kein Auto, und der Bus fuhr nur nach Bad Kreuznach mit Haltestellen in Ebernburg und Bad Münster.
In Bad Münster stiegen wir schon mal aus, wenn wir Großen an wirklich heißen also unerträglich heißen Sommertagen, Geld für den Bus nach Bad Kreuznach bekamen, um uns dort im Schwimmbad abzukühlen. In Bad Münster gab es auch ein Schwimmbad, aber da war der Eintritt viel teurer, weil es ein Solebecken mit brauner Brühe gab und viele Kurgäste. Die billigere Busfahrkarte für den nähergelegenen Ort konnte den Gesamtpreis also nicht positiv beeinflussen, unterm Strich war für die knappe Haushaltskasse unserer Eltern Bad Kreuznach günstiger. Aber auch wir Kinder konnten rechnen. Und so stiegen wir in Bad Münster aus, gingen die letzten Kilometer zu Fuß und stellten uns später in die Schlange am Schwimmbad-Kiosk, um die zwanzig Pfennig Gewinn in Süßigkeiten umzusetzen. Ich tat mich jedes Mal schwer mit der Kaufentscheidung. Ein Eis am Stiel war verlockend, aber auch schnell weg. Die Storck-Lutscher (davon hätte ich zwei bekommen) steckten sich die meist langhaarigen Mädchen, die so gut nach Sonnenöl rochen und von Jungens verfolgt wurden, in den Bund ihrer Bikinihosen. Das fand ich total schick. Aber ich hatte keinen Bikini. Ich hatte einen hellblauen Badeanzug, der an den Beinöffnungen ausgeleiert war, und von Jungen wollte ich schon gar nicht verfolgt werden. So verbrachte ich viel Zeit vor dem Kiosk, wo es nach heißen Würstchen roch und beschlagene Cola- und Sinalco-Flaschen mit Strohhalmen über den Tresen geschoben wurden während Wespen über vollgestopften Mülleimern schwärmten und beängstigende Geräusche machten, bis ich mich nicht nur von denen bedrängt fühlte, und mir eine Schaumwaffel oder etwas anderes Blödes in die Hand drücken ließ. Darüber ärgerte ich mich umgehend, weil es mich durstig machte. Das blieb ich dann bis zu Hause, weil wir nichts zu trinken dabei hatten: vor einem laufenden Wasserhahn wäre ich damals schlicht verdurstet. Ich bekam Leitungswasser nicht runter.
Ich erinnere mich, dass ich häufig durstig war als Kind. Nicht, dass meine Eltern es darauf angelegt hätten. Morgens wurden zwei Liter Malzkaffee gekocht und beim Bauern kauften wir jeden Abend fünf Liter Milch. Ich spreche von den Zeiten, als unsere Familie das Maximum erreicht hatte und sieben Kinder versorgt werden mussten. Was am Morgen vom Malzkaffee übrig blieb, wurde mit den Resten der Milch vom Vorabend gemischt und stand in einem bauchigen Krug, aus dessen Gießtülle ein Stück ausgebrochen war auf dem Kühlschrank. Daraus konnten wir uns bedienen. Und wenn ich mit dem Turnverein zu einem Sportfest fuhr (das tat ich relativ oft, ich war eine begeisterte Leichtathletin) oder ein Wandertag anstand, musste ich mir von diesem Milchkaffee eine Plastikflasche mit Schraubverschluss füllen, der ein bunter Plastikbecher übergestülpt war, aus dem man, wenn man wollte, trinken konnte, wenn man es nicht direkt aus der Flasche tat. Wir hatten mehrere Flaschen, weil wir ja auch mehrere Kinder waren, aber alle stanken gleich. Eine Wolke aus billigem Kunststoff, sauerer Milch und ein bisschen Keller drückte sich nach draußen, wenn die Reste aus dem gelben Krug über die kaputte Tülle durch die Schraubverschlussöffnung eingefüllt wurde. Dann hoffte ich schon, unterwegs keinen Durst zu bekommen, zumal ich meist im Sommer unterwegs war, und da dauerte es nicht lange, dem Flocken der Milch durch die trübe Flaschenwand zuschauen zu können. Meist bekam ich schon Durst, nur weil ich Angst hatte, überhaupt im Laufe der Abwesenheit von zu Hause Durst zu bekommen und auf den sich wandelnden Flascheninhalt angewiesen zu sein. Wenn ich Glück hatte, lag eine Zitrone im Kühlschrank, die nicht gebraucht wurde. Die durfte ich mir dann auspressen und mit Wasser und reichlich Zucker zu einer Limonade mischen. Um die Plastikflasche kam ich allerdings nicht herum.
Ob rauf oder runter, meine Befreiungsversuche im Birnbaum schmerzten, und ich weinte, aber nicht, weil der neue Busen dabei verschrammt wurde, ich weinte, weil ich spürte, dass etwas zu Ende ging und sich Neues in mein Leben drängte, worauf ich keine Lust hatte. Ich wollte mich nicht fügen, zumindest an diesem schönen Frühlingstag noch nicht, der schon einen Vorgeschmack vom Sommer lieferte. Auf den freute ich mich immer, weil wir in kurzen Hosen und mit ewig aufgeschlagenen und verschorften Knien die langen Tage im Freien verbrachten. Ohne an die Qualen des Abstiegs zu denken, kämpfte ich mich auf meinen Platz ganz oben in den mächtigen Baum, an dem noch die Blätter fehlten, aber viele Blütenknospen kurz vor der Explosion standen. Ich wischte mir mit von der Rinde geschwärzten Händen die Tränen aus dem Gesicht und schaute über den Rotenfels hinweg in den Hunsrück hinein mit dem vielen Wald, in dem sich der Schinderhannes einst versteckt hatte, weil er ein gesuchter Räuber war. Allerdings soll er ein netter Räuber gewesen sein. Trotzdem war ich damals froh, als uns im Heimatkundeunterricht vermittelt wurde, dass er schon lange tot sei. Aber selbst wenn er noch gelebt hätte, meine Angst wäre unberechtigt gewesen, denn wie schon gesagt, hatten wir kein Auto, um in das nahegelegene dicht bewaldete Mittelgebirge zu fahren, und der Bus fuhr nur in die Stadt.
Auf der Schulwiese sah ich die Mädchen aus der achten Klasse im Kreis in der Frühlingssonne sitzen. Sie waren die Großen, die noch vor den Osterferien die Schule verlassen würden, um dann jeden Morgen mit dem Sieben-Uhr-Bus in die Stadt zu fahren, weil sie Frisöse werden wollten oder Einzelhandelskauffrau oder Anwaltsgehilfin oder Krankenschwester oder irgendwo uffm Bürro lerne wollten. Sie hätten dann eine Monatskarte für den Bus und müssten sich nicht überlegen, ob sie es sich gerade leisten konnten, eine Fahrt in die Stadt zu machen. Bei uns zu Hause wurde immer genau überlegt, wann und vor allem, wer in die Stadt fahren durfte. Ein Warum hatte immer triftige Gründe. Nur einfach mal so war finanziell nicht drin.
Ich hatte auch einmal eine Monatskarte für den Bus, also eigentlich drei Monatskarten. Für den April, den Mai und den Juni. Da ging ich nach der vierten Klasse zum Gymnasium, das Lina-Hilger-Gymnasium. Eine Schule damals nur für Mädchen. Mein Bruder Gregor besuchte schon seit zwei Jahre das Gymnasium an der Stadtmauer. Dafür mussten meine Eltern kämpfen, weil der Dorfschullehrer meinte, dass nur der Pfarrerssohn, der vom Bürgermeister, der Sohn von den Eltern mit dem Malergeschäft und natürlich der eigene die rechte Qualifikation hätten. Wir waren ja kinderreich mit einem Vater, der Frührentner war, und somit unqualifiziert. Und weil es keine Empfehlung aus der Dorfschule gab, musste mein Bruder eine Aufnahmeprüfung machen. Die hatte er bestanden, und danach gingen meine Mutter und er in der Stadt ins Café Wonsyld und haben Kuchen gegessen. Das machte mich total neidisch, auch weil er mir genau beschrieb, dass er sich ein Schweinsohr aus gezuckertem Blätterteig genommen hatte, dessen eine Hälfte dick mit Schokolade überzogen war.
Also ich hatte nur drei Monatskarten, weil seitens des Gymnasiums nach einem Vierteljahr eine Empfehlung an meine Eltern geschickt wurde, mich doch besser wieder die Hauptschule besuchen zu lassen. Meine Art, dem Unterricht zu folgen reichte für eine weiterführende Schule offensichtlich nicht aus. Im Grunde folgte ich noch nie, sondern nahm in den ersten Jahren nur nebenbei wahr, was sich vorn abspielte, während ich nach draußen zum Birnbaum schaute und die Krähen zählte, die dort ein- und ausflogen. Aber es reichte für die Dorfschule mit dem Fräulein (wir sagten immer nur Fräulein … das Fräulein hat gesagt … guten Morgen Fräulein … auch wenn sie einen Namen hatte).
Ich gab die richtigen Antworten, selbst wenn ich mit meiner Freundin Petra die Puppenstube unter der Bank einrichtete und all die Personen dazu malte und ausschnitt, die dort einmal einziehen sollten. Vielleicht war meine flüchtige Aufmerksamkeit ausreichend für den geringen Anspruch. Dass man uns durchaus hätte mehr vermitteln können, zeigten mir all die Mitschülerinnen, die aus der Ringschule der Stadt in meiner neuen Klasse im Gymnasium saßen. Die kannten sich schon mit Subjekt, Prädikat und Objekt aus. Das schien mir alles sehr kompliziert, ich sah mich durchaus in der Lage, Sätze auch ohne Bauanleitung zusammenstellen zu können. Und wenn Vokabeln im Englischbuch sich auf der letzten Seite befanden, betrachtete ich das als einen Hinweis für Nebensächliches. Ich fand es einfach nur wunderbar, am frühen Morgen mit dem Bus in die Stadt zu fahren. Ganz alleine, also ohne Erwachsenen am Bahnhof auszusteigen, über die stark befahrene Brücke (zumindest empfand ich sie als stark befahren, der Verkehr in unserem Dorf hielt sich in Grenzen) die über die Gleise führte, zur Schule zu laufen und manchmal beim Betten Golling in der Mannheimerstrasse ins Schaufenster zu gucken, um mich zu wundern, was in Sachen Bettwäsche so alles möglich war. Jemals in solch bunter Bettwäsche zu schlafen, wo Vögel und Pflanzen sich auf hochwertigem Damast tummelten, schloss ich schon ganz ohne Gefühl von Anspruch von vorneherein aus. Das war nicht unsere Welt, da hatten wir keinen Zutritt. Sehnsuchtsfrei, weil undenkbar.
Auch der Pilz am Bahnhof gehörte nicht zu unserer Welt. Er war ganz neu, mit einem roten, halbkugeligen Dach und dicken weißen Punkten und einem Fenster mit Theke, über die all das gereicht wurde, was man in einem Kiosk so bekommen konnte und sogar noch viel mehr. Sie verkauften Pommes frites in Tüten mit Ketchup oder Mayonnaise, die kamen gerade in Mode, und alleine der Geruch war für mich schon Grund genug, auf dem Nachhauseweg nach der Schule immer eine Weile stehenzubleiben, ohne das Einlaufen des Busses Nummer Zehn aus den Augen zu verlieren.
Im Juli saß ich dann wieder neben Petra in der Dorfschule und alle bewunderten mich wegen meines Ausflugs, auch weil ich window sagen konnte anstatt Fenster.
Die Mädchen aus der Achten trugen ihre selbst genähten Schürzen mit der Stickerei am Saum. Das war die Abschlussarbeit im Handarbeitsunterricht. Bei der Stoffwahl hatte man die Möglichkeit sich für rot-weiß kariert oder blau-weiß kariert zu entscheiden. Die meisten hatten rot genommen, ich wollte mich für blau entscheiden, wenn ich im nächsten Jahr von Frau Roth gefragt werden würde.
Frau Roth war unsere Handarbeitslehrerin und die Mutter von unserem Metzger Roth. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt eine Ausbildung hatte oder eben nur gut stricken, häkeln, nähen und sticken konnte. Ob Metzger Roth schon zu den Dorf-Honoratioren gehörte, konnte ich nicht richtig einschätzen, aber ich hatte zumindest das Gefühl, dass er zu denen gehörte, denen man Achtung entgegenbringen sollte. Ich schwärmte fast ein bisschen für ihn, er schien immer gut gelaunt, und ich wartete, dass ich seinen gold gerahmten Schneidezahn blitzen sah, wenn er lachte. Der Glanz seiner mit Pomade nach hinten gekämmten schwarzen Haare stand in völligem Gegensatz zur blutverschmierten Schürze, die mich immer etwas verschreckte, weil es meine Vorstellungskraft übertraf, dass ein so netter Mann einem Tier den Hals durchschneiden konnte.
Willsche e Sticksche Woscht? Darauf sagte ich nie nein.
Irgendwann hat er dann geheiratet, eine Frau aus einer Zeitungsannonce oder von einem Vermittlerbüro wurde gemunkelt, eine Fremde, die eine Tochter mit in die Ehe brachte. Kann sein, dass das etwas an seiner >Dorfstellung< rüttelte, denn es wurde getuschelt, und auch ich stand die ersten Wochen nur mit gesenktem Kopf vor der Theke. Da war so eine Beklemmung, wie ich sie auch Bärbel aus dem Turnverein gegenüber hatte, deren Eltern geschieden waren, oder gegenüber Frau Siefert aus dem ersten Haus unserer Siedlungsreihe, die Brustkrebs haben sollte.
Frau Roth war alt und hatte graue, in Wellen gelegte Haare. Natürlich trug sie Selbstgestricktes (als ich mich mit dem Frühstücksbeutelchen aus mintfarbener Baumwolle mit einem Fünfernadelsatz durch die Musterfolge quälte, konnte ich mir nicht vorstellen, einen ganzen Pullover zu Ende zu bringen!) und sah immer sehr schick aus, war aber streng. Wenn wir ein paar Reihen selbstständig vor uns hergestickt, gestrickt oder gehäkelt hatten, mussten wir uns hintereinander aufstellen, damit sie, am Lehrerpult thronend, ihr fachmännisches Auge darauf werfen konnte. Wir mussten ganz gehorsam in der Reihe stehen, auch wenn ich es kaum aushalten konnte, meinem Vordermann nicht die Strick- oder Häkelnadel in den Rücken zu bohren. Wir standen dann so still wie bei einer Schul-Reihenimpfung, wo jeder von uns die Hosen voll hatte, wenn er nach ganz vorn aufgerückt war. Auch wenn Frau Roth nicht selten das Geleistete wieder aufribbelte oder das Stickgarn aus dem zerknautschten Aidastoff zog, an eine Impfung kam das lange nicht ran und irgendwann wurde auch aus meinem zur Trapezform neigenden Häkelwerk ein quadratischer Topflappen.
Jeder Jahrgang produzierte, ohne Abweichungen vom Stricklieselzopf über ein Nadelbüchlein, den Pausenbrotbeutel und einem Handarbeitstäschlein bis hin zur Abschlussschürze immer wieder dasselbe. Frau Roth musste zu Hause einen unerschöpflichen Vorrat an Aidastoffen in den Farben hellblau, rot und beige, Stickgarne der Firma MEZ, Baumwolle zum Verhäkeln und Verstricken und Karo-Meterware eingelagert gehabt haben. Wer nicht von Haus aus das Werkzeug mitbringen konnte, wurde auch damit von ihr versorgt. Die Häkel- und Stricknadeln waren von INOX, garantiert rostfrei. Aber die Schweißhände meiner Freundin Petra brachten neben Reißverschlüssen und dem Notgroschen in ihrem Federmäppchen auch dieses Qualitätsprodukt zum Oxidieren. Bei uns gingen die Nadeln ziemlich häufig verloren. Dann gab es richtig Ärger. Mein Vater saß mit aufgestütztem Kopf am Schreibtisch und stöhnte wegen all der Ausgaben und wenn dann auch noch vierzig Zentimeter mal zwanzig Zentimeter Aidastoff zum Besticken anstand, hatte ich schon Angst, den Preis zu diesen Maßen zu erwähnen.
Mein Vater stützte häufig seinen Kopf auf. Meist am Nachmittag, nachdem er die Geschirrberge in der Küche bewältigt hatte, und wir Kinder unsere Hausaufgabenplätze im Wohnzimmer geräumt hatten. Dann nahm er sich den Schreibtischstuhl und schob ihn zur Terrassentür. Den linken Arm über den Bauch verschränkt, und die rechte Hand unter das Kinn geschoben, schaute er in den Garten. Er würde nachdenken, sagte er mir, als ich einmal fragte, warum er nur so rum sitzen würde. Wenn er dann vom vielen Nachdenken müde wurde, fielen ihm die Augen zu, das heißt, eigentlich nur das rechte, beim linken drückte er mit dem Zeigefinger das von Augensalbe tropfende Lid nach unten. Das konnte er nicht mehr alleine schließen, und die ölige Augensalbe sollte es vor dem Austrocknen schützen. Seine komplette linke Körperhälfte funktionierte nicht mehr richtig, nachdem man ihm einen Tumor aus dem Kopf operieren musste. So hatte er einen schiefen Mund, einen schlaffen Arm und ein wackeliges Bein, mit dem er nicht mehr laufen konnte, ohne sich irgendwo festzuhalten.
Wenn wir gelegentlich bei schönem Wetter einen karawanenähnlichen Sonntagsspaziergang machten, schob mein Vater immer den Kinderwagen (der stand bei uns jahrelang zur Verfügung), was Väter seinerzeit niemals freiwillig taten. Aber mein Vater tat es ja auch nicht freiwillig, und ich weiß nicht, ob er überhaupt freiwillig kochte und mit Begeisterung die Wäscheberge wegbügelte. Aber ich weiß, dass er gerne Marmeladen rührte und über zweihundert Gläser im Jahr füllte, wobei jedes einzelne mit einem feuchten Cellophanquadrat, von einem Gummiring fixiert, überspannt wurde. Die Bewegung, wie er mit beiden Händen die in Wasser eingeweichte Folie über die heiße Glasöffnung strich, habe ich heute noch vor Augen. Waren die Gläser abgekühlt, spannte sich das Cellophan trommelhart und beulte sich nach innen. Da sollte ich die Finger davon lassen, was mir selten gelang. Auf die erkalteten Gläser klebte er unleserliche Etiketten. Mit seinem Gekrakel hätte ich auf dem Zeugnis in ›Schrift‹ immer eine Sechs kassiert. So orientierten wir uns an der Farbe, wenn wir ein neues Glas aus dem Keller holen sollten. Dort standen die eingekochten Vorräte in Regalen aufgereiht, die er aus gestapelten Hohlblockziegeln und Baubrettern nicht ohne Stolz selbst konstruiert hatte. Mein Vater legte generell gerne Vorräte an und ich verstand nie, warum wir so viel Salz ganz oben im Speiseschrank hatten. Dann sprach er von der vergangenen Koreakrise, wobei ich weder eine Vorstellung von Korea noch von einer Krise hatte. Jeden Abend steckte auf dem länglichen Terminkalender im Schreibtisch hinter einer Büroklammer ein Einkaufszettel für den nächsten Tag mit den Konstanten:
1 Gelfix (Rücklagen für die Marmeladensaison)
1 Kilo Zucker (Rücklagen für die Marmeladensaison und Blick auf die Weihnachtsbäckerei)
1 Reichenhaller Salz (es musste Reichenhaller sein! Angst vor einer zweiten Koreakrise?)
1 Pfund Mehl (auch mit Blick auf die Weihnachtsbäckerei)
1 Vierpfundbrot von gestern
500 Gramm Rama
Die Rama wurde nicht wegen der Koreakrise ganz nach oben gestellt, die wurde an einem Tag aufgegessen, zusammen mit dem Vier-Pfund-Brot von gestern. Der Bäcker hat sich sicherlich über den Großabnehmer für Altbrot gefreut. Nur manchmal mussten wir ein Frisches nehmen, weil es keines von gestern mehr gab. Dann wurde beim Abendessen wenig gesprochen und viel gegessen, bis mein Vater das Brot im Brotkasten verschwinden ließ. Er musste die knappen Finanzen zusammenhalten, denn seit man bei ihm diesen gutartigen Hirntumor diagnostiziert hatte, welcher etliche Krankenhausaufenthalte nach sich gezogen hatte, war er Frührentner. Ein Wort, das ich benutzte, wie andere Bauer, Maurer, Elektriker oder bei de Seitzwerge in Kreiznach, wenn in der Schule nach den Berufen der Väter gefragt wurde. Was er denn vorher gewesen wäre, wurde dann meist nachgefragt. Mit Schauspieler konnte man im Dorf offensichtlich wenig anfangen. Irgendwann erfuhren auch wir, dass mein Vater ein Zirkusartist gewesen sei, der durch einen Sturz vom Seil das Augenlicht verloren hatte.
Ich fand es ziemlich doof, dass mein Vater Schauspieler war. Er ging abends zur Arbeit (in das Staatstheater Karlsruhe), wenn die anderen Väter nach Hause kamen und ihre Kinder begrüßten, die auf dem Rasenstück vor dem Haus spielten. Die fragten dann nach Hasenbrot und bekamen die in fettigem Butterbrotpapier eingewickelten Reste vom Proviant, den die Väter am Morgen mitgenommen hatten. Allerdings waren die meisten Väter aus unserem Haus beschädigt. Manchmal fehlte ein Arm oder ein Bein, und es gab einen mit einer Augenklappe. Das seien Kriegsversehrte, erklärten meine Eltern und von da an hatte ich Angst vor dem Krieg (auch wenn er schon fünfzehn Jahre vorbei war, wie man mir versicherte) und vor den amerikanischen Soldaten mit ihren Gewehren, die in der Kaserne, nicht weit von der Straßenbahnhaltestelle wohnten.
Obwohl mein Vater nicht kriegsversehrt war (Kriegsversehrte wurden bevorzugt), bekamen wir in dem Haus am Hirtenweg eine Wohnung im vierten Stock eines von sieben identischen grauen Nachkriegsbauten mit zwei Hauseingängen und Balkonen auf der Rückseite. Meine Eltern waren überglücklich nach Jahren der Untermiete in der Heidelberger Altstadt, wo sie mit einem alten Lederkoffer als Tisch ihre Ehe starteten und mit meinem Bruder Gregor und mir die Grundsteine für eine kinderreiche Familie legten.