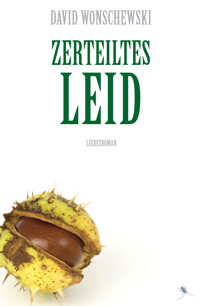9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Periplaneta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Periplaneta
- Sprache: Deutsch
Der verhaltensauffällige Abiturient Frankenfelder begeht im Jahr 1997 eine extraordinäre Anzüglichkeit. Was dazu führt, dass die Organisation rechtschaffener kontinentaleuropäischer Männer (OrkM) ihren Undercover-Mitarbeiter Krebs mit der „zeitnahen Entsorgung“ Frankenfelders beauftragt. Allerdings sieht IM Krebs in Frankenfelder keine große Gefahr für die Nation, sondern einen theatralischen Jüngling, der nur etwas zurechtgebogen werden muss. Ein kleiner weiblicher Anreiz hier, ein wenig kapitalistische Sehnsucht dort und schwupp würde er zu einem vollwertigen Mitglied des Staates werden. Hinbiegen könnte Krebs das – schließlich sind die IMs auf Gedankenmanipulation spezialisiert. Ein zu Gefährlichkeit neigender Charakter wird so lange beschattet und mental drangsaliert, bis er in sich zusammenfällt und in der Masse untergeht. Doch Frankenfelder entpuppt sich als harter Brocken, der in seinem Denken stetig weiter eskaliert. Eine „zeitnahe Entsorgung“ wird Krebs 20 leidvolle Jahre kosten. Eines Tages ist Frankenfelder endlich weg. Und plötzlich ist es Krebs, der sich beobachtet fühlt, und eine Angst überkommt ihn, dass Frankenfelder gar nicht tot ist, sondern das Spiel einfach rumgedreht haben könnte … David Wonschewski ist zurück. Sieben Jahre nach „Zerteiltes Leid“ erschafft der Meister des psychisch auffälligen Kammerspiels einen neuen, verstörenden Mikrokosmos, in dem nicht nur seine Protagonisten auf der imaginären Psycho-Couch liegen. Liedermacher Christoph Theussl hat dem Roman einen sechs Lieder umfassenden Soundtrack spendiert, der, neben weiteren digitalen Inhalten, via QR-Codes abrufbar ist..
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
periplaneta
„Blaues Blut“ ist als Papier-Buch ein multimedial gestalteter Roman. Sie können während der Lektüre die QR-Codes mit Ihrem Smartphone oder Tablet scannen. Es erwarten Sie MP3-Files und Videos.
Für diese E-Book-Version stellen wir Ihnen den Soundtrack von Christoph Theussl als Soundcloud-Link zur Verfügung. Sie können den folgenden QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet scannen. Haben Sie die Soundcloud-App installiert, öffnet sich diese. Sie können die 6 Lieder, die als Eröffnung der Kapitel gedacht sind (plus einen Song für die Credits), aber auch mit Ihrem Internetbrowser anhören.
Christoph Theussl "Frankenfelder-EP" - Der Sound zum Buch 1997
David Wonschewski
Blaues Blut
Eine Biedermeiersehnsucht
periplaneta
DAVID WONSCHEWSKI: „Blaues Blut“ 1. Auflage, März 2022, Periplaneta Berlin, Edition Periplaneta © 2022 Periplaneta – Verlag und Medien Inh. Marion Alexa Müller, Bornholmer Str. 81a, 10439 Berlin periplaneta.com Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Übersetzung, Vortrag und Übertragung, Vertonung, Verfilmung, Vervielfältigung, Digitalisierung, kommerzielle Verwertung des Inhaltes, gleich welcher Art, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags. Lektorat, Korrektorat: Thomas Manegold, Marion Alexa Müller Cover, Satz & Layout: Thomas Manegold Coverbilder: Jeremy Bishop (Mensch), Isabel Galvez (Oktopus)- (Unsplash.com) Musik zum Buch by Christoph Theussl (theussl.de) Gesang, Gitarre, Drums (Track 2), Banjo (Track 6): Christoph Theussl Leadgitarre, Bass (Tracks 1 & 2): Erich Gramshammer © periplaneta 2022 All rights reserved Made in Berlin, Germany print ISBN: 978-3-95996-219-3 epub ISBN: 978-3-95996-220-9
Vorspiel
Und nun schau dich an. Wie du hier liegst, mit Messer im Körper. Hinterhältig darniedergestochen wie Julius Cäsar. Oder Marat. Nein, warte, viel zu heroisch. Du denkst schon wieder zu groß. Nimm eine andere Vergleichsgröße. Eine, die sich besser geziemt. Nimm Kaspar Hauser. Ein linkisch durch die Welt stolpernder Blödmann er, ein linkisch durch die Welt stolpernder Blödmann du. Abgestochen von düsteren Mächten, denen das, was aus euch hätte werden können, ein Dorn im Auge gewesen ist.
Eine Situation, so vorhersehbar wie unappetitlich: das Messer, dein aufgeschlitzter Bauch. Die übelriechenden Innereien, die zwar nicht zum Vorschein kommen, ihr ekelhaftes Dasein aber nicht länger verheimlichen können. Ein Pflaster wird nicht helfen. Nähen ebenso wenig. Ist die Bauchdecke erst einmal auf, ist sie auf. Das unrühmliche Ableben deiner Person ist eingeleitet.
Dir steht der Sinn nach Drama und Verzweiflung. Auch das ein eitler Wunsch. Denn du bist die Ruhe selbst. Was für ein Betrug. Wie oft hast du im Fernsehen jemanden, von einem Messer tief und heimtückisch getroffen, niedersinken sehen. Zu einer schmerzverzerrten Fratze entstellt die Züge, weit aufgerissen die Augen. Mit Pupillen, die aus dem Schädel zu springen scheinen. Dass jeder andere Tod besser ist als der durch Erdolchen, hast du gedacht, wann immer du es vor der Mattscheibe hattest mit ansehen können. Doch nun, da dir selber ein Messer im Leibe steckt, erweist sich diese Art des Dahinscheidens als geradezu unprätentiös, an Beiläufigkeit kaum zu überbieten. Das hattest du dir bedeutend spektakulärer vorgestellt. Hattest mit mehr Horror, mehr Schlitzerromantik gerechnet. Zersplitternde Knochen, ein zerberstender Brustkorb, schlangenhaft aus deiner Leibesmitte emporschießende Eingeweide, singende Englein, brüllende Agonie. Zeter und mordio, das große „Vater, warum hast du mich verlassen?“
Doch nichts von dem will eintreten. Stattdessen liegst du einfach da. Verreckst in aller Seelenruhe.
Das immerhin ist verblüffend. Da durchdringt dir ein blitzescharf geschliffener Fremdkörper aus Stahl dein Haut-, Muskel- und Fettgewebe. Touchiert die Leber, tranchiert die Milz. Und alles, was du dafür übrig hast, sind nüchterne Betrachtungen.
Weder Schmerzen noch Panik wollen aufsteigen in dir. Du fahndest nach einem Hauch von Bedauern in deinen Gedanken. Und findest nicht einmal den.
Ob die Reibungslosigkeit dieses gewaltsam an dir vorgenommenen Aktes nun deiner körperlichen Weichheit zu verdanken ist oder der Qualität des Messers, das weißt du nicht. Es machte flutsch, die Klinge steckte, du fielst hin, bliebst liegen. Das einzige, was dir nun schmerzt, ist dein Hinterkopf, derbe aufgestoßen beim Fall.
Eindruck hinterlassen will der sterbende Mensch. Doch das sieht schlecht für dich aus, Frankenfelder. Keinerlei Action fürs reichlich gezahlte Lebenslehrgeld steht in Aussicht. Einer sticht. Ein anderer fällt um. Bumm. Aus die Maus. Ende im Gelände. Sollte dir in den letzten Minuten deiner Existenz nicht noch ein feiner Kniff einfallen, ein weiterer grenzgenialer Dreh, dein Tod wird wie dein Leben gewesen sein: ganz spannend, summa summarum aber für die Katz.
Sicherlich, du könntest schreien, den Atem hast du noch. Vor Wut, vor Freude, egal. Hauptsache Performance, Hauptsache Music for the Masses, HauptsacheOpium fürs Volk.Wie am Spieß losbrüllen könntest du. Und niemand nähme es dir krumm, so mit Messer im Bauch. Doch das wäre Theater, wäre viel Lärm um nichts. Denn dir tut gar nichts weh. Und überrumpelt worden bist du auch nicht, so hinterhältig war die Attacke auf dich gar nicht. Du hast es kommen sehen. Sogar zur Seite hättest du noch springen, es auf einen Kampf hinauslaufen lassen können. Das war dir aber irgendwie blöd erschienen. Hatte sich nicht plausibel angefühlt, so als Reaktion auf einen tätlichen Angriff auf deine Person.
Nein, neben dem ausbleibenden Schmerz wird auch der ausbleibende Schock dich nicht ins lautstarke Wehklagen bringen. Wirkung zeigt er dennoch, der mit kräftigem Schwung ausgeführte Hieb, der knapp oberhalb deines Bauchnabels in dich hineindrängte. Wie ein Betonblock liegst du auf dem Teppichboden, kalt und schwer und bewegungslos. Die Klinge steckt dir tief im Leib. Du kannst sie nicht sehen, spüren schon gar nicht. Du schlussfolgerst sie. Anhand des Griffs, der dir aus der Bauchdecke ragt und den du so eben noch erkennen kannst in dem knapp bemessenen Sichtfeld, das dir dein steifer Hals und dein starres Gesicht noch gestatten. Nun ist es keine Paranoia, keine Wahnvorstellung mehr. Sondern Tatsache. Du wurdest verfolgt! Und dieser Verfolger spürte dich auf, holte dich ein, stach zu! Jubeln möchtest du nun. Immerhin als Rechthaber darfst du sterben! Niemand hat dir geglaubt, wenn du ihnen von den Schatten und den Träumen erzähltest. Von den Männern ohne Gesicht, immer hinter dir; von den heuchlerisch mit den Gesäßen wackelnden Frauen, immer vor dir; von der Übelkeit, die all das in dir erzeugte.
Du weißt, dass dir nicht mehr viel Zeit bleibt. Die Gedanken, die du jetzt denkst, werden auch die sein, die du mit ins Grab nehmen wirst. Was Epochales willst du darum denken. Nicht zürnend nach hinten schauen. Wie ein beim Duell erschossener Gentleman willst du sie angehen, deine letzten Minuten. Nicht auf Rache sinnen. Dich viel lieber an deinem Widerstandsgeist erfreuen, der sie so viele Jahre gekostet hat, dich zu beseitigen. Doch, oh weh, es ist nur abgegriffener Schmarrn, der dir einfallen will.
Krieg den Palästen. Wir sind das Volk. Du bist Deutschland.
Peinlich für einen, der sich so gern als originärer Kämpfer ausgab, jedoch nichts zuwege brachte. In Würde sterben geht anders.
Was einem doch so an Unschicklichkeiten widerfahren kann, hier in der Provinz, denkst du stattdessen. Dass es vielleicht doch keine so gute Idee gewesen war, zurückzukehren, mitten hinein in die westfälische Einöde. Dich mit Frau und Kindern zu umgeben, als seien sie Tarngestrüpp. Und du ein untergetauchter Soldat, auf ewig unauffindbar.
Nein, du bist nicht allein. Das wäre ja noch schöner. Gestalten bevölkern den Raum, in dem du stirbst. Neugierig blickst du zu ihnen empor. Ist es euer Wohnzimmer? Ist es das Bad? Oder bereits die Leichenhalle? Du weißt es nicht. Nur, dass es sich, bedenkt man, wie übel du zugerichtet worden bist, gar nicht unübel hier liegenlässt. Du hättest deinen Arsch darauf verwettet, dass sie dich mit einem Genickschuss richten und dich dann einen Abhang hinab in ein Massengrab hinabrollen lassen. Das ist es, worauf du dein Leben lang hingearbeitet hast.
Doch du liegst sanft gebettet auf einem Teppich. Flokati. Und ereilt hat dich auch keine Kugel der Juntasystemfaschisten. Nein, ein Messer von derart erlesener Qualität erstach dich, dass du es, nun im Sterben liegend, auf einen Warenwert von gut und gerne achtzig bis hundertzwanzig Euro taxierst. Wie wenig klassenkämpferisch sich das doch ausnimmt. Und wie sehr nach Mord in besserer Gesellschaft es ausschaut.
Du liegst ruhig, du liegst gemütlich. Wie betäubt hinwegdösen könntest du nun. Wenn doch diese Bambule um dich herum nicht wäre. Dieses dich umlagernde Tohuwabohu.
Jemand weint. Und jemand anderes schreit. Hektisch wird nach einem Krankenwagen telefoniert. Ein großer Aufruhr herrscht, neben dir, über dir, rings um dich herum. Chaotisches Treiben. Das muss die Action sein, die du dir für deinen Todeskampf bestellt hattest. Nur dass sie nicht dich erfasst, sondern die Deinigen. Sieh sie dir an! Alle sind sie da. Alle sind sie gekommen, um angesichts deiner Niedergestochenheit quer durch die Bank sauber die Fassung zu verlieren.
Doch du willst nicht schlecht denken über die Deinigen. Ihre Anwesenheit in deinen letzten Lebensminuten ehrt dich. Ihre Bereitwilligkeit, sich durch zielloses Herumgehopse und seihendes Wehklagen bereitwillig zu Trotteln zu machen, tut ihr Übriges. Sterbebegleitung der unterhaltsamen Art, so von unten betrachtet. So also bringt man die, die man liebt, zum Tanzen. So hilft man ihnen auf die Sprünge. Mord zahlt sich aus.
Schau, deine Frau ist da – die Schöne! Die Kinder sind da – die Süßen! Und sogar der Hund, der blöde. Springt um dich herum, schnüffelt an dir. Kratzt dir, wie du siehst, den Unterarm blutig, leckt dir, wie du siehst, den Hals ab. Jault das Jaulen, das dir in diesem Augenblick viel besser zu Gesicht stünde. Will Leckerlis haben. Will Gassi gehen. Ist und bleibt Dreckstöle. Kann nicht hinaus aus seiner Dreckstölen-Rolle. Erschießen wollen hast du das Viech, mit jedem neuen Tag, den der nichtexistente Gott anbrechen ließ, wurdest du von einer größeren Lust erfasst, dieses so sklavisch um Liebe bettelnde, dauerkackende Sabbertier über den Haufen zu schießen, einen Abhang hinunterrollen und in einem Erdloch verrecken zu lassen. Oh, das Recht dazu hättest du gehabt, schließlich hast du nie einen Hund gewollt! Die Kinder, die du auch nie wolltest, die wollten den Hund. Dass du die Töle nicht auf einem Acker erschossen und in irgendeine Grube hinabkullern lassen hast, ist keineswegs deinem großen Herzen zu verdanken, sondern einzig und allein deinem Wissen, dass ein Hundemord sie auf den Plan gerufen hätte. Ihnen unbotmäßig früh einen Hinweis darauf gegeben hätte, wo du ein Versteck gefunden, wo du vor ihren Häschern in Deckung gegangen warst. Ach, welch Ironie des Schicksals das doch ist – gefunden haben sie dich dennoch, umgebracht auch. Und die Töle springt und sabbert und lechzt, weiter ungesühnt, weiter ungestraft.
Auch Cosmin und Cristina sind da. Du erkennst sie, wie eingefroren tragen sie jene Gesichtsausdrücke mit sich herum, die du ihnen im Frühjahr 2016 hinterlassen hast, als du aus der Großstadt türmtest, um hier in Hönningstrup in Deckung zu gehen.
Und, überraschend früh und noch vor den Notärzten vor Ort: der Kommissar. Das nennst du einen Riecher. Das nennst du einen Instinkt. Im beigen Trenchcoat und mit tief ins Gesicht gezogenem Schlapphut nimmt er bereits die Ermittlungen auf. Dabei bist du noch gar nicht fertig mit Sterben.
Ja, sie alle sind gekommen. Du siehst sie kaum, hörst sie aber. Witterst die Gegenwart deiner Lieben, die anlässlich deines Ablebens wild und wirr durcheinanderlaufen. In Überraschung, in Verzweiflung, in Trauer und Zorn.
Nur einer nicht. Einer von ihnen treibt ein doppeltes Spiel. Sitzt direkt neben dir am Tisch, so nah, dass du nur die Knie sehen kannst. Kippelt mit gemimter Nervosität auf dem Stuhl. Ätschebätscht sich in Wahrheit aber eins.
Das ist er. Der, der dir in einem Augenblick, als keiner hinsah, das Messer in den Bauchinnenraum drückte. Anstatt dem Tatort zu entfliehen, verhöhnt dich stuhlkippelnd nun dein Mörder.
Ergreift ihn! – willst du nun rufen. Das ist mein Mörder! OrkM!
Doch das Aufspringen, das Rufen, das Fingerzeigen, all das funktioniert schon nicht mehr. Und deinen Lieben zu erklären, was OrkM überhaupt ist, ach, vergiss es. Sie haben es dir früher nicht geglaubt, sie werden es dir weiterhin nicht glauben. Also stammelst du, hustest, keuchst es in unverständlichen Fetzen mehr aus dir heraus, als dass du es sagst. Folgenlos. Niemand interessiert sich für deine letzten Worte, keiner enttarnt den unheimlichen Ätschebätscher. Wie auch?! Reiht sich hier doch Grimasse an Grimasse. Ist die schmerzbrüllende Visage des einen von der glotzenden und gaffenden Fresse des anderen kaum zu unterscheiden. Regelrecht unter geht der Ätschebätscher in dieser Kollektion aus den Fugen geratener Gesichter. So schöpft niemand Verdacht, wähnt niemand den Mörder noch am Ort, bedenkt niemand die Macht des OrkM. Zu sehr damit beschäftigt, sich die Haare zu raufen sind deine Lieben, um zugleich auch noch über den Tellerrand menschlichen Auffassungsvermögens hinauszuspähen. Unterwanderung heißt deshalb Unterwanderung, weil die Unterwanderten nichts mitbekommen davon. Mitwandern, ohne zu ahnen, dass die Wege, die sie beschreiten, keine frei gewählten Wege mehr sind.
Du kannst dich selbst sehen. Ob das logisch ist, das weißt du nicht. Aber es geht. Nun schwebst du einen halben Meter über deinem gemeuchelten Leib. Siehst dich sterben. Wie malerisch du aussiehst, so von blanker Klinge danieder gestreckt. Pittoreskes, in zäh aus dir herausfließendem Dunkelrot getauchtes Stillleben.
„Mensch mit Magenmesser, liegend“, betitelst du das Gemälde, das du abgibst. Nicht Öl auf Leinwand, nein, authentischer. Blut auf Teppich. Hönningstrup, Sommer 2017.
Ach, immerhin schwindet dir nun der Geist. Wurde auch Zeit. Ist schließlich kein Zustand, so liegend, so blutend. So verhöhnt und doch bei Sinnen. So also ist das, wenn einer abgestochen wird wie ein Schwein.
Warum du nun sterben musst, warum der Ätschebätscher ausgerechnet jetzt das Messer nahm und es dir in den Bauch rammte, das weißt du nicht. Gründe genug hätten sie alle gehabt, einer wie der andere. Sogar der Hund, der blöde. Gerade der.
Und nun sieh’ sie dir an, die honorable Gesellschaft! Aufgereiht wie in einem Agatha-Christie-Stück stehen sie da, alle beieinander, alle versammelt. Machen einen auf bestürzt, auf zu Tode betrübt. Verschwenden so keinen Gedanken daran, dass der klingenschwingende Ätschebätscher unter ihnen sein könnte.
Und decken damit den klingenschwingenden Ätschebätscher unter ihnen. Heuchlerisches Mörderpack! Schaustellertrupp!
„Nein“, wirst du dem Kommissar sagen, so er dich doch noch fragen sollte, „gesehen habe auch ich nichts. Ich stand dort, mit dem Rücken zum Ätschebätscher, wendete mich jäh herum, empfing auch schon die Klinge, nahm sie in mich auf, sah sie in mir verschwinden, fiel.“
Genau das wirst du sagen, denn es entspricht der Wahrheit. Es könnte Cosmin gewesen sein, deine Frau oder, das wäre doch eine nette Pointe, der Kommissar höchst selbst. Wo er doch so verdächtig früh am Tatort aufgetaucht ist, der werte Herr Staatsbedienstete, der werte Herr Beamte! Kann doch kein Zufall sein.
Der Kommissar aber, du kennst den Idioten, wird dir auf deine Zeugenaussage hin antworten, dass ihm deine Aussage zu subjektiv sei, um den Block zu zücken, sie zu notieren. Zudem sei dein Standpunkt der Standpunkt eines Ermordeten. Von allenfalls eingeschränkter Beweiskraft, nur bedingt zurechnungsfähig seiest du im Moment deines Ablebens gewesen. Und vor Gericht erscheinen könntest du auch nicht mehr. Eher die Kinder, die Süßen, den Hund, den Blöden oder den Stuhl, den Kippelnden könne er da befragen. Als dich. Also wirst du dich zusammenreißen, ein wenig in deiner Grammatik herumpfuschen, das unglaubwürdige, redselig daherschnatternde Ich tilgen, dich selbst in die dritte Person Singular setzen und wiederholen: „Herr Kommissar! Er, der so mir nichts dir nichts Dahingemeuchelte, er hat nichts gesehen. Er stand mit dem Rücken zum Ätschebätscher, wendete sich jäh herum, empfing auch schon die Klinge, nahm sie in sich auf, sah sie in sich verschwinden, fiel.“
Und der Kommissar wird raunen: „Aha. Recht so. Fein so.“
Du weißt nichts. Hast jedoch eine Theorie, wie hier eines zum anderen führte. Und bis der Krankenwagen oder der Tod oder auch beide zugleich eintreffen, hast du Zeit, dieser Theorie nachzuhängen.
1. Kapitel
IM Krebs über Frankenfelder 2016
Denke ich zurück an Frankenfelder, so sehe ich nicht den jungen Frankenfelder vor mir. Sondern den Frankenfelder des Jahres 2016. Den Frankenfelder, wie ich ihn einen Tag und eine Nacht hindurch im Frühjahr jenes Jahres erlebte: eindeutig von Sinnen und doch unwiderlegbar glücklich.
Ich sehe ihn vor mir, an jenem Tag und der darauffolgenden Nacht, wie er sich mit Cristina und Cosmin in dieser viel zu kleinen Wohnung aufhält. Erst auf seiner Matratze sitzt, dann steht. Schließlich liegt. Nichts anderes als diese eine verdammte Matratze mehr besitzt, von der er sich aufzustehen über Tage geweigert hat. Bis Cosmin und Cristina auftauchten. Begannen, ihn zu bearbeiten.
Ich stieß erst später hinzu. Beobachtete die drei, lange, intensiv. Studierte jedes ihrer Worte, eine jede ihrer Bewegungen. Griff zunächst nicht ein ins Geschehen.
Warum ich nicht eingriff? Ich weiß es nicht. Etwas hielt mich zurück, ließ mich dieser Szenerie fasziniert aus der Ferne beiwohnen. Was genau mich derart untätig schauen ließ, gilt es herauszufinden. Denn der Auftrag, den mir meine Organisation knapp zwanzig Jahre zuvor gegeben hatte, war einleuchtend und klar. Gab keinerlei Anlass zu Interpretation oder gar Zweifel. Deutlich umrissen und geschnitten scharf formuliert stand diese Aufgabe auf dem blassgelben Auftragsblatt, das ich all die Jahre zum ständigen Antrieb und zur ständigen Mahnung in meiner Hosentasche mit mir herumtrug: Zeitnahe Entsorgung des sinnentleerten Nationalbürgers Frankenfelder. Und direkt über diesem Satz ein großes, ein fettgedrucktes E.
Mehr stand dort nicht. Nichts zu deuteln gab es daran.
Dass nicht nur die Welt, sondern auch Frankenfelder selbst vor Frankenfelder gerettet werden muss und dass er im gleichen Maße wie vor sich selbst auch vor Cosmin und Cristina gerettet werden muss, jeder vor jedem gehörig in Deckung zu gehen hatte, erkannte ich erst später. Zu spät.
Wie eingepfercht sehe ich die drei in meiner Erinnerung, dort in Frankenfelders kleiner Wohnung. Eine unheilvolle Ménage-à-trois. Derart fruchtlos miteinander verbandelt und verwoben, dass nichts anderes als desaströse Lebenslust die Folge sein konnte.
Da ist eine Tür, natürlich ist da eine Tür, ich sehe sie noch genau vor mir. Doch keiner der drei tut, was dringlich geboten gewesen wäre: Keiner geht. Und wenn in einer bedrohlichen Situation keiner geht, dann ist es unabdingbar, dass ein weiterer kommt, um für Ordnung zu sorgen. So verhält es sich nun einmal bei den Menschen und ihren selbsterschaffenen Konfliktsituationen. Und dieser andere, der kommen, hinzustoßen und für Auflösung sorgen musste, der war ich.
Frankenfelder ist an jenem letzten Tag, jenem Frühlingsmittwoch, als erster in der Wohnung. Natürlich ist er das, ist er doch ihr vorrangigster Bewohner. Dann aber kommt Cosmin und schließlich, wenige Stunden später, Cristina. Verabredet sind Cristina und Cosmin nicht gewesen. Im Gegenteil, sie hassen einander. Oder aber bilden sich – einer wie der andere – zumindest ziemlich überzeugend ein, einander dringend loswerden zu müssen. Doch genau das gelingt ihnen nicht. Anstatt sich in alle Winde zu zerstreuen, Cristina nach Süden, Cosmin nach Osten und Frankenfelder – ja, wohin mit Frankenfelder? – verbarrikadieren sie die Tür, wohl wissend, dass nur einer von ihnen nach einem Tag und der darauffolgenden Nacht wieder ins Freie treten, eine Zukunft unter den Menschen haben wird. Ein Irrsinn, nicht wahr?
Der schöne Cosmin. Die ernste Cristina. Und natürlich Frankenfelder. Alle Adjektive dieser Welt simultan auf sich vereinend. Und zugleich kein einziges.
Ja, so sehe ich Frankenfelder vor mir, wenn ich an ihn zurückdenke. An diesem letzten Tag, in dieser sich anschließenden letzten Nacht. Engumschlungen mit Cosmin und Cristina, erst tanzend, dann im Liebesakt, schlussendlich, als ich dazu komme, kämpfend.
Möbel sind keine mehr in der kleinen Wohnung, Frankenfelder hat sie allesamt entfernt. Stück für Stück, eines nach dem anderen. Geblieben sind ihm nur die Wände, die ihn umgeben, ein Fußboden, der ihn hält, eine Zimmerdecke, die ihn zu zermalmen trachtet, sowie Fenster und Tür, die ihm ein Draußen vorgaukeln, an das er längst nicht mehr glaubt. Nicht zu vergessen die Matratze. Natürlich die Matratze. Sein letzter Besitz.
Er hat mir zu erklären versucht, warum er nicht mehr leben konnte und nicht mehr leben wollte mit Möbeln in seiner Wohnung. Verstanden habe ich es nicht.
Und so tanzten die drei an jenem letzten Tag und in jener letzten Nacht in dieser so abstrus kargen Wohnung. Bevor sie sich schließlich in wildem Liebesspiel über den harten Bretterboden rollen ließen. Ich sehe es noch exakt vor mir, eingebrannt hat es sich in meinem Hirn. Der Tag geht zur Neige und die Dunkelheit hält Einzug in Frankenfelders Wohnung. Lampen gibt es keine mehr, Frankenfelder hat auch sie entsorgt. Alles, was auch nur im Entferntesten in der Lage schien, für Licht zu sorgen, hat er in die große Mülltonne im Hof geworfen. Nicht einmal mehr Glühbirnen gibt es, Frankenfelder hat sie bereits einige Wochen zuvor allesamt kaputtgeworfen. Hatte sich zusammen mit den letzten ihm verbliebenen Gabeln und Messern in die hinterste Ecke seiner leeren kleinen Wohnung gekauert, gezielt, geworfen. Wieder und wieder. Bis er dann, nach auffallend langer Zeit, endlich einen Treffer gelandet, die nackt aus der Fassung ragenden Glühbirnen von der Decke gesäbelt hatte.
Klirr hatte es gemacht und zersprungen war die Birne und die vielen kleinen Scherben waren auf Frankenfelders Zimmerboden gefallen. Und Frankenfelder hatte in seiner Ecke gekauert, mit einem ganz schiefen Grinsen im Gesicht. Hatte sich dann nackt ausgezogen und in die Scherben gelegt. Und sich schließlich, nach einigen Minuten bewegungslosen Liegens, begonnen darin zu suhlen. Ahhh! und Oooh! hatte Frankenfelder gemacht, während er sich darin suhlte, seine Haut wieder und wieder über die scharfkantigen, gezackten kleinen Glühbirnenscherben rieb. Schnell hatten sich kleine Wunden auf Frankenfelders Rücken und auch an seinem Gesäß gebildet und Blut war daraus hervorgetreten. Und kaum hatte Frankenfelder das bemerkt, hatte er sich mit der Spitze seines Zeigefingers in eine seiner eigenen Wunden begeben, bis sein Fingernagel getränkt war von seinem eigenen Blut. Daran gelutscht hatte Frankenfelder dann, sehr langsam und sehr wollüstig hatte er sein eigenes Blut von seinem eigenen Fingernagel gezutscht. Und dann begonnen, sich mit der anderen Hand zwischen seinen Beinen herumzuspielen. Und dann hatte er wieder Ahhh! und Oooh! gemacht. Und ich hatte, als heimlicher Beobachter dieses Vorgangs, hinter einem Vorsprung gekauert und gedacht: Schau an, schau an, der politische Klassenkämpfer Frankenfelder, die Zierde bundesdeutscher Verweigerungs- und Entsagungskultur – ereifert sich an sich selbst, ereifert sich an seiner eigenen Menschlichkeit!
Und dann hatte ich lautlos kichern müssen. Damit aber sofort aufgehört, als ich mich zu fragen begann wie das, was Frankenfelder dort treibt, sich wohl anfühlt.
So nackt. So in Scherben. So blutend. So Ahhh! Und so Oooh!
Das war einige Wochen zuvor gewesen. Nun aber, in dieser letzten Frankenfelder-Erinnerung in meinem Kopf, ist er notdürftig bekleidet und schwitzt. Ich bin mir nicht sicher, wovon er schwitzte, war die Wohnung doch gut gekühlt. Wie auch Cristina gut gekühlt war in ihrer angeborenen Ernsthaftigkeit. Steht in meiner letzten Erinnerung dort an der einen Wand des Zimmers, derweil Frankenfelder und Cosmin ihr gegenüber stehen, an der anderen Wand, auf der Matratze. Keiner spricht ein Wort, alle drei sind die Beherrschung in Person, anfangs. Sieht man einmal von Frankenfelder ab, der schwitzt, als gelte es, in der Stille und der Kargheit seiner Wohnung und unter den intensiven Blicken Cristinas und Cosmins ein Geheimnis zu bewahren. Ein allerletztes Geheimnis, etwas, das nur er kennt, nur er weiß, nur er versteht – und von dem Cristina und Cosmin, die ansonsten alles über ihn wissen und die in ihm lesen können wie in einem Buch, keinen Schimmer haben.
So wie Frankenfelder in jenem Moment schwitzt, so denke ich noch heute, schwitzt nur einer, der entgegen aller Erwartung doch noch ein letztes Stück Würde, einen letzten Rest Anstand, einen kleinen verbliebenen Funken Verstand und Vernunft in sich trägt. Genau das alles nun aber, in einen Hinterhalt gelockt und umzingelt von Feinden, zu verlieren fürchtet.
Neunzehn lange Jahre bin ich hinter ihm hergehetzt, neunzehn lange Jahre habe auch ich ihn bearbeitet. Habe mich, zwar später als Cosmin, jedoch deutlich vor Cristina, nachhaltig in Frankenfelders Leben einzumischen begonnen. Derweil meine beiden Konkurrenten sich als allenfalls partielle Wegbegleiter fühlen dürfen, bin ich ihm nie von der Seite gewichen. Auf Schritt und Tritt gefolgt bin ich Frankenfelder. Und doch hat es fast zwei Jahrzehnte gebraucht, ihn in eine solche von mir gewünschte Finalsituation zu bringen, wie ich sie dann im Frühling 2016 vorfand. So es jemanden gibt, der von sich sagen darf, mehr über Frankenfelder zu wissen als Frankenfelder selbst, so bin das mit Sicherheit ich.
Was genau er dort aber an diesem letzten Tag noch in petto zu haben glaubte, das vermag auch ich nicht mit letzter Gewissheit zu sagen. Allenfalls darüber nachdenken kann ich. Spekulieren.
Und so kann ich noch immer nicht lassen von ihm. Frankenfelder war ein Mann der Fragen, nie ein Mann der Antworten.
Ich sollte ihn eliminieren, ich habe ihn eliminiert. Frankenfelder ist fort. Doch wo er ist, niemand weiß es. Wie sehr nicht mehr auf dieser Welt ist er? Saubere Arbeit habe ich geleistet. Stolz sollte ich sein. Stattdessen aber beginne ich, mir den Kopf zu zermartern. Habe mich in ein ruhiges Zimmer unseres Hauses verzogen. Den Laptop aufgeklappt. Ein neues Textdokument angelegt. Und schreibe nieder, was mir noch einfällt. Latsche grobschlächtig durch die Geschichte, die mich mit Frankenfelder verbindet. Und hoffe, zufällig doch noch auf jene Antwort zu treten, die Frankenfelder mir weiterhin schuldig ist.
Ist es das schlechte Gewissen? Möglich, ja. Ist doch jeder noch so grandiose Erfolg mit einem kleinen Makel behaftet. Jeder Triumph, jeder noch so rechtschaffen verbreitete Gottesglaube, ja sogar jegliches Liebesglück, alles wird auf dem Rücken eines Anderen, zum Schaden und zum Leidwesen eines Beteiligten oder Unbeteiligten erreicht. Selten sieht man es sofort, dieser dreckige Makel. Freude und Lust und Gier überstrahlen alles. Doch es ist da, wo immer ein Lächeln entsteht, wo immer ein Freudensprung durchgeführt wird, drückt es jemanden in den Staub, mit dem Gesicht voran in die Verzweiflung. So verbunden sind die Menschen miteinander, dass der Erfolg des einen stets die Niederlage eines anderen ist.
Ein einziges Tauziehen ist das menschliche Miteinander.
In der Geschichte von Frankenfelder, Cosmin, Cristina und mir bin ich der Sieger. Niemand würde das bezweifeln, nicht Cosmin, nicht Cristina, schon gar nicht Frankenfelder. Ich springe in die Luft, balle meine Hand zur Faust des Siegers, rufe: Juhu! Doch Freude verspüre ich nicht.
Nachdem ich Frankenfelder auftragsgemäß eliminiert, ihn unschädlich gemacht und nach besten Kräften enteiert hatte, damals, im Sommer 2016, da knallten in unserem Institut die Sektkorken. Ich bekam meine Beförderung und meine Gratifikation, der Generalmajor klopfte mir vor der versammelten Mannschaft auf die Schulter, rief bollenstolz und theatralisch zugleich: IM Krebs ist unser Maaaann! Und ich sah ihn an dabei und er mich. Und augenblicklich wurde mir klar, was seine Augen verrieten: Dass die Lösung eines Problems stets ein neues Problem gebiert. Und dass Frankenfelder zwar erfolgreich eliminiert und nach Leibeskräften enteiert worden, fort, fort und noch mal fort ist. Aber eben nicht: weg.
Wenn fort jedoch kein Zustand und weg keine Richtung ist – wo verdammt ist Frankenfelder dann? Das begann ich mich noch am Abend unserer rauschenden Siegesfeier, die Beförderungsurkunde in der einen, ein Sektglas in der anderen Hand, zu fragen. Wir töten nicht, wir eliminieren. Säbeln so lange an den Ecken und Kanten eines Individuums herum, bis es sich als enteiertes Subjekt in die Gesellschaft zurückpressen lässt. Richtiggehend hineinflutschen muss das Individuum. Sich großartig vertun, womöglich gar Fehler begehen kann man da nicht. Macht es nicht ordentlich, flutsch, so sind noch Eier dran. Schlimme Sache. Je geschmeidiger es zurückflutscht, desto größer die Gratifikation, desto heftiger das Schulterklopfen des Generalmajors. Und Halleluja ist Frankenfelder, kaum war ich fertig mit ihm, geflutscht. Wie ein Wassertropfen, den man zurück ins Meer wirft, sah Frankenfelder aus, als ich mich mit einem Siegerlächeln nach neunzehn Jahren intensiver Arbeit von ihm verabschiedete. Im Frühjahr 2016.
Ich habe gewonnen. Doch, wie ich es auch drehe und wende, so sehr ich mich an meinem Erfolg zu berauschen versuche, der von mir erwünschte Zustand der Befriedigung mag sich nicht einstellen.
Ich war nicht der Schnellste, neunzehn Jahre Bearbeitungszeit sind ein ziemlicher Brocken, keine Frage. Immerhin gut habe ich meine Arbeit gemacht. Nahezu perfekt. Genau das aber ist das Problem. Ich habe Frankenfelder eliminiert, alle Spuren verwischt. So gut, dass nicht einmal ich selbst ihn noch wiederfinden könnte. Frankenfelder ist ein hervorragend funktionierender Bestandteil unserer Zivilgesellschaft geworden. Derart gut integriert ist Frankenfelder, dass er jetzt in diesem Augenblick vor mir stehen könnte. Und ich ihn nicht erkennen würde vor der kalkweißen Wand dieses stillen Zimmers, unseres häuslichen Ruheraums.
Und so baldowert Frankenfelder, dieser von mir selbst eliminierte Hund, mir noch immer unter meiner Schädeldecke herum. Als wären 19 Jahre Verfolgungsjagd für die Katz gewesen, treibt er sein Unwesen in meinen Gedanken. Und ich sorge mich, so ich diese Gedanken nicht besonnen aufs digitale Papier bringe, dass es mich den Schädel kosten könnte, ich zwar Frankenfelder und die Gesellschaft gerettet habe, jedoch zu dem Preis, dass ich darüber selbst zum matratzenhockenden Frankenfelder werde.
Also haue ich in die Tastatur. Wälze mich – obschon es mich weiterhin reizt – nicht nackt in Scherben. Wozu mich selbst spüren, so intensiv, so ungefiltert wie Frankenfelder dereinst? Führt doch zu nichts als Eiter und schorfigen Narben.
Ab und zu träume ich dennoch davon. Doch verfüge ich nicht über diese Brutalität, die Frankenfelder sich selbst gegenüber anzuwenden imstande war. Alles, was ich kann, ist durchdenken und tippen. Und wieder Durchdenken und wieder Tippen. Anstatt meinem echten Roten mein falsches, mein Ersatzblut aus mir herausfließen lassen. Gewählt habe ich eine mittlere Schriftgröße, gewählt habe ich auch einen einfachen Zeilenabstand. Ersetzt habe ich jedoch das standardisierte Schwarz der Laptopschrift. Grün wäre lächerlich, für Rot bin ich noch nicht bereit. Schwarz hingegen ertrage ich nicht mehr. Eingetauscht habe ich es also gegen ein kräftiges, ein dunkles Blau. Füllfederhalterblau strömt es mir nun mechanisch aus den Fingerkuppen. Blaues Blut.
Ich schreibe. Beschreibe, wie sie dort stehen, die drei. In dieser leeren, kühlen Wohnung. Und Cristina schaut Frankenfelder und Cosmin an und Frankenfelder schaut Cristina an, derweil nur Cosmin, der schöne, der überragende Cosmin sich mal wieder für niemand anderen als sich selbst interessiert. Nichts weiter als Spott und Hohn und Überlegenheit und Spaß im Schilde führt. Und es nicht einmal zu verheimlichen versucht. Der geborene Hedonist.
Und Cristina, gerade erst nach einem zaghaften Anklopfen zur Tür hereinkommen, sagt, an Frankenfelder gerichtet: Und, hast du mir nichts zu sagen?
Und Frankenfelder, schwitzend und wie peinlich berührt, geht hinter Cosmin in Deckung. Greift sich an den Schädel, ruft dann: Nein, ich habe Ihnen nichts zu sagen! Sie können mir nicht helfen. Gehen Sie bitte!
Doch Cristina geht nicht. Vielleicht weil sie nicht möchte, vielleicht weil Cosmin sie nicht gehen lässt, ich bin mir nicht sicher. Vermutlich trifft beides zu, denn Cristina hasst Cosmin und sie liebt Frankenfelder. Und noch immer zerreißt es ihr das Herz, dass sie allein auf der einen Seite dieser so eigentümlich entleerten Wohnung, die vor gar nicht langer Zeit auch ihre Wohnung gewesen ist, stehen muss. Während auf der anderen Seite Frankenfelder und Cosmin stehen. Cosmin noch nicht so lässig wie später, als ich auftauche. Und Frankenfelder noch nicht so fahrig und nervös, stattdessen wie in flagranti ertappt. Innig mit und in Cosmin verschlungen und verhakt. Als ein Herz. Und eine Seele. In der zunehmend in dieser Wohnung Einzug haltenden Dunkelheit für Cristina kaum noch zu entwirren, kaum noch als zwei, sondern mit jeder verrinnenden Minute nur noch als eine Person zu erkennen. Als ein einziger dunkler, ein in sich verkeilter Cosmin-Frankenfelder-Klumpen.
Exakt so wie Cristina Frankenfelder gesehen haben muss, im schwindenden Licht eines sterbenden Tages, gemeinsam mit Cosmin an der ihr gegenüberliegenden Wand auf der zerlumpten Matratze stehend, so habe auch ich mir Frankenfelder in meinen Erinnerungen bewahrt.
Warum gerade so? Nun – ich weiß es nicht. Vielleicht weil ich an jenem Abend zum ersten Mal nicht nur wie Cristina sah, sondern auch wie sie fühlte. So oft habe ich sie verflucht, für all die Liebe, mit der sie diesen dem Untergang geweihten Frankenfelder jahrelang überzogen hat. Verflucht für jeden einzelnen Kuss auf seine Lippen, verflucht für jede einzelne Umarmung, verflucht für ihren auf groteske Weise nicht zu brechenden Willen. Und ihr Ziel, Frankenfelder zu ihrem Mann zu machen, zu ihrem Partner auf Lebenszeit. Auch ihretwegen hat es mich neunzehn Jahre gekostet. Machte ich einen Schritt nach vorne, warfen Cristinas liebevolle Handlungen mich um zwei Schritte zurück. Um wie viel hilfreicher war da Cosmin gewesen. So widerwärtig er mir auch gewesen ist, die hohe Kunst Frankenfelders Bewusstsein zu Brei zu verarbeiten, beherrschte er noch weitaus besser als ich.
Ich habe einen jeden meiner Schritte bezüglich Frankenfelder sorgsam durchdenken, minutiös vorplanen müssen. Nicht so Cosmin, der ein Instinktzerstörer war. Tat intuitiv immer exakt das, was nötig ist, um Frankenfelder mit einem größtmöglichen Schaden zurückzulassen. Kam stets als Bruder, ging jedoch als Freier. Machte Frankenfelder zu nicht weniger als seiner persönlichen Nutte.
Cristina war ehrlich, liebte Frankenfelder, wie er war, hatte niemals vor, ihn zu ändern. Wollte ihn sogar heiraten. Ein schönes, ehrenhaftes Ziel, durchaus. Aber auch furchtbar naiv. War es doch ein Ziel, das meine eigenen Pläne mit Frankenfelder ungebührlich konterkarierte. Frauen, so bin ich mir heute sicher, waren nicht vorgesehen in meiner eigenen Geschichte, die mich mit Frankenfelder verband. Auch wenn ich mich im Gegensatz zu Cosmin, der sich laut, aufdringlich, polternd und fordernd aufführte, stets respektvoll im Hintergrund hielt, verband mich mit ihm mehr als mit Cristina. Die ich im Gegensatz zu Cosmin zunehmend als Systemfehler zu betrachten bereit bin.
Ja, wie Cosmin so hatte auch ich meine ganz eigenen Pläne mit Frankenfelder, dieser verwirrten, desorientierten Gestalt. Und nichts stand diesen Plänen – denen Cosmins wie meinen eigenen – derart im Wege wie eine liebende, ehrliche und gutherzige Frau.
So also war der Stand an jenem Abend im Frühjahr des Jahres 2016, als Frankenfelder, Cosmin und Cristina in dieser entsetzlich leeren Wohnung aufeinandertrafen. Und sich entschieden, nicht eher auseinanderzugehen, bevor diese ganze unselige Angelegenheit nicht ein für alle Mal geklärt, nicht ein für alle Mal ausgestanden war. Bevor nicht klar war, was es auf sich hatte mit Cristinas fortwährender Ernsthaftigkeit, Cosmins Drang, alles zu übertreiben, alles zu überdrehen, seine Lust am Leben zu einer Last am Leben für die ihn umgebenden Menschen zu machen. Und Frankenfelders auf seine jahrelangen Zornattacken so plötzlich folgende Lethargie, seine von mir minutiös vorangetriebene Teilnahmslosigkeit. Seine Weigerung, die Wohnung zu verlassen, sich überhaupt noch einmal von seiner Matratze zu erheben.
Während ich als heimlicher Beobachter dieser Szenerie hinter einem Vorsprung in einem nicht näher benannten Winkel dieser Wohnung kauerte. Mit zum Zerreißen gespannten Nerven, mich nicht rührend. Penibel darauf achtend, nur nicht entdeckt zu werden. Wo Anwesenheit sich doch so furchtbar gerne selbst verrät.
Ich kauerte also dort. Und protokollierte. Notierte eifrig, was dort vorging in Frankenfelders Wohnung. Klickklackerte es morsend ins Institut. Wartete auf weitere Befehle. Und wie ich dort lag oder stand oder saß oder kauerte, und auf Verhaltenshinweise aus der Zentrale wartete, kam mir der junge Frankenfelder in den Sinn. Der Frankenfelder, auf den ich vor nunmehr 19 Jahren angesetzt worden war.
Und der zu einem Lebensprojekt geworden ist.
IM Krebs über Frankenfelder 1997
An einem Juliabend des Jahres 1997 suchte Frankenfelder seinen Schulfreund Brachwitz auf. Seinerzeit lebte Brachwitz mit seinen Eltern in einem großzügigen Anwesen am Ortsrand von Hönningstrup, einer kleinen westfälischen Gemeinde, von der man weder etwas gesehen noch gehört haben muss. Bezeichnend, dass Hönningstrups einzige Sehenswürdigkeit eine breit angelegte Durchfahrtsstraße ist. Kaum ist man drin in Hönningstrup, so ist man im Grunde auch schon wieder raus aus Hönningstrup. Und sieht, so man dem wenig plausiblen Gedanken verfällt, doch noch einen Blick zurückzuwerfen, an sonnigeren Tagen immerhin noch das brachwitzsche Anwesen im Rückspiegel verschwinden. Entworfen worden war dieses Anwesen von Brachwitz Senior, einem angesehenen Architekten, erstem Vorsitzenden der westfälischen Baumeisterinnung und, derlei Dinge schließen sich selten aus, Choleriker ersten Ranges.
In Hönningstrup, es ist nicht anders zu sagen, wohnten zu jener Zeit nur zwei Arten von Menschen: Ein bisschen langweilig die einen, ein bisschen aufschneiderisch die anderen. Und Vater Brachwitz eben, der auf mysteriöse Weise in beide Kategorien zugleich zu fallen schien. Und dem deshalb eine besondere Rolle zufiel in der 6.000-Seelen-Gemeinde Hönningstrup.
An jenem sonnigen Abend, auf den ich mir hier beziehe, waren die Eltern Brachwitz verreist, sodass Frankenfelder seinen Schulfreund allein vorfand. Das hatte es nie zuvor gegeben, pflegte Vater Brachwitz das von ihm selbstkreierte Heim doch nur ungern zu verlassen. Derweil Mutter Brachwitz zeitlebens von einer Angst um die Beschaffenheit und Sauberkeit ihrer hingebungsvoll behandelten Fußböden und Gardinen getrieben wurde. Besuchte man Brachwitz, so erinnerte sich Frankenfelder später während einer Unterhaltung mit mir, so war es, als bewege man sich auf Eierschalen durch dessen Elternhaus. Entfachte so oder so den Argwohn des cholerischen Vaters oder aber die Verunsicherung der übernervösen Mutter.
Wir erkennen bereits: Brachwitz war keiner jener Schulfreunde, den man einer spontanen Laune folgend aufsuchte. Weder gab es in Zusammenhang mit Besuchen bei Brachwitz ein just for fun, noch ein ich war gerade in der Gegend und da dachte ich mir… Nein, ein Besuch bei Brachwitz musste wohlüberlegt, gut durchkalkuliert sein, einen klaren Grund haben und eine klare Zielsetzung verfolgen. Konnte man das nicht vorweisen, so ließ man es besser bleiben, machte einen großen Bogen um das Anwesen Brachwitz. Ersparte sich jene für das Haus Brachwitz so typische, ewiglich gereizt-angespannte Atmosphäre.
In Rekapitulation jener Juli-Ereignisse des Jahres 1997 gab Frankenfelder später an, er habe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts vom Verreisen der Eltern Brachwitz gewusst, ja sei geradewegs überrascht gewesen als nach seinem Klingeln an der verdammten Spießerhaustür, wie er es formulierte, eben nicht Vater oder Mutter Brachwitz, sondern Schulfreund Brachwitz öffnete. Ob wir Frankenfelder diese Behauptung glauben dürfen, ist schwierig zu sagen. Aus rein prinzipiellen Erwägungen möchte ich jedoch empfehlen, davon abzusehen. Frankenfelder verfügte über viele, teils hervorstechende Eigenschaften. Aufrichtigkeit gehörte nicht dazu, Ausschmückung sehr wohl. Mithin also kein tragischer, durchaus aber dramatischer Charakter.
Wie dem auch gewesen sei: Frankenfelder klingelte, Brachwitz öffnete und nach Art aller aufeinandertreffenden jungen Männer jener Jahre kam es noch dort, direkt an jener verdammten Spießerhaustür zu einem längeren Abklatschen. Einem etwas albernen und sinnbefreit durchchoreographiertem Begrüßungsprozedere unter Zuhilfenahme der Handinnenflächen, für das seit jeher nur Jungen anfällig zu sein scheinen.
Nachdem sie ihr Aufeinandertreffen dieserart zelebriert und – sagen wir doch, wie es ist – hochstilisiert hatten, bat Brachwitz Frankenfelder hinein, schloss fast andächtig die Wohnungstüre hinter ihm, ließ ihn seine Schuhe ausziehen und führte ihn schließlich durch den langgezogenen Hausflur, auf direktem Weg ins Wohnzimmer. Frankenfelder rutschte ihm auf seinen Socken hinterher. Und obschon nicht zum ersten Male im Hause Brachwitz, raunte er einer alten Gewohnheit folgend fortwährend anerkennend. Lobte im Vorbeigehen den individuellen Zuschnitt der Zimmer, die pragmatische Raumaufteilung, das feine austarierte Zusammenspiel aus hellen Wandfarben und dunklem Mobiliar. Und versäumte es nicht, auch den durch geschickte Bauweise in diese Wohnkomposition integrierten Einfall von Sonnenlicht anerkennend zu erwähnen. Das alles meinte er keineswegs ironisch, sondern ehrlich und aufrichtig. Auch wenn er – vom Sockengang auf spiegelglatten Fliesen aufs Ärgste herausgefordert – dabei einige Ruderbewegungen mit den Armen und Schlenker mit den Knien vollführte. In der vergeblichen und von vornherein zum Scheitern verurteilten, ja komplett naiven Hoffnung, weder Halt noch aufrechten Gang einzubüßen.
Brachwitz selbst, der vielen Großtaten seines Vaters und der fortwährenden Sauberkeitsparanoia seiner Mutter überdrüssig, hörte sich die vielen Lobpreisungen einige wenige Minuten lang schweigend an, winkte dann jedoch unwirsch ab.
Murrte lediglich: Jaja, passt schon.
Frankenfelder, so behauptete er es später zumindest, beabsichtigte, seinen Freund sogleich in eine Unterhaltung bezüglich ihrer jeweiligen Zukunftsperspektiven zu ziehen. Die erfolgreich bestandenen Abiturprüfungen lagen seit wenigen Wochen hinter ihnen, derweil sich vor ihnen – sah man einmal von Militärdienst Frankenfelders und dem Zivildienst von Brachwitz ab – ein noch immer bedenklich form- und gesichtsloses Ungetüm namens Erwachsensein auftürmte. Außer perfekt durchchoreografierte Begrüßungszeremonien hatten beide, so gestand Frankenfelder mir gegenüber später ein, keinen Plan vom Leben. Hatten, wie Brachwitz, alles – oder wie Frankenfelder doch zumindest vieles in die metaphorische Wiege gelegt bekommen. Landeten bei all ihren Zukunftsüberlegungen aber in nichts anderem als Gestrüpp. Dieses Gestrüpp zu entwirren wollte Frankenfelder sich also, wie er zeitlebens behauptete, in eine tiefer gehende Unterredung mit seinem Schulfreund Brachwitz begeben. Brachwitz jedoch, offenbar selbst recht angetan von der Abwesenheit seiner Eltern, dachte gar nicht daran, den Ernst ihrer Lage zu erkennen. Und machte sich, anstatt über Auslandsaufenthalte, Universitäten oder Ausbildungsmöglichkeiten zu sinnieren, unter der augenblicklichen Einbindung seines Freundes Frankenfelder, an der reichhaltig bestückten Minibar seiner Eltern zu schaffen. Eine Aktion, die er stumm, verkniffen und auf fast schon diebische Art begann, die mit zunehmendem Verstreichen von Zeit und in bester spätpubertärer Tradition jedoch lauter und ausgelassener wurde. Zwar beharrt Frankenfelder auch hier darauf, dass nur seine Arglosigkeit ihn zu einem Teil des nun folgenden alkoholischen Exzesses werden ließ, ja er seinen Freund mehrere Male mit Verweis auf dessen Vater und dessen cholerisches Gemüt sowie den Riesenärger, den beide doch sicherlich bekommen würden, zu stoppen versuchte. Doch mit Blick auf die noch folgenden Ereignisse jenes Abends sowie Frankenfelders mannigfaltige Entgleisungen späterer Jahre dürfen wir ihm auch hier einen erneuten Versuch plumper Geschichtsfälschung attestieren. Täterschaft, die im Nachhinein als Opferschaft umgedeutet werden soll.
Flaschen wurden also geleert an jenem sonnigen Juliabend im Hause Brachwitz. In Abwesenheit des Hausherrn, dafür jedoch in Anwesenheit von, es muss an dieser Stelle erneut und verstärkend gesagt werden: Frankenfelder. Denn derweil Kollege Brachwitz tat, was man von einem Abiturienten nach drei Flaschen Wein, fünf Bier sowie diversen Cognac und Schnaps zu erwarten hat – selig schlummerte er auf der Couch ein – begann Frankenfelder erstmalig in seinem Leben einen Aufruhr in sich zu verspüren. Eine mentale Entflammung, einen Furor kaum zu definierender Art.
Unmöglich erschien es ihm, dieser seltsamen Wallung Herr zu werden, was er – wie auch ich – späterhin fahrlässig und vorschnell den stark divergierenden Auswirkungen übermäßigen Alkoholkonsums zuschrieb. Und so begab es sich, dass Frankenfelder, anstatt hinweg zu dösen, sich gegen Mitternacht in Begleitung einer Flasche Elijah Craig schwerfällig und doch enthusiastisch aus dem Sessel erhob, in welchem er die vergangenen Stunden trinkend und prostend zugebracht hatte. Unbemerkt vom embryonenhaft vor sich hin schlummernden Brachwitz verließ er torkelnd das Wohnzimmer, stolperte durch den Flur und krachte geradewegs in das Büro von Brachwitz Senior. Und brachte auf dieser Wegstrecke das moralisch beanstandungswerte, physisch jedoch durchaus bemerkenswerte Kunststück fertig, auch diesen Elijah Craig noch zu leeren.
Angekommen im Arbeitszimmer von Vater Brachwitz sah er sich ein wenig um und vollführte einige unkontrollierte Bewegungen. Drehte kurz am Globus und riss ihn fast um dabei, zog ein Buch vom Holzboard und holte selbiges um ein Haar komplett von der Wand, hielt sich kurz am Regal fest, stütze sich dann aber, gerade noch rechtzeitig, doch an der Wand ab. Und zog alsdann mit aus unerfindlichem Grund plötzlich erlangter Sicherheit – eine Sicherheit, die ich erst Jahre später in Kaltblütigkeit umbenennen sollte – in einer sauber und kontrolliert durchgeführten Bewegung den unter dem riesigen massiven Buchenschreibtisch platzierten sündteuren Bürostuhl hervor. Es handelte sich dabei, zumindest zu jenem Zeitpunkt noch, um einen echten Bauhaus. Drehbar, höhenverstellbar, mit Gasdruckfeder, Rückneige-Mechanik sowie Fünfstern-Fuß mit Rollen. Kostenpunkt, damals im Juli 1997 und selbstredend bevor Frankenfelder beschloss, ihn unter dem massiven Schreibtisch hervorzuziehen: 3.000 Deutsche Mark.
Wertverlust am Ende jener Nacht, also nachdem Frankenfelder dieses wunderbare Stück für seine fragwürdigen Zwecke genutzt hatte: ebenfalls 3.000 Deutsche Mark. Große Stilkunst, binnen Sekunden ein Fall für den Schrottplatz. Kraft plötzlich entflammtem, kaum erklärlichem Furor in Frankenfelder.
Was war geschehen? Nun, Frankenfelder hatte mit frappierender Sicherheit den Stuhl unter dem Schreibtisch hervorgezogen, war danach gemessenen Schrittes um den selbigen herumgegangen und hatte sich schließlich direkt davorgestellt, die Sitzfläche des Bauhaus-Stuhls in seinen Kniekehlen erspürend. Hatte dort also gestanden wie einer, der bereit ist, sich hinzusetzen. Doch Frankenfelder setzte sich nicht. Und stand stattdessen dort, über eine längere Zeit, starr und aufrecht. Schwankte und wankte auch nicht mehr, sondern stand, wie heißt es doch so schön: wie eine Eins. Minuten verstrichen, derweil Frankenfelder bewegungslos in dieser Position ausharrte. Und was gäbe ich dafür heute, all die vielen Jahre später einen Blick in Frankenfelders Gedanken jener Minuten werfen zu dürfen. Seinen Kopf aufzuschrauben, sein Gehirn aufzuklappen, mich tief in sein Neuronennetz zu bücken, laut: Huhu, jemand da? zu rufen.
Doch ich kann nicht in seinen Kopf des Jahres 1997 schauen, kann lediglich Indizien sammeln und hernach versuchen, eins und eins zusammenzuzählen. Und so sehe ich ihn vor mir, den jungen Frankenfelder, wie er wie erstarrt dort steht, inmitten des Büros von Vater Brachwitz, den sündteuren Bauhaus-Stuhl in den Kniekehlen ahnend. Und dann, nach einiger Zeit, lassen wir es fünf Minuten gewesen sein, den Kopf schieflegt und sich in einer bedächtigen Geste mit der linken Hand ans Kinn greift. Vielleicht war es auch die rechte Hand, so genau vermag ich das nach all den Jahren nicht mehr zu sagen, in unseren Unterlagen und Aufzeichnungen nachsehen müsste ich, wozu mir jedoch offen gesprochen der Antrieb fehlt. Jedenfalls stand Frankenfelder dort, spürte den sündteuren Bauhaus-Bürostuhl in seinen Kniekehlen, langte sich mit einer Hand ans Kinn und murmelte nachdenklich: Hmm. Hmm. Hmm.
Im Wohnzimmer lag Schulfreund Brachwitz noch immer feucht schmatzend auf der Couch. Und im Arbeitszimmer stand sein bis zur wohlbekannten Oberkante Unterlippe mit Elijah Craig abgefüllter Schulkumpane Frankenfelder und verharrte in der intensivsten aller Denkerposen.
Fünf Minuten stand er also da, bewegungslos, zwirbelte sich allenfalls das Kinn ein wenig wund – und wurde dann mit einem Male von einem heftigen Zucken übermannt. Ein kurzes, ein einmaliges Durchzucken nur, doch so heftig, dass es einem abrupt erhaltenen Stromschlag glich. Doch handelte es sich weder um einen Strom- noch um einen vermeintlichen Herzschlag, sondern: eine Idee. Frankenfelder, so viel steht für mich heute fest, war auf etwas gekommen.
Gleich jener Cartoonfigur namens Wickie strich er sich mit ausgestrecktem Zeigefinger einige Male unter seiner Nasenspitze entlang, um direkt danach mittels Zeige- und Mittelfinger eine fein geschwungene Pan-Tau-Bewegung vor seiner Stirn zu beschreiben. An deren Ende er sich mit der Fingerspitze auf seinen Kopf tippte. Und ausrief: Heureka! Na, wenn’s der Wahrheitsfindung dient!
Heute, all die vielen Jahre später, frage ich mich, wie oft ich diesen bizarren Handlungsablauf zu Beginn fassungslos und belustigt, später dann ohnmächtig und das Schlimmste befürchtend, habe beobachten müssen. Und wie oft ich versucht habe, ihn zu unterbrechen, Frankenfelder daran zu hindern, von der Denkerpose in den Wickie, vom Wickie in den Pan Tau oder doch zumindest vom Pan Tau ins Heureka! übergehen zu lassen. So sehr ich auch darüber nachdenke, ich komme auf keine klare, nicht einmal auf eine ungefähre Zahl. Ihn abzuhalten, von was auch immer da kommen möge. Gelungen ist es mir nur einmal.
In jener Nacht im Hause Brachwitz, da kam jedenfalls noch der Elijah Craig als Ausgangspunkt dieser bizarren Nachdenker- und Problemlösungsreferenzgeste in Betracht. Wie ich auch in den folgenden Jahren und angesichts weiterer Ausraster Frankenfelders immer wieder bereit war, den Alkohol als Hauptschuldigen auszumachen. Es wäre halt so schön, so leicht gewesen, Frankenfelder als einen abzutun, dessen mentale Reinigung über ausgedehnte Aufenthalte in Ausnüchterungszellen und Entziehungskonservatorien zu realisieren ist.
Ein Irrtum, für den ich bitter habe bezahlen müssen. In jener Nacht im Arbeitszimmer von Vater Brachwitz strich Frankenfelder sich mit ausgestrecktem Zeigefinger also unter seiner Nasenspitze entlang, beschrieb dann die feingeschwungene Pan-Tau-Bewegung vor seiner Stirn, tippte sich mit der Fingerspitze auf seinen Kopf. Rief aus: Heureka! Und öffnete dann seinen Gürtel, ließ seine Hosen hinunter. Stemmte sich rücklings mit seinen Handflächen auf die Armlehnen des sündteuren Bauhaus-Bürostuhls, bewegte dieserart sein nacktes Hinterteil langsam gen Sitzfläche, ohne sie freilich zu erreichen. Setzte dann einen Pressvorgang ein, der ihm den Kopf hochrot anlaufen und die feinen Gesichtszüge zu einer furchterregenden Grimasse werden ließ – fast sah es so aus, als ginge es ihm darum, noch an Ort und Stelle ein Kind zu gebären.
Doch er gebar kein Kind, natürlich nicht. Sondern beging stattdessen die erste moralische Unsagbarkeit seines Lebens.
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich habe Nomaden in der Wüste, Bauern auf Feldern und kleine Kinder auf Geheiß ihrer Mütter in Stadtparks ihr Geschäft verrichten sehen. Habe spaßwütige Studenten in die Bierflaschen ihrer Kommilitonen und seriöse, aber reichlich betrunkene Familienväter in hohem Bogen in die Vorgärten ihrer Nachbarn schiffen sehen. Alles kein schöner Anblick, aber, an dieser Wahrheit kommen wir kaum vorbei, durchaus Teil dessen, was wir Zivilisation zu nennen pflegen. So ist er halt, der Mensch: Hat er was – so gibt er was! Und da nicht alles von dem, was er da hat, schön ist, wird manch gebende Tat automatisch, es ist kaum zu verhindern, zur Ekelhaftigkeit. Da kann er gar nichts gegen tun, der Mensch, die allerbesten Vorsätze kann er sogar haben. Die eigene Widerwärtigkeit ist ihm von der Natur direkt in den Leib hinein gepflanzt worden, beginnt er sich also zu öffnen, sei es nun in Demut, sei es in Freundschaft oder auch im Spaß, so kommt stets auch die Ekelhaftigkeit zum Vorschein.
Obwohl ich also behaupten darf, mit allen gängigen Methoden menschlichen Geben und Nehmens vertraut zu sein und sämtlich vorstellbare Darreichungsformen dieses natürlichen Kreislaufs in den Archiven unserer Organisation aufgezeichnet sind – weil es für eine jede menschliche Idee und eine jede menschliche Handlung bereits eine Blaupause gibt, einen Präzedenzmenschen sozusagen, der das, was man tut und denkt schon weit vor einem selbst in exakt dieser Form gedacht und getan hat – obwohl unsere Organisation also Archivar über alle jemals gezeigten und jemals zu zeigenden menschlichen Verhaltensweisen ist, war das hier neu. War Frankenfelders unnötige und doch bewusste Verschandelung so noch nicht vorgekommen, nicht aufzufinden in unseren Akten.