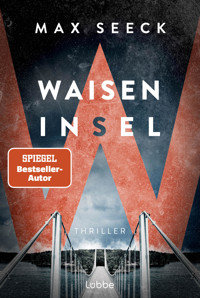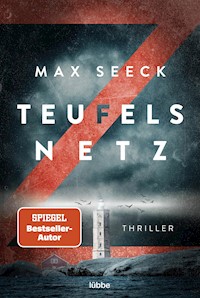9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Band 1 der neuen Thriller-Reihe vom finnischen Bestsellerautor
»Der Finne Max Seeck gehört aktuell sicherlich zu den besten europäischen Thrillerautoren.« KRIMI-COUCH
Ein junger Mann stiehlt eine Aktentasche aus einem SUV. Wie sich herausstellt, gehört sie einem Serienmörder, und kurze Zeit später ist der Dieb tot. Schnell gibt es ein weiteres Mordopfer: eine Frau, die komplett mit weißer Farbe bedeckt ist. Warum diese mysteriöse Inszenierung der Toten?
Die Kripo Helsinki bittet den Profiler Milo daraufhin um Hilfe. Als ihn eine anonyme Nachricht in Schachnotation erreicht, ahnt er, dass er sich mitten in einem tödlichen Spiel befindet. So sehr es ihm widerstrebt, kontaktiert er den Ex-Partner seiner Mutter, einen versierten Schachspieler und jemand, dem er eigentlich nie mehr begegnen wollte ....
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumZitatEröffnung123456789101112131415Mittelspiel161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172Endspiel73747576777879808182838485868788DANK AN:Über dieses Buch
Ein junger Mann stiehlt in der Helsinkier Innenstadt aus einem SUV eine Aktentasche. Wie sich herausstellt gehört die Aktentasche einem Serienmörder. Kurze Zeit später ist der Dieb tot. Und es gibt ein weiteres Mordopfer: eine Frau, die komplett mit weißer Farbe bedeckt ist. Der Profiler Milo wird zu den Ermittlungen dieser mysteriösen Morde gerufen. Gleichzeitig erreicht ihn eine anonyme Nachricht: Bxc6. Ein Schachzug? Was bedeutet das alles? Milo will es nicht gelingen, sich ein Bild vom Mörder zu machen. Muss er Schach besser verstehen, um den Fall lösen zu können? So sehr es ihm widerstrebt, kontaktiert er den Ex-Partner seiner Mutter, Stanislav. Der war Europameister im Schach …
Über den Autor
Max Seeck war zunächst im Marketing einer finnischen Firma tätig. Mittlerweile widmet er sich jedoch ganz dem Schreiben von Spannungsromanen. Mit großem Erfolg: HEXENJÄGER war sein internationaler Durchbruch, und er ist inzwischen der erfolgreichste Thriller-Autor Finnlands. Als einer von wenigen europäischen Autoren stand er auf der NEW-YORK-TIMES-Bestsellerliste. Für den dritten Band der Jessica-Niemi-Reihe, FEINDESOPFER, wurde Max Seeck zudem mit dem renommierten NORDISCHEN KRIMIPREIS ausgezeichnet.
Der Autor lebt mit seiner Familie in Helsinki.
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der finnischen Originalausgabe:
»Merkitty«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2024 by Max Seeck
Originalverlag: Tammi publishers, 2024
German edition published by arrangement withMax Seeck and Elina Ahlbäck Literary Agency, Helsinki, Finland
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2025 byBastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Ingola Lammers, München
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
Einband-/Umschlagmotiv: © shutterstock: JSpannhoff
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-7460-4
luebbe.de
lesejury.de
Dann schlief er ein, und ohne die Wärme und den Humor in seinen Augen verwandelte sich sein Gesicht in eine unbewegte Maske eiskalter Brutalität.
Ian Fleming: Casino Royale(Deutsch von Stephanie Pannen und Anika Klüver,Cross Cult 2012)
Eröffnung
1
Alexander Ewans senkte den Finger auf den Bildschirm und tippte die Buchstaben sorgfältig ein: J – E – E – S – U – S.
Falscher Sicherheitscode. Das Gerät ist eine Stunde gesperrt.
»Feck off!«, fauchte Alexander. Das Tablet in seinen Händen wollte sich nicht kampflos ergeben. Das Ding war völlig nutzlos, nur weil er nicht der rechtmäßige Besitzer war und die Ziffernkombination, die es entsperren würde, nicht kannte. Alexander presste seinen mageren Daumen auf den Bildschirm. Am liebsten hätte er das Gerät in der Mitte gefaltet und so lange an die Wand geworfen, bis es in tausend Stücke zerfiel. Stattdessen griff er nach seinem Stift und kritzelte die Kombination, die er gerade eingegeben hatte, auf ein Stück Papier. Beim vorigen Mal war er mit dem Geburtsdatum des Besitzers ans Ziel gekommen. Diesmal wusste er nichts über die Person, der er die Aktentasche geklaut hatte. Er wusste nur, dass der Besitzer des Wagens allem Anschein nach gläubig war, denn am Rückspiegel hatte ein silbernes Kruzifix gehangen. Die Lösung des Coderätsels war jedoch nicht der Heiland, und nun konnte er erst in einer Stunde einen neuen Versuch starten.
Alexander schloss die Augen. In Gedanken hörte er immer noch das Splittern der Scheibe und das Heulen der Alarmanlage. Die Gelegenheit hatte den Dieb gemacht, buchstäblich. Die lederne Aktentasche hatte auf dem Rücksitz eines teuren Sportwagens in Munkkisaari gelegen, und nirgends war eine Menschenseele zu sehen gewesen. Obendrein gab es wie auf Bestellung ein paar Meter weiter eine verlassene Baustelle, an deren Rand ein Stapel Ziegelsteine lag, das geeignete Werkzeug für das Verbrechen. Das rechte hintere Seitenfenster hatte nach ein paar kräftigen Stößen nachgegeben, und obwohl er sich den Handrücken aufritzte, als er die Tasche herauszog, war er schon in weniger als einer Minute mit seiner Beute weit weg von dem Auto. Bei aller Spontaneität ein perfektes Verbrechen; allerdings drohte die Ausbeute mager zu bleiben.
Scheiße, Sascha, das Pad is nix wert, wenn man’s nich aufkriegt.
Alexander dachte an die Textnachricht, die Ripa ihm geschickt hatte, und die Erbitterung schnürte ihm die Kehle zu. Ripa gab sich als Freund aus, wusste aber überhaupt nicht, was Alexander in den letzten zwei Jahren durchgemacht hatte. Ripa hatte keine Ahnung, wie es war, ohne Geld in einer fremden Stadt zu leben, als angehender Gitarrist, der wie durch einen Blitzschlag zuerst die im Aufstieg begriffene Band gegen einen Scheißjob in einem Schnellrestaurant und dann auch noch seine Zweierbeziehung gegen bittere Einsamkeit eintauschen musste. Alles war umgefallen wie Dominosteine, und plötzlich war er nicht mehr der unter einem glücklichen Stern geborene junge Rockstar, als der er sich immer gesehen hatte. Trotzdem hatte er es um jeden Preis vermeiden wollen, nach Waterford zurückzukehren, denn das wäre die absolute Niederlage gewesen, die endgültige Kapitulation. If work was a bed, you’d sleep onthe floor! Selbst Alexanders finnischer Vater, der die Einfälle seines Sohnes im Allgemeinen wohlwollend aufgenommen hatte, würde sich kaum über seine Rückkehr freuen. Ich habe es dir ja gesagt, würde er brummen. I told you so, Alex.
Trotzdem vermisste Alexander seinen Vater. Sein Vater hatte ihn zum Flughafen gebracht, war an der Sicherheitskontrolle zurückgeblieben und hatte mit den Tränen gekämpft – das erste Mal, dass er seine Gefühle gezeigt hatte. Ironischerweise erst, als Alexander sich entschieden hatte, die Flügel auszubreiten und ans andere Ende Europas zu reisen.
Jetzt, anderthalb Jahre später, waren der warme Sommer und das unermüdliche Licht in Helsinki zum zweiten Mal der Kälte und Dunkelheit gewichen, und diesmal war Alexanders Stimmung durch und durch düster. Er vertrieb sich die Zeit, indem er in der Innenstadt umherstreifte und die gut situierten Helsinkier beobachtete, die in gemütlichen kleinen Restaurants saßen und bei Kerzenlicht ihren Wein genossen. Der Wechsel der Jahreszeiten, der die nördliche Halbkugel so hart behandelte, störte sie offenbar nicht, sie schienen sich selbst im tiefsten Winter wohlzufühlen. Diese Gefühlsseligkeit war Alexander verwehrt geblieben; in den letzten Monaten hatte er die Kontrolle über seinen Alkoholkonsum verloren, und ohne Geld und ohne Freunde war er in kurzer Zeit immer tiefer in Düsterkeit versunken. Von seinen Eltern hatte er seit Anfang September ebenfalls nichts mehr gehört, wie denn auch: Er hatte im Lauf des Jahres wer weiß wie oft seine Telefonnummer gewechselt, von einem Prepaid zum nächsten. Womöglich machten sie sich sogar Sorgen um ihn. Vielleicht würde sein Vater herkommen, um ihn zu suchen und ihn nach Hause zurückzuholen. Falls ja – würde er die helfende Hand ergreifen?
Alexander legte das Tablet neben sich auf das Sofa und lehnte den Kopf an die Wand. Zu allem Überfluss hatte er bei den falschen Typen Schulden gemacht. Nicht so viel, dass sein Leben in Gefahr war, aber genug, um schwer eins in die Fresse zu kriegen, wenn er das Geld nicht bis heute Abend zurückzahlte. Er musste das Pad unbedingt öffnen.
In der Brusttasche seiner Steppjacke steckte noch ein letzter Joint, den könnte er rauchen und die Sorgen für eine Weile vergessen. In einer Stunde konnte er dann einen neuen Versuch starten. Vielleicht schaffte er es, das Pad zu öffnen, und Ripa oder irgendein anderer würde ihm wenigstens ein paar Hunderter dafür zahlen. Alexander steckte den Zettel in die Jeanstasche und machte sich auf den Weg in die Diele. Überall lagen Klamotten und Pappteller herum, die von Mikropizzas und Fleischpasteten verfärbt waren. Ein paar leere Kartons, ein Beutel Schmutzwäsche, die er schon vor einiger Zeit gesammelt, aber dann doch nicht in die Waschküche gebracht hatte. Die Folie vom gestrigen Dürüm-Döner, aus der Soße auf den Laminatboden gelaufen und festgetrocknet war. Die einzigen Dekorationselemente in der kleinen Zweizimmerwohnung waren die Poster von The Shades, Panik Attaks und Edwyn Collins und ein gerahmtes Foto vom McLaren MP4/4 der Formel 1 von 1988. Die schwarze Aktentasche wirkte in dem Durcheinander fehl am Platz, wie ein Gast in Smoking und Lacklederschuhen im Pub um die Ecke. Womöglich war die Tasche sogar wertvoller als das gesperrte Pad.
Alexander hatte gerade die Hand in die Brusttasche der auf dem Boden liegenden Steppjacke gesteckt, als er im Wohnzimmer einen lauten Signalton hörte. Der Schweiß unter seinem Hemd fühlte sich wie eine kalte Umarmung an. Irgendwer ortete das Gerät, das er gestohlen hatte, mit dem Suchdienst Find my iPad. Er musste das Ding so schnell wie möglich loswerden.
Im selben Moment klopfte jemand an die Tür, und Alexanders Herz schien einen Schlag auszusetzen. Scheiße, wer war das? Wenn er noch auf dem Sofa säße, hätte er sich jetzt eingerollt und die Augen zugemacht. Und wäre aus dieser Welt verschwunden wie Harry Potter in seinem Tarnumhang. Oder vielleicht eher wie ein Kaninchen, das den Kopf ins Gebüsch steckt. Aber Alexander hockte in der Diele, nur ein paar Schritte von dem Anklopfenden entfernt: Um die Person zu sehen, brauchte er lediglich aufzustehen und durch den Türspion zu gucken. Und genau das würde er tun, ohne einen Laut von sich zu geben.
Wieder wurde geklopft. Diesmal fordernder. Verdammt, vielleicht waren es doch die Schuldeneintreiber.
Alexander legte die Wange an die Tür und hielt den Atem an. Dann warf er einen schnellen Blick ins Treppenhaus. Okay. Okay. Kein Grund zur Panik. Vor der Tür stand ein Mann, der auf den ersten Blick in keiner Weise bedrohlich wirkte. Er trug einen hellbraunen Wollmantel, ein schwarzes Polohemd und eine dicke Brille; seinem Habitus nach war er kein Ganove, aber auch kein Polizist. Eher einer dieser scheißwichtigen Fachidioten, wie sie in den gläsernen Bürotürmen in Ruoholahti arbeiteten: ein Steuerjurist oder vielleicht ein Versicherungsagent. Also keiner, dem er die Tür öffnen musste.
Da hob sich plötzlich mit leisem Knarren die Klappe am Briefschlitz.
»Ich weiß, dass du zu Hause bist«, sagte eine Männerstimme.
Alexander holte lautlos Luft. Er war überzeugt, dass der Mann seinen rasenden Puls hören konnte, der in seinen Ohren dröhnte.
»Ich bin hier, um meine Aktentasche zu holen«, fuhr der Mann leise, mit ruhiger Stimme, fort.
Verdammt noch mal, dachte Alexander. Es war dumm von ihm gewesen, das Gerät in seine Wohnung mitzunehmen, obwohl er wusste, dass es praktisch unmöglich war, den Sicherheitscode zu knacken. Natürlich könnte er den Mann im Treppenhaus einfach ignorieren, aber als Nächstes würde zweifellos die Polizei vor der Tür stehen. Und dann wurde er verhaftet, vielleicht brummte man ihm wieder eine Gefängnisstrafe auf. Verdammte Scheiße. Allein schon das Autofenster kostete Tausende, er würde mindestens ein Jahr brauchen, um es zu bezahlen, selbst wenn er irgendwo einen neuen Job bekäme.
»Hör zu, ich bin dir nicht böse«, sagte der Mann. »Natürlich ärgere ich mich über das kaputte Fenster, aber ich nehme an, es war nicht persönlich gemeint, oder? Man darf seine Sachen nie so offen herumliegen lassen, dann ist man selber schuld.«
»Scher dich zum Teufel«, sagte Alexander leise. »Ich habe Freunde.«
Durch den Türspion sah er, dass der Mann belustigt grinste.
»Zweifellos, aber ich habe auch welche. Also machen wir die Sache nicht kompliziert und lassen die Freunde aus dem Spiel. Ich bin nur hier, um mir das zu holen, was mir gehört. Ich versuche, fair zu sein, und dasselbe hoffe ich von dir.«
»Woher soll ich wissen, dass die Aktentasche dir gehört?«, sagte Alexander, obwohl er wusste, dass es eine dumme Frage war. Er spielte auf Zeit, auch wenn die gewonnenen Sekunden ihm nichts nützten. Leise trat er einen Schritt zurück und betrachtete die Tür. Seine schweißnasse Handfläche hatte einen feuchten Fleck auf dem Holz hinterlassen.
»Willst du, dass ich das iPad nochmal singen lasse?«, fragte der Mann.
Alexander kniff die Augen zusammen. Panik hämmerte in seinen Schläfen. Wie war alles so schnell in den Arsch gegangen?
»Weißt du was?«, fuhr der Mann mit seltsam leiser Stimme fort, als hätte er plötzlich Angst, jemand könnte ihn hören. »Es geht mir nicht ums Geld. Ich brauch bloß die Aktentasche und alles, was dadrin ist. Also, damit wir weiterkommen: Ich zahl dir ’nen Hunni, wenn du mir die Sachen zurückgibst. Und wir brauchen keine Polizei. Keine Strafanzeige. Ein ziemlich gutes Angebot, oder?«
»Du verarschst mich.«
»Denk doch mal nach. Ich bezahl dich dafür, dass du mir mein Eigentum zurückgibst. Wenn hier jemand übers Ohr gehauen wird, bin ich es.«
Alexander überlegte. Das Angebot klang auf einmal akzeptabel. Sogar großzügig.
»Und du rufst nicht die Polizei an?«
»Nein. Mein Ehrenwort. Okay?«
Alexander rieb sich die verschwitzte Stirn, die Haarsträhnen, die ihm ins Gesicht fielen, fühlten sich klebrig an. Wenn der Mann zu seinem Wort stand, könnte er einen Teil seiner Schulden abbezahlen. Er würde wenigstens einen kleinen Gewinn aus dem Diebesgut ziehen. Kein ganz normales Arrangement, aber die Leute waren seltsam, das hatte Alexander gelernt. Am besten hörte er auf, die Situation zu genau zu analysieren, und nahm das Angebot an.
»Zweihundert«, hörte er sich sagen und bereute sein spontanes Gegenangebot sofort. Durch den Briefschlitz drang leises Lachen.
»Ein Kaufmann. Aber gut, abgemacht. Verdammter Gauner. Machst du jetzt die Tür auf?«
Alexander sah durch den Türspion, wie der Mann orangebraune Geldscheine aus der Manteltasche holte. Fünfzig, hundert … Das Bündel war ziemlich dick. Er hätte ebenso gut dreihundert verlangen können. Aber er wollte die Sache nicht in die Länge ziehen, sonst überlegte der Mann es sich womöglich anders und rief die Polizei an.
»Keine faulen Tricks.«
»Ich will nur die Aktentasche.«
Alexander eilte ins Wohnzimmer, legte das Tablet auf einen Stadtplan des Helsinkier Zentrums und schloss die Aktentasche. Auf einer leeren Pizzaschachtel lag das gezackte Steakmesser, das er im August auf der Terrasse eines Restaurants geklaut hatte. Er griff nach dem Messer, hielt es hinter den Rücken und kehrte in die Diele zurück. Nach einem letzten Blick durch den Türspion öffnete er die Tür. Im Treppenhaus schwebte intensiver Rasierwasserduft, in den sich der Geruch von getrocknetem Schweiß und stark gewürztem Essen mischte.
»Hier«, sagte Alexander und warf dem Mann die Aktentasche zu. Dann wischte er sich den Schweiß von der Stirn und fügte hinzu: »Und du rufst niemanden an oder …«
Der Satz blieb unvollendet. Ein dumpfes Geräusch ertönte, als hätte jemand mit einer Gummisohle gegen einen Tisch getreten. Alexander spürte einen Knuff an der Brust, dem ein stechender Schmerz folgte. Ihm stockte der Atem. Unwillkürlich trat er ein paar Schritte zurück, fiel zu Boden und schlug mit dem Hinterkopf auf das Laminat. Er starrte auf die Deckenlampe über ihm. Tote Fliegen bildeten unten im Lampenschirm einen unförmigen schwarzen Klumpen. Er hörte, dass die Tür geschlossen wurde und der Fußboden ein paarmal knarrte. Dann zeichnete sich im Licht der Deckenlampe eine schwarze Silhouette ab. Nach und nach erkannte er das Gesicht des Mannes und sah die Pistole in dessen rechter Hand. Der lange, schmale Lauf senkte sich über Alexanders Gesicht, die Mündung drückte schmerzhaft gegen das Stirnbein. Alexander hatte das Gefühl, dass sein Kopf explodierte.
»Weiß irgendwer davon?«, fragte der Mann. »Denk genau nach.«
Alexander versuchte, Luft zu bekommen; die Fingerspitzen, die er gegen die Brust gedrückt hatte, hatten sich rot gefärbt. Er hat auf mich geschossen, Scheiße, er hat auf mich geschossen.
»Nein, ich …«, stammelte Alexander. Sein Atem ging immer mühsamer. Der Schmerz breitete sich tief unter dem Brustbein aus, es war, als hätten sich Hunderte spitze Nadeln in seine Eingeweide gebohrt. Finger und Zehen fühlten sich plötzlich kalt an. Das Zimmer begann sich zu drehen.
»Hat jemand gesehen, was in der Tasche ist?«, fragte der Mann. »Außer dir?«
Alexander hatte das Gefühl zu ersticken. Er dachte an den finnischen Sommer, an Lilja, in die er sich vor Jahren bei einem Sprachkurs in Helsinki verliebt hatte. An Waterford, an das Eigenheim in John’s Hill, an die neue Fender Stratocaster. An The Great Looking Fellows, die Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern der Band und den rothaarigen Jimmy Woodward, der ihn schließlich als Rhythmusgitarristen der Band verdrängt hatte. An Liljas hellblaue Zahnbürste, die immer noch auf ihrem Platz am Waschbeckenrand stand, mit vertrockneten Borsten. An Ripa, der ihn zwar mit sich in die benebelte Welt von Schnaps, Cannabis und Kokain gezogen hatte, der ihn aber immer unterstützt und selbst mitten in der Nacht seine Anrufe beantwortet hatte. Auch jetzt würde er sich bestimmt melden, wenn Alexander ihn anrufen könnte. Zum letzten Mal. Er würde Ripa um keinen Preis verraten.
Alexander schüttelte den Kopf.
»Nein«, ächzte er. Er wimmerte vor Schmerzen, nahm aber seine letzte Kraft zusammen, um dem Mann die Worte entgegenzuschleudern, in denen die ganze Wut und Verbitterung der letzten Jahre lagen: »Blast you to hell, you feckin’ cunt!«
Alexander richtete den Blick vom Lauf der Pistole wieder auf die Deckenlampe und auf die Fliegen. Sie hatten ans Licht gewollt, waren aber in einer glühend heißen Falle gelandet. Man konnte ihnen wohl keine Vorwürfe machen, weil sie sich hatten blenden lassen, als sie inmitten der Dunkelheit nach etwas Hellem strebten. Nach etwas Besserem. Und dann glücklich starben.
2
Die akustische Coverversion des Songs Yellow von Coldplay, die aus den Lautsprechern des Restaurants drang, endete ziemlich genau in der Sekunde, als Anna Wuorela sich auf die mit Kissen bedeckte lange Bank setzte und den Rücken an die weiß getünchte Wand lehnte. Sie drückte die Handtasche an sich und blickte auf die Weinflasche, deren Stearinkaskade vermutlich von Dutzenden, wenn nicht gar Hunderten Kerzen stammte. Sie hatte die friedlich züngelnde Flamme während des ganzen Essens betrachtet, immer dann, wenn sie dem prüfenden Blick ihres Gegenübers ausweichen wollte.
»Ist die Rechnung schon gekommen?«, fragte sie. Der Mann, der ein schwarzes Polohemd und einen Blazer trug, fingerte an seiner Brieftasche herum. Anna war länger als nötig auf der Toilette geblieben, hatte auf dem Klo gehockt, an ihrem Handy gefummelt und versucht, Minuten verstreichen zu lassen, die ihr wie eine Ewigkeit erschienen. Nicht, um sich vor dem Bezahlen zu drücken, sondern eher deshalb, weil sie nicht länger am Tisch sitzen wollte. Der einzige Nachteil ihrer Flucht auf die Toilette war, dass sie den attraktiven Kellner verpasst hatte, mit dem sie immer wieder verstohlene Blicke gewechselt hatte.
»Schon erledigt«, sagte der Mann grinsend. Anna dachte unwillkürlich, dass sein Lächeln irgendwie unangenehm war. Seine Zähne waren zwar gepflegt, aber das katzenhafte Grienen konnte man nicht als schön bezeichnen. Vielleicht hatte das unerfreuliche Abendessen, das nur eine knappe Stunde gedauert hatte, ihre Sicht auf den Mann negativ beeinflusst. Sein Mienenspiel, die unruhigen Gesten und das Zucken des kleinen Mundes. Die Brille mit dem dicken schwarzen Gestell, deren starke Gläser die Augen des Mannes lächerlich groß wirken ließen. Die dünne Goldkette unter dem Hemdkragen, an der ein kleines Kreuz hing. Alles war auf unerklärliche Weise abstoßend.
»Falls du nicht doch einen Nachtisch möchtest?«, sagte der Mann, als der Kellner das Wechselgeld brachte, einen Fünf-Euro-Schein und ein paar Münzen. Sie wechselten einen raschen Blick, Anna spürte ihr Herz hüpfen. Dann verschwand der Kellner, und Anna blieb wieder mit ihrem widerwärtigen Date allein. Wechselgeld? Heutzutage zahlt im Restaurant kaum noch jemand bar, dachte Anna, während der Mann die Banknote und die Münzen aufklaubte und in die Brusttasche seines Blazers steckte. Ganz offensichtlich war er nicht so freigebig, dem Kellner das wenige, was von einem Hunderter übrig blieb, als Trinkgeld zu gönnen.
»Danke, nein.« Anna trank den letzten Rest Wein aus ihrem Glas. Er schmeckte merkwürdig süß, als wäre Treber oder ein Teelöffel Zucker in das Weinglas geraten.
»Okay«, sagte der Mann. »Aber es war doch nett hier, oder?« Er betrachtete Anna, während sie ihr Glas leerte.
»Doch, ja«, sagte Anna und dachte daran, wie sehr sie all das gelangweilt hatte, was der Mann ihr erzählt hatte: woher er stammte und was er beruflich tat.
»Wollen wir noch ein Gläschen trinken? Ich kenne ein richtig schönes Lokal ganz in der Nähe …«
»Ich muss jetzt nach Hause, morgen früh wartet die Arbeit«, log Anna entschlossen. Sie hatte schon genug Zeit für diesen Blödian verschwendet und verspürte keine Lust, über eine Fortsetzung zu verhandeln oder sich die Überredungsversuche des Mannes anzuhören. Sie wollte sich möglichst kurz und schmerzlos von ihrem Tinder-Date verabschieden. Auf der Toilette hatte sie Google Maps zurate gezogen und festgestellt, dass sie zur Einzugsparty ihrer Freunde fahren konnte, indem sie am Telakanpuistikko die Straßenbahn Nr. 6 nahm und am Hauptbahnhof in den Vorortzug umstieg. Von Tür zu Tür würde sie im günstigsten Fall eine halbe Stunde brauchen, wahrscheinlich aber etwas mehr, denn sie stammte aus Turku und kannte sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Helsinki immer noch nicht gut aus, obwohl sie nun schon seit Jahren in der Hauptstadt wohnte.
»Wirklich?«, fragte der Mann. Einen Augenblick lang schien es, als würde Annas Antwort das widerwärtige Lächeln von seinem Gesicht wischen. Trotz seiner unverkennbaren Enttäuschung kam es jedoch nicht dazu; er schaffte es, seine selbstsichere Miene zu bewahren. Es war schwer zu glauben, dass die Absage ihn überrascht hatte. Man hätte blind sein müssen, um nicht zu merken, dass die Chemie zwischen ihnen beiden nicht stimmte, dass es nicht einmal ansatzweise gefunkt hatte. Das Abendessen hatte eher einem peinlichen Einstellungsgespräch geglichen als einem Date, und Anna verspürte nicht die geringste Lust, eingestellt zu werden. Wenn der Mann sich nicht nach Einzelheiten aus Annas Leben erkundigte, hatte er mit offenem Mund schmatzend gegessen und geradezu obsessiv über sein tödlich langweiliges Hobby geschwafelt. Ein Hobby, in dem er es seinen Worten nach zum Meister hätte bringen können, wenn er nur die richtige Unterstützung und Ermutigung bekommen hätte. Der Kerl war also nicht nur langweilig, sondern offensichtlich auch verbittert über seine Eltern und womöglich über die ganze Welt. Die Opfergeschichten wütender egozentrischer Männer waren manchmal unterhaltsam und sogar sexy, aber dieser Typ war alles andere als anziehend. Genau genommen hatte Anna noch nie so fade Geschichten gehört. Bla, bla, bla.
»Macht nichts«, sagte der Mann ein wenig überraschend und zog die Autoschlüssel aus der Tasche. »Ich muss auch früh raus, also …«
Anna lächelte zum ersten Mal, seit sie das Restaurant betreten hatte. Aus purer Erleichterung. Zum Glück kapitulierte der Mann widerstandslos, statt sich als plärrender Märtyrer zu gebärden. So wie der lettische Student der Tiermedizin, der Anna vor ein paar Wochen, als sie ihm einen Korb gab, als oberflächliche Knauserin beschimpft hatte, die nicht wagte, im Augenblick zu leben.
»Danke für das Essen«, sagte Anna und griff nach ihrem Daunenmantel, der auf der Bank lag. Beim Aufstehen stieß sie versehentlich mit der Handtasche gegen ihr Glas, das vom Tisch fiel und klirrend zersplitterte. Das Geräusch weckte die Aufmerksamkeit des attraktiven Kellners, der mit Besen und Schaufel herbeieilte.
»Entschuldigung«, sagte Anna und versuchte, ihre Handtasche auf der Schulter zurechtzurücken. Ihre Bewegungen kamen ihr merkwürdig langsam vor, es war, als würden ihre Finger nicht so wie sonst auf die Befehle ihres Gehirns reagieren.
»Macht nichts«, antwortete der Kellner lächelnd.
Auf dem Weg nach draußen fing Anna ein letztes Mal den Blick des Kellners auf und erwiderte sein Lächeln. Hätte sie den Abend doch mit einem Mann wie ihm verbracht, dann wäre die Verabredung womöglich ganz anders ausgegangen.
Erst als sie unter der Markise des Restaurants hervor auf die Straße traten, merkte Anna, dass es in Strömen regnete. Der Wind ließ die über der Straße hängenden Lampen schaukeln wie Ruderboote auf stürmischem Meer. Aus irgendeinem Grund wirkte ihre schwankende Bewegung unnatürlich langsam, wie auf einem mit halber Geschwindigkeit ablaufenden, grobkörnigen Video.
»Ich kann dich nach Hause bringen«, sagte der Mann und hob den Autoschlüssel auf Augenhöhe. Als er auf den Knopf drückte, leuchteten die Scheinwerfer eines weißen Audi Kombi an der anderen Straßenseite einladend auf. Anna wusste jetzt also, dass der Mann einen etwas teureren Wagen fuhr. Na und? Ihren Plan, den Rest des Abends mit ihren Freunden zu verbringen, würde sie deswegen nicht aufgeben, aber vielleicht saß sie doch lieber in einem warmen Auto, als im Regen an der Straßenbahnhaltestelle zu schlottern. Und da sie zur Party ihrer Freunde am anderen Ende der Stadt wollte, würde der Mann nicht erfahren, wo sie wohnte.
»Fährst du zufällig Richtung Pasila?«, fragte Anna und merkte, dass ihre Stimme seltsam dumpf geworden war. Ihre Augenlider fühlten sich schwer und trocken an, sie blinzelte mehrmals, damit sie wenigstens ein bisschen Feuchtigkeit bekamen.
»Liegt beinah an meinem Weg«, sagte der Mann und ging gemächlich zum Auto. Zu Annas Erleichterung wirkte er gleichgültiger als bisher. Erneut betrachtete sie die riesigen Pfützen, die sich auf der Straße gebildet hatten. Ihre Beine waren schwer, ihr Kopf dagegen fühlte sich leicht an, als wäre sie beschwipst. Die zwei Glas Wein nach dem anstrengenden Arbeitstag hatten ihr wohl zugesetzt. Mit dem Auto käme sie in einer Viertelstunde ans Ziel, obendrein trockenen Fußes. Vielleicht war es sogar ganz gut, dass sie ein bisschen getrunken hatte, bevor sie zu der Party ging. Dadurch war sie bestimmt geselliger, was wiederum die Chance erhöhte, mit wirklich interessanten und faszinierenden Menschen in Kontakt zu kommen.
»Okay, danke«, sagte Anna. Als sie dem Mann mit leicht unsicheren Schritten folgte, glaubte sie auf seinem Gesicht, das sich im Autofenster spiegelte, ein Lächeln zu sehen, ein abstoßendes Grinsen, das so schnell wieder verschwand, wie es aufgetaucht war. Einen flüchtigen Augenblick lang überlegte sie, auf dem Fuße umzudrehen und doch die überfüllte Straßenbahn zu nehmen, aber der Mann war schon eingestiegen und beugte sich zur Seite, um die Beifahrertür zu öffnen. Beim Einsteigen merkte Anna, dass das rechte hintere Fenster mit Duck Tape und einem schwarzen Müllsack verklebt war. Der Anblick ließ sie an eine schwarze Augenklappe in einem schneeweißen Gesicht denken. An eine Piratenflagge. Und dann an einen Totenkopf. Und als das Auto schließlich anfuhr, dachte sie aus irgendeinem Grund einzig und allein an den Tod.
3
Die Plane über dem Boot knallte im Wind. Banksy erstarrte, reckte die linke Vorderpfote hoch und betrachtete die im Luftstrom wogende Erscheinung. Bei dem Anblick dachte Milo an Napoleons Pferd auf dem Schlachtfeld, an Antoine-Jean Gros und den Louvre. Hatte das Pferd Morenga geheißen?
»Alles gut«, seufzte Milo, obwohl er vermutete, dass der Hund ihn im heulenden Wind nicht hörte. Er erinnerte sich, irgendwo gelesen zu haben, dass Hunde Geräusche aus einer viermal größeren Entfernung hören konnten als ihre Besitzer, dass diese Eigenschaft jedoch meist nutzlos war, weil sie die Bedeutung der Geräusche nicht verstanden.
»Alles gut«, wiederholte Milo, als er den Hund eingeholt hatte, und bückte sich, um ihm auf den Rücken zu klopfen. Banksy stand immer noch reglos da, den Blick auf den Trailer mit dem Motorboot geheftet, das mit einer dunkelgrünen Plane bedeckt war, die im Takt des Windes tanzte und dem Tier bedrohlich erscheinen musste. Milo wischte sich das Gesicht am Mantelärmel ab, aber der Ärmel war nass und machte das Gesicht nur noch feuchter. Der Wind, der mit einer Geschwindigkeit von mehr als zwanzig Metern pro Sekunde wehte, schmeckte leicht salzig. Die Straßenlampen warfen schwere Schatten zwischen die für den Winter aufgebockten Boote. Nirgends war eine Menschenseele zu sehen – wer auch nur ein bisschen Selbsterhaltungstrieb besaß, blieb in seinen vier Wänden, zündete Kerzen an und entkorkte eine Flasche Rotwein. Draußen gab es nichts als trostlose Dunkelheit, in deren Schutz der Sturm ungestört Schaden anrichten konnte.
Nein, es war nicht Morenga. Sondern Marengo, berichtigte Milo sich. Der Name von Napoleons Pferd. Er hatte das Gemälde vor langer Zeit zum ersten Mal gesehen mit seiner Mutter im Louvre.
Die Kälte drang durch den Mantel, und Milo schrak aus seinen Gedanken auf. Ein Blick auf die Uhr sagte ihm, dass es höchste Zeit war, nach Hause zurückzukehren, obwohl er eigentlich lieber mit Banksy weiter durch die verregneten Straßen gewandert wäre. Milo seufzte, zog leicht an der straffen Leine, und der Hund setzte sich widerstrebend in Bewegung.
4
Ein Knall weckte Anna Wuorela; der süßliche Geruch der Lederpolster stieg ihr in die Nase. Die Dunkelheit verwandelte sich zuerst in trübes Grau, dann in ein gezacktes Bild vom Wageninneren und von einer grauen Wand hinter der Windschutzscheibe. Annas Blick fiel auf den Anhänger am Rückspiegel, der Jesus am Kreuz darstellte. Ihre Kehle war trocken und ihr Kopf schwer. Da ging die Tür auf, und ihr Oberkörper sackte halb aus dem Wagen. Sie spürte einen pochenden Schmerz an der Seite. Jemand schob sie zurück auf den Sitz. Ihre Hände waren ganz und gar eingeschlafen, im Hinterkopf wogte ein seltsames Brennen. Sie wollte sich übergeben und die Übelkeit aus ihrem Körper vertreiben.
»Wo …«, flüsterte Anna mit heiserer Stimme. Dann spürte sie einen Stich und sah gleich darauf, wie der Mann eine lange Nadel aus ihrem Oberarm zog. Ein scharfer Geruch stieg durch die Nasenhöhlen bis ins Stirnhirn, und allmählich verschwand der Schmerz. Sie starrte nach vorn. An die Wand waren Chromplatten gebolzt, an Metallhaken hingen Werkzeuge. Irgendwo ertönte ein schleppendes metallisches Geräusch, das mit einem kurzen Schnalzen endete. Es roch nach frischem Holz und frisch gestrichenen Wänden. Nach Schlossöl und neuen Autoreifen.
Dann packte der Mann Anna, hob sie mühsam aus dem Wagen und führte sie ins Innere eines Hauses, in ein riesiges Wohnzimmer, dessen große Fenster den Blick auf das nächtliche Meer freigaben. Die Möbel waren in durchsichtiges Plastik gehüllt, der Fußboden war mit Zeitungen ausgelegt. Auch die ausgestopften Vögel an den Wänden waren in Schutzfolie gewickelt. Der Anblick erinnerte Anna an einen Film, in dem ein Banker, dargestellt von Christian Bale, mit Axt und Kettensäge Prostituierten und Obdachlosen den Garaus machte. Dann ließ der Mann Anna los, und sie fiel wie eine Stoffpuppe auf den Boden. Einen Augenblick lang lebte sie in der Vorstellung, bei ihren Freunden anzukommen, in der engen Diele, wo sie ihre Schuhe auszog und zu den vielen anderen stellte. Beinahe hörte sie das Dröhnen der Musik, das Stimmengewirr und das Gelächter. Es würde ein netter Abend werden, nur durfte sie nicht zu lange feiern, denn am nächsten Morgen musste sie um acht Uhr zur Arbeit erscheinen. Aus dem Nebel streckten sich Arme nach ihr aus, Finger pressten sich um ihren Hals. Anna betrachtete sich im Spiegel; ihr Make-up war perfekt und ihre Frisur trotz des Regens so makellos wie vorhin, als sie ihre Wohnung verlassen hatte. Und dann, als sie gerade zu ihren Freunden ins Zimmer gehen wollte, wurde alles wieder dunkel.
5
Im Treppenaufgang des Jugendstilhauses zog es, und hier und da war rastloses Knarren zu hören, als ob die alten Holztüren vor Kälte in ihren ungeölten Scharnieren bibberten. Auf dem Dachboden ließ der Wind das frisch renovierte Blechdach poltern. Milo fuhr mit seinen feuchten Fingerspitzen an den hellblauen heraldischen Lilien entlang, die unmittelbar über dem Holzgeländer an die Wand gemalt waren. Im dritten Stock blieb er vor der Tür stehen und berührte das kupferne Namensschild. PERHO. Der Schlüsselbund, den er schon eine Weile umklammert hatte, fühlte sich warm an, und als er die Faust öffnete, stieg süßlicher Metallgeruch auf. Er könnte Banksy hineinlassen und die Tür gleich wieder schließen. Die Treppe hinunterlaufen und sein zielloses Herumirren in den dunklen Straßen fortsetzen. Er könnte sich in seine Galerie stehlen, die liegen gebliebene Buchführung erledigen oder sich per Streaming die neue Ripley-Serie ansehen, schon die dritte Verfilmung des vor Jahrzehnten erschienenen Bestsellers von Patricia Highsmith. Oder er könnte auf einen Drink in Dianas Whiskybar gehen, irgendwen anrufen. Ronja würde es verstehen, Milo würde nicht erklären und begründen müssen, weshalb er im letzten Moment einen Rückzieher machte. In dem Moment hörte er Kinderstimmen in der Diele der Nachbarwohnung. Er steckte den Schlüssel ins Schloss und öffnete die Tür.
Milo nahm dem Hund die Leine ab und zog in der Diele seine Schnürschuhe aus. Er rief Ronja einen Gruß zu, doch als er Wasser rauschen hörte, begriff er, dass sie unter der Dusche stand. Er legte seinen feuchten Mantel auf den ledernen Schemel und blieb vor dem Spiegel stehen. Sein vor Nässe glitzernder Stoppelbart hatte vier Tage wachsen dürfen und hatte jetzt die perfekte Länge. Ronja hatte schon oft gesagt, er sei sexy.
Draußen wehte der Wind immer heftiger. Das Wasser rauschte nicht mehr, und Milo hörte, wie die Tür der Duschkabine zur Seite geschoben wurde. Dann quietschte die Badezimmertür, und der Fußboden knarrte unter den nackten Füßen seiner Frau.
»Ist das Wetter immer noch so schrecklich?« Ronja hatte ein dunkelblaues Handtuch um den Oberkörper gewickelt, ihre nassen Haare lagen schwer auf den Schultern, und über das linke Schlüsselbein lief ein dünnes Rinnsal. Milo blickte über die Schulter seiner Frau und sah auf dem Küchentisch eine Karaffe, in der Ronja offenbar eine Flasche Dragon’s Teeth dekantierte. Banksy trank so gierig aus dem Wassernapf in der Küche, als hätten sie ihren Abendspaziergang nicht im novemberlichen Helsinki gemacht, sondern in einer dürren Wüste.
»Guck dir mal seine Pfoten an«, sagte Milo. »Irgendwer hat auf dem Bürgersteig direkt vor der Tür eine Bierflasche zerschlagen. Wir haben uns bemüht, den Splittern auszuweichen.«
»Das schlechte Wetter hindert nicht alle daran zu feiern.« Ronja ging in die Hocke und überprüfte die Pfoten des Hundes. Dann stand sie auf und schüttelte den Kopf. »Alles in Ordnung. Ihr seid gut ausgewichen.«
Milo nahm sich vor, Janne, den Hausmeister, über die Scherben zu informieren. Er betrachtete das ungeschminkte Gesicht seiner Frau. Ronja war mit fünfunddreißig schöner als je zuvor. Fast pechschwarze Locken umrahmten ihr hellbraunes Gesicht. Ihre Augen waren groß und smaragdgrün, in ihrem Blick lag zurückhaltende Freude. Ronja kam näher, stellte sich auf die Zehenspitzen und gab Milo einen Kuss. Dann legte sie die Stirn an sein Kinn, und der Duft von Lavendelseife stieg ihm in die Nase.
»Napoléon …«, murmelte Milo. »Sur le champ de bataille d’Eylau.«
Ronja warf ihm einen rätselhaften Blick zu. Dann ging sie in die Küche und holte zwei Rotweingläser aus dem Schrank. Sie stellte sie auf den Tisch, kehrte nach kurzem Zögern an den Schrank zurück, schnappte sich noch ein weiteres Glas und platzierte es ein Stück von den beiden anderen entfernt. Milo dachte unwillkürlich, dass es sich um eine symbolische Geste handelte. Sie beide hatten ihren Gast gemeinsam eingeladen.
»Ich dachte, du wärst mit Banksy am Ufer spazieren gegangen, aber offenbar hast du eine spontane Kunstexkursion in den Louvre gemacht«, sagte Ronja, hob den leeren Wassernapf auf und füllte ihn nach.
»Das fiel mir nur ein, als ich Banksy angeguckt habe. Napoleons Pferd, meine ich.«
»Marengo?«
Milo nickte und kam ebenfalls in die Küche, wo der vollmundige Duft des Weins in der Luft hing.
»Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das Gemälde gerade Marengo zeigt«, sagte er und strich sich die feuchten Haare hinter die Ohren. »Oder ein anderes von Napoleons Pferden.«
»Er hatte bestimmt hundert. Aber die anderen kennst du wohl nicht beim Namen.« Ronja lächelte. Ihr Kommentar ließ Milo an die erste Zeit ihrer Beziehung denken, daran, wie sie außer einer starken körperlichen Anziehungskraft auch ein brennendes Interesse für Kunstgeschichte verbunden hatte. Jetzt war nur noch das Letztere übrig.
»Nein, das muss ich zugeben«, sagte er.
Ronja zuckte lässig die Achseln und stellte den Napf auf den Boden, woraufhin Banksy aufsprang und weitertrank, als wäre er immer noch kurz vor dem Verdursten. Dann warf Ronja einen Blick auf die alte Standuhr in der Küchenecke. Milo hatte das Gefühl, die Stille, die auf einmal herrschte, sei für den letzten Protest reserviert. Noch könnte er ablehnen, könnte sagen, dass er das Treffen am heutigen Abend für keine gute Idee hielt. Nur ein Wort, und das Ganze würde abgeblasen.
Er begnügte sich mit einem schwachen Lächeln.
»Ich mach mich zurecht«, sagte Ronja, blieb neben Milo stehen und legte eine Hand auf seine Schulter. An ihrem Ringfinger funkelten zwei Ringe aus Weißgold, für die Milo vor einigen Jahren viel mehr Geld ausgegeben hatte, als er sich leisten konnte.
»Milo?«
»Was denn, Schatz?«
»Sind wir uns ganz bestimmt einig?«
»Natürlich«, sagte Milo, ohne zu zögern, obwohl er wusste, dass er sowohl Ronja als auch sich selbst belog. Vielleicht vor allem sich selbst. Zwar hatte die Routine ihn abgestumpft: Er hatte Ronja so hartnäckig eingeredet, das Arrangement würde funktionieren, dass er wohl angefangen hatte, selbst daran zu glauben. Wenigstens teilweise. Ronja hatte allerdings gesagt, es gebe auch andere Optionen. Sie könnten alle Erwartungen vergessen und sich darauf konzentrieren, einander ohne Stress zu genießen. Sex sei nicht nur Penetration. Milo genüge ihr, hatte Ronja versichert, aber es fiel ihm schwer, ihr zu glauben. Er war sich sicher, dass Ronja ihre sexuellen Bedürfnisse anderswo befriedigen würde, da Milo sie nicht erfüllen konnte. Dank des Arrangements behielt er immerhin die Zügel in der Hand. Er war Herr der Lage, auch wenn irgendein Spötter womöglich das Gegenteil behauptet hätte.
»Ich liebe dich«, sagte Ronja und ging an Milo vorbei. Er hörte, wie die Tür zum Bad geschlossen wurde und der Fön zu surren begann. Dann nahm er den Geruch von Stearin wahr und sah, dass Ronja am Fenster zum Innenhof eine Kerze angezündet hatte. Ihre Flamme flackerte unruhig.
»Ich dich auch«, flüsterte Milo und dachte, dass er die Fenster wohl abdichten sollte, bevor das Frostwetter begann.
6
Die Kriminalkommissarin Minka Laine saugte an ihrer E-Zigarette und hielt den Atem an. Dann blies sie den Dampf durch die Nasenlöcher vor ihr Gesicht, von wo der Wind ihn im Nu forttrug. Die Wipfel der hohen Bäume am Ufer reckten sich zum Meer. Die Temperatur lag zwar ein paar Grad über null, aber durch die Feuchtigkeit und den Wind fühlte es sich viel kälter an.
»Hast du so was je gesehen?«, fragte eine Männerstimme hinter ihr. Sie gehörte Kriminalhauptkommissar Kalle Åvist, der einige Minuten vor Minka eingetroffen war.
Minka schüttelte den Kopf und beugte sich über die Leiche der jungen Frau, die in eine Plane gewickelt war, von der ein seltsam industrieller Geruch ausging.
»Wir müssen die Umgebung sofort absperren«, sagte Minka und zog die Plane über das Gesicht der Frau.
»Die Technik ist schon da«, antwortete Åvist und zeigte mit dem Daumen zur Brücke. Minka warf einen Blick über die Schulter und sah, wie die Lichtkegel der Taschenlampen über den Sandweg tanzten, der das schwarz wogende Meer und das stockdunkle Wäldchen voneinander trennte. Über der Bucht krächzte ein Vogelschwarm – dem Lärm nach waren es Dutzende, vielleicht sogar Hunderte von Vögeln.
»Ruf Milo an«, sagte Åvist plötzlich. Minka sah ihn verwundert an. Der Vorschlag kam nicht völlig aus dem Nichts, aber auf den ersten Blick schien die tot aufgefundene Frau kein so spezieller Fall zu sein, dass man Milo Perho zum Fundort rufen musste. Milo war eine Karte, die Åvist, der Leiter der Einheit für Kapitalverbrechen in Helsinki, nicht ohne gewichtigen Grund ausspielen würde. Der Einsatz externer Berater musste zudem immer vorab von dem für die Etatmittel zuständigen Beamten des Innenministeriums abgesegnet werden, und Åvist hatte bestimmt keine Zeit gehabt, diesen Prozess in Gang zu setzen.
»Warum?«, fragte Minka. »Wenn ich fragen darf«, fügte sie sicherheitshalber hinzu. Nicht, dass sie etwas gegen den Vorschlag gehabt hätte. Minka schätzte Milos Know-how hoch ein, außerdem hatten sie während ihrer früheren Zusammenarbeit Freundschaft geschlossen. Milo Perho war jedoch auf das Profiling von Serienmördern spezialisiert, und in diesem Stadium wies nichts darauf hin, dass es mehr als ein Opfer gab.
»Zwei in unserem Team sind krank«, sagte Åvist und rieb sich die Nase. »Wir brauchen zusätzliche Kräfte.«
»Aber schon die Information, dass Milo dabei ist, führt zu Spekulationen …«, beharrte Minka, doch Åvist hob die Hand, um sie zu unterbrechen.
»Mach dir darüber keine Sorgen. Es wird noch mehr spekuliert, wenn wir nicht von Anfang an alle Räder in Bewegung setzen.«
Minka zog an ihrer E-Zigarette und richtete den Blick auf das dunkle Meer. Gerade eben noch hatte sie ihren freien Abend im Einkaufszentrum Kamppi verbracht und ein Geburtstagsgeschenk für ihren Freund Ibe gekauft. Falls sie Ibe als ihren Freund bezeichnen konnte. Ibe schien nicht gewillt, den nächsten Schritt zu tun, von gelegentlichen Verabredungen zur Zweierbeziehung, aber Minka empfand seine Bindungsangst nicht als persönliche Beleidigung. Auch sie hatte keine Eile, die Beziehung sozusagen offiziell zu machen. Das Leben als Alleinerziehende von zwei lebhaften Schulmädchen war auch ohne Partner hektisch genug.
»Okay«, sagte Minka. »Du bist der Boss.«
Åvist sah sie traurig lächelnd an.
»Der bin ich. Und in Momenten wie diesem wünschte ich, ich wäre es nicht.«
Åvists glatt rasiertes Kinn schien anzuschwellen, als er die Zunge im geschlossenen Mund bewegte. Er wirkte nervös, obwohl er allem Anschein nach den gegenteiligen Eindruck erwecken wollte. Bei dieser Gleichung musste es etwas geben, worauf Minka erst später stoßen würde.
Minka warf einen letzten Blick auf die Plane, auf der der Regen eine kleine Pfütze gebildet hatte. Dann holte sie ihr Handy hervor. Åvist ging ein Stück zur Seite und begann zu hüpfen wie ein Hürdenläufer, der sich auf seinen Start vorbereitet. Ein Spezialist, dachte Minka. Wie fast alle in diesem Beruf.
7
Milo setzte sich im Sessel zurecht und betrachtete Ronjas rot lackierte Fingernägel, die sich in das Bettlaken krallten. Das matte Licht der Nachttischlampe ließ Ronjas dunkle Haut seidenweich glänzen. Milo seufzte schwer und richtete den Blick auf das Gesicht seiner Frau, auf die halb geschlossenen Augen und den offenen Mund. Ronjas Augenlider wirkten schwer, ihre Miene war gleichzeitig müde und aufmerksam. Abwartend.
»Are you ready?«, fragte eine Männerstimme.
Milo griff nach dem Weinglas, nahm einen großen Schluck und schloss die Augen. Das halbdunkle Schlafzimmer verwandelte sich in einen Saal, der in goldgelbes Licht gebadet war und in dem der süßliche Geruch von Lack und Konservierungsmitteln waberte. In dem mit Fresken geschmückten, hohen Raum schallten das Stimmengewirr der Touristen, das Klicken der Kameras und die französischen Worte des Guides, die unglaublich charmant klangen. Als Milo vom Boden aufblickte, sah er vor sich ein blassgelbes Ross und auf dessen Rücken den Kaiser, umgeben von seinem getreuen Stab. Das Schlachtfeld sah eisig aus, einige der Leichen, die vor den Pferden auf der Erde lagen, waren bereits gefroren. Manche Soldaten hatten ihr Leben dagegen offenbar erst kürzlich verloren, denn der Reif hatte ihre Gesichter und ihre Rüstung noch nicht mit seiner weißen Decke überzogen. Weit hinten am Horizont schimmerten weitere Soldaten in schnurgerader Formation, bereit, in den Kampf zu ziehen. Wie hat der Maler es nur geschafft, die Sinnlosigkeit des Krieges so großartig auf die Leinwand zu bannen, sagte Milos Mutter und rückte die Handtasche aus Schlangenleder zurecht, die über ihrer Schulter hing. Die militärische Ordnung wurde nur geschaffen, damit das Chaos keine Sekunde zu früh ausbricht, fuhr sie fort. Damit die Sinnlosigkeit sich nicht selbst verrät. Milo dachte bei sich, dass seine Mutter ihm nie im Leben erlauben würde, sich im Fernsehen einen Film anzusehen, in dem zwei Truppen sich gegenseitig abschlachteten. Aber in Paris, im berühmtesten Kunstmuseum der Welt, war es offenbar völlig akzeptabel, Gewalt und Leid zu betrachten. Dasselbe galt für Nacktheit und Erotik: Die gewagten Gemälde von Rubens, Botticelli oder Bronzino waren genial, die Mädchen auf den Titelseiten der Illustrierten am Kiosk dagegen geschmacklose und der Psyche schadende Pornografie.
Milo schrak aus seinen Gedanken. An die Stelle der leisen Seufzer war genussvolles Stöhnen getreten. Milo spürte das Handy in seiner Hosentasche vibrieren. Verdammt, er hatte vergessen, es stumm zu schalten. Er holte es hervor und sah, dass der Anruf von Minka Laine kam, seiner Bekannten bei der Kripo. Als sie nach ihrer letzten gemeinsamen Ermittlung auf einen Drink in die Whiskybar gegangen waren, hatte Milo hoch und heilig versprochen, sich immer zu melden, wenn Minka anrief, ganz gleich, wie spät es war. Derartige Versprechen gab er nicht oft, aber wenn, hielt er sein Wort.
Das rhythmische Knarren des Betts hatte aufgehört. Ronja starrte ihren im Sessel sitzenden Ehemann verdutzt an. Der Rücken des jungen Mannes, der auf ihr lag, glänzte vor Schweiß. Ronja ließ ihn los und wischte sich die Hände am Laken ab.
»Was jetzt?«
»Sorry, ich muss drangehen.«
Ronjas Miene verfinsterte sich.
»Du musst … ans Telefon gehen?«
Milo stand auf, vielleicht zu schnell, denn einen Augenblick lang glaubte er, das Gleichgewicht zu verlieren. Sein Herz schlug wie wild.
»Should we stop … or …?«, murmelte der junge Mann verlegen. Der durchtrainierte Zwanzigjährige wirkte auf einmal wie ein Teenager, der schleunigst weitere Anweisungen brauchte. Milo blickte auf sein Handy, das immer noch klingelte. Jetzt war er sich sicher: Minka würde ihn so spät an einem Freitagabend nur anrufen, wenn es sich um etwas Wichtiges handelte. Mit anderen Worten, wenn jemand ums Leben gekommen war.
»Wir machen ein anderes Mal weiter, okay?«, sagte Ronja, während der Mann sich von ihr auf die Seite rollte. Milo betrachtete das Pärchen auf den zerwühlten Seidenlaken, das in seiner Nacktheit und Schutzlosigkeit Gustave Courbet als Inspirationsquelle hätte dienen können.
»Na ja … ich werde ja eigentlich nicht gebraucht«, sagte er und warf einen Blick auf sein Handy, das erneut zu klingeln begann.
»Nein, Schatz. Das ist unsere gemeinsame Sache.«
»Schon, aber … ihr müsst nicht mittendrin aufhören.«
Die Miene, die mit einer kleinen Verzögerung auf Ronjas Gesicht erschien, war gleichzeitig mitfühlend und erregt.
»Bist du sicher?«
»You’re good to go«, sagte Milo. Es tat ihm weh, die Worte auszusprechen, doch er glaubte nicht, dass man es ihm ansah. »Ich muss wirklich drangehen.«
Als Milo kurz darauf das Telefonat beendete und seine immer noch feuchten Schnürschuhe anzog, hörte er, wie Ronja im Schlafzimmer einen Orgasmus bekam. Die Situation war fremd: Bisher war er immer im selben Raum gewesen. Vielleicht hat sich diesmal wirklich etwas verändert, zum Guten oder zum Schlechten, dachte Milo, während Ronjas Stöhnen im Schlafzimmer allmählich nachließ. Sie könnten morgen darüber reden. Milo griff nach der Türklinke, zögerte kurz, trat dann aber in das dunkle Treppenhaus. Während er die Treppe hinunterging, stellte er sich vor, wie der Mann in Ronja kam. Der Gedanke war maßlos beklemmend.
8
Milo starrte durch das Seitenfenster in die Dunkelheit. Es war, als hätte man einen schwarzen Schleier über die Stadt gelegt, unter dem die Straßenlampen ihr Bestes taten, aber keine Wunder vollbringen konnten. Für jemanden, der das Licht liebte, war der November die bitterste Zeit des Jahres: Die Sonne hatte sich schon lange verabschiedet, und noch verhüllte keine tröstende Schneedecke den schwarz glänzenden Asphalt. Das Wetter war ganz anders als im Sommer, als Milo der Polizei zuletzt geholfen hatte, eine Mordserie aufzuklären. Damals hatten Minka und er eine Krankenpflegerin, die drei Menschen vergiftet hatte, aufgespürt und für ihre Taten dingfest gemacht, denen andernfalls zweifellos weitere gefolgt wären. Die Verbrechen waren alle nach demselben Muster verübt worden, und es war ziemlich bald klar gewesen, dass sie miteinander in Verbindung standen. Aber die Lösung hatte sich erst abgezeichnet, nachdem es Milo gelungen war, ein Täterprofil zu erstellen, das auf eine Frau mittleren Alters hindeutete. Der Ermittlungsleiter Kalle Åvist hatte öffentlich zugegeben, dass die Fälle ohne Milos Hilfe womöglich nie geklärt worden wären.
Der Taxifahrer hielt auf dem Parkplatz an der Brücke zur Insel Seurasaari. Dort standen zwei Kleintransporter der Polizei, ein Krankenwagen und ein elfenbeinfarbener Škoda Octavia, den Milo sofort als Minkas Fahrzeug erkannte. Unter dem dekorativen Holzdach am Anfang der Brücke stand ein Polizist, der in das Monofon am Revers seines Overalls zu sprechen schien. Vor der Brücke flitzte eine schwarze Katze vorbei, der man bei diesem Wetter gewünscht hätte, dass sie ein Dach über dem Kopf fand. Milo glaubte nicht an Vorzeichen, wusste den seltsamen Zufall aber zu würdigen.
»Was ist denn hier passiert?«, fragte der Taxifahrer beiläufig, während er das Kartenterminal nach hinten reichte.
Milo hatte kurz zuvor überlegt, an der Tamminiementie auszusteigen, damit der Fahrer nicht merkte, welcher Zirkus nach Seurasaari gekommen war. Andererseits war der Fundort der Leiche nach Minkas Worten vom Parkplatz aus nicht zu sehen, und außerdem würden die Medien ohnehin früher oder später Witterung aufnehmen. Insofern spielte es keine Rolle, was der Fahrer berichtete oder nicht.
»Eine polizeiliche Untersuchung«, sagte Milo genau in dem Moment, als das Kartenterminal Signal gab.
»Was untersucht die Polizei denn hier?«
Milo seufzte tief. Der Abend war ganz anders verlaufen als geplant, und er spürte, dass sein Ärger die Oberhand gewann.
»Irgendwo wartet bestimmt ein Fahrgast auf Sie«, sagte er barsch, was der Fahrer mit einem feindseligen Blick in den Rückspiegel quittierte.
Er stieg aus und blickte sich um, während das Taxi wendete und wegfuhr. Die Insel Seurasaari war Milo vertraut: Früher waren Ronja und er im Sommer immer mit dem Fahrrad hergefahren, hatten das Freilichtmuseum besucht und in Anttis Kaffeeschuppen Kaffee getrunken. Sie waren oft den Sandweg am Ufer des Ivars-Hauses entlanggegangen, von wo aus der Amtswohnsitz des Staatspräsidenten am gegenüberliegenden Ufer zu sehen war. Seit sie sich Banksy angeschafft hatten, verbrachten sie jedoch mehr Zeit auf der Insel Rajasaari, die eine große Hundezone zu bieten hatte und näher bei ihrer Wohnung in Ullanlinna lag. Außerdem begegnete man in Seurasaari häufiger Familien mit Kindern: Kinderwagen, Kraxen, Picknickdecken, auf denen zwischen dem Proviant pausbäckige Babys brabbelten. Kein Grund zur Verbitterung, sagte Ronja immer, wenn in solchen Momenten Schweigen zwischen ihnen aufkam. Das Glück der anderen macht uns nicht ärmer. Es waren die Worte eines reifen Menschen, aber Milo wusste, dass seine Frau sich innerlich nicht damit abgefunden hatte. Nachdem sie die Pille abgesetzt hatte, war auf die Hoffnung Enttäuschung und dann Verzweiflung gefolgt, da Ronja trotz aller Versuche nicht schwanger wurde. Milo war sich letzten Endes nicht sicher, was schlimmer gewesen war: über den Grund für die Kinderlosigkeit im Ungewissen zu sein oder die Wahrheit zu erfahren.
»Abend!« Eine Männerstimme durchdrang das Rauschen des Windes. Als Milo sich umdrehte, sah er eine Gestalt in einem langen Kapuzenmantel, die eine Autotür zuschlug und sich mit raschen Schritten näherte. Der kleine dreitürige Fiat 500 war ihm bisher nicht aufgefallen, denn er wurde von dem davor parkenden Polizeifahrzeug verdeckt.
»Nur ein paar Fragen zu dem, was auf der Insel los ist«, sagte der Mann und nahm die Kapuze ab. Nun sah Milo die mit einem langen Teleobjektiv versehene Systemkamera, die dem etwa Vierzigjährigen um den Hals hing, und das digitale Aufnahmegerät in seiner Hand. Die Reporter fanden den Weg zum Tatort von Jahr zu Jahr schneller.
»Ich habe nichts zu sagen«, gab Milo ruhig zurück und wollte sich, die Hände in den Taschen, auf den Weg zur Brücke machen.
»Otto Behm, ich bin Freelancer und …«
»Wie gesagt, ich kann Ihnen nichts berichten«, sagte Milo, ohne den Blick von dem Mann abzuwenden, und zog den Reißverschluss seiner Jacke zu.
»Wurde das Opfer vergewaltigt?«
Milo sah eine Frau in einer schwarz-weißen Segeljacke und engen Jeans auf der Brücke näher kommen. Das Gesicht, das unter der Kapuze hervorschaute, war das der Kriminalkommissarin Minka Laine vom Morddezernat. Die Frau blieb ungefähr in der Mitte der Brücke stehen und bedeutete dem Polizisten, der das abgesperrte Gebiet bewachte, Milo durchzulassen.
»Jetzt wäre eine gute Gelegenheit, dafür zu sorgen, dass das, was über den Mord geschrieben wird, der Wahrheit entspricht und …«
Milo winkte Minka zu und richtete den Blick dann wieder auf den Reporter.
»Hören Sie mal, Behm, von was für einem Mord reden Sie?«
»Wieso wären Sie sonst an der Ermittlung beteiligt? Aus Ihrer Anwesenheit kann man einiges schließen«, sagte Behm. Milo gab ihm keine Antwort, sondern ging an dem Polizisten im Overall vorbei. Behm verstand wohl auch ohne Worte, dass er ihm nicht auf die Brücke folgen konnte.
Milo ergriff Minkas ausgestreckte Hand, die in Anbetracht des Wetters überraschend trocken und warm war. Wenn sie sich nach einer längeren Pause wieder begegneten, gaben sie sich immer die Hand, als würde die Freundschaft zwischen einem Mann und einer Frau ein besonders förmliches Verhalten voraussetzen, um platonisch zu bleiben. Und platonisch war ihre Beziehung immer gewesen, von dem Moment an, als sie abendelang im Besprechungsraum im dritten Stock des Polizeigebäudes in Pasila das Ermittlungsmaterial durchgesehen und gemerkt hatten, dass ihre gemeinsamen Interessensgebiete sich nicht auf die Kriminologie beschränkten. Sie hatten tiefschürfende Gespräche geführt, unter anderem über die Fernsehserie Breaking Bad, die Harry-Hole-Romane von Jo Nesbø und Roman Polanskis Filme, obschon sie beide der Meinung waren, dass die allmählich publik gewordenen Sexualdelikte des polnisch-französischen Regisseurgenies einen dunklen Schatten über sein einzigartiges Schaffen warfen.
»Nett, dass du gleich gekommen bist«, sagte Minka und zog ihren Lederhandschuh wieder an. Auf dem Rücken trug sie den roten Rucksack, der zu ihrem Markenzeichen geworden war.
»Wie war’s heute in der Schule, Minkalein, so im Allgemeinen?« Milos Worte brachten Minka zum Lächeln.
»Leck mich«, sagte sie. »In diesem Rucksack habe ich auch für dich schon Proviant geschleppt.«
»Stimmt«, gab Milo zu. »Aber ich muss dich doch ein bisschen verarschen, die Gelegenheit ergibt sich ja so selten.«
»Mich zu verarschen?«
»Nein, dich zu sehen«, sagte Milo und folgte Minka über die lange Holzbrücke.
»Hoffentlich war Ronja nicht allzu sauer. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass es gerade an den Wochenenden abends mehr Einsätze gibt …«
»Ist das nicht auch statistisch erwiesen?«, sagte Milo und versuchte, nicht an den tätowierten Muskelprotz zu denken, der noch vor Kurzem auf seiner Frau gelegen und die Lenden bewegt hatte wie eine rasende Bestie.
»Was?«
»Verbrechen werden abends begangen«, erklärte Milo. »Wenn man sich amüsiert. Im Rausch.« Ronjas genussvolles Stöhnen hallte in seinen Ohren wider. Die vor Schweiß glänzende Haut, die angespannten Muskeln. Die geröteten Wangen. Milo hatte jedem Kuss, jeder Berührung, jedem Stoß seine wortlose Zustimmung gegeben. In ihrem Schlafzimmer hatte sich schon oft ein dritter Partner aufgehalten, aber auf der Gefühlsebene waren sie bisher zu zweit gewesen. Bisher. Milo und Ronja. Jetzt hatte Milo das Gefühl, er hätte den Mann nicht mit Ronja in der Wohnung zurücklassen sollen. Würden sie es noch ein zweites Mal tun und womöglich ein drittes? Würde ihre Lüsternheit wieder aufflammen, sobald die Ermattung nach dem Höhepunkt abgeklungen war?
»Diesmal kannst du alle Statistiken auf den Müll werfen«, sagte Minka und schien ihre Schritte plötzlich zu beschleunigen, bis sie auf der kleinen Insel zwischen den beiden Brückenhälften stehen blieb. Der Weg, der über die Insel führte, war von hohem Gebüsch gesäumt. Das Schilf säuselte unter der Brücke, die Wellen schlugen gegen die Uferfelsen. Milo warf einen Blick zurück und sah, dass der Reporter, der ihm so hartnäckig zugesetzt hatte, in seinen Wagen stieg.
»Etwas genauer, bitte«, sagte er.
»Diese Tat wurde nicht spontan im Suff begangen«, erklärte Minka.
»Okay«, sagte Milo. Seine Gedanken drehten sich im Kreis, es fiel ihm schwer, sich auf Minkas Worte und auf den Fall zu konzentrieren. Fickt ruhig. Als drittes Rad war wieder einmal ein junger, gut aussehender Mann gewählt worden, aber hätte für den Zweck auch ein weniger maskulines und attraktives Exemplar genügt?
Im selben Moment spürte er, wie das Handy in seiner Hosentasche vibrierte: eine Nachricht auf WhatsApp.
Bin jetzt allein. Alles in Ordnung?
Milos ganzer Körper entspannte sich vor Erleichterung, und seine Fingerkuppen prickelten. Natürlich hatte Ronja den Burschen sofort weggeschickt. Das Spiel in Milos Abwesenheit fortzusetzen wäre brisant gewesen; vielleicht hätte es nicht direkt gegen die gemeinsam vereinbarten Regeln verstoßen, aber doch unbedingt ihren Geist verletzt.
Alles ok. Sorry, dass ich gehen musste, dienstlich, schrieb Milo schnell zurück. Der Touchscreen, der einige Regentropfen abbekommen hatte, wollte seinen Fingern nicht gehorchen, und es dauerte einige Zeit, die Nachricht abzuschicken.
»Ronja?«, fragte Minka und winkte Milo am Ufercafé vorbei nach rechts. Die Holzhäuser wirkten im Abenddunkel wie verlassen – und das waren sie ja auch, bis die Unternehmer im Frühjahr die Türen wieder öffneten.
»Ja, Ronja«, antwortete Milo, wobei er den Namen seiner Frau beinahe verschluckte.
»Sitzt sie jetzt allein am Esstisch?«, sagte Minka und schien ihre Worte im selben Moment zu bereuen. Nicht etwa, weil sie auch nur im Geringsten ahnte, wie das Ehepaar seine Freizeit verbrachte, sondern eher deshalb, weil sie mit ihrer Frage die eigentliche Wurzel des Problems berührt hatte. Allein am Esstisch. Milo hatte Minka im Sommer offen von dem seit Jahren unerfüllten Kinderwunsch erzählt, allerdings ohne die Gefühlssperren und Arrangements zu erwähnen, zu denen die Situation schließlich geführt hatte. Minka war vorurteilslos und liberal, hätte es aber trotzdem vielleicht nicht verstanden. Mitunter war Milo sich nicht sicher, ob er selbst es verstand.
»Sorry, ich wollte nicht …«
»So ungefähr«, sagte Milo rasch. Jetzt sah er das blaue Zelt mitten auf dem Sandweg, davor standen zwei Tatortermittler in weißen Overalls und ein breitschultriger Mann im Regenmantel. Robert Nyman – oder unter Bekannten Robbe – war ein athletischer Kriminalhauptmeister Anfang vierzig, der als Ermittler im Morddezernat arbeitete. Milo grüßte seinen Rücken, denn Robbe hatte sich gerade vorgebeugt, um den Reißverschluss am Schutzzelt zu öffnen.
Der Wind fuhr in die Zeltplane und ließ ihren unteren Rand unruhig flattern. Milo dachte an Banksy, den der Anblick bestimmt nervös gemacht hätte. Er bückte sich und ging hinein. An beiden Seiten des zehn Quadratmeter großen Zelts standen Stative mit starken Halogenlampen, die auf die Leiche gerichtet waren, als handle es sich um eine makabre Aufführung.
»Was sagst du dazu?«, fragte Minka, während sie die nasse Kapuze von ihren hellbraunen Haaren zog. Milo betrachtete die auf der Erde liegende junge Frau und kam nicht gleich darauf, warum ihm die Venus von Milo in den Sinn kam, die Skulptur der Göttin Aphrodite, nach der er vermutlich benannt worden war. Erst als er vorsichtig neben der Frau in die Hocke ging, erkannte er den Grund: Das Gesicht, der Hals und die unter der Abdeckung hervorschauenden Hände waren mattweiß. Als würde es sich nicht um einen Menschen handeln, sondern um eine Statue oder Puppe in Menschengestalt.
»Die Haut ist mit einer dicken Farbschicht bedeckt«, sagte Minka und hockte sich neben Milo. »Die Leiche wurde hier gefunden, in diese Plane gewickelt.«
»Damit der Regen die Farbe nicht abwäscht?«
»Vermutlich. Und die Farbe wurde nicht nur auf Gesicht und Hände verteilt, sondern der ganze Körper ist weiß gestrichen. Der ganze Körper.«
Irgendetwas an der Art, wie Minka die Worte wiederholte, ließ Milo vor Ekel schaudern. Er legte eine Fingerspitze auf das weiße Handgelenk des Opfers; das Gesicht der Toten zu berühren wäre ihm respektlos vorgekommen.
»Die Farbe ist trocken«, beeilte Minka sich zu sagen.
»So sieht es aus. Was kann man daraus schließen?«
»Praktisch nichts. Als Mutter von zwei Schulkindern weiß ich, dass Gesichtsfarbe in weniger als einer Stunde trocknet.«
»Und die Todesursache?« Milo musterte die Leiche. Auf den ersten Blick deutete nichts auf körperliche Verletzungen hin. Der Körper war unversehrt, und der Gesichtsausdruck war eigenartig friedlich.
»Wenn du nach Zeichen äußerlicher Gewalt suchst – es wurden keine gefunden. Der Rigor Mortis hat noch nicht eingesetzt. Der Tod ist also vor …«
»… höchstens vier, fünf Stunden eingetreten.«
Minka nickte und wischte sich die Nase am Ärmel ab.
»Oder sie ist vor mehr als vierundzwanzig Stunden gestorben, und die Starre ist schon geschwunden«, sagte sie. »Das werden wir von der Pathologie erfahren. Ich habe die Formulare schon ausgefüllt, und sie haben versprochen, die Leiche heute noch zu untersuchen.« Milo seufzte. Vielleicht war der Vergleich zwischen Banksy und Napoleons Pferd, der ihm beim Spaziergang durch den Kopf geschossen war, eine Art Omen gewesen, denn er hatte ihn gezwungen, an seine Kindheit zu denken. Und nun geriet er also in eine Situation, in der er womöglich nach langer Zeit seiner Mutter gegenübertreten musste.
»Weißt du, wer dort heute Abend Dienst hat?«, fragte er.
»Nein«, antwortete Minka nur. Sie wusste sehr wohl, warum Milo sich danach erkundigte: Er hatte ihr von seinen Eltern erzählt, von deren Scheidung, dem neuen Mann, dem Tod seines Vaters und der gleichgültigen Reaktion seiner Mutter darauf. Es gebe wohl kaum Halbwüchsige, die sich die Scheidung ihrer Eltern wünschen, aber dass zwei erwachsene Menschen sich scheiden lassen, sei kein Grund, seine Mutter für alle Zeiten zu hassen, hatte Minka gesagt.
»Wurde das Opfer schon identifiziert?«, fragte Milo.
Minka schüttelte den Kopf.
»Ein Hundebesitzer hat die Leiche vor ungefähr zwei Stunden gefunden. Wer zum Teufel geht mit seinem Hund bei diesem Wetter auf Seurasaari spazieren?«
Milo rieb sich die Bartstoppeln. Seine Gedanken wanderten wieder zu Banksy, zu dem Spaziergang in Eira, dann zu der nackt im Bett liegenden Ronja und ihrem vor Leidenschaft verzerrten Gesicht: zu dem geöffneten Mund und dem zerstreuten Blick, der in einer anderen Zeit und an einem anderen Ort verankert zu sein schien.