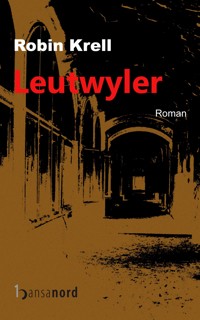3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Wirtin Mrs. Flynn hat zwei Könige und drei Ehemänner überlebt – und denkt nicht daran, sich ihr Geschäft durch ein paar dahergelaufene „Untote“ ruinieren zu lassen. Ausgestattet mit einem guten Gespür für Profit und nicht allzu viel Moral, setzt sie sich in chaotischen Zeiten gegen die humanitären Reformversuche des als wahnsinnig geltenden Kronprinzen Ivor zur Wehr. Dabei ist sie auf die Hilfe der fanatischen Sekte des Straßenräubers Cathal sowie des mit moralischen Prinzipien ebenfalls nicht vertrauten Allgemeinarztes Dr. Fowler angewiesen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Robin Krell
Blut ist das neue Bier
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Epilog
Recht vs. Gerechtigkeit
Freund oder Feind?
Gabe oder Fluch?
Alkohol ist sehr wohl eine Lösung
Not macht erfinderisch
Ein Hoch auf die Zivilisation
Bloody Alexandra
A star is born
Auf gute Nachbarschaft
Der Feind meines Feindes ist mein Freund … oder?
Epilog
Impressum neobooks
Epilog
„Eine Seuche?“ Doktor Ignotius Fowler klemmte das Monokel vor sein rechtes Auge, wodurch dieses scheinbar auf die Größe einer Erbse reduziert wurde. Mit einer ungeduldigen Handbewegung bedeutete er dem Patienten, ein paar Schritte zurückzutreten. Den kleinen Holzhammer am äußersten Ende des Griffs haltend, begann er, den Rücken des Mannes abzuklopfen.
„Ja“, erwiderte der Patient mit kläglicher Stimme. Seine Haut war totenbleich, die Augen blutunterlaufen, und etwas an der Art, wie ihn der Mann musterte, gefiel Fowler überhaupt nicht. Vielleicht war der Kerl ja tatsächlich krank. Es galt, ihn so schnell wie möglich loszuwerden.
„Fast alle Leute in meiner Nachbarschaft haben sich schon angesteckt“, ließ der Mann nicht locker.
„Unsinn!“, erwiderte Fowler und bedeutete dem Patienten, auf die Waage zu steigen. „Wenn hier eine Seuche grassieren würde, dann wäre ich darüber informiert!“ Fowler hatte keinerlei Verständnis für Patienten, die glaubten, alles besser zu wissen als er, der Spezialist. Sage und schreibe dreiundvierzig Personen hatte er an diesem Tage bereits mit der Versicherung, dass die Stadt nicht von einer Seuche heimgesucht wurde, nach Hause geschickt, und nach wie vor belästigten ihn neue Patienten mit diesem Unfug. Fowler schnaubte. Gegen Dummheit gab es nun einmal kein Heilmittel.
„Was ist denn?“, fragte er ungeduldig, als der Patient immer noch am selben Fleck stand und auf einen schmalen Lichtstreifen, den die Sonne auf den Boden malte, starrte, als handele es sich um eine unüberwindliche Barriere. „Nun stell dich schon endlich auf die Waage!“
Der Patient – falls er beim Eintreten seinen Namen genannt hatte, konnte sich Fowler jedenfalls nicht mehr daran erinnern – warf ihm einen fast flehentlichen Blick zu. „Seit dem Ausbruch meiner Erkrankung ist meine Haut extrem lichtempfindlich, Herr Doktor.“
„Unsinn!“ Der Arzt legte all seine Autorität in dieses eine Wort. „Ein bisschen Sonnenlicht hat noch keinem geschadet.“
In diesem Jahr war das Königreich mit einem besonders milden Sommer gesegnet, und dennoch trug der Patient Lederhandschuhe. Ein Blick auf die Garderobe zeigte Fowler, dass der Mann zudem in einem langen Herbstmantel und einem breitkrempigen Hut erschienen war.
Wortlos streifte der Patient den Handschuh seiner rechten Hand ab, um den Blick auf seinen Handrücken freizugeben, der über und über mit großen Brandblasen übersät war, ja, an einigen Stellen lag sogar das Fleisch offen. Fowler nickte zufrieden. Wie ein Knochenbruch war eine Verbrennung wenigstens etwas Konkretes – nicht wie die übrigen Symptome des Patienten, welche nichts ihm Bekanntem glichen und daher höchstwahrscheinlich nur Einbildung des „Kranken“ waren.
„Kochendes Wasser? Dampf?“, fragte er und griff nach der Hand des Mannes, um sie sich mit gewichtiger Miene von allen Seiten zu besehen.
„Sonnenlicht“, erwiderte der Mann schlicht.
„Sonnenlicht?“ Fowler runzelte verärgert die Stirn. Dadurch verlor das Monokel seinen Halt und wäre sicherlich am Boden zerschellt, hätte der Patient es nicht mit einer blitzschnellen Bewegung aufgefangen.
„Ausgezeichnete Reflexe“, brummte Fowler und nahm ihm ohne ein Wort des Dankes das Monokel aus der Hand. „So krank, wie du behauptest, kannst du also gar nicht sein.“
Der Patient seufzte tief. „Muss ich es Ihnen denn wirklich beweisen?“, fragte er. Er streckte einen zitternden Finger nach dem Lichtstrahl aus, wagte es jedoch nicht, ihn hineinzutauchen.
„Ich bin seit fünfunddreißig Jahren Arzt“, erklärte Fowler streng. „Und noch niemals, hörst du, noch niemals habe ich davon gehört, dass Sonnenlicht die Haut zerstört!“
„Nun ja“, erwiderte der Patient leise. „Ein Sonnenbrand schädigt doch ebenfalls … “
„Du glaubst also, dich in Gesundheitsfragen besser auszukennen als ein Arzt?“, unterbrach Fowler kalt. „Weshalb bist du dann überhaupt zu mir gekommen, frage ich mich?“
„Verzeiht, Herr Doktor, ich wollte nicht … “
„Schon gut. Stell dich endlich auf die Waage.“
„Aber … “ Der Patient deutete in einer hilflosen Geste auf den Sonnenstreifen am Boden.
„Habe ich denn nicht gerade gesagt, dass Sonnenlicht der Haut nicht schadet?!“ Langsam aber sicher neigte sich Fowlers Geduld dem Ende zu.
Mit einem tiefen Seufzer zog der Patient seinen Handschuh wieder über und setzte den Hut auf. Erst nachdem er auch noch den Mantel übergezogen hatte, schickte er sich an, den Sonnenstrahl zu durchqueren.
„Ich habe genug von diesen Kindereien!“, platzte es aus Fowler heraus. Mit jedem Patienten, mit dem er sich mehr als fünf Minuten und dreiundvierzig Sekunden befasste, machte ein Arzt Verlust. Wie lange ihn dieser spezielle Gast nun schon aufhielt, konnte Fowler nicht genau sagen, da die Sonnenuhr auf dem Marktplatz die Messung so kleiner Zeitabstände nicht zuließ, aber er hatte keinerlei Zweifel daran, dass es zu lange war. „Nimm den Mantel ab, Herrgott nochmal, der wiegt doch sicherlich drei Kilo!“
Der Patient zögerte so lange, dass Fowler bereits drauf und dran war, ihn seiner Praxis zu verweisen. Letzten Endes siegte aber doch die Vernunft, d.h. der Mann beugte sich Fowlers Forderungen.
„Hmm!“, machte Fowler. „In der Tat ungewöhnlich.“
Auf der Wange des Mannes zeichneten sich deutlich die Umrisse seiner Finger ab, die er zum Schutz vors Gesicht gehalten hatte, als er durch den Lichtstrahl getreten war. Überall dort, wo die Haut dem bloßen Sonnenlicht ausgesetzt gewesen war, war sie stark gerötet.
„Du bist zu dünn“, wandte sich Fowler greifbareren Problemen zu, woraufhin ihn der Patient mit leisem Vorwurf aus seinen dunklen, tief in den Höhlen liegenden Augen musterte. In Kombination mit den eingefallenen Wangen und den scharf hervortretenden Kiefer- und Wangenknochen ergab sich ein höchst unangenehmer Eindruck.
„Seit meiner Erkrankung kann ich keine Nahrung mehr bei mir behalten“, erwiderte der Patient in einem Tonfall, als erwarte er von Fowler auch noch, hellsichtig zu sein, oder als hätte er diesen Umstand bereits erwähnt. „Darüber hinaus schmerzen meine Schneidezähne bei jeder noch so leichten Berührung.“
„Vermutlich sind deine Beschwerden psychosomatischer Natur“, konstatierte Fowler nach kurzer Überlegung. Niemand wusste so recht, was unter diesem Begriff zu verstehen war, und doch löste seine bloße Erwähnung die verschiedenartigsten Probleme wie durch Zauberhand. „Was die Zahnschmerzen angeht, so werde ich dich an meinen Kollegen Doktor Winther überweisen. Zähne gehören nicht zu meinem Fachgebiet.“
„Aber die Zahnschmerzen sind Teil eines Symptomenkomplexes!“, begehrte der Patient auf.
„Und schon wieder glaubst du, dich besser auszukennen als der Fachmann!“ Ein derart dreistes Individuum lief Fowler nicht oft über den Weg, wenn er auch ganz allgemein den Eindruck hatte, dass die Patienten in den letzten Jahren viel aufmüpfiger geworden waren. In seiner Jugend war man Ärzten mit entschieden mehr Respekt begegnet, das stand außer Zweifel.
War das Ganze denn wirklich so kompliziert, dass es der Verstand der einfachen Leute nicht zu erfassen vermochte? Mit dem grauen Star ging man zum Augenarzt, mit dem Schnupfen zum HNO-Arzt, mit Zahnschmerzen zum Zahnarzt, und wer bereits tot war, den brachte man zum Forensiker. Der menschliche Körper war komplex – da konnte man ja schlecht von einem Einzelnen verlangen, den vollen Überblick zu haben. Umso erstaunlicher war es, dass sich in den Köpfen der Bevölkerung der Irrglaube verankert hatte, die Aufgabe eines Allgemeinarztes bestünde gerade darin, sich mit dem gesamten Körper auszukennen. Darüber konnte Fowler nur den Kopf schütteln. Wie die meisten Allgemeinärzte war er bescheiden und wusste, dass er nichts wusste. Daher zögerte er auch nicht, seine Patienten bei den geringsten Komplikationen einem Spezialisten zu überantworten.
„Öffne den Mund!“, befahl er und drückte mit einem Holzstäbchen die Zunge des Patienten herab. Wie erwartet fand er nicht die geringsten Anzeichen für eine Erkältung. Was für eine Zeitverschwendung! Zu allem Überfluss ritzte er sich, als er die Hand zurückzog, den Zeigefinger an einem der ungewöhnlich scharfkantigen Schneidezähne des Patienten auf.
„Ich werde dich definitiv an Herrn Winther überweisen“, murmelte er.
Er wollte gerade das Blut mit einem Handtuch abwischen, als der Patient plötzlich sein Handgelenk ergriff.
„Was fällt dir ein?!“, empörte sich Fowler und zerrte an seiner Hand. Obwohl der Mann derart ausgemergelt war, dass man den Eindruck hatte, er könne sich kaum auf den Beinen halten, war sein Griff so fest wie ein Schraubstock. Fowlers Indignation schlug sehr schnell in Fassungslosigkeit und dann in regelrechtes Entsetzen um, als der Patient die Hand an seine Lippen führte – und dann ohne Vorwarnung zubiss.
Recht vs. Gerechtigkeit
1
„Herein!“
Die Tür schwang mit einem leisen Knarren auf, und das rundliche Gesicht eines etwa sechzehnjährigen Burschen schob sich durch den Spalt.
„Nur immer hereinspaziert!“, ermutigte ihn Fowler. „Was führt dich zu mir?“
Der junge Mann betrat den Raum und schloss die Tür hinter sich. Unter seinem linken Arm klemmte eine verschlissene Ledertasche, wie sie üblicherweise zur Aufbewahrung von Dokumenten verwendet wurde. Der Anzug, der ganz offensichtlich für eine um gut zehn Zentimeter größere und zehn Kilogramm leichtere Person geschneidert worden war, befand sich in keinem besseren Zustand. Das Hemd war von einem ungewöhnlich grellen Orange, schien aber etwas besser erhalten zu sein als der Rest seines Aufzugs.
„Mein Name ist Oscar Drescher, Herr Doktor“, stammelte der junge Mann. Aus seinen kleinen Maulwurfäuglein blinzelte er ins Halbdunkel des Sprechzimmers. „Ich komme wegen … “
„Fieber“, stellte Fowler mit einem Blick auf die roten Bäckchen des Jungen fest. Er nahm ein Messer zur Hand und erhob sich hinter dem Schreibtisch.
„Nein, Sir!“, erwiderte Drescher hastig und wich einen Schritt zurück. Mit zitternden Händen zog er eine Liste hervor und reichte sie dem Arzt. „Es geht um die Steuern, Sir! Die Zahlungen der letzten drei Monate stehen noch aus, sehen Sie?“
Ein Steuereintreiber, und allem Anschein nach war er neu in seinem Job. Das erklärte auch seine Nervosität: Die Lebenserwartung in diesem Berufsstand war nicht unbedingt hoch.
„Du bist zu nervös, mein Junge“, sagte Fowler. „Das tut dem Organismus nicht gut. Ich empfehle einen Aderlass.“
Drescher warf einen Blick auf das Messer in Fowlers Hand und schluckte hart. „Vielen Dank, Herr Doktor, aber ich bin im Dienst. Vielleicht ein andermal.“ Er hielt das Pergament vor sein Gesicht, als wolle er sich dahinter verstecken. „Hier steht … hier steht, dass Sie mit 463 Talern im Rückstand sind, Herr Fowler. Wenn … wenn Sie das Geld nicht da haben, werde ich nächste Woche wiederkommen … “
Während er sprach, war er Schritt um Schritt zurückgewichen, so dass er fast schon die Tür erreicht hatte, als Fowler ihn zurückrief.
„Nicht so eilig!“ Fowler öffnete eine Schreibtischschublade. „Ich habe das Geld.“
„Sie haben das Geld?“ Auf dem Gesicht des Steuereintreibers wechselten Argwohn und Hoffnung miteinander ab.
„Aber natürlich.“ Fowler lächelte. „Schließlich habe ich dich erwartet.“
Für gewöhnlich erwarteten die braven Bürger einen Steuereintreiber nicht mit Geldsäckchen, sondern mit Mistgabeln oder Armbrüsten. Oscars Misstrauen war geweckt, aber die Aussicht, an diesem Abend nicht mit leeren Händen seinem Vorgesetzten gegenübertreten zu müssen, war einfach zu verführerisch, und so streckte er zögerlich die Hand nach dem münzgefüllten Säckchen aus, welches der Arzt ihm entgegenhielt wie einen Köder.
„Ich bin dazu angehalten, nachzuzählen“, sagte er in fast entschuldigendem Tonfall.
Als Doktor Fowler keinerlei Einwände erhob, schüttete er den Inhalt des Beutels auf den Schreibtisch und begann zu zählen, wobei sich seine Lippen lautlos bewegten. Von Zeit zu Zeit sah er auf, um dem Arzt, der ihn mit etwas zu viel Interesse bei dieser langwierigen Tätigkeit beobachtete, einen beunruhigten Blick zuzuwerfen.
„173 … 174“, murmelte er. „Einhundertfünfund … “
„Du solltest dich unbedingt untersuchen lassen“, bemerkte der Arzt wie beiläufig. „Zurzeit grassiert eine Seuche.“
Hastig versicherte Oscar ihm ein zweites Mal, sich nicht krank zu fühlen.
„Die Medizin ist eine Wissenschaft, mein Junge“, sagte Fowler streng. „Wir stützen uns auf Fakten und nicht auf Gefühle.“
„Aber … “
„In dem Moment, in dem du etwas fühlst, ist es ohnehin bereits zu spät“, fuhr der Arzt erbarmungslos fort. „Es gilt, die Krankheit zu bekämpfen, bevor sie überhaupt ausbrechen kann.“
„172“, sagte Oscar und nahm eine weitere Münze zur Hand, während ihm auseinandergesetzt wurde, dass er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellte, da er bei seiner Tätigkeit laufend mit Menschen in Berührung kam, die sich in der Folge bei ihm anstecken konnten, um dann ihrerseits weitere Unschuldige zu infizieren.
„Leidest du an Appetitlosigkeit, Müdigkeit und hast Probleme, dich zu motivieren?“, fragte Fowler und musterte ihn lauernd. Schien es Oscar nur so, oder stand der Mann plötzlich viel näher bei ihm als noch vor einem Augenblick?
„Nein? Und wie steht es mit Kopfschmerzen, Zahnweh oder Übelkeit?“, fuhr der Arzt fort, als Oscar den Kopf schüttelte. „Ebenfalls nicht? Hmm … Dein Organismus unterdrückt also jegliche Form von unangenehmer Empfindung. Das ist ernst. Sehr ernst. Du wirst um eine Blutanalyse nicht herumkommen.“
„Im Januar hatte ich einen Schnupfen!“, beeilte sich Oscar zu versichern. „Fast drei Tage lang … nein, vier! Vier Tage lang!“ Auf welche Weise ließ sich die Blutentnahme umgehen? Indem er behauptete, er habe Beschwerden, oder indem er dies abstritt?
Fowler lächelte, wobei er aus irgendeinem Grund darauf zu achten schien, die obere Zahnreihe nicht allzu sehr zu entblößen. „Du kannst kein Blut sehen?“, fragte er. „Dann hast du wohl den falschen Beruf gewählt, mein Sohn.“
„189“, stammelte Oscar und nahm eine Münze zur Hand.
Ohne Vorwarnung packte ihn Fowler am Handgelenk. „Es wird nicht weh tun“, behauptete er. „Vielleicht stellt sich nach der Blutanalyse heraus, dass ein Aderlass nicht notwendig sein wird.“
Obwohl der Arzt eher fettleibig als kräftig genannt werden konnte, war sein Griff so fest, dass Oscar nicht den Hauch einer Chance sah, sich zu befreien. Was auch immer eine „Analyse“ sein mochte – Oscar zog sie einem Aderlass entschieden vor, und so ließ er sich relativ widerstandslos von Doktor Fowler zu einer großen Kupferschüssel führen, die auf einem Tischchen neben der Garderobe stand. Im Zimmer war es so dunkel, dass Oscar gleich zwei Mal über irgendwelche am Boden liegenden Gegenstände stolperte.
„Herr Doktor“, sagte er schüchtern. „Würde es Ihnen etwas ausmachen, die Vorhänge aufzuziehen? Ich kann kaum meine Hand vor Augen sehen … “
Statt eine Antwort zu geben, krempelte ihm Fowler den Hemdsärmel hoch. Dann legte er Oscars linken Arm in die Rinne, die an der Kupferschüssel befestigt war, und schnallte ihn mit einem Riemen fest. Die Reflexion eines schwachen Lichtstrahls lief gleich einem Wassertropfen den Rücken der Klinge, die der Arzt plötzlich in Händen hielt, entlang.
„Du leidest also darüber hinaus an einer Sehschwäche“, stellte Fowler fest und setzte die Schneide an der Innenseite des Ellenbogens an. Oscar fühlte einen kurzen Schmerz in der Armbeuge, und gleich darauf rann ein dünner Blutstrom seinen Unterarm entlang. Mit dem Zeigefinger fuhr der Arzt durch die kleine Pfütze, die sich am Boden der Schüssel gebildet hatte, wobei er Oscar den Rücken zukehrte. Wie von selbst fuhr Oscars rechte Hand an den Verschluss des Riemens und begann an der Dornschnalle zu nesteln. Sei es nun seiner Ungeschicklichkeit oder seiner Nervosität geschuldet, jedenfalls hatte er das harte Leder nicht einmal halb durch die Schlaufe gezogen, als sich der Arzt wieder nach ihm umdrehte. Oscar hatte den Eindruck, dass die Iris seiner Augen im Dunkeln leicht glühte.
Mit unverhohlener Missbilligung in der Stimme sagte der Arzt: „Nichts, rein gar nichts“ – und löste zu Oscars unbeschreiblicher Erleichterung seinen Arm aus der Halterung.
„Das heißt, dass ich keinen Aderlass brauche?“, vergewisserte Oscar sich dennoch.
„Ja“, bestätigte Fowler finster. „Und nun geh. Ich habe mich bereits viel zu lange mit dir aufgehalten.“
Oscar machte eine hilflose Geste in Richtung der Münzsäckchen. „Was ist mit dem Geld?“, fragte er. „Ich bin noch nicht mit dem Zählen fertig.“
„Dann komm nächste Woche wieder“, erwiderte der Arzt brüsk. „Was ist denn noch?“, blaffte er, als Oscar zögerte. „Meine Geduld mit dir neigt sich dem Ende zu.“
Nach einem letzten sehnsüchtigen Blick auf die Münzen klemmte Oscar sich seinen Aktenkoffer unter den Arm und verließ den Raum. Als er ins Tageslicht hinaustrat, atmete er erleichtert auf – wie jedes Mal, wenn es ihm gelungen war, das Haus eines Schuldners ohne größere Blessuren zu verlassen. Die Ausbeute des heutigen Tages ließ mehr als zu wünschen übrig, und dennoch entschied sich Oscar dafür, zum Schloss zurückzukehren und für heute Feierabend zu machen. Aus irgendeinem Grunde erschien ihm die Aussicht, mit nahezu leeren Händen bei Lord Pereira aufzukreuzen, plötzlich weit weniger erschreckend als sonst.
Ein eisiger Windstoß fuhr fast ungehindert durch den dünnen Stoff seines Mantels. Für Anfang September war es entschieden zu kalt. Kein Wunder, dass jeder die Grippe hatte. Fröstelnd verbarg er das Gesicht hinter dem aufgestellten Kragen – seinen Schal hatte er allem Anschein nach in der Arztpraxis vergessen. Einen Moment lang spielte er mit dem Gedanken, zurückzugehen und ihn zu holen, entschied sich letztendlich aber dagegen. So kalt war es nun auch wieder nicht.
Die Sonne war schon fast hinter dem Dachgiebel eines von einem reichen Händler bewohnten steinernen Wohnhauses verschwunden, als plötzlich drei vermummte Gestalten aus dem Schatten einer alten Eiche hervortraten und Oscar den Weg versperrten.
Straßenräuber. Auch das noch.
Keine Sekunde lang gab sich Oscar der Illusion hin, einer dreifachen Übermacht gewachsen zu sein, doch der Gedanke an Lord Pereira ließ ihn dennoch nach dem Griff des an seinem Gürtel befestigten Kurzschwerts tasten.
„Kommt mir nicht zu nahe!“ Der Versuch, seiner Stimme Festigkeit zu verleihen, scheiterte kläglich. „Ich bin im Auftrag Seiner Majestät unterwegs!“
Die Umrisse der drei Männer verschwammen vor seinen Augen. Er blinzelte – und ließ vor Schreck seine Tasche fallen, als unvermutet das bis unter die Augen vermummte Gesicht eines der Räuber direkt vor ihm auftauchte. Trotz der Bandagen konnte Oscar erkennen, dass die Haut darunter unnatürlich bleich war und sich über Wangenknochen und Nasenbein spannte. Die im Schatten eines breitkrempigen Hutes liegenden Augen schienen wie von innen heraus zu leuchten.
„Ich habe nicht viel bei mir“, stammelte Oscar. „Aber ich werde dir alles geben, was … “ Als er sich nach seiner Tasche bücken wollte, stieß er mit der Schulter gegen einen weiteren Vermummten, der vollkommen lautlos neben ihm aufgetaucht war. Schritt um Schritt wich er zurück, bis er auf Widerstand stieß – den dritten Räuber.
Sein Herz begann wie wild zu pochen. Ja, er war vielleicht nicht der Mutigste unter den Mutigen – doch irgendetwas an diesen Männern war entschieden unheimlich und hätte auch einen verdienteren Mann als ihn in die Flucht geschlagen. So kam es, dass Oscar fast Erleichterung verspürte, als der direkt vor ihm Stehende endlich den Bann brach und zu sprechen anhob – aber nur so lange, bis der Sinn der Worte in sein Bewusstsein eingesickert war.
„Mick, Dewey“, sagte der Fremde. „Überprüft sein Blut.“
Oscar hob abwehrend die Hände. „Meine Herren, ich bin mir sicher, dass es sich um ein Missverständnis handelt!“, stammelte er. „Ich gebe euch alles Silber, das ich bei mir habe!“
Doch da wurde sein Kopf schon grob nach hinten gerissen, und kalter Stahl drückte sich gegen seinen Hals. Aus den Augenwinkeln gewahrte er, wie einer der anderen Räuber mit einem Messer in der Hand an ihn herantrat. Ohne auf das Flehen seines Opfers zu achten, zog er den Handschuh von Oscars linker Hand und fuhr mit der Klinge über dessen Handrücken. Mit einer Mischung aus Befremden und Entsetzten verfolgte Oscar, wie der Mann den Kopf beugte, um gleich einem Hund an dem frischen Blut zu schnüffeln.
„Ekelerregend!“, lautete sein Urteil. „Auf mein Wort, Boss, so etwas hatten wir bisher noch nicht.“
Der Anführer musterte Oscar einige Augenblicke lang mit starrem Blick, dann fuhr sein Kopf plötzlich ruckartig herum.
„Boss?“, fragte derjenige, der hinter Oscar stand. „Was ist … “
Ein Zischen durchschnitt die Luft, so leise, dass Oscar es vermutlich gar nicht wahrgenommen hätte, hätte der Armbrustbolzen, der nun aus der Schulter des Räuberhauptmanns ragte, nicht in wenigen Zentimetern Abstand sein rechtes Ohr passiert. Fast im selben Moment fühlte er, wie der Druck des Messers an seinem Hals nachließ. Mit einem Stöhnen ging der Räuber hinter ihm zu Boden.
Der Anführer der kleinen Räuberbande griff um den Schaft des Bolzens, der aus seiner Schulter ragte, und zerbrach ihn zwischen Daumen und Zeigefinger. „Kommt raus!“, schrie er und breitete die Arme aus. „Oder zieht ihr es vor, wie Feiglinge aus dem Hinterhalt zu schießen?“ Zur Antwort regnete es von allen Seiten Bolzen.
„Boss!“ Der Räuber, der Oscar in die Hand geschnitten hatte, kniete neben seinem am Boden liegenden Gefährten.
„Was willst du?!“, herrschte ihn der andere an, während er eines der Geschosse aus der Luft fing.
„Er ist tot, Boss! Mick ist tot!“
„Schafskopf!“, zischte der Räuberhauptmann, wandte sich aber dennoch zu ihm um. Ein Bolzen nach dem anderen Schlug in seinen Rücken ein, doch er schenkte dem keinerlei Beachtung. „Das ist unmöglich!“
„Es ist, wie es ist, Boss“, erwiderte der andere. „Er ist tot. Toter geht's nicht.“
Mit einem Mal schien sich der Hauptmann nicht mehr ganz so wohl in seiner Haut zu fühlen. Seine hellen grauen Augen suchten unstet die Schatten zwischen den Gebäuden ab.
„Ich habe ebenfalls den Eindruck, dass er tot ist“, fügte Oscar hilfsbereit hinzu, denn mit Freundlichkeit erreichte man oft mehr als mit Gewalt.
Als der Hauptmann daraufhin zu ihm herumfuhr, kamen ihm berechtigte Zweifel an dieser Devise, aber da war es auch schon zu spät. Der Räuber packte ihn am Kragen und hielt ihn vor sich, so dass Oscar sich in der Schusslinie des unsichtbaren Schützen wiederfand. Aufmerksam die Umgebung im Blickfeld behaltend, wich der Hauptmann Schritt um Schritt zurück und zog ihn dann in eine Seitengasse. Dewey, der andere Räuber, langte nur wenige Sekunden später bei ihnen an. Fluchend riss er sich zwei oder drei Bolzen aus der Brust.
„Los, weg hier!“, zischte der Hauptmann. Seine Gestalt verschwamm.
Oscar blinzelte und sah sich um. Die Räuber waren verschwunden, doch ganz am anderen Ende der Gasse gewahrte er eine Bewegung. Konnte es wirklich sein, dass … ? Er schüttelte kurz den Kopf und trat aus der Gasse heraus. Manchmal war es besser, die Dinge nicht allzu genau zu hinterfragen. Es galt, die Tasche zu finden und sich dann so schnell wie möglich aus dem Staub zu machen. Doch als er den kleinen gepflasterten Platz unter der Eiche fast erreicht hatte, erwartete ihn die nächste unliebsame Überraschung: Ein Mann in einem zerschlissenen Mantel war gerade dabei, Oscars Tasche zu durchwühlen, wobei seine in abgeschnittenen Handschuhen steckenden Finger achtlos ein Dokument nach dem anderen über die Schulter zu Boden warfen. Lord Pereiras Gesicht erschien plötzlich vor Oscars innerem Auge, und für einen Moment vergaß der Steuereintreiber seine Furcht und stürzte auf den Platz hinaus. Die Tatsache, dass der Mann nicht allein war, sondern ihm zwei weitere, schäbig gekleidete Gestalten mit abenteuerlicher Bewaffnung Gesellschaft leisteten, registrierte er durchaus, doch vermochte sie nicht, auf sein Handeln Einfluss zu nehmen.
„Was macht ihr denn da?!“, rief er und legte die wenigen Meter, die ihn noch von der Gruppe trennten, in einer Art Trab zurück.
Der Mann, der Oscars Tasche in Händen hielt, sah auf. Eine Strähne seines vor Schmutz starrenden, dunkelblonden Haares fiel ihm über die Augen, der Rest war zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Es handelte sich zweifellos um einen ganz gewöhnlichen Straßenräuber. Trotz der alles andere als vorteilhaften Situation, in der er sich befand, empfand Oscar für einen Moment so etwas wie Erleichterung. Für den Moment. Das Gefühl verflog nahezu augenblicklich, als einer der anderen Räuber seine Armbrust hob und auf seine Brust richtete.
Der Steuereintreiber hob abwehrend die Hände.
„Ist das alles, Junge?“, fragte der Blonde und musterte Oscar aus müden, blauen Augen. Er hielt zwei kleine Säckchen mit Silbermünzen in die Höhe. Aus dem Augenwinkel gewahrte Oscar, wie der Kerl mit der Armbrust auf Metzger Atkinsons Schuldenliste trat, als er auf Oscar zuging, um der Frage seines Vorgesetzten Nachdruck zu verleihen. Währenddessen machte sich der Dritte im Bunde in aller Seelenruhe daran, Oscars Besitztümer zu begutachten.
„So hör doch auf damit!“, rief Oscar verzweifelt und versuchte, gleichzeitig die Bolzenspitze und die Tasche im Auge zu behalten. Eine eisige Windböe fegte über den Platz, zerrte an den Mänteln der Räuber und wirbelte drei oder vier Pergamentblätter in die Luft. In einem Reflex streckte Oscar die Hand aus, um eines davon zu erhaschen, ließ sie aber erschrocken wieder sinken, als der Mann mit der Armbrust seine Waffe in Anschlag brachte.
„Durchsucht ihn“, befahl der Blonde und ließ mit einem Seufzer die Säckchen fallen. „Ich habe noch niemals einen Steuereintreiber auf dem Weg zum Schloss abgefangen, der derart wenig Geld bei sich hatte.“
Sofort krochen zwei Räuber, die sich bislang im Hintergrund gehalten hatten, aus den Schatten. Als er feststellte, dass Oscar auch wirklich gar nichts Wertvolles bei sich trug, entledigte ein auffallend großer, stämmiger Mann ihn seines Mantels und versuchte mit bewundernswertem Optimismus, ihn selbst überzuziehen.
Der Armbrustschütze trat gegen eines der beiden winzigen Säckchen, aus denen Oscars ganze Ausbeute bestand und fluchte ungehalten vor sich hin. „Verdammt! Die Bolzen, die ich in diese Kerle gejagt habe, waren mehr wert!“ Sich neben der Leiche niederlassend, riss er ihr ungehalten das Geschoss, das ungefähr auf Höhe des Herzens aus ihrem Rücken ragte, aus dem Leib. „Einer von Reids Männern“, kommentierte er. Oscar fühlte eine leichte Übelkeit in sich aufsteigen und wandte sich ab.
Der Blonde seufzte. „Ich hoffe bloß, dass es nicht Cathal ist.“
„Nein.“
„Was sollen wir mit dem Jungen machen, Chef?“, fragte der stämmige Mann, der immer noch mit Oscars Mantel kämpfte.
Der Anführer zuckte lustlos mit den Schultern, woraufhin der Fragesteller, der es offenbar gewohnt war, die Befehle seines Herrn nach seinem eigenen Gutdünken auszulegen, kurzerhand ein Messer zog. Die Klinge war über und über mit Kratzern und Kerben überzogen, was von einem regen Gebrauch sprach.
„Lasst die Waffen fallen!“, ertönte da ein Ruf aus einer der Gassen, gefolgt von dem charakteristischen Geräusch klappernder Rüstungsteile.
Das Gesicht des Räubers verzerrte sich. Statt der Aufforderung nachzukommen, fuhr er blitzschnell herum und warf das Messer in Richtung des Sprechers. Seine Kameraden dachten ebenfalls nicht daran, sich den Soldaten der Stadtwache zu ergeben – kein Wunder, wenn man an die Strafe für Raub oder Diebstahl dachte, die König Thaddeus' irrer Sohn eingeführt hatte. Drei Wachmänner gingen von Armbrustbolzen niedergestreckt zu Boden, ehe es ihren Kameraden gelang, den Schützen zu überwältigen.
Der Kampf währte nicht lange. Ehe Oscar sichs versah, lag auch schon der Kerl, der seinen Mantel gestohlen hatte, blutend zu seinen Füßen, während ein weiterer beim Versuch, sein Heil in der Flucht zu suchen, gerade unter einem Schwerthieb zu Boden taumelte. Zu guter Letzt war außer Oscar selbst nur noch der Anführer der Räuber auf den Beinen, der die Hände über den Kopf hielt und das Geschehen um sich herum resigniert verfolgte.
„Ist das alles?“ Der Hauptmann der Wache hielt ihm die beiden Beutel voll Silber vor die Nase. Aus seinem Tonfall sprach unverhohlenes Misstrauen.
„Ja“, erwiderte der Räuber, während er sich widerstandslos die Handgelenke zusammenbinden ließ. „Der Kleine ist der schlechteste Steuereintreiber, mit dem ich jemals Bekanntschaft gemacht habe.“
„He, du! Junge!“ Der Hauptmann winkte Oscar heran. „Ist das alles, was du heute eingenommen hast?!“
Oscar starrte ihn aus weit aufgerissenen Augen an.
„Antworte!“
„N-nein“, kam es wie von selbst aus Oscars Mund.
„Aha! Und wo ist der Rest?“
„I-ich weiß es nicht!“
Der Offizier wandte sich wieder seinem Gefangenen zu. „Zu deinem eigenen Besten rate ich dir, uns das Geld zu geben!“
„Wo soll ich es denn hingesteckt haben?“, erwiderte der Bandit in einem Tonfall, als spräche er zu einem etwas zurückgebliebenen Schuljungen.
Hastig wandte Oscar den Blick ab, als den Räuber als Antwort auf diese Respektlosigkeit ein Faustschlag in die Magengegend traf.
2
„Der Bengel lügt!“, rief einer der beiden Angeklagten, ein hochgewachsener, muskulöser Kerl mit pechschwarzem Haar, dessen aufbrausendes Temperament ihn nicht zum ersten Mal auf die Anklagebank führte. „Mehr hatte er nicht bei sich!“
Kronprinz Ivor II. ließ den Blick durch den Gerichtsaal schweifen. Für gewöhnlich waren Gerichtsverhandlungen recht gut besucht, da die Bevölkerung sie als eine Form der Unterhaltung ansah, doch heute war der Raum nur zu fast drei Vierteln gefüllt. Nicht wenige der Anwesenden wirkten unterernährt, obwohl die Ernte dieses Jahr mehr als reichlich ausgefallen war. Ivor fragte sich, ob die Stadt vielleicht von einer Seuche heimgesucht wurde.
„Herr Drescher!“ Richter Louis Powell, ein rundlicher älterer Herr, dessen Wangen beständig gerötet waren, wandte sich an einen unbeholfen wirkenden jungen Mann, der den beiden Angeklagten gegenüber auf dem Podium saß. Der Kleine konnte nicht älter als fünfzehn oder sechzehn Jahre alt sein. „Wenn Sie uns bitte die Höhe der Einnahmen besagten Tages nennen würden!“
Der Steuereintreiber hielt den Blick starr vor sich auf den Tisch gerichtet. „80734 Taler, Euer Ehren“, murmelte er.
Der Räuberhauptmann stieß ein kurzes, humorloses Lachen aus. „So viel wird der Kerl in seinem ganzen Leben nicht eintreiben.“
„Du drohst dem Ankläger, erbärmliche Kreatur?“, blaffte ihn der Richter an.
Hywel Williams seufzte resigniert. „Aber nicht doch, Euer Ehren.“
„Meister Gert Lloyd, der Metzger Pete Atkinson, die Händler Alexis Soto und Günther Pruitt sowie zehn weitere ehrenwerte Bürger haben unter Eid ausgesagt, an diesem Tage ihre Schulden gegenüber dem Staat bei Herrn Drescher beglichen zu haben!“, donnerte der Richter. „Ihr Wort steht gegen eures!“
Ivors Gesicht verfinsterte sich. Seines Wissens hatte der alte Atkinson seit sage und schreibe fünf Jahren keinen Taler Steuergeld bezahlt. Woher also der plötzliche Sinneswandel?
Er beugte sich zu seinem Vater hinüber und raunte ihm ins Ohr: „Der Junge lügt.“
„Was macht das für einen Unterschied?“, erwiderte König Thaddeus leichthin. „Die beiden sind gesuchte Verbrecher. Darüber hinaus haben sie gestanden, dem Steuereintreiber zwei Säckchen mit Silbermünzen entwendet zu haben. Ihnen wird so oder so die rechte Hand abgehackt werden.“
Ivor kniff die Lippen zusammen. „Es macht einen Unterschied“, erwiderte er kalt.
Die nächste halbe Stunde über verfolgte er schweigend, wie die „ehrenwerten Bürger“ einer nach dem anderen in den Zeugenstand gerufen wurden und nach einem Schwur bei Gott, dem Herrn, fast ausnahmslos angaben, nicht nur die für diesen Monat fälligen, sondern auch die seit etlichen Jahren ausstehenden Schulden beglichen zu haben. Um alle diese Herren an einem einzigen Tag besucht zu haben, hätte der junge Wunderknabe nicht nur professioneller Marathonläufer sein, sondern auch eine Zeitmaschine besitzen müssen – wie sonst könnte er das Haus des Uhrmachers um 14:10 Uhr verlassen haben und schon um 13:50 Uhr auf Atkinsons Schwelle gestanden haben?
Trotz der offensichtlichen Widersprüche in den Aussagen der Zeugen zweifelte Ivor nicht daran, zu welchem Schluss der Richter kommen würde, und so erhob er sich, bevor Powell Gelegenheit hatte, seiner Majestät das Urteil zu verlesen. Ohne Vorwarnung richtete er das Wort direkt an den Steuereintreiber: „Junger Mann, nennen Sie mir bitte den genauen Betrag, der Ihnen geraubt wurde.“
„Eure Hoheit“, fiel der Richter ein. „Herr Drescher hat die Höhe der Summe dem hohen Gericht bereits mitgeteilt. Es handelt sich um … “
Mit einer knappen Handbewegung brachte Ivor ihn zum Schweigen. „Wie viel?“, wiederholte er mit eisiger Stimme.
Aus dem Gesicht des Jungen wich jegliche Farbe. „A-achtzigtausend und … und … “ Hilfesuchend sah er zum Richter auf. „ … und sechshundert, nein, nein! Siebenhundert… 80716!“
„80734“, verbesserte Ivor.
„Eure Hoheit!“, rief der Richter erregt. „Der Junge ist nervös und muss sich versprochen haben!“
Gut möglich, doch sollte man meinen, dass ein Steuereintreiber, noch dazu ein so junger, eine Rekordsumme wie diese im Gedächtnis behalten konnte. „Er hat gelogen“, entschied Ivor. „Ich will, dass er wegen Meineides verurteilt wird. Und alle, die behaupten, an diesem Tage ihre Schulden beglichen zu haben und es nicht beweisen können, ebenfalls.“
Die Augen des Jungen quollen vor Entsetzen fast aus den Höhlen; er schien irgendetwas sagen zu wollen, brachte jedoch keinen Ton hervor.
„Mein Prinz!“, rief Powell. „Es handelt sich um ehrenwerte Bürger … “
„Sie haben versucht, den Staat zu bestehlen“, unterbrach Ivor, „und demnach sind sie Diebe. Also sollen sie auch wie Diebe behandelt werden.“
In der daraufhin eintretenden tödlichen Stille warf der Richter einen Blick auf den König, der jedoch keine Anstalten machte, einzuschreiten.
„Wie Eure Hoheit wünscht“, sagte Powell schließlich in demütigem Tonfall. „Wie soll mit den beiden Angeklagten verfahren werden, mein Prinz?“
Ivor sah zur Anklagebank. Derjenige, den die Anklage als Iain Flynn vorgestellt hatte, erwiderte seinen Blick. Der Verbrecher bemühte sich, seinem Gesicht einen möglichst teilnahmslosen Ausdruck zu verleihen; in seinen dunklen Augen jedoch glitzerte eine Mischung aus Furcht und wilder Hoffnung. Der andere, Hywel Williams, sah sich teilnahmslos im Saal um, als ginge ihn die Verhandlung im Grunde genommen gar nichts an.
„Hackt ihnen die rechte Hand ab“, sagte Ivor. „Sie sind Diebe.“
Freund oder Feind?
1
„Fürchte dich nicht!“, flüsterte Alexandra, obwohl sie beim Gedanken, die steinernen Stufen hinabsteigen zu müssen, selbst irrationale Furcht überkam. „Es ist doch bloß ein Keller.“
Judith starrte in den düsteren Treppengang hinab, der nur spärlich von in unregelmäßigen Abständen an den Wänden angebrachten Fackeln erhellt wurde. „Ich will nicht“, sagte sie, als Alexandra sie am Handgelenk hinabziehen wollte.
„Ich befehle es dir!“ Alexandra versuchte, den Tonfall ihres Bruders zu imitieren. „Du wirst da hinabsteigen und erst wieder herauskommen, wenn ich es dir sage!“
Judiths Augen, die in ihrem mageren Gesicht ohnehin bereits riesig wirkten, weiteten sich vor Entsetzen. „Bitte nicht!“, stammelte sie.
„Es ist zu deinem eigenen Besten!“, erklärte Alexandra entschieden. „Komm!“
Sie holte tief Luft und begann, die hohen, schmalen Stufen hinabzusteigen, ohne sich auch nur ein einziges Mal nach Judith umzusehen.
„Eure Hoheit!“, rief Judith, als Alexandra um die Kurve gebogen und von der Schwelle aus nicht mehr zu sehen war. Alexandra erlaubte sich ein triumphierendes Lächeln. Kurz darauf hörte sie Judiths Schritte hinter sich auf dem kalten Steinboden widerhallen.
„Warum bringt Ihr mich hierher, Hoheit?“, fragte Judith, als sie neben ihr anlangte.
Judith war erst zwölf Jahre alt, also zwei volle Jahre jünger als sie selbst – und das merkte man ihr auch an. Zumindest war Alexandra davon überzeugt, sich mit zwölf nicht derart kindisch benommen zu haben.
„Ich muss mich vor dir nicht rechtfertigen“, erwiderte Alexandra schroff. „Ich will kein Wort mehr darüber hören!“
Hätte sie ihrer Freundin die Wahrheit gesagt, so wäre ihr Plan von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen, dessen war sich die Prinzessin sicher. Judith wäre in Panik ausgebrochen und hätte versucht, aus dem Schloss zu fliehen. In der Stadt jedoch wimmelte es von Sir Pereiras Häschern, und Judith in ihrer Tollpatschigkeit wäre unweigerlich einem von ihnen in die Hände gefallen. Ihren Bruder zu bitten, Judith zu verschonen, hatte Alexandra erst gar nicht in Erwägung gezogen. Sie kannte Ivor gut genug, um zu wissen, dass er in solch einem Fall keine Ausnahme machen würde.
Seit mehreren Jahren schon pflegte die Prinzessin, sich hinter den schweren roten Samtvorhängen im Thronsaal zu verstecken, wenn eine Ratssitzung einberufen worden war. Meistens war es unerträglich langweilig, so dass es Alexandra all ihre Willenskraft kostete, den Sitzungen dennoch beizuwohnen. Doch sie hielt es nun einmal für ihre Pflicht, darüber informiert zu sein, was im Königreich vor sich ging – schließlich würde sie eines Tages die Herrschaft übernehmen. Nach Vaters Tod. Falls Ivor sterben sollte, ohne Nachkommen hinterlassen zu haben.
Diese besagte Ratsversammlung jedoch war anders gewesen als alle anderen, die sie bislang belauscht hatte. Gleich zu Beginn hatte Ivor Sir Hammond einsperren lassen, obwohl dieser überhaupt nichts getan hatte – und weder ihr Vater noch einer der anderen Fürsten hatte es gewagt, einzugreifen. Alexandra kannte Sir Hammond, soweit ihre Erinnerung zurückreichte: Ein gutmütiger, älterer Herr mit einem dichten, schneeweißen Schnauzbart, der sie stets mit „Eure Hoheit“ angeredet hatte, und nicht mit „Kleine“ oder „Mädchen“ wie die anderen Adligen, allen voran Borissow. Wenn sich schon niemand für Sir Hammond einsetzte – was würde dann erst mit der Tochter eines einfachen Dienstmädchens wie Judith geschehen?
Das Entscheidende aber war, dass Ivor angeordnet hatte, alle Kranken ausfindig zu machen und in Gewahrsam zu nehmen – und auch da hatte ihm niemand widersprochen. Sobald sich der Saal geleert hatte, hatte Alexandra Judith aus dem Zimmer, welches diese zusammen mit drei weiteren Mägden bewohnte, geholt und sie geheißen, ihre wenigen Habseligkeiten zusammenzupacken.
Kurz hatte sie mit dem Gedanken gespielt, sich ihrem Vater anzuvertrauen. Der König war ein umgänglicher Mann, jedoch fehlte es ihm an Willensstärke. Im Laufe der letzten Jahre hatte er zugelassen, dass Ivor mehr und mehr essenzielle Aufgaben im Staat übernahm, so dass das Königreich mittlerweile faktisch vom Kronprinzen regiert wurde. Nein, vom König konnte sie keinerlei Hilfe erwarten. Er würde sie bedauern, oh ja, doch die Wahrheit war nun einmal, dass er nicht frei von Furcht vor seinem eigenen Sohn war. Alexandras Gesicht verfinsterte sich. Im ganzen Königreich war sie wohl die einzige, die keine Angst vor Ivor hatte. Sie wagte gar nicht daran zu denken, mit welchem schafsköpfigen Prinzen sie ihr Vater bereits verlobt hätte, hätte Ivor nicht jedes Mal sein Veto geltend gemacht.
Mittlerweile waren sie im Keller angekommen. Zweifelnd sah sich Alexandra um. Von der Decke hing das Dörrfleisch herab, und entlang der Wände waren riesige Fässer aufgereiht – manche von ihnen waren höher als sie selbst. Die Luft war feucht und roch schimmlig. Kein geeigneter Ort für eine Kranke, daran bestand kein Zweifel, aber Alexandra sah keinen anderen Ausweg. Erneut ergriff sie Judiths Handgelenk und zog sie das aus den Fässern gebildete Spalier entlang zum äußersten Ende des Kellers.
„Prinzessin!“, entfuhr es Judith, als Alexandra sich zwischen zwei Fässern niederkauerte und ihr Bündel öffnete. Ihr war nicht viel Zeit geblieben, und so hatte sie nur die notwendigsten Dinge zusammengerafft: Eine Decke, ein Kissen und etwas Verpflegung. Auf Kerzen hatte sie absichtlich verzichtet. Judith würde sie in ihrer Unvernunft aus Furcht vor der Dunkelheit Tag und Nacht brennen lassen und somit zwangsläufig die Aufmerksamkeit irgendeines Bediensteten, die zwar nicht oft, aber regelmäßig in den Keller hinabstiegen, auf sich ziehen.
„Ihr wollt mich doch hier nicht alleine lassen?!“ Aus der Stimme Judiths sprach keine Angst mehr, sondern regelrechte Panik.
„Ich werde nach dir sehen, so oft ich kann“, versprach Alexandra und fügte nach kurzem Zögern hinzu: „Und dir ein paar meiner Bücher bringen, damit du dich nicht langweilst.“ Ihre Bücher waren ihr Heiligtum. Ivor hatte die besten Schreiber unter den Mönchen gezwungen, von ihrer Arbeit an den Abschriften religiöser Texte abzulassen und eigens für Alexandra Bücher mit Sagen, Märchen und Erzählungen anzufertigen. Jede Seite zierten feinste Malereien, die die jeweilige Geschichte illustrierten.
„Ich kann doch gar nicht lesen!“, erwiderte Judith mit weinerlicher Stimme.
„Gut, dann eben nicht.“ Alexandra versuchte, sich ihre Erleichterung nicht anmerken zu lassen, da sie sich nur äußerst ungern von ihren Schätzen getrennt hätte. Sie erhob sich und glättete unwillig ihren Rock. Blöde Kleider. Überall blieb man damit hängen, und es war fast unmöglich zu rennen. Zudem war es nicht leicht, sich mit so einem Ding zu verstecken. Ständig ragte irgendwo ein Stofffetzen hervor. War sie erst einmal Königin, dann war es mit diesem Unsinn vorbei, das hatte sie sich fest vorgenommen. Sie würde das Tragen von Kleidern und Röcken schlichtweg verbieten.
Judith griff nach Alexandras Hand. „Ich flehe Euch an, Prinzessin! Lasst mich nicht hier! Lasst mich nicht hier!“
„Ich muss gehen“, erwiderte Alexandra und versuchte ihre Hand zu befreien, doch Judiths Griff war ganz ungewöhnlich fest. Vermutlich verlieh die Angst ihr Kraft. „Ich habe zu tun.“ In der gegenwärtigen Situation war es von äußerster Wichtigkeit, über alle Vorgänge im Schloss und in der Stadt informiert zu sein.
„Was machst du denn da?“, fuhr sie auf, als Judith plötzlich Alexandras Hand an die Nase hielt.
„Ihr riecht heute so gut, Prinzessin“, sagte Judith leise.
„Ach, ja?“ Alexandra befreite mit äußerster Kraftanstrengung ihr Handgelenk. „Dir wird es bald besser gehen“, urteilte sie. „Du bist sehr kräftig.“
„Prinzessin!“ Judith streckte erneut die Hand nach ihr aus. Diesmal war Alexandra allerdings auf der Hut und trat hastig einen Schritt zurück.
„Ich werde zurückkommen, sobald ich kann.“ Sie wandte sich ab und durchquerte den Keller etwas schneller als beim Hinweg.
Nahezu fünf Minuten wartete sie, das Ohr an das feuchte Holz gepresst, bevor sie es wagte, die Kellertür zu öffnen und auf den Gang hinauszutreten. Nach kurzer Überlegung verriegelte sie die Tür hinter sich. Wer konnte schon sagen, zu welchen Dummheiten Judith imstande war? Dann marschierte sie entschlossenen Schrittes in Richtung Thronsaal.
„Verzeiht, Eure Hoheit.“ Eine Hand legte sich auf ihre Schulter. Wütend fuhr sie herum. „Ihr müsst Euch wohl noch ein Weilchen gedulden. Der König empfängt gerade einige, hmm, Gäste.“
Alexandra kniff die Lippen zusammen. Nur wenige Meter trennten sie von der Thronsaaltür. Es war ihr unerklärlich, von woher Lord Pereira so plötzlich aufgetaucht war. Weshalb schlich er hier auf den Gängen herum, wenn der König gerade einen Besucher oder Boten in Empfang nahm?
„Tretet beiseite, Lord Pereira“, sagte sie und sah zu ihm auf. „Ihr seid nicht in der Position, mir Vorschriften zu machen!“
Auf Lord Pereiras schmalen Lippen erschien das übliche dünne Lächeln. Auch er wurde von jedermann gefürchtet. „Ihr missversteht mich, Eure Hoheit“, erwiderte er sanft. „Ich habe Euch lediglich einen Rat erteilt. Kehrt in Euer Zimmer zurück. Zu Eurem eigenen Besten. Der König wird nicht erfreut sein, bei einer wichtigen Besprechung gestört zu werden.“
Die Worte bewirkten bei Alexandra genau den entgegengesetzten Effekt. Es handelte sich also um eine wichtige Besprechung. Nun war sie entschlossener denn je, in den Thronsaal vorzudringen.
„Was kümmert mich der König?!“, platzte es aus ihr heraus. „Ich möchte meinen Bruder sprechen!“
Lord Pereira musterte sie aufmerksam. „Wie interessant“, sagte er wie zu sich selbst. Dann machte er eine einladende Geste in Richtung Tür. „In dem Fall möchte ich Euch nicht länger aufhalten.“
Misstrauisch runzelte Alexandra die Stirn. „Weshalb seid Ihr nicht im Thronsaal?“, fragte sie.
Pereira lächelte erneut. „Ich habe zu tun, Hoheit. So gern ich auch den ganzen Tag an der Seite Eures Vaters Boten und Bittsteller in Empfang nehmen wollte … “ Er hob in einer vagen Geste die Hände. „ … leider finde ich dazu nicht die Zeit.“
„Hmm“, machte Alexandra. Einen Augenblick lang spielte sie mit dem Gedanken, ihr Vorhaben aufzugeben und stattdessen Pereira zu beschatten. Bevor sie indes einen Entschluss fassen konnte, hatte ihr der Vogt bereits den Rücken zugekehrt und entfernte sich mit fast lautlosen Schritten. Gut, dann also der Thronsaal. Alexandra holte tief Luft und öffnete die Tür. Zu ihrer Enttäuschung handelte es sich bei den „Gästen“ lediglich um einfache Boten. Ihre Stiefel waren staubig, und sie trugen Rüstungen aus Leder. Dennoch raffte sie ihr Kleid und schritt würdevoll den Mittelgang entlang. Sie war sich bewusst, dass aller Blicke auf sie gerichtet waren, doch das verursachte ihr nur wenig Unbehagen, denn es war allemal besser, als überhaupt nicht beachtet zu werden. Vor dem Thron angekommen, entschied sie sich statt eines albernen Knickses für eine leichte Verbeugung. Ihrem Vater war nur allzu deutlich anzusehen, dass er über die Unterbrechung ganz und gar nicht erfreut war; er verzichtete indes darauf, sie vor den Boten zurechtzuweisen oder gar des Thronsaals zu verweisen. Ganz genau darauf hatte sie gehofft.