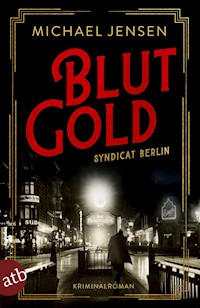9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Brüder Sass
- Sprache: Deutsch
Der spektakulärste Coup von Berlin.
Sommer, Ende der 1920er Jahre: die beste Zeit der Weimarer Republik. Für die Sass-Brüder und ihr Syndicat wird das Pflaster in Berlin jedoch allmählich zu heiß. Zu sehr sind sie ins Visier der Behörden geraten. Franz Sass plant einen letzten großen Coup: In einem der Tresore der Commerz- und Disconto-Bank sollen eine Million Reichsmark aus illegalen Wahlkampfspenden liegen. Mit dieser Beute hätten die Brüder endgültig ausgesorgt. Doch mit dieser Aktion legen sie sich mit einem höchst gefährlichen Feind an: Joseph Goebbels ...
Das grandiose Finale der Syndicat-Reihe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Sommer 1927. Endlich scheint es für alle bergauf zu gehen. Wirtschaft und Wachstum sind neue Zauberworte, der Traum vom Glück ist nahe für jene, die etwas wagen. Aber im Verborgenen rumort es weiter. Joseph Goebbels will Berlin für die NSDAP erobern, und die Hauptstadt hat sich innerhalb weniger Jahre zu einem alles verschlingenden Moloch entwickelt: Nach außen gedeihen Kultur und Glamour; im Inneren greifen Gier und Korruption um sich.
Franz Sass hat sich aus dem operativen Geschäft des Syndicats zurückgezogen, er und sein Bruder genießen das pulsierende Leben in den Theatern, Varietés und Cafés. Insgeheim gehen sie weiter ihrer Leidenschaft nach: dem Knacken von Panzerschränken. Sie wissen, dass sie seit Monaten einen Schatten haben, der sie auf Schritt und Tritt verfolgt. Der Kriminalbeamte Max Fabich hat die Zerschlagung der organisierten Kriminalität zu seinem Lebenszweck erkoren. Und ganz besonders abgesehen hat er es auf die schlitzohrigen Brüder …
Über Michael Jensen
Michael Jensen wurde im Norden Schleswig-Holsteins geboren. Hauptberuflich ist er als Arzt tätig und interessierte sich früh für jüngere deutsche Geschichte und deren Folgen für die Nachkriegsgenerationen. Für sein literarisches Schreiben hat er ein Pseudonym gewählt. Er lebt mit seiner Familie in Hamburg und im Kreis Schleswig-Flensburg.
Im Aufbau Taschenbuch sind seine historischen Krimis um die Brüder Sass lieferbar sowie seine Reihe um Inspektor Jens Druwe.
Mehr zum Autor unter autor-jensen.de.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Michael Jensen
Bluthunde
Syndicat Berlin
Kriminalroman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Kapitel 1 — Berlin, März 1928
Kapitel 2
Kapitel 3 — April 1928
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7 — Ende April 1928
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13 — Anfang Mai 1928
Kapitel 14
Kapitel 15 — Mitte Mai 1928
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21 — Anfang Juni 1928
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25 — Sommer 1928
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31 — Januar 1929
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Epilog
Kopenhagen, Weihnachten 1933
Nachwort
Danksagung
Impressum
Für Yvonne.
1
Berlin, März 1928
Die Silhouette des Direktionsgebäudes der Reichsbahn am Schöneberger Ufer hob sich bedrückend dunkel gegen den ohnehin nachtschwarzen Himmel ab. Von Südwesten zog ein Gewitter heran und tauchte den riesigen Bereich des Gleisdreiecks in Finsternis. Hin und wieder zuckten Blitze durchs Dunkel, gaben kurz den Blick frei auf mächtige Wolken und blendeten den Betrachter für einige Sekunden. Von der Innenstadt kroch ein bleicher Lichtschein über den Landwehrkanal, den ein dichtes Nebelband bedeckte. Das Herz dieser Stadt schlug ständig, und nördlich des Anhalter Bahnhofs wurden Tag und Nacht nur durch die Öffnungszeiten der Geschäfte und die Uhren ihrer Kunden bestimmt. Bis fünf Uhr wurde in Abertausenden Büros geschuftet, bis sechs standen die Tore der Konsumtempel offen. Ab acht erwachten die Varietés, um zehn die Nachtklubs. Der Schlaf galt vielen Amüsierwilligen nur als unliebsame, aber leider notwendige Pflichtübung vor der Kür der nächsten Attraktion. Die lästige Unterbrechung erschien diesen Menschen jedes Mal wie ein kleiner Tod, eine Verschwendung von Leben in einem dampfenden, heiß gelaufenen Moloch.
Franz und Erich hatten Fabich wieder einmal abgeschüttelt. Sie wurden seit Monaten von dem Kriminalsekretär beschattet, der es sich scheinbar zur Lebensaufgabe gemacht hatte, die Tresorknacker dingfest zu machen. Natürlich konzentrierte sich der Kripobeamte bei seiner Überwachung auf mögliche lukrative Ziele im Bankenbereich. Geldschränke gab es zwar auch in großen Privathäusern, aber was war dort schon zu holen? Im besten Fall verwahrten die Geldaristokraten in Grunewald oder Zehlendorf darin den Schmuck der Gattin, Genussscheine oder Aktien und ein paar Tausender Bargeld. Und der Schmuck gab beim Verkauf an die Hehler nur einen Bruchteil des Werts. Die meisten Börsenpapiere waren zudem über Nummerierung oder Namenszeichnung zurückzuverfolgen, somit wertlos für Diebe. Die paar Kröten in bar reichten oft gar nicht, um die Unkosten zu decken. Die Sass-Brüder stellten mittlerweile hohe Ansprüche an ihr Arbeitsmaterial, das sie nach einem Raub manches Mal sogar zurücklassen mussten. Schnell waren dann zehntausend Mark flöten. Sie hatten deshalb beschlossen, nicht mehr das Risiko einzugehen, irgendwo privat einen Bruch zu machen. Zudem gab es einen entscheidenden, aber wichtigen Unterschied zwischen angestellten Wachleuten und Eigentümern. Erstere wussten, wann sie verloren hatten, hoben brav die Hände, wenn eine Pistole auf sie zeigte, und ließen sich fesseln. Letztere kämpften oft verbissen um ihr Hab und Gut, als ginge es ums eigene Kind. Ein Schuss konnte sich in einem Gerangel schnell lösen, und aus einem einfachen Einbruch wurde dann Raubmord. Nicht, dass die Sass-Brüder jemals in eine solche Situation gekommen wären. Sie trugen aus Prinzip bei ihren Unternehmungen nur ihr Werkzeug bei sich. Aber immer noch besaßen viele Leute Waffen aus dem Krieg. Franz und Erich waren keinesfalls erpicht darauf, zu erfahren, ob ein überraschter Privatier gewillt war, seine ungebetenen Gäste über den Haufen zu schießen.
Auf die Eisenbahndirektion als Ziel ihres neuerlichen Vorhabens waren sie eher zufällig gestoßen. Das Gebäude stammte aus einer Zeit, als Architektur noch im Dienst von Autorität und Macht gestanden hatte. Das Polizeipräsidium am Alexanderplatz, das Kriminalgericht zu Moabit oder das Zuchthaus Plötzensee waren weitere, überkommene Zeugen dieser Haltung, die dem Untertanen der wilhelminischen Zeit gezeigt hatte, wo oben und unten waren. Wer von Nordosten, zwischen Potsdamer und Anhalter Bahnhof stehend, über den Landwehrkanal in Richtung Süden blickte, konnte meinen, dass sich dort ein großer, herrschaftlicher Landsitz erstreckte. Allerdings waren in dem roten Fuchsbau, wie das burgähnliche Gebilde mit seinen sechshundert Räumen im Volksmund genannt wurde, das gesamte Direktorium der Reichsbahn, eine Anwärterschule für die höheren Ämter sowie die Verwaltung der Pensionskasse untergebracht.
»Das Geld unserer Mitarbeiter ist hier sicherer verwahrt als bei der Reichsbank«, hatte ein hochgestelltes Tier bei der Reichsbahn neulich in der Vossischen Zeitung geprahlt. Und damit das Interesse der Brüder erst geweckt. »Da sehen sogar die Herren Meistereinbrecher keinen Stich.«
Die Herren Meistereinbrecher. Die B. Z. am Mittag hatte im vergangenen Herbst erstmals eine Artikelserie über ihre Aktivitäten herausgebracht. Natürlich, ohne Franz und Erich beim Namen zu nennen. Aber in ihren Stammlokalen hatte man ihnen danach auf die Schultern geklopft und sie wie Helden gefeiert. Mittlerweile waren beide bekannt wie bunte Hunde. Erich hatte vor einigen Wochen herausgefunden, dass die Pensionskasse am Schöneberger Ufer mehrere Tresore der Firma Wiedemar verwendete. Schweizer Wertarbeit zwar, aber veraltete Technik. Und sofort hatte Franz wieder diese typische Unruhe in sich verspürt. Schien das innere Feuer der Brüder erst einmal entfacht, dann war es nicht mehr zu löschen.
»Die ollen Dinger haben wir im Handumdrehen auf«, hatte der jüngere Sass erklärt. »Und da sollen zum Monatsende eine Menge Moneten lagern.«
In Rekordzeit hatten die Brüder ihren Plan ausgeheckt. Der Grundriss des wilhelminischen Protzbaus war über die Universität öffentlich zugänglich. Für hundert Mark besorgte ihnen ein Student die Blaupausen der Bauzeichnungen. Durch eine Ortsbegehung und die Teilnahme an einer öffentlichen Gebäudeführung fand Franz heraus, dass die Eisenbahner ihre Tresore im Hochparterre untergebracht hatten, was ihn sofort auf eine kühne Idee brachte.
»Wir gehen von unten rein, Erich! Wir müssen uns nicht durch die Erde wühlen, sondern nutzen einfach das Kellergeschoss. Es würde mich wundern, wenn es im Boden eine zusätzliche Sicherung gibt. Sie haben die Pensionskasse erst zehn Jahre nach dem Abschluss der Bauarbeiten dort untergebracht. Wahrscheinlich haben sie nur die Statik geprüft und alles so belassen, wie es während der Bauzeit ausgeführt wurde. Die Pläne zeigen, dass es eine einfache Decke aus Stahlbeton ist. Ein Kinderspiel.«
Er fühlte sich plötzlich wieder lebendig. Seit einiger Zeit war er zur Untätigkeit verdammt gewesen. Was auch daran lag, dass ihm seine Familie eine Auszeit in Sachen Einbruch und Tresorknacken verordnet hatte. Im vergangenen Jahr waren die Brüder immer öfter auf der Straße angesprochen worden. Ein Reporter hatte sie sogar gefragt, wann denn der nächste Coup zu erwarten wäre. Man hatte sie beglückwünscht und wie Schauspieler gefeiert. Einer der Gründe, dass Max Fabich auf sie aufmerksam geworden war. Toni hatte daraufhin resolut gefordert, dass sie eine Pause einlegen sollten. In solchen Ruhephasen versuchte Franz jedes Mal, mit Rennfahrten auf der AVUS, Kinobesuchen und einer Menge Alkohol die Zeit totzuschlagen. Da er sich zudem aus dem aktiven Geschäft des Syndicats zurückgezogen hatte, musste er oft sprichwörtlich Däumchen drehen. Und die Tage waren elendig langsam dahingekrochen wie Schnecken auf trockenem Sand. Durch den neuen Plan waren jedoch seine Lebensgeister zurückgekehrt, als hätte man ihm ein magisches Elixier verabreicht.
»Wir müssen nur eine Stelle finden, von der aus wir unauffällig arbeiten können«, sagte er aufgekratzt. »Im Fuchsbau ist ein ständiges Kommen und Gehen. Da dürfen wir nicht einfach eine Decke aufstemmen. Wir müssen erstens so tun, als ob wir dazugehören. Als wären wir zwei Arbeiter unter Hunderten. Und zweitens brauchen wir einen Ort, an dem wir unbehelligt arbeiten können. Ein derart großes Gebäude hat sicherlich irgendwo eine vergessene Ecke, die seit Jahren nicht mehr genutzt wurde.«
˚˚˚
Nach Wochen intensiver Vorbereitung war es schließlich so weit. Der März war zwar dieses Jahr wieder lausig kalt, aber wenigstens trocken. Der Erfahrung nach waren Wachleute bei dem Wetter eher daran interessiert, ihre Runden schnell zu beenden und an den Bollerofen zurückzukehren, als bei jeder Kleinigkeit genau hinzusehen. Die Brüder schlichen sich im Halbdunkel über die Brücke, die vom Potsdamer Bahnhof über den Landwehrkanal führte. Sie trugen Eisenbahnerkleidung und auf dem Rücken Jutesäcke, in denen sich ihr Werkzeug befand. Diese letzte Phase vor Beginn eines Bruchs war nicht weniger gefährlich als die Schlosser-, Bohr- und Schweißarbeiten vor Ort. Ein übereifriger Schupo oder Werksposten konnte verlangen, dass sie ihm die Papiere zeigten. Oder den Inhalt der großen Beutel. Hier auf dem Bahngelände waren zudem die ganz scharfen Hunde zuständig, wie die Schutzbeamten von der Bahnpolizei im Volksmund gern genannt wurden. Die Kerle fackelten nicht lange. Neulich erst hatten sie drei Jugendliche angeschossen, die ein paar Kohlebriketts klauen wollten. Trotz aller Anspannung war Franz jedoch zufrieden. Dieses Hochgefühl war durch nichts zu ersetzen. Er spürte die Lebendigkeit, war voller Energie und hoch konzentriert. Susanne hatte ihn einmal gefragt, weshalb er diese Risiken überhaupt einging. Er hatte versucht, es ihr zu erklären, war jedoch gescheitert. Man musste erleben, was er erlebte, um ihn wirklich zu verstehen.
»Hier entlang«, zischte Erich neben ihm.
Er hatte eine kleine elektrische Leuchte dabei, die in der Werbung als »praktische Taschenlampe« angepriesen wurde. Tatsächlich passte sie in die Hosentasche. Er zog sie hervor und hielt sie ganz dicht vor einen Plan, den er abgezeichnet hatte. Sie mussten über die Gleise der Fernbahn und des Südrings der Ringbahn, um zum hinteren Bereich des Fuchsbaus zu gelangen. Das als Gleisdreieck bezeichnete Gelände war riesig. Von den beiden Kopfbahnhöfen aus ging es zu allen Zielen im Reich und in Europa. Nach Köln, Aachen, Frankfurt, München, Leipzig. Aber auch nach Wien, Straßburg, Metz und Paris. Hinzu kamen zwei Güterbahnhöfe sowie das Gelände fürs Rangieren und für die Wartung der Züge. Ungefährlich war es hier nicht. Erst letztes Jahr waren zwei Hausierer, die in einem verfallenen Schuppen kampiert hatten, von einem Zug erfasst worden, als sie sich um eine gestohlene Geldbörse gestritten hatten. Und die scharfen Hunde hatten nach Weihnachten einen Kerl zum Krüppel geschossen, der zwei Postsäcke gestohlen hatte.
»Vorn ist der Bau gesichert wie die Reichsbank, und hinten gibt es nur ein Bartschloss am Tor«, meinte Erich, als sie endlich den Nebenzugang zum Direktionsgebäude erreichten. Das Schloss war denkbar einfach, ein Kind hätte es öffnen können. Bereits eine halbe Minute später stand die Tür zum Innenhof offen.
»Ist der Wagen da?«, fragte Franz. Er konnte seine Erregung kaum verbergen und sah sich hektisch um.
Er selbst besaß vor allem das nötige Fingergeschick und war für die Planung vor Ort zuständig, sein Bruder hingegen konnte hervorragend organisieren. Erich hatte im Open House einen Weichenwärter angesprochen, der für zweihundert Mark bereit gewesen war, ihnen einen Teerwagen der Bahn zu besorgen. Das alte Gefährt stank fürchterlich, und jedermann hielt respektvoll Abstand von dem Drecksteil. Die Brüder hatten seitlich an der einzig sauberen Stelle eine Kiste abgestellt und das Ding mit ihrem schweren Werkzeug, den Bohlen und den Gerüsten beladen. Den ganzen Kram hätten sie unmöglich in kurzer Zeit über das weitläufige Gleisgelände tragen können. Der Bahnarbeiter hatte zugesagt, den Anhänger im Innenhof des Fuchsbaus abzustellen. Zur Tarnung – und Abschreckung – wollte er noch einige Kellen frischen Teers auf den Planen und Bohlen verteilen.
»Du machst dir zu viele Gedanken, Bruder. So etwas nennt man proletarische Ehre. Gibst du einem Arbeiter hundert Mark, hält er sein Wort. Gibst du einem Schnösel tausend, wird er dich verpfeifen. Also bitte etwas mehr Vertrauen in die Aufrichtigkeit der Unterdrückten.« Erich blickte sich um und schüttelte den Kopf. Man hatte auf dem rückwärtigen Gelände an den überaus teuren Dampflampen gespart. Wahrscheinlich glaubten die Verantwortlichen an den Rechenschiebern, dass dicke Mauern und die Rundgänge der Bahnpolizisten jede Begehrlichkeit unlauterer Geister abschrecken konnten. Das Licht war entsprechend trübe, überall ließen tiefe Schatten genug Raum, sich verborgen zu halten.
»Sag ich doch«, raunte Erich seinem Bruder zu, stieß ihn an und zeigte auf einen dunklen Umriss, der sich vielleicht dreißig Meter entfernt aus einem Lichtkegel schälte. »Dort steht die Karre. Wie abgesprochen.« Er schlich zu einem kleinen Anbau, sorgsam darauf achtend, nicht über das im Hof liegende Baumaterial zu stolpern. Die Rohre, Schienen, Bolzen und Bohlen lagen abenteuerlich verstreut herum. Es roch nach Karbolineum. Die sich nach außen so korrekt gebende Reichsbahn pflegte hier drinnen – wahrscheinlich weil sie sich unbeobachtet fühlte – ein Chaos, das Großmutter Sass sicherlich als Tohuwabohu bezeichnet hätte. Im Schutz der Wand spähte Erich wieder auf seine Skizze. Ihr Plan hing entscheidend davon ab, dass der Student der Bauakademie alle Einzelheiten und Maße aus den alten Bauzeichnungen übertragen hatte. Franz prüfte derweil die Ladung des Hängers. Der alte Arbeitswagen roch penetrant nach einer Mischung aus Moder und Ölteer. Ihre Ausrüstung war vollständig, stellte er zufrieden fest. Niemand, der nicht unbedingt musste, näherte sich diesem schwarz beschmierten Ungetüm. Das Zeug bekam man nur mit Mühe von den Händen und meist gar nicht von der Kleidung ab.
»Ist perfekt«, hatte der Bahnarbeiter gesagt, als er mit dem Ding angekommen war. »Alle springen zur Seite, wenn sie die Karre sehen. Bisschen frischen Teer an die Plane, dann fasst sie keiner mehr an.«
Zunächst hatten Erich und Franz protestiert. Sie fürchteten, dass sie sich mit dem Dreck ihre Ausrüstung ruinieren könnten. Aber die Idee, die Eisenbahnfestung mit Hilfe eines trojanischen Pechkochers einzunehmen, erwies sich dann doch als reizvoll, zumal sie ihnen die Schlepperei ersparte. Erich streifte sich dicke Lederhandschuhe über und öffnete die hintere Ladeklappe des Wagens. Dann zogen die Brüder vorsichtig ihr Material daraus hervor. Sie hatten nach den Maßen der Bauzeichnung bereits vorab eine Stellage angefertigt, mit der sie die Deckenbohrungen durchführen konnten. Eine Arbeit über Kopf war mit dem Bohrhammer, der allein acht Kilo wog, kaum über längere Zeit möglich. Zudem waren es die Brüder nicht gewohnt, körperlich zu schuften. Und sie würden mindestens vierzig Löcher brauchen, um später ein dreißig mal dreißig Zentimeter messendes Quadrat aus der Betondecke zu stemmen. Danach mussten sie nur noch mit einem Brennschneider die Stahlträger durchtrennen. Und schon wären sie im Tresorraum der Direktion. Sofern sich die Angaben auf der Blaupause als korrekt erwiesen.
»Lärm, Dreck, Zeit«, hatte Franz bei den Planungen als ihre Hauptgegner identifiziert. »Aber wie gesagt, wir müssen uns wenigstens nicht durch zehn Meter Erde buddeln oder mit dem Schneidbrenner Stahlplatten durchtrennen.«
Sie hatten ausbaldowert, dass gegen zehn die nächtlichen Rangierarbeiten auf dem Güterbahnhof begannen. Das Kreischen der Drehkreuze und die Prallgeräusche der Puffer waren dabei nur ein kleiner Teil des orchestralen Missklangs, der am Gleisdreieck stundenlang durch die Dunkelheit drang. Hinzu kamen die Schweißarbeiten, ein beständiges Rammen und Bolzenschüsse an den Verbindungen. Die Brüder liefen also kaum Gefahr, durch den eigenen, übermäßigen Lärm entdeckt zu werden. Sie hatten geplant, den anfallenden Schmutz und Bauschutt mit Eimern in einer dunklen Ecke zu entsorgen. Aber dieses Vorhaben gaben sie angesichts der allgemeinen Unordnung im Innenhof auf. Ein Haufen Dreck mehr fiel hier nicht weiter auf. Blieb also der Faktor Zeit. Die Arbeit war nicht in einer Nacht zu schaffen. Gegen halb vier mussten sie das Gelände verlassen, bevor die Morgenschicht kam. Folgerichtig hatte Franz vier Nächte veranschlagt, um durch die Decke – eigentlich eher den Boden – in den Tresorraum zu kommen.
Die Pensionskasse hielt es weiterhin mit der altmodischen Art, die Geldbeträge auszuzahlen: vom Schalter in die Hand. Denn viele Arbeiter und kleinere Beamte verfügten über kein Bankkonto. Strom und Gas wurden einmal in der Woche an der Haustür bezahlt. Und die Pension holte man sich eben an den Zahlstellen ab. Obwohl die Kasse mit der Reichsbank eine Deckungsvereinbarung unterhielt, mussten an Ort und Stelle immer noch erhebliche Summen in bar bereitgehalten und verteilt werden. Hinzu kam eine gewisse Überheblichkeit der Reichsbahnkasse, die sich gern als eigenständige Bank sah. Und der verständliche Wunsch, die Kosten für eine Verwahrung der Gelder bei anderen Instituten einzusparen. Nach Informationen der Brüder mussten vor jedem Zahltag etwa eine Million Mark im Fuchsbau zu holen sein. Franz hatte den Beginn ihrer Arbeiten so berechnet, dass sie just zu dem Zeitpunkt zum Tresorraum durchbrechen konnten, an dem die meisten Moneten in den Geldschränken lagerten.
Zwei Nächte lief alles glatt. Die Betondecke wurde mit über fünfzig Löchern durchbrochen, jedes zwei Zentimeter messend. Ihre Geräte verstauten die Brüder gegen Morgen wieder im Hänger, den sie an die Wand schoben und mit einem Schild Vorsicht Reparatur versahen. Freiwillig würde sich niemand darum reißen, das Monstrum in Augenschein zu nehmen. Im Abstellraum platzierten sie eine Deckenattrappe aus Pappmaché über dem Loch, so dass ein kurzer Blick in das Kabuff ebenfalls keinen Verdacht erregen würde.
Für die dritte Nacht waren die Brennerarbeiten geplant. Der moderne Schneidbrenner der Firma Fernholz aus Tiergarten war ein handliches Modell, das mit Benzol statt Acetylen betrieben wurde. Franz hatte den zusätzlich notwendigen Sauerstoff im Teerwagen gelagert, aber seinen Fernholz-Brenner gab er nicht aus der Hand, sondern schleppte ihn jedes Mal hin und her. Mittlerweile hatte es sich nämlich unter den Ganoven der Stadt herumgesprochen, dass man mit diesen Geräten Tresore hervorragend auf ihre Sicherheit hin überprüfen konnte. Die Zahl der Einbrüche, bei denen die neuen Schneidbrenner verwendet wurden, hatte sprunghaft zugenommen. Und auf Betreiben von Kriminalsekretär Fabich musste Fernholz nun alle Apparate mit Nummern versehen und zusammen mit den Namen der Käufer an die Polizei melden. Da war es sicherer, man pflegte den eigenen Fernholz wie ein Schoßhündchen.
Der Plan war meisterlich ausgearbeitet. Alles war bis ins kleinste Detail durchdacht. Die Brüder hielten ihre Zeitvorgaben bis auf die Minute ein. Es konnte einfach nichts schiefgehen. Nur ein Faktor blieb außen vor, war naturgemäß nicht fassbar: der Zufall. Wer konnte ahnen, dass ein schreckhafter Nachtwächter seine Notdurft gerade an jener Stelle im Innenhof verrichten wollte, an der das Zischen des Schneidbrenners gut zu hören war? Der Abort vorn in der Nähe der Wachstube war dabei, überzulaufen, also hatte sich der gute Mann in eine dunkle Ecke verzogen. Zunächst hielt er die hohen Töne, die dort an seine Ohren drangen, für Katzenjammer, dann jedoch bekam er es mit der Angst zu tun und rief nach einem Kollegen. So waren es das Schicksal und eine verstopfte Toilette, die Franz und Erich schließlich doch noch um die Früchte ihrer schweißtreibenden Arbeit brachten.
˚˚˚
Max Fabich war kein Mensch, der sich gern eine Blöße gab. Ruhig und sachlich hatte er an die Sache herangehen wollen, als ihn die Meldung erreichte, bei der Eisenbahndirektion hätte es einen Einbruch gegeben. Als er hörte, es wäre unter dem Tresorraum der Pensionskasse gebohrt worden, hatten alle Zahnräder in seinem Verstand ineinandergegriffen. Und es hatte für ihn keinerlei Zweifel daran bestanden, dass hier die beiden Sass-Brüder wieder zugeschlagen hatten.
Nun stand er am Tatort und fluchte, alle Vorsätze über Bord werfend, wie ein Rohrspatz. Er riss die Tür des im Innenhof zurückgelassenen Anhängers auf, ohne Handschuhe zu benutzen. Er trat zu dicht an den Wagen und ruinierte sich prompt den Überzieher. Zu allem Überfluss fuhr er sich mit schmutzigen Fingern entnervt über die wenigen Haare auf dem Schädel und riss sich beim Versuch, die Teerhand wieder von ihnen zu lösen, welche davon aus.
»Kein Zweifel, sie waren es«, meinte er eher zu sich selbst, als er die Vorrichtung sah, die zum Bohren benutzt worden war. »Wie kann man so blöd sein, unter einem Tresor einen Raum ungesichert und unbewacht zu lassen?«, fuhr er seinen Assistenten an, der zu dieser frühen Zeit noch nicht ganz wach war und nun zusammenzuckte.
»Weiß nicht, Chef.«
»Wer ist hier verantwortlich?« Fabich sah sich um. Zwei Nachtwächter hoben gleichzeitig und zaghaft die Hände. »Nicht ihr Nasen!«, fauchte Fabich. »Ich will wissen, wo der Direktor ist. Der Abteilungsleiter? Der Schlossherr. Die Puffmutter. Herr Gott, was weiß ich. Irgendjemand! Es muss doch einer der Herren hier sein.«
»Der Herr Direktor kommt um acht«, sagte ein Wachmann. »Und er wünscht, nur im Notfall gestört zu werden.«
»Und was ist das hier? Ein Kaffeekränzchen, das jeden Morgen hier hinten am Schuppen abgehalten wird? Oder was?«
»Wir dachten, es wären Katzen«, sagte der andere Mann.
»Es hat seltsam gekratzt im ersten Stock.« Der andere nickte. »Im Boden. Und da war ein Kreischen.«
»Oder Jaulen.«
»Wir haben mit Stangen an die Heizungsrohre geschlagen.«
»Und gerufen.«
»Damit sie verschwinden.«
»Prima. Hat doch hervorragend geklappt«, sagte Fabich, als die Männer schwiegen. Sein Ärger flammte oft auf wie Zunder, grell und kurz. Danach kam das Grollen, dann eine unterschwellige Ermattung, die ihn seit Jahren schon am Sinn des Lebens zweifeln ließ. »Verschwunden sind sie ja, die Herren Sass.« Er schüttelte den Kopf. »Katzen! Diese beiden Idioten haben gerufen und geklopft! Ist das zu fassen?« Er stieß weitere Verwünschungen aus und rieb die geteerte Hand an einem Lappen ab.
»Herr Kriminalsekretär«, warf sein halbwacher Assistent ein, »wir können nicht mit Sicherheit ausschließen, dass …«
»Lassen Sie den Erkennungsdienst anrücken«, unterbrach ihn Fabich barsch. Seiner Bitte, einen Mitarbeiter zugeteilt zu bekommen, hatte man zwar entsprochen. Aber der Kerl war höchstwahrscheinlich auf dem Abort gewesen, als der liebe Herrgott den Verstand unter den Menschen verteilt hatte. »Fingerabdrücke, Stiefelspuren, Werkzeugliste. Und ich will Fotografien. Klären Sie, wer diesen Teerwagen besorgt hat. Woher kommt das Holz für die Stellage? Wie sieht es mit dem Bohrgerät aus?«
»Der ED wird eine Weisung vom Vizepräsidenten haben wollen«, gab der Assistent zu bedenken. »Schließlich ist ja nichts passiert. Ich meine, die Tat wurde erfolgreich vereitelt.«
»Erfolgreich vereitelt? Ich bin von Kretins umgeben!« Wieder riss sich Fabich ein paar Haare mit der klebrigen Hand aus. »Dass die Kerle nicht im Tresorraum waren, bedeutet doch nicht, dass nichts geschehen ist. Wir müssen die Spuren sichern, um sie wenigstens beim nächsten Mal zu schnappen. Vielleicht können wir ihnen sogar nachweisen, dass sie hier waren! Begreifen Sie das nicht, Mann?«
Kurz nach acht Uhr erschien der Direktor der Pensionskasse. Fabich persönlich hatte versucht, ihn am Telefon dazu zu bewegen, auf Morgenspaziergang und Frühstück zu verzichten. Aber der Kerl schien ähnlich gestrickt wie seine Mitarbeiter.
»Nun plustern Sie sich gefälligst nicht so auf, Herr Kriminalsekretär!«, hatte er den Kripobeamten angeschnauzt. »Es ist doch nichts entwendet worden. Dafür haben wir unser Wachpersonal. Und in den Tresor wären die Kerle ohnehin nicht hineingekommen. Es ist also alles wunderbar.«
Max Fabich hätte vor Wut am liebsten in die Sprechmuschel des Fernsprechapparats gebissen.
2
»Steck doch den Kopf nicht gleich in den Sand. Es hätte auch klappen können. Es fehlte nicht viel«, meinte Franz. Sein Bruder schwieg. Im Hinterzimmer des Klub Berlin war es ansonsten vollkommen still. Die Fenster waren eine spezielle Anfertigung, hatten drei Scheiben, und die Tür war innen mit dickem Leder überzogen, so dass alle Geräusche ausgesperrt wurden. Franz saß im Büro seines Bruders, von dem aus Erich die Lokale des Syndicats leitete. Das Rad der Geschäfte drehte sich. Und es drehte sich schwindelerregend schnell. Was heute schick und angesagt war, galt morgen schon als olle Kamelle. An der Tür stand jetzt in goldenen Lettern: E. Sass – Manager.
Franz mochte diese frühe Tageszeit. Kurz nach fünf Uhr. Noch war draußen auf den Straßen nichts los. Aber bald erwachte die Stadt zum Leben, machten sich die Menschen bereit, einem neuen Tag ins Gesicht zu sehen. Manchmal packten sie den Stier bei den Hörnern, schwangen sich auf und ritten den Koloss, dann konnte es ein guter Tag werden. Viel öfter wurden sie jedoch durch die Manege des Daseins getrieben und versuchten nur, irgendwie durchzukommen, zu überleben. Die Brüder hatten nach ihrer überstürzten Flucht vom Gelände der Bahndirektion zunächst einfach erschöpft geschwiegen, geraucht und getrunken. Sie waren verdreckt und verschwitzt. Franz hatte vorher darauf bestanden, die Werkzeuge in einem Kellerraum abzustellen, dessen Mietvertrag über einen Mitarbeiter lief. Dort hatten sich die Brüder auch gewaschen und die Kleidung gewechselt. Franz wollte kein Risiko eingehen. Sollte die Polizei auftauchen, schärfte er seinem Bruder ein, dann würden sie angeben, dass sie zunächst ihrer Tante und ihrem Lebensgefährten bis in die Nacht bei deren Hausrenovierung geholfen hatten. Danach waren sie hier im Klub versackt. Erich schien die ganze Sache jedoch nicht so gelassen zu nehmen. Er lief im Raum auf und ab, fummelte an der Schnur des Fernsprechers herum und verschob mehrmals die Tischlampe, als wäre er mit deren Standort unzufrieden.
»Mensch, irgendwann kommen wir noch schwer inne Bredulje«, meinte er. »Imma jeht wat krumm.« Er zerriss ein Blatt Papier, knüllte es zu kleinen Kugeln und schnippte sie unwirsch durch den Raum.
»Ist doch alles nur zum Spaß, Erich. Det Jeld is doch ejal.« Franz lachte, als er ganz bewusst in den Straßendialekt wechselte. Eigentlich geschah dies nur, wenn er mächtig angefressen war. »Spaß hat es doch gemacht. Fast waren wir so weit. Wer kann ahnen, dass dieser Torfkopp ausgerechnet bei unserem Schuppen pullern geht? Freundlicherweise hat er gerufen, als ihm mulmig zumute wurde. So konnten wir wenigstens jut verduften.«
»Was meinst du, steckt Fabich dahinter? Hat er uns doch ausspioniert?«
»Glaube ich nicht, Erich. Dann hätten sie uns sicherlich geschnappt.« Franz forderte seinen Bruder auf, sich endlich zu setzen und die Hände in die Hosentaschen zu stecken. Langsam nervte ihn die Unruhe, die Erich verbreitete. »Wahrscheinlich war es Zufall, dass die Polente aufgetaucht ist. Der Wachmann hat uns beim Bohren und Stemmen gehört und dann die Schupos gerufen. Diese Kerle liefen doch strunzdumm auf dem Gelände herum und haben sogar laut gerufen, als sie ankamen. Nee, Fabich wäre schlauer gewesen und hätte uns sicher gleich hopsgenommen. Wir haben nur Pech gehabt. Oder Glück, wie man es nimmt. Beruhige dich endlich, Erich.«
Kaum hatte er diese Gedanken ausgesprochen, merkte Franz, dass ihm die Angelegenheit doch mehr auf den Magen schlug, als er zugeben wollte. Wenn die Polizei in solchen Fällen besser organisiert wäre, säßen die Brüder jetzt wohl auf irgendeinem Revier. Stattdessen wusste Franz von Kommissar Konter, dass die meisten Raubüberfälle in Berlin zunächst vom örtlich zuständigen Revier untersucht wurden. Man schickte dann zwei unterbelichtete Wachtmeister, die sich vor allem um ihre Butterbrote und Nachtruhe sorgten. Und meist waren sie nicht erpicht darauf, jemanden auf frischer Tat zu ertappen. Welcher Beamte ließ sich schon gern für eine Mark Schichtzuschlag von ein paar aufgeschreckten Gaunern zusammenschießen? Franz war sicher: Würde man hingegen das Überfallkommando und erfahrene Ermittler wie Fabich sofort einbinden, dann sähe es zappenduster aus für schräge Vögel wie die Brüder. Franz kippte einen weiteren Kognak hinunter, ohne ihn zu genießen.
»Was hältst du davon, wenn wir uns ein ordentliches Alibi beschaffen? Nur für alle Fälle«, meinte Erich. »Bei der Gelegenheit lassen wir uns mal wieder in der Birke bei Mutti und Vadder blicken.«
Birke war seit ihrer Kindheit die Bezeichnung der Sass-Jungs für die elterliche Wohnung in der Birkenstraße im Ortsteil Moabit. Dort hatten sie zeitweise mit sieben Personen in zwei Zimmern mit Küche und Abstellkammer gelebt. Auf engstem Raum hatte es damals nichts Privates gegeben; weder ein Flüstern noch die allzu menschlichen Verrichtungen oder gar die Geräusche ehelicher Pflichten waren verborgen geblieben. Während jedoch in vielen Behausungen das völlige Chaos herrschte und Kinder unter den Misshandlungen und dem Suff der Eltern zu leiden hatten, waren Marie und Andreas Sass immer bemüht gewesen, die Familie zusammenzuhalten. Selbst in den schlimmsten Zeiten wurden die wenigen Kartoffeln mit wässriger Mehlstippe gerecht unter allen verteilt. Zwar zog der Vater auch manches Mal den Riemen, um die Burschen, wie er seine Söhne nannte, auf Trab zu bringen. Und Mutter Marie schimpfte, wenn sie die Hosen zum zehnten Mal flicken musste, weil ihre Kinder beim Toben nicht achtgegeben hatten. Aber alles in allem hatten die Sass-Brüder eine Kindheit erlebt, die den Namen durchaus verdiente.
»Wenn wir uns beeilen, erwischen wir Vadder noch, bevor er auf Maloche jeht«, sagte Erich und blickte auf seine Armbanduhr. »Bringen wir ihm Schrippen und eine Packung Fünfer mit. Und zwei Bier für den Feierabend, dann frisst er uns aus der Hand.«
Als die Brüder eine halbe Stunde später in Moabit ankamen, begannen sich die Straßen in dem Arbeiterviertel bereits zu füllen. Männer und Frauen strömten in die vielen Fabriken. Übermüdung stand ihnen in den Gesichtern, stumm und noch halb schlafend eilten sie ihren Zielen zu. Die kleineren Angestellten machten sich meist erst eine Stunde nach diesem Schichtwechsel auf den Weg. Vom Westhafen zog ein modriger Geruch durch die Straßen. Man hatte dort vor kurzem das Hafenbecken ausgebaggert und den übel stinkenden Schlick auf einer Brachfläche des nahe gelegenen Reichsbahngeländes abgekippt. Aus diesem Grund suchten nun seit einiger Zeit allabendlich Myriaden von Mücken und Fliegen die Moabiter heim. Trotz der winterlichen Kälte schienen sich die Mistviecher in dem gärenden Dreck gut zu vermehren.
»Ihr lasst euch also auch mal wieder blicken«, stellte Andreas Sass fest, als Erich und Franz ihn in der Küche begrüßten. Seine Miene hellte sich auf, als er die Tüte des Bäckers bemerkte.
»Seid ja doch zu was zu gebrauchen«, fügte er hinzu, als Franz die Zigaretten auf den Tisch legte und die zwei Flaschen Bier abstellte. Sein Vater rauchte am liebsten die billigen Fünfer, die jetzt zwar acht Pfennig kosteten, aber immer noch Fünfer hießen. Er weigerte sich beharrlich, vom Reichtum seiner Kinder etwas anzunehmen. Immer noch ging der Lohnschneider seiner Arbeit nach und bestand darauf, dass auch seine Frau jeden Tag Wäsche auslieferte.
»Eure Mutter weint sich wegen euch die Augen aus«, sagte er dann. Er verzog dabei keine Miene, aber Franz war sicher, dass sein Vater nur nicht zeigen wollte, dass er sich selbst Sorgen machte. »Habt ihr wieder etwas ausgefressen?«
»Nur ein paar kleine Prügeleien mit den Jungs.« Franz lachte, als er an die Zeit in der Clique dachte. Etwas ausgefressen. Es klang, als wären drei geklemmte Stangen Zigaretten das Schlimmste, was Andreas Sass seinen Söhnen zutraute. Er mochte den alten Griesgram.
»Habt ihr etwas gegessen?«, fragte ihre Mutter. Sie war eine rundliche Frau, deren Liebe zu ihren Kindern sich gern in ständiger Sorge um deren leibliches Wohl ausdrückte. »Du bist schmaler geworden, Franz.«
Gerade vor einer Woche hatte sich ihr Sohn darüber geärgert, dass er sechs Anzüge zum Schneider gebracht hatte, die ihm zu eng geworden waren. Er fand, dass er langsam aus dem Leim ging. Folglich wechselte er jetzt lieber schnell das Thema. Obwohl sie versuchten, es zu ignorieren, wussten die Eltern von den Geschäften ihrer Söhne, auch den illegalen. Zumindest war ihnen in groben Zügen bekannt, womit sie ihr Geld verdienten. Die Gerüchte der Straße fügten ihren Teil dazu bei. Andreas Sass hatte es vehement abgelehnt, von den Söhnen ausgehalten zu werden, als sie angeboten hatten, ihren Eltern ein kleines Haus am Stadtrand zu kaufen. Er hatte darauf bestanden, weiterhin seinem Handwerk als Schneider nachzugehen und sein Geld auf ehrliche Weise zu verdienen.
So konnten sie nur hin und wieder ihrer Mutter einen Schein zustecken, ohne dass er etwas bemerkte. Ihr lebt euer Leben, wir leben unseres, war die Quintessenz der väterlichen Einstellung zu dieser Frage. Franz hatte sich schon immer gewundert, wie unterschiedlich beide Elternteile in Bezug auf ihre Kinder dachten. Bei Andreas Sass schien es, als sähe er seine Aufgabe als erfüllt an. Als wären Zeugung, Versorgung und Erziehung von Kindern eine Arbeit wie jede andere auch. Man bekam einen Auftrag, erledigte ihn, und dann war Schluss. Marie Sass war dagegen immer eine Mutter geblieben, auch für die längst erwachsenen Söhne. Sie hatte Susanne, der Verlobten ihres Sohnes, bei der Einrichtung der neuen Wohnung helfen wollen, schließlich sollte ihr Franz es dort gut haben. Sie schaute regelmäßig bei Erich vorbei, der Junggeselle und nur mäßig begeistert war, dass sie bei ihm aufräumte und putzte. Und Max, der sich mit dem Handel von Tabakwaren einen eigenen Geschäftszweig aufgebaut hatte, versuchte sie seit längerer Zeit mit einem ordentlichen Mädchen zu verkuppeln. »Wenn du zu alt bist, nimmt dich doch keine mehr, Mäxchen«, setzte sie ihn beständig unter Druck.
»Wir haben heute Nacht hier geschlafen«, meinte Franz, als seine Mutter Kaffee einschenkte. Es klang nicht wie eine Frage, sondern wie eine Feststellung. Um seinen Vater nicht wütend zu machen, fügte er noch schnell hinzu: »Geht das in Ordnung?«
»Eigentlich fragt man das, bevor man irgendwo pennt«, sagte der Vater und griff nach der zweiten Schrippe, die er dick mit grober Leberwurst bestrich. »Ärger?«
»Kleine Sache, die schiefgelaufen ist«, wiegelte Erich ab. »Alles nur zur Sicherheit. Wir sind also gestern um zehn gekommen, haben Karten gespielt bis eins und jede Menge Schultheiss vernichtet. Dann ab in die Falle. Und du, Mutti, bist um vier wach geworden, weil Franz so laut geschnarcht hat. Du hast in der Küche nach dem Rechten gesehen, und wir lagen da wie tot.«
»Sag so was nicht!« Marie Sass bekreuzigte sich.
In diesem Moment läutete es an der Tür. Nicht nur einmal, sondern wiederkehrend. Dann schlug eine Faust dröhnend gegen das Holz. Instinktiv blickte Franz seinen jüngeren Bruder an.
»Hier ist die Polizei!«, drang es dumpf aus dem kleinen Flur. »Öffnen Sie die Tür.« Wieder ein Hämmern, dieses Mal noch lauter, als wollte jemand die Tür aufbrechen.
»Hat ja lange gedauert, bis man euch auf die Schliche gekommen ist.« Andreas Sass sah seine Söhne an. Er sprach damit aus, was sie selbst dachten. »Kleine Sache, was? Nur zur Sicherheit, ja? Ich sollte den alten Gürtel holen, ihr Lauser!«
An ein Entkommen war nicht zu denken. Im vierten Stock eines Mietshauses war ein Sprung aus dem Fenster in den Hinterhof glatter Selbstmord. Und die alte Strickleiter, die vor Jahren vom Fenster der Kammer zum Dach geführt hatte, war vom Hausmeister längst entfernt worden. Damals, während ihrer Cliquenzeit, waren Max und Franz oft stiften gegangen, wenn das Jugendamt einen Beamten geschickt hatte. Und Franz war sich jetzt ohnehin nicht sicher, ob er das Ding überhaupt noch hochkäme.
»Denkt dran. Gestern gegen zehn, Karten bis eins. Und wir haben gesoffen wie die Löcher«, raunte Erich seiner Mutter zu, als sie verunsichert in Richtung Haustür ging.
Wenig später stand kein Geringerer als Max Fabich im Durchgang zur Küche. Sein Gesicht war hochrot angelaufen, auf Glatze und Stirn standen Schweißperlen.
»Herr Kriminalsekretär, welch eine schöne Überraschung!«, rief Franz und breitete sogar die Arme aus. »Setzen Sie sich doch. Eine Schrippe und einen Kaffee? Vielleicht einen frühen Korn? Wir feiern den Namenstag meines Vaters.«
»Andreastag ist am dreißigsten November«, knurrte der Kripobeamte.
»Wir haben ihn letztes Jahr verpasst und feiern nach.«
»Keine Mätzchen, Sass!«, fuhr Fabich ihn an. Er musterte die Brüder abwechselnd. »Ich nehme Sie beide fest. Sie stehen unter Verdacht, den Raubüberfall auf die Reichsbahndirektion geplant und begangen zu haben.«
»Nein! Wirklich? Die Eisenbahndirektion wurde ausgeraubt?«, fragte Franz und sah erstaunt in die Runde. »Wie kommen Sie da auf uns? Ich bin etwas enttäuscht, Herr Fabich. Wir sind unbescholtene Bürger, die ihre Steuern zahlen.«
»Wir können es gar nicht gewesen sein, denn heute Nacht waren wir zu Hause«, fügte Erich etwas zu eifrig hinzu. »Hier bei unseren Eltern. Nicht wahr, Mutti?«
»Ich habe nichts davon gesagt, dass die Tat heute Nacht verübt wurde«, meinte Fabich und grinste triumphierend. »Und in der Zeitung stand es ebenfalls noch nicht. Also, woher wissen Sie davon?«
»Sie stürzen hier früh am Morgen herein, Fabich«, meinte Franz und warf seinem Bruder einen warnenden Blick zu. Erich neigte wie Max dazu, den Mund aufzumachen, bevor er richtig nachgedacht hatte. »Sie reden von einem Raubüberfall auf die Bahndirektion. Da geht doch jeder vernünftige Mensch davon aus, dass es erst vor kurzem passiert ist.«
»Festnehmen«, wies Fabich die drei Schupos an, die ihn begleiteten. Die vierschrötigen Kerle hätten auch aus einer Schlägertruppe des Frontkämpferbundes kommen können. Obwohl die Sass-Brüder keinerlei Widerstand leisteten, wurden ihnen die Hände auf den Rücken gebunden, und man verfrachtete sie rüde nach unten. Auf der Straße wartete ein Mannschaftswagen der Schutzpolizei samt Fahrer.
»Woher wussten die, dass wir zu Hause waren?«, flüsterte Erich, als sie auf der Querbank nebeneinandersaßen.
»Uns ist niemand gefolgt. Darauf habe ich geachtet«, meinte Franz. Er überlegte einen Moment. »Vielleicht hat Fabich jetzt auch Spitzel? Da haben sich doch im Haus vor einem Monat zwei Damen neu eingemietet. Im ersten Stock. Mutti dachte, es wären Bordsteinschwalben. Erinnerst du dich? Vielleicht hat Fabich die beiden angeheuert, damit sie uns ausspionieren. Es gibt doch jetzt auch weibliche Kriminale. Dem Kerl traue ich alles zu.«
»Ruhe«, schnauzte sie ein Oberwachtmeister an, der ihnen gegenübersaß. Drohend ließ er seinen Knüppel immer wieder in die Handfläche klatschen.
Der Wagen fuhr sie direkt zum Untersuchungsgefängnis nach Moabit. Die Sache ist ernst, dachte Franz, als er bemerkte, dass es nicht nur zu einer simplen Befragung in die Rote Burg ging. Eine Fahrt aufs Präsidium am Alexanderplatz bedeutete, dass man nur vernommen wurde. Da man sie jedoch jetzt zum Gefängnis brachte, mussten sie irgendeinen Fehler begangen haben, der es rechtfertigte, dass sie gleich in den Knast einfuhren. Denn dafür brauchte Max Fabich einen Haftbefehl. Franz hoffte, dass seine Mutter schlau genug war, ihre Schwägerin anzurufen. Toni würde sich umgehend mit Paul Konter und ihrem Anwalt Alfons Renger in Verbindung setzen. Er ahnte, dass sie sich aus dieser Sache nicht so einfach herausmogeln konnten.
˚˚˚
»Ich wusste nichts davon«, beteuerte Konter. Die Teilhaber des Syndicats waren einen Tag nach der Verhaftung der Brüder zu einem Krisentreffen zusammengekommen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. »Mein Kollege Max Fabich sieht sich auf einem Kreuzzug gegen das Verbrechen, und er hat unsere Familie auf dem Kieker. Außerdem ist er krankhaft misstrauisch und hat sicher niemandem von seinem Plan erzählt. Ich habe auf dem Präsidium jedenfalls keine Gerüchte gehört.«
»Franz und Erich haben ihn aber in letzter Zeit auch mächtig geärgert«, gab Katja zu bedenken. »Diese Sache im letzten Jahr. Als sie ihn zu einem Tatort gelockt haben. Und da saßen dann zwei Strohpuppen auf dem Lokus. Das wird er ihnen nie verzeihen. Für die Presse sind die beiden die Helden der Stadt, und er ist immer der Depp vom Dienst.«
»Ich habe mit einem Kollegen gesprochen. Fabich hat eine Liste erstellt mit fünfzig Zielen in der Stadt, die für Tresorknacker besonders interessant sein könnten«, meinte Konter. »Es gibt davon nur eine persönliche Ausfertigung, die er Tag und Nacht bei sich trägt. Er macht sich die Mühe, die Objekte regelmäßig abzuklappern oder wenigstens dort anzurufen. Er ist wie ein Blutegel. Wenn er sich festgesaugt hat, fällt er so schnell nicht ab. Außerdem will er den beiden offenbar seit langem eine Falle stellen.«
»Eine Falle?«, fragte Max Sass, der älteste Bruder.
»Fabich hat einige Kontakte zu Geschäftsleuten.« Konter nickte. »Er geht ihnen um den Bart, indem er verspricht, die Stadt sicherer zu machen. Ich habe etwas munkeln hören. Angeblich brütet er irgendetwas mit der Presse aus.«
»Der Mann ist doch irgendwie krank im Kopf«, sagte Katja. »Er wirkt ja wie besessen.«
»Er ist Franz und Erich seit über einem Jahr auf den Fersen«, bestätigte Max. »Manchmal schickt er auch seine Mitarbeiter. Erich hat schon einige Toilettenfenster in den Klubs umbauen lassen, damit er Fabich hintenraus entwischen kann. Katz und Maus. Ist doch der reinste Irrsinn.«
»Ich habe Franz gesagt, er soll für ein Jahr mit den Brüchen aufhören, damit dieser Fabich endlich Ruhe gibt«, sagte Antonia Sass. »Jetzt baut er wieder Mist! Er ist selbst schuld. Am liebsten würde ich ihn mal sechs Monate in Moabit oder Plötze schmoren lassen.«
»Worum geht es eigentlich?«, hakte Katja nach. »Sind sie dieses Mal wirklich auf frischer Tat erwischt worden?«
Konter schilderte kurz die ihm bekannten Fakten. Ein Raunen ging durch den Raum, als er die Eisenbahndirektion erwähnte. Max stieß sogar einen leisen Pfiff aus.
»Fabich, Fabich. Ich höre immer nur Fabich. Wie gefährlich kann uns der Mann werden?«, fragte Antonia Sass. Sie trug ein atemberaubend dünnes Kleid, das kaum mehr als Nichts auf ihrer Haut war. Sehr zu Konters Verdruss gab jedoch eine Seidentoga, die sie klassisch ohne Bänder oder Fibeln um ihren Körper geschwungen hatte, nur selten den Blick auf ihre Reize frei.
»Ich sage doch, der Kerl ist ein Blutegel«, erwiderte er. »Beißt sich fest und lässt dann nicht mehr los. Er hat im Präsidium zwar keine Beziehungen nach oben und geht allen auf die Nerven. Aber niemand will sich dem Verdacht aussetzen, die organisierte Kriminalität zu unterstützen.«
»Die organisierte Kriminalität?«, grunzte Wilhelm Meyer. Der ehemalige Ringboss, der früher als Messer-Willy stadtweit bekannt gewesen war, hatte – zumindest offiziell – die Wandlung zum respektablen Unternehmer vollzogen, der gute Geschäfte mit der öffentlichen Hand machte. Über die Tatsache, dass er nebenbei weiterhin ordentlich am Glücksspiel verdiente, sahen seine einflussreichen Gäste aus Wirtschaft und Politik gern hinweg. »Organisiert. Wer hat sich denn diesen Mist ausgedacht?«
»Fabich hat den Begriff aus den Staaten, verschlingt jeden Artikel darüber und hält Vorträge auf dem Präsidium. Er meint, dass die Polizei speziell ausgebildete Abteilungen braucht, um dem gewerbsmäßig tätigen Verbrechen etwas entgegensetzen zu können.« Konter zuckte mit den Schultern. »Und als Kriminaler muss ich sagen, er hat sogar recht. Er wird uns in den kommenden Jahren ziemlichen Ärger machen, wenn wir nicht aufpassen.«
»Du meinst, wenn ihn niemand aufhält«, sagte Meyer. »Eine Tram, eine Motordroschke, eine steile Treppe. Berlin ist ein gefährliches Pflaster.«
»Ein Angriff auf einen Polizisten? Geht es dir noch gut, Wilhelm?« Konter funkelte den Ringboss wütend an. »Dann jagen uns alle.«
»Können wir bitte beim Thema bleiben?«, ging Antonia dazwischen und wandte sich an den ebenfalls anwesenden Anwalt des Syndicats. »Wann und wie bekommen Sie meine Neffen wieder frei, Herr Dr. Renger?«
Der alte Mann ordnete einige Papiere, die er aus seiner teuren Aktentasche gezogen hatte. Dann wechselte er die Brille und trank einen Schluck Wasser.
»Herr Fabich hat den Reichsanwalt davon überzeugt, einen Haftbefehl bei Gericht zu beantragen. Und der Richter hat zugestimmt. Formal könnten wir gegen die Festsetzung der beiden in Moabit vorgehen. Mangelnde Haftgründe und so weiter. Aber die Herren werden argumentieren, dass eine Verdunkelungsgefahr besteht. Ich schlage deshalb vor, umgehend und direkt in die Schlacht zu ziehen.«
»Und das bedeutet?«, fragte die Dame des Hauses weiter.
»Frau Marie Sass, Ihre Schwägerin, hat mich angerufen. Ihr Sohn Erich hatte ihr aufgetragen, mich zu informieren. Franz und er waren seit zehn Uhr abends in der Wohnung ihrer Eltern, haben mit dem Vater einen über den Durst getrunken und dort übernachtet.«
»Ach so, dann ist doch alles klar«, meinte Max erleichtert. »Wenn die beiden bei Vadder und Mutti waren, können sie ja nicht bei der Direktion eingestiegen …« Er stockte, als ein Gedanke, offenbar auf Umwegen, seinen Verstand erreichte. Er kratzte sich verlegen am Kopf. »Ach so, verstehe. Sie waren gar nicht … Warum sagt das denn keiner?«
»Ein Alibi durch Angehörige gilt von Natur aus als schwach«, fuhr Renger fort. »Dennoch haben wir hier einen möglichen Hebel. Aber es bleibt immer noch ein am Ort des Verbrechens aufgefundener Beweis.« Der alte Mann sah von den Akten auf, die er sich im Untersuchungsgefängnis hatte aushändigen lassen. »Alle neu angefertigten Spezialwerkzeuge werden auf Veranlassung Fabichs von den Betrieben im Großraum Berlin mit einer Seriennummer versehen. Meist an unauffälliger Stelle platziert.« Renger erklärte, dass am Tatort ein Brecheisen besonderer Güte und Größe gefunden worden war. Nur drei Werkzeugmacher in der Stadt stellten so etwas her.
»Aber sie können doch nicht beweisen, dass Franz oder Erich das Ding gekauft haben«, wandte Max ein.
»Fabich hat es überprüfen lassen. Er hat offenbar Listen der Hersteller und wurde bei Müller & Söhne in der Oranienburger Vorstadt schnell fündig«, sagte er, ohne eine Miene zu verziehen. »Sie haben das Brecheisen laut ihren Unterlagen an einen Gesellen der Firma Weinhell-Bau verkauft. Das Unternehmen gibt es nicht. Natürlich nicht. Und der Mann, der dort war, ähnelte nach den Beschreibungen des Angestellten Franz sehr stark. Jedenfalls behauptet Gustav Müller, ihn auf der Fotografie wiederzuerkennen.«
Konter wusste, dass dieser Vorwurf schwer wog. Die Zuordnung der Nummer zum Käufer und das Wiedererkennen auf dem Foto waren bereits kaum widerlegbare Indizien. Die Angabe eines falschen Namens wies zudem auf erhebliche kriminelle Energie hin. Der Reichsanwalt würde vor Gericht einen Freudentanz aufführen. Wahrscheinlich hatte sich der feixende Fabich bereits eine Flasche Henkell kalt gestellt.
»Gustav Müller muss sich geirrt haben«, sagte Willy Meyer und sprach nur aus, was Konter dachte. Es schien die einzige Möglichkeit zu sein, wie Franz und Erich heil aus der Sache herauskamen. »Er muss. Ich hoffe, dass ihr versteht, was ich meine. Ich kenne einen guten Mann. Er wird mit diesem Müller sprechen und ihn überzeugen. Wahrscheinlich wurde die Nummer versehentlich zwei Mal vergeben. Und die Augen des Alten sind sicherlich nicht mehr die besten. Er wird sich also ganz sicher geirrt haben. Wird das reichen, Herr Anwalt?«
»Begründete Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Zeugen.« Renger nickte. »Sehr gut.«
»Sehe ich ähnlich«, meinte Antonia. Ihre Stimme klang dankbar, sie schenkte Meyer und sich einen Schwenker mit Hennessy Eau de Vie ein. Beide führten die Gläser mit dem Kupferrot beinahe zärtlich zueinander. Ein hauchfeines Singen erklang, als sie sich berührten. »Nur bitte nicht zu heftig, Willy.« Danach wandte sie sich an den Anwalt. »Herr Dr. Renger, ich hoffe, dass Sie die Sache schnell ausbügeln. Unsere Familie hält zusammen.«
»Zwar haben wir nur ein wackliges Alibi auf Seiten der Beschuldigten. Aber wenn es Herrn Meyer gelingt, den Zeugen umzustimmen, dann können die Indizien seitens der Ermittler einer näheren Prüfung nicht standhalten.« Rengers Stimme hatte etwas Schnarrendes. Ein gutes Zeichen, denn mit ihr sägte er sich auch vor Gericht durch jeden Vorwurf, jede Aussage, jeden Beweis und hinterließ Späne des Zweifels in den Köpfen von Schöffen und Richtern. Und letztlich warf Justitia unter seinen beherrscht geführten, verbalen Attacken allzu oft entnervt das Handtuch. »Damit sollte es möglich sein, die beiden Herren binnen spätestens einer Woche wieder auf freien Fuß zu bekommen.«
˚˚˚
Fünf Tage später saß Max Fabich in seinem Büro und schäumte vor Wut. Er hatte eben Akten und Schreibgerät vom Tisch gefegt und ein Glas an die Tür geworfen. Ein Betrachter hätte sich wahrscheinlich um seinen Gesundheitszustand gesorgt, denn das Gesicht des Beamten war karmesinrot angelaufen, die Kiefermuskeln waren angespannt und die Hände zu Fäusten geballt. Sein manchmal unbändiger Zorn hatte ihn schon oft in Verlegenheit gebracht. Seine Umgebung war in solchen Momenten vor allem deshalb irritiert, weil sein ansonsten leises, behäbiges Auftreten überhaupt nicht zu den unvermutet auftretenden Ausbrüchen von Gewalt passte. Schon in seiner Kindheit und Jugend war er häufig durch Wutanfälle aufgefallen. Er hatte geschrien, Sachen durch den Raum geworfen oder Dinge zerstört. Seine Mutter hatte ihn sogar für drei Monate in eine Anstalt gegeben, in der man ihm »die Flausen austreiben« sollte. Ein Lehrer hatte ihn einmal vor versammelter Klasse zu einem großen Eimer gerufen, in dem sich Aale wanden. Der Junge sollte ein Tier daraus hervorholen. Es gelang ihm trotz aller Anstrengung nicht. Er war wieder wütend geworden und hatte sich von oben bis unten mit dem glitschigen Schleim der Tiere eingesaut. Sosehr er sich auch abgemüht hatte, immer waren ihm die Viecher entglitten. Alle Mitschüler hatten gelacht.
»Mit deinem Zorn machst du dich nur lächerlich«, hatte der Lehrer schließlich gesagt, einen Aalstecher in den Eimer gerammt und einen Fisch herausgezogen. »Denk nach, wähle das richtige Instrument, und dann kannst du handeln. Nur auf diese Weise wirst du Erfolg haben.«
Fabich versuchte jetzt, sich zu beruhigen, und blickte auf das Chaos neben seinem Schreibtisch. Dass er derart die Kontrolle verlor, kam nur noch selten vor. Nach außen ließ er sich meist nichts anmerken. Er dachte wieder an den Lehrer mit dem Aaleimer. Er hatte die Lektion gelernt. Wenn er seine Gefühle jedoch allzu lange unterdrückte, neigte er zu einer Art Selbstverletzung und gab sich oft die Schuld am Misslingen eines Vorhabens. Er grübelte viel und bestrafte sich sogar, indem er sich dann seinen geliebten Bohnenkaffee oder einen Wochenendausflug versagte.
»Verdammte Kerle!«, rief er und hob die Aktenmappe mit der Aufschrift Sass – Raubüberfall Eisenbahndirektion vom Boden auf. Wieder einmal hatte ihn die Familie Sass an der Nase herumgeführt. Der Reichsanwalt war einfach eingeknickt, als deren Anwalt seine neuen Argumente vorgetragen hatte. Dem wackligen elterlichen Alibi traute zwar selbst ein schwachsinniger Kohlenträger nicht. Aber dieser Renger hatte eine eidesstattliche Erklärung vorgelegt, in der der Hauptzeuge Gustav Müller kleinlaut erklärte, er hätte sich bei der Identifizierung des Käufers geirrt. Grinsend waren die Burschen am Morgen entlassen worden und in einer Art Triumphzug aus dem Gerichtsgebäude an der Turmstraße marschiert. An der Straße hatten zwanzig oder dreißig Taugenichtse gewartet, die dann lautstark ihre Freilassung bejubelten. Sogar Reporter und Fotografen waren erschienen, um von dem Ereignis zu berichten. Diese unverschämten Kerle hatten schließlich noch mit Geldscheinen um sich geworfen und Fabich, der oben an der Treppe zum Gericht gestanden hatte, frech zugewinkt.
Er zwang sich durchzuatmen. Aaleimer, ging es ihm wieder durch den Kopf. Er musste nur das richtige Instrument finden. Und wie hatte es vor hundert Jahren ein preußischer Offizier nach einer Niederlage gegen Napoleons Truppen ausgedrückt? Der König hat eine Bataille verloren. Jetzt ist Ruhe die erste Bürgerpflicht. Nach der Schlacht war eben vor der Schlacht, entschied der Beamte grimmig und durchwühlte seine Akten, bis er gefunden hatte, was er suchte.
Der Kaufhauskonzern Wertheim hatte vor einiger Zeit verlauten lassen, dass er beabsichtigte, sein Stammhaus an der Leipziger Straße deutlich zu erweitern. Und in diesem Zusammenhang sollten die im Kellergeschoss des Gebäudes untergebrachten Tresorräume ausgebaut und mit der neuesten Sicherheitstechnik versehen werden. Der Geschäftsführer des Konzerns, Klaus Grothewald, hatte sich sogar an die Kripo-Abteilung gewandt. Angeblich, um sich abzusprechen. Max Fabich wusste es jedoch besser. Diesem Herrn ging es nur um kostenfreie Werbung für sein Unternehmen. Und die konnte er gern bekommen, überlegte der Kripobeamte. Er würde um eine Unterredung mit Grothewald bitten. Man musste die Spitzbuben aus der Reserve locken, sie bei der Ganovenehre packen. Was wäre besser dafür geeignet als eine Herausforderung? Wenn der Geschäftsführer von Wertheim hinausposaunte, dass seine Wertschränke absolut sicher waren. Dass nicht einmal die Herren Meistereinbrecher sie knacken konnten. Dann, da war sich Fabich sicher, würden die Sass-Brüder anbeißen und das Gegenteil unter Beweis stellen wollen. Er musste ihnen nur auf den Fersen bleiben und zum richtigen Zeitpunkt die Falle zuschnappen lassen. Vielleicht konnte man sie ein wenig mehr reizen, indem man einen entsprechenden Artikel in der Zeitung veröffentlichte. Es wäre dann sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis die Kerle ihr Glück in den Kellern des Kaufhauskonzerns versuchten. Fabich machte sich Notizen und entwarf einen Plan. Er entschied, den Brüdern in den nächsten Wochen etwas Leine zu geben, damit sie sich als Sieger fühlten. Sollten sie ruhig denken, er wäre frustriert und kurz davor aufzugeben. Fabich spürte wieder die Enge in seiner Brust. Er hatte sich zu sehr in seine Vorstellungen hineingesteigert, sah seinen Erfolg bereits zum Greifen nahe. Er kannte das Phänomen. Sein Körper gebot ihm Einhalt, wenn sein Verstand sich allzu weit von der Wirklichkeit entfernte. Aaleimer, versuchte er sich zu beruhigen.
3
April 1928
Feiner Sprühregen hatte sich seit dem Nachmittag wie ein Vorhang über die Stadt gelegt. Zusammen mit einer dichten, bleiernen Wolkendecke tauchte er alles in ein ödes Grau, das jedem Objekt seine Farbe auszusaugen schien. Nach einigen Stunden erlöste die Dämmerung das Auge endlich von dieser Trübsal. Wenigstens war der schwüle Dreck aus der Luft gewaschen geworden, das Atmen fiel leichter. Fabich litt seit seiner Kindheit unter Asthma. Borsig-Lunge nannten es die Ärzte. Seine Eltern hatten mit ihm zu einer Zeit in der Oranienburger Vorstadt gelebt, als die Traditionsgießerei des Eisenbahnbauers ihre giftigen, schwarzen Dämpfe noch ungehindert in die Luft und Atemwege der Anwohner blasen konnte. Der Kriminalsekretär fluchte leise, als sich die Feuchtigkeit am Kragen seines Überziehers wieder einmal zu Tropfen gesammelt und in den Nacken gelaufen war. Hin und wieder beugte er sich vor und nahm den Homburg vom Kopf. Er schüttelte ihn, damit sich das Nass der Hutkrempe nicht als Rinnsal über Rücken und Hose ergoss. Er wartete seit gut einer Stunde im schmalen Grünzug am Leipziger Platz, der genau genommen nur ein Ausläufer des Potsdamer Platzes war. Aber da es hier viel ruhiger zuging als auf dem belebten Verkehrsknotenpunkt, war der Bereich ein überaus beliebter Treffpunkt für Verabredungen. Fabich beobachtete unauffällig die Hintereingänge des gigantischen Wertheim-Baus, der immer wieder durch Anbauten erweitert worden war. Mittlerweile war Wertheim sogar das größte Warenhaus Europas.
Am Vormittag hatte er sich noch mit der Akte der Brüder Sass beschäftigt. In den Wochen seit ihrer Entlassung aus Moabit hatte er sie zähneknirschend in Ruhe gelassen. Jetzt, so fand er, war es wieder Zeit, die Zügel anzuziehen. Zunächst wollte er jedoch einen anderen Fall abschließen. Er war seit Monaten an einer Bestechungssache dran, die an diesem Abend seine Aufmerksamkeit erforderte, da der Verdächtige, ein höherer Regierungsbeamter, überwacht werden musste. Es ärgerte ihn, dass er die Observation selbst hatte übernehmen müssen. Aber sein Chef Bernhard Weiß, der Leiter der Kriminalpolizei am Alex, hielt nicht viel von seinen Ermittlungsmethoden. Offiziell war Max Fabich nämlich der Inspektion B, zuständig für Raubüberfälle, zugeteilt. Und eben da lag das Problem. Seine Arbeit lieferte auch viele Hinweise für andere Delikte wie Diebstahl, Einbrüche, Bestechung und organisierten Betrug. Und dadurch kam er oft in Konflikt mit anderen Inspektionen, denen er allzu gern die Ergebnisse seiner Arbeit aufdrängte. Meist zusammen mit ein paar Empfehlungen. Und nichts hasste ein preußischer Beamter so sehr wie eine – und sei es auch nur gefühlte – Beschneidung seiner Zuständigkeit und Kompetenz. Folglich wurden Fabichs gutgemeinte Ratschläge und Hinweise von den meisten Kollegen einfach ignoriert. Als er bereits zu Jahresbeginn die Überwachung von Kurt Pohlmann, einem verdächtigen Mitarbeiter aus dem Verkehrsministerium, angemahnt und um Unterstützung gebeten hatte, war die Reaktion nur ein müdes Abwinken gewesen. Ihm war schließlich nichts anderes übriggeblieben, als die Aufgabe selbst zu übernehmen.
Fabich blickte auf seine kleine Taschenuhr. Eine weitere, durchwachte Nacht würde er ganz sicher nicht überstehen, sondern wahrscheinlich gegen eine Linde gelehnt einschlafen, um morgens von einem pinkelnden Hund, einer keifenden Dame oder der Straßenreinigung geweckt zu werden. Er hatte den Verdächtigen bereits gestern in der Nähe von dessen Wohnort in Charlottenburg beschattet. Dann hatte sich allerdings herausgestellt, dass der Kerl dort nur sein Liebchen getroffen und offenbar mehrere Schäferstündchen in einer kleinen Wohnung verbracht hatte. Und jetzt war es wieder fast zehn Uhr abends. Die äußerst ungewöhnliche Uhrzeit schien Fabichs Verdacht nur zu bestätigen. Was hatte ein hoher, städtischer Beamter lange nach Ladenschluss bei Wertheim, Berlins angesagtestem Konsumtempel, zu suchen? Ganz sicher würde er dort kein Parfüm oder Miederwaren für seine Geliebte erstehen. Fabich zog eine Zuckerstange aus der Tasche seines Mantels und fluchte wieder. Die Tüte war nass geworden, das Zeug klebte wie Teufel. Gerade wollte er seine Finger an den feuchten Blättern eines kümmerlichen Rhododendrons abreiben, als oben am Treppenabsatz ein Lichtkegel erschien. Jemand hatte eine Hintertür des Ministeriums geöffnet. Die Gestalt war nur ein Schemen im Gegenlicht, dann verschwand sie im Grau der fortschreitenden Dämmerung, als die Tür geschlossen wurde. Fabich versuchte, ein Stück seiner Süßigkeit von seiner Hand zu schütteln, das dann prompt auf seinem Überzieher landete. Es kümmerte ihn nicht. Heute musste er endlich Erfolg haben! Wenn er den Mann überführen konnte, wie er behördliche Geheimnisse an unbefugte Dritte weitergab, dann hatte sein Vorgesetzter keinen Grund mehr, ihn zu ignorieren. Er war überzeugt, dass er dann endlich eine Kommission, vielleicht sogar eine Unterinspektion, zugeteilt bekommen würde.
Der Kriminalbeamte kniff die Augen zusammen und versuchte, die Gestalt in der Dunkelheit auszumachen. Es gab kein Taxi in der Nähe. Wenn der Mann später am Potsdamer Platz in einen Wagen stieg, wäre es Fabich ein Leichtes ihm zu folgen, denn dort standen zu jeder Tageszeit mindestens zwei Dutzend Motordroschken herum. Und sollte er eine späte Tram nehmen wollen, würde Fabich ihm ebenfalls problemlos folgen können. Tatsächlich schien es in diesem Moment so, als wäre dies der Plan des Mannes, der sich gerade eine Zigarette anzündete und ohne Eile auf der Leipziger Straße in Richtung der zentralen Verkehrskreuzung schlenderte. Die beiden riesigen Kandelaber mit ihren Bogenlampen tauchten den Platz in ein unwirkliches Licht, das den Kripobeamten an die Stimmung der Mabuse-Filme erinnerte. Und an diesen seltsamen Streifen Metropolis, den er neulich im Ufa-Kinopalast am Nollendorfplatz gesehen hatte.
Der Observierte überquerte die Friedrich-Ebert-Straße und steuerte auf das Eckhaus an der Bellevuestraße zu. Josty’s Conditorei und Café hatte natürlich längst geschlossen, da es tagsüber vor allem Touristen und kleinere Angestellte anzog. Vom dritten Stockwerk des Gebäudes irritierte eine Wanderschrift das an die Nacht gewöhnte Auge. Fabich konnte sich der Faszination dieser sich scheinbar bewegenden, zehntausend Glühbirnen nicht entziehen, die ihn erst aufforderten, nach einem langen Tag das wohlverdiente Glas Doornkaat zu genießen, um dann die Gattin mit Odol-frischem Atem zu überraschen. Die überall in der Stadt geklebte Werbung an Wänden und Litfaßsäulen ärgerte ihn, aber diese neuartige Leuchtreklame hatte ihren Reiz. Auf diese Weise kurz abgelenkt, hätte er beinahe übersehen, dass der von ihm beobachtete Mann in einem Hauseingang neben dem Café Josty verschwand.
»Na, meen Juter, janz alleen?« Eine grell geschminkte, junge Frau in viel zu dünnem Kleidchen und waghalsig hohen Schuhen passte ihn ab, als er gerade über die Kreuzung geeilt war. Sie drängte sich dicht an ihn heran, so dass das Wasser von ihrer Schirmkante auf seine Schultern tropfte. »Brauchste een paar Schenkel, um dir zu wärmen?«
Max Fabich war vom Äußeren und Charakter her eher die Sorte von Mann, für die sich Frauen nur aus zwei Gründen zu interessieren vermochten: Entweder weil sie zu den Mächtigen dieser Welt gehörten. Oder weil sie jede Menge Geld besaßen. Da allerdings sein Einfluss kaum über seine abgestoßene Schreibtischkante hinausreichte, sein Machtbereich also spätestens an der Türschwelle seines kleinen Büros endete und das Beamtengehalt allenfalls für besagten Doornkaat oder den billigsten Sekt ausreichte, hätte er höchstens noch mit Charme und Aussehen punkten können. Vorzüge, die ihm die Natur jedoch in beinahe boshafter Weise und Konsequenz versagt hatte. Folglich war ihm jetzt sofort klar gewesen, dass es sich hier nur um das Angebot einer Bordsteinschwalbe handeln konnte. Unwillig wischte er die Tropfen von seinen Brillengläsern und murmelte einige unschöne Worte.
»He, du Flitzpiepe«, rief die Frau. »Wat jloobst du, wer du bist? Ick für meen Teil bin eene echte Dame, mit der man nich so reden tut.«
»Verzieh dir«, zischte Max Fabich und passte sich dem Straßenjargon bewusst an. »Oder ick ruf die Sitte. Dann biste die janze Nacht oofm Revier. Also keen Jeld und morgen Hiebe von deen Lude. Also, subtrahiere dir jefällichst!«
Maulend zog die Frau ab. Der Potsdamer Platz hatte vor gut zwei Stunden seine eigene Art von Wachablösung erlebt. Zur blauen Stunde – heute war sie eher grau gewesen – verzogen sich die Angestellten, Sekretärinnen, Touristen und Geschäftsleute, die noch ein Gläschen heben gegangen waren, in ihre Wohnungen und Hotels. Spätestens gegen acht oder halb neun räumte das biedere Kleinbürgertum das Feld zugunsten des anrüchigen Berliner Nachtpublikums. Künstler, Trinker, Varietébesucher und Prostituierte sorgten für einen fast reibungslosen Wechsel des Bühnenbilds. Und dazwischen, des Tags und bei Nacht, lungerten hier immer ein paar vermögende Dandys und Lebemänner herum, denen der Spagat zwischen beiden Welten die bleierne Langeweile des Geldes vertreiben sollte.