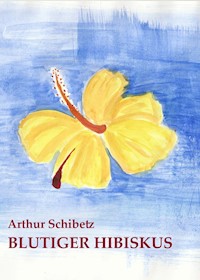
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In naher Zukunft breitet sich eine neue Krankheit aus. Wissenschaftler tun sich schwer, den Erreger zu identifizieren oder gar eine Heilung anzubieten. Man weiß nur, dass sie ansteckend ist und unweigerlich zum Tod führt. Zum Schutz vor Ansteckung haben die USA die hawaiianische Insel Moloka'i zur Quarantäne-Insel erkärt, auf die die Infizierten gebracht werden, wo sie entweder auf ihren Tod oder auf ein Heilmittel warten sollen. Doch nicht alle Kranken sind mit dieser Ausgrenzung einverstanden, und so versuchen oft einige von ihnen, auf eine der Nachbarinseln zu fliehen. Jeremy Hagen, Polizist aus L.A., lässt sich nach Maui versetzen und übernimmt hier zusammen mit seinem Kollegen John Oshiro den Spezialauftrag, jene Flüchtlinge aufzuspüren. Tödliche Waffengewalt ist dabei ausdrücklich erwünscht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arthur Schibetz
Blutiger Hibiskus
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort für die Ebook-Ausgabe
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Impressum neobooks
Vorwort für die Ebook-Ausgabe
Eine grobe Idee zu dieser Geschichte hatte ich bereits vor einigen Jahren. Meine übliche Vorgehensweise ist dann folgende: Erst kommt die Idee, danach arbeite ich im Kopf den roten Faden aus, dann schreibe ich ein Exposee, und dann erst mache ich mich ans Werk.
Diese Idee wollte sich allerdings nicht zu einer Geschichte entfalten. Also ließ ich sie irgendwo in einer Schublade verstauben. Bis ich im Frühjahr 2018 auf irgendeinem Doku-Sender im Kabelfernsehen eine Dokumentation über die ehemalige Leprakolonie auf Moloka’i gesehen hatte. Und plötzlich tauchte diese verstaubte Idee wieder auf. Die Bilder vermischten und entwickelten sich, und innerhalb kürzester Zeit hatte ich die komplette Geschichte in meinem Kopf. Und damit den Handlungsort: Hawaii, speziell Maui und Moloka’i.
Allerdings ergaben sich mit dem Handlungsort auch zwei kleine Probleme, auf die ich hier hinweisen möchte.
Zuerst wäre da das Problem für die Ortsunkundigen: Die hawaiianischen Ortsnamen. Zwischen Kalaupapa und Kapalua zu unterscheiden ist deutlich schwieriger, als zwischen Los Angeles und San Diego. Daher empfehle ich, nebenher einen beliebigen Online-Kartendienst (ich nenne keine Namen und empfehle auch keinen Speziellen) zu öffnen, damit man immer nachschlagen kann, wo sich der Protagonist gerade befindet.
Dann wäre noch das Problem für die Ortskundigen: Die Szenerie passt nicht immer zur Geschichte. Daher habe ich mir an manchen Stellen die kreative Freiheit genommen, ein paar Ecken auf Hawaii ein wenig an meine Geschichte anzupassen. So gibt’s zum Beispiel keine Zuckerrohrplantagen mehr auf Maui, bei mir aber schon noch. An alle, die sich daran stören: E kala mai ia’u!
Und dann ist da noch die Frage nach dem korrekten Adjektiv. Heißt es hawaiianisch oder hawaiisch? Der Duden lässt beides zu. Ich habe mich für die erste Variante entschieden, da sie meiner Meinung nach besser klingt.
Arthur Schibetz, im April 2019
Kapitel 1
Durch einen starken Ruck wurde Jeremy Hagen geweckt. Das Flugzeug, das ihn von Los Angeles nach Honolulu bringen sollte, setzte soeben sehr hart auf der Landebahn seines Zielflughafens auf.
„Wir sind gelandet“, sagte der ältere Mann, der neben ihm saß. Er macht es schon wieder, ging es Jeremy durch den Kopf. Er hatte sich in Los Angeles noch nicht richtig hingesetzt, da hatte ihn der alte Mann bereits angesprochen. Und seitdem sprach er bei jeder Gelegenheit. Darüber, dass er Sam Connor heißt, dass er seine Tochter besuchen möchte, die auf Maui lebt, über sein bisheriges Berufsleben bis hin zu Themen wie seinen Lieblingsspeisen und Lieblingsrestaurants. Und vor allem kommentierte er ständig das Offensichtliche. Zum Glück hielt er irgendwo auf halber Strecke für fünf Minuten die Klappe. Jeremy nutze die Zeit, um einzuschlafen.
Jeremy schaute auf seine Armbanduhr. Der Flug war fast eine Stunde hinter dem Plan zurück. Der Kapitän meldete sich über den Kabinenfunk.
„Meine Damen und Herren“, sagte er, „wir sind soeben auf dem Daniel K. Inouye International Airport gelandet. Bitte bleiben Sie angeschnallt, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben. Wir hoffen Sie hatten einen angenehmen Flug und würden uns freuen, Sie bald wieder an Bord einer unserer Maschinen begrüßen zu dürfen.“
Jeremy teilte diese Hoffnung nicht. Er hasste das Fliegen. Er hasste es, stundenlang auf einem engen Sitz eingepfercht zu sein, sich von berufsgrinsenden Stewardessen Tomatensaft und Knabbereien aufdrängen zu lassen, und vor allem hasste er verwitwete Rentner, die ihr Bedürfnis nach Gesellschaft damit befriedigen mussten, ihren unbekannten Sitznachbarn in einer Tour zu bequatschen. Jeremy hatte kein Bedürfnis nach Gesellschaft.
„Da, gucken Sie mal. Das ist das Terminal der Verdammten“, sagte Sam und zeigte aus seinem Fenster. Jeremy beugte sich etwas rüber, damit er auch aus dem kleinen Bullauge schauen konnte. Er konnte ein einzelnes, freistehendes weißes Gebäude mit zwei Fluggastbrücken erkennen, an denen je ein Flugzeug angedockt war. Dahinter war das Meer.
„Vor zwei Jahren war es noch nicht da“, sagte Sam. „Da hatten die dafür immer das Inter-Island-Terminal hergenommen, und immer nur nachts, das wurde dafür extra abgesperrt. Aber dann wurden es immer mehr und dann kam die Geiselnahme. Da hatte der Gouverneur beschlossen, dass es ein eigenes Terminal geben müsse. Meine Tochter hatte damals Riesenglück, wissen Sie? Eigentlich sollte sie an jenem Morgen dort sein, weil sie den ersten Flug nach Maui nehmen wollte. Aber sie hatte verschlafen. Ja ja, das Glück der Iren.“
Das Terminal der Verdammten. Ein spezielles, isoliertes Terminal für all jene, die das Pech hatten, sich mit MODAPS zu infizieren.
MODAPS, die Abkürzung für Multiple Organic Dysfunction and Paranoia Syndrome. Eine Krankheit, die vermutlich vor einem Jahrzehnt zum ersten Mal auftauchte, und seit einigen Jahren immer weiter um sich griff. Wissenschaftler waren sich sicher, dass sie durch ein Virus verursacht wurde, aber sie waren bisher nicht in der Lage gewesen, es zu identifizieren. Zumindest sprach die Übertragung dafür, dass es sich um einen viralen Infekt handeln musste. Die Übertragung über Körperflüssigkeiten galt als gewiss, zum Beispiel über Sexualkontakte oder Bluttransfusionen. Aber es gab auch Fälle, in denen solche Übertragungswege ausgeschlossen werden konnten, so dass auch die Schmier- oder sogar die Tröpfcheninfektion in Frage kam. Letztlich konnte der Übertragungsweg ebenso wenig geklärt werden wie der Erreger, und das trieb die weltweit unter Hochdruck forschenden Wissenschaftler fast in die Verzweiflung.
Was man leichter erforschen konnte, das waren die Symptome. Die ersten Anzeichen der Erkrankung konnten vielfältig sein, je nachdem, welche Organe zuerst in Mitleidenschaft gezogen wurden. Bei dem einen war es Übelkeit, beim anderen Müdigkeit und Schwindelgefühl, wieder andere zeigten Veränderungen ihrer Persönlichkeit. Die Organe begannen, langsam aber sicher zu degenerieren, bis sie sechs bis neun Monate nach den ersten Symptomen vollständig versagten und man qualvoll starb. Da auch das Gehirn betroffen war, litten die Erkrankten zusätzlich unter paranoiden Wahnvorstellungen.
Immer mehr Menschen erkrankten. Etwa vor fünf Jahren erreichte die Epidemie ihren ersten Höhepunkt. Einige Regierungen begannen damit, spezielle Quarantäne-Bereiche einzurichten, in die die Erkrankten gebracht wurden. Gegen diese Ausgrenzung wurde von manchen Menschenrechtsorganisationen erfolgreich geklagt, und so änderten diese Regierungen ihre Gesetzgebung zum Teil sehr stark. Individuelle Menschen- und Freiheitsrechte wurden radikal beschränkt, um diese Quarantäne-Bereiche zu ermöglichen.
Die Vereinigten Staaten von Amerika kauften zu diesem Zweck die hawaiianische Insel Moloka’i komplett auf. Dieselbe Insel, auf der bis 1969 Leprakranke in einer isolierten Kolonie lebten. MODAPS-Kranke wurden zwangsweise auf diese Insel gebracht, auf der sie entweder bis zu ihrem Tod oder bis zur Entdeckung eines Gegenmittels leben mussten. Von einigen einzelnen liberalen Stimmen abgesehen akzeptierte die Gesellschaft das, da einerseits die Angst vor der Ansteckung sehr hoch war, und andererseits die Ansteckung mit dieser Krankheit einem Todesurteil gleichkam. Nicht wenige Stimmen wurden laut, dass die Infizierten doch dankbar sein sollten, die letzten Monate noch in Würde leben zu dürfen, nur eben nicht unter den Gesunden.
Im ganzen Land wurden die Kranken mit Flugzeugen nach Honolulu gebracht, und von hier per Boot nach Moloka’i. Hierfür benutzte man bis vor einigen Jahren eines der normalen Terminals des Flughafens; von hier brachte man die Infizierten dann per Bus zum Hafen und von da ging es dann weiter.
Bis vor einigen Jahren eine Gruppe Infizierter nicht damit einverstanden war. Sie überwältigten am Flughafen einige Wachleute, nahmen deren Waffen an sich und hielten mehrere Wachleute, Mitarbeiter des Flughafens und Passagiere als Geiseln. Nach einigen Stunden wurde die Geiselnahme blutig beendet. Insgesamt starben 18 Infizierte, elf Geiseln und ein Polizist.
Daraufhin beschlossen die hawaiianischen Behörden den Bau dieses neuen Terminals an der Südseite des Flughafens, weitab von den anderen Terminals, direkt am Meer. Und auf die Rückseite baute man eine Anlegestelle für die Fähre, so dass die Infizierten direkt aufs Boot verfrachtet werden konnten.
Das Flugzeug rollte noch einige Minuten über das Vorfeld, bevor es stehen blieb und die Anzeichen zum Abschnallen aufleuchteten. Für Jeremy konnte es nicht früh genug kommen, er schnallte sich los.
„Wann fliegen Sie zurück?“, wollte Sam wissen.
„Gar nicht“, antwortete Jeremy, und er fühlte eine Genugtuung beim Gedanken, sich einen zweiten Flug mit ähnlicher Gesellschaft sparen zu können. „Ich trete hier einen Job an und bleibe.“
Sam wünschte ihm noch viel Spaß. Jeremy bedankte und verabschiedete sich höflich und stand auch schon im Gang.
Sofort nach dem Verlassen des Flugzeugs begann eine für Jeremy fast endlos anmutende Reihenfolge unterschiedlicher Sicherheitsprozeduren. Passkontrolle, Fingerabdruck- und Iris-Scan, Körper-Scan, die üblichen Fragen nach Zweck der Reise und ob er ein Moslem wäre oder vorhätte, den Gouverneur oder andere Funktionsträger zu töten, ob er Waffen oder Bomben oder waffen- oder bombenfähige Materialen mit sich führe und so weiter und so fort. Eigentlich dasselbe wie vor dem Abflug in Los Angeles. Er war sich des Sinns dieser Redundanz nicht im Klaren. Vielleicht entscheiden sich manche Passagiere während des Fluges um oder konvertieren zum Islam. Wäre ja möglich, zum Beispiel wenn man neben einem Sam sitzt.
Natürlich hatte Jeremy eine absolut weiße Weste und auch keine Pläne, jemanden zu töten. Zumindest nicht, wenn es nicht sein musste. Denn Jeremy war Polizist, und in der Ausübung seiner Pflicht hatte er schon zweimal tödliche Waffengewalt anwenden müssen. Das war in Los Angeles.
Endlich durfte Jeremy an die Gepäckausgabe. Hier warteten bereits einige Leute aus seinem Flugzeug, Sam war aber nicht darunter. Die Ausgabe hatte schon begonnen. Jeremy hoffte, seinen Koffer zu finden, bevor er Sam wieder über den Weg lief. Diesmal hatte er Glück. Er schnappte sich seinen Koffer und eilte in Richtung Ausgang.
Ein Koffer. Mehr hatte er nicht. Und mehr brauchte er auch nicht. All seine Sachen passten in diesen Koffer. Hauptsächlich Kleidungsstücke, dazu noch einige Hygieneartikel, eine Mappe mit all seinen wichtigen Papieren und sein Laptop. Das war alles, was er sein Eigentum nannte. Mit leichtem Gepäck reiste es sich leichter. Das war schon seine Devise, als er vor acht Jahren aus seiner Heimat Wisconsin nach L.A. gezogen war. Er hatte auch keine Waffe, seine Dienstwaffe würde ihm reichen.
Zuhause in Wisconsin hatte er noch mehrere Waffen. Das war da normal, da hatte jeder zweite mindestens eine Waffe. Jeremy hatte einen Revolver und mehrere Gewehre, letztere hauptsächlich für die Jagd. Er war Polizist und Jäger, genau wie sein Vater. Und genau wie dieser war er leidenschaftlicher Biertrinker. Als sein Vater vor acht Jahren an einer Leberzirrhose starb – zwei Jahre nach dem Unfalltod seiner Mutter -, verkaufte Jeremy das Haus und all sein Hab und Gut einschließlich seiner Waffen, kündigte seinen Job und zog nach Los Angeles. Bereits damals nur mit einem einzigen Koffer.
Auch in Los Angeles arbeitete er als Polizist. Er bewohnte ein kleines möbliertes Appartement in North Hollywood. In seiner Freizeit schaute er viel fern, am Wochenende zog er durch Bars. Nicht um zu trinken, seit dem Tod seines Vaters hatte er keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Er suchte nach kurzen, unverbindlichen sexuellen Kontakten mit gleichgesinnten Frauen. Es funktionierte nicht immer, in den meisten Fällen musste er wieder alleine nach Hause, aber manchmal hatte er Glück.
Einmal wandelte sich das Glück in Unglück: Eine der Frauen bedeutete ihm mehr, als er wollte, und sie erwiderte seine Gefühle. Ihr Name war Catherine. Ein Jahr später heiratete er sie und sie zogen in eine größere gemeinsame Wohnung nach Sherman Oaks. Aber im Grunde wurde er zum Bigamisten, denn er war schon mit seinem Job verheiratet. Früher hielt Jeremy das immer für einen dämlichen klischeehaften Spruch, bis er seine Bedeutung am eigenen Leib zu spüren bekam. Denn Catherine war nicht die Frau, die diese Nebenbuhlerin längere Zeit aushielt. Und so war Jeremy nur anderthalb Jahre später wieder geschieden. Zum Glück hatte er nicht viel mit in die Ehe gebracht, sieht man mal vom Erlös aus dem Verkauf seines Hauses in Wisconsin ab, so dass die Scheidung schnell und schmerzlos vonstattengehen konnte. Danach bewohnte Jeremy wieder ein kleines möbliertes Appartement, diesmal in Del Rey.
Und erneut verzichtete er auf viel eigenes Hab und Gut, so dass ihm wieder nur ein Koffer genügte, um sein altes Leben in L.A. hinter sich zu lassen und nach Hawaii zu ziehen.
Auf dem Weg durch das Foyer lief Jeremy am Laden einer bekannten Fast-Food-Kette vorbei. Er hatte an diesem Tag noch nichts gegessen, und so überlegte er kurz, ob er einen Burger zu sich nehmen mochte. Da er weder rauchte noch Alkohol, Tabletten oder sonstige Drogen zu sich nahm und er auch nicht spielte, betrachtete Jeremy ungesundes Essen als sein einziges Laster, welches er dann auch gerne als solches akzeptierte. Nur sein Arzt beschwerte sich ständig über seine schlechten Leber- und Cholesterinwerte. Aber auch ihn und seine Nörgeleien ließ Jeremy in L.A. zurück.
Da erblickte er Sam in der Schlange und entschied sich gegen einen Burger. Jeremy drehte sich um und ging zum Ausgang. Er hätte eh keine Zeit gehabt, um etwas zu essen. Zusätzlich zur Verspätung des Flugzeugs hatte er nicht damit gerechnet, nochmal die ganze Sicherheitsprozedur wie beim Abflug zu durchlaufen. Er schaltete sein Mobiltelefon ein und rief beim Polizeipräsidium an, um Bescheid zu geben, dass er wenige Minuten später ankommen werde.
Vor dem Flughafen winkte er sich ein Taxi herbei. Er beauftrage den Fahrer, ihn zum Polizeipräsidium von Honolulu in die 1060 Richards Street zu fahren.
Kapitel 2
Eine Viertelstunde später hielt das Taxi an seinem Ziel. Zu seiner Rechten war die Fassade eines dreistöckigen Gebäudes mit hohen Arkaden hinter einer Palmenzeile, zu seiner linken ein Park, in dem, ein Stück von der Straße abgesetzt, ein seltsam anmutendes Gebäude stand. Es erinnerte ihn an eine Burg, oder zumindest an das, was sich die Amerikaner unter einer mittelalterlichen englischen Burg vorstellen. Die Iolani Barracks, erklärte der Taxifahrer. Das Polizeigebäude wäre das Gebäude mit den Arkaden zu seiner Rechten.
Nach einer weiteren kurzen Durchleuchtung per Metalldetektor im Eingangsbereich meldete sich Jeremy bei einer jungen uniformierten Polizistin im Empfangsbereich an. Kurze Zeit später wurde er auch schon von Commissioner Morris in Empfang genommen und in dessen Büro im zweiten Stockwerk geleitet.
Morris war ein etwas stämmiger Weißer, Mitte fünfzig und mit Halbglatze. Zu dem vollendeten Klischeebild, das Jeremy von dem typischen Südsee-Polizei-Captain hatte, fehlte nur noch das Hawaiihemd. Sowohl auf den Straßen als auch hier im Foyer hatte er viele Träger dieses inseltypischen Kleidungsstücks gesehen. Auch fiel ihm auf dem Weg auf, dass es hier im Vergleich zu L.A. sehr viele Asiaten und kaum Schwarze gab.
Obwohl Jeremy den Job schon sicher hatte, führte Morris dennoch ein kurzes Vorstellungsgespräch mit ihm, vorrangig um ihn kennenzulernen. Jeremy war noch nie ein großer Redner, daher hielt er sich mit seinen Ausführungen recht knapp: Er erzählte über seine Kindheit und Jugend in Wisconsin, warum er Polizist geworden war und über seinen Umzug nach Kalifornien. Hier bremste Morris Jeremys Tempo ab und fiel ihm ins Wort.
„In L.A.“, sagte Morris, „haben Sie zwei Menschen im Dienst erschossen, ist das richtig?“
Jeremy fehlten im ersten Moment die Worte. Er war nicht darauf vorbereitet, unterbrochen zu werden, und schon gar nicht bei diesem Thema.
„Ja“, antwortete er. „Ist das relevant?“
„Sagen Sie es mir“, antwortete Morris. „Was bedeutet das für Sie, dass Sie zwei Menschen getötet haben?“
Jeremy fühlte sich in seine Gespräche mit dem Polizeiseelsorger zurückversetzt.
„Es bedeutet“, antwortete er schließlich, nachdem er einige Sekunden überlegt hatte, „dass ich noch lebe. Entweder sie oder ich.“
„Sie haben also in Notwehr gehandelt?“
„Sie hatten Waffen und haben auf mich geschossen. Und ich habe zurückgeschossen.“
„Bereuen Sie es?“
„Sie erschossen zu haben?“, fragte Jeremy.
„Überhaupt. Die Situationen. Wenn Sie die Chance hätten, diese Tage jeweils erneut zu durchleben, mit dem Wissen, was passiert. So wie Bill Murray am Murmeltiertag. Würden Sie mit Absicht den Situationen aus dem Weg gehen?“
„Nein. Ich würde vielleicht früher schießen. Ich hatte jeweils Glück, dass die beiden nicht zielen konnten. Aber ich würde sie erneut erschießen.“
„Warum?“
„Ich verstehe die Frage nicht.“
„Warum würden Sie sie erschießen?“
Die Fragen an sich klangen sehr forsch. Der Inhalt passte aber ganz und gar nicht zur entspannten und lockeren Art, mit der Morris sie stellte.
„Weil es schwere Jungs waren“, antwortete Jeremy schließlich. „Gangmitglieder, Drogenhändler, Mörder. Sie waren skrupellos und kaltblütig. Wenn ich nicht da gewesen wäre, hätten sie es vielleicht mit weniger entschlossenen Kollegen zu tun gehabt. Die hätten vielleicht gezögert und wären erschossen worden. Und auch danach hätten sie noch Chancen gehabt, andere zu erschießen.“
„Sie befürworten also die Todesstrafe?“
„Ich weiß nicht. Zuhause in Wisconsin hatte ich sie noch befürwortet. Da hatten wir sie nicht. Dennoch war ich der Meinung, dass wir sie bräuchten, als Abschreckung und Sühne. In L.A. hingegen herrschte die Gewalt. Mord und Totschlag waren an der Tagesordnung. In Kalifornien gibt es doppelt so viele Tötungsdelikte je Einwohner wie in Wisconsin. Trotz Todesstrafe. Nein, ich glaube nicht, dass sie wirkt.“
Morris, der bisher nach vorne gebeugt saß und seine gefalteten Hände auf dem Tisch ruhen ließ, richtete sich auf und runzelte die Stirn.
„Diese Antwort überrascht mich jetzt“, sagte er. „Sie sind Polizist und haben zwei Tötungen vollzogen. Aber Sie sind ein Gegner der Todesstrafe.“
„Nein, kein Gegner“, sagte Jeremy. „Ich zweifle sie an, durchaus. Sagen wir mal, ich bin unentschlossen. Ich weiß, dass es sie in Hawaii nicht gibt.“
„Ja… nein, darauf will ich nicht hinaus“, antwortete Morris, seine Hände gestikulierten auf der Suche nach den passenden Worten. „Sagen wir es mal so. Einerseits haben Sie anscheinend keine Probleme damit, zwei Leute zu erschießen, andererseits zweifeln Sie die Wirkung der Todesstrafe an. Das passt für mich nicht ganz zusammen. Ich möchte es verstehen.“
Jeremy wusste zunächst auch nicht, wie er darauf antworten sollte. Da ergriff Morris wieder das Wort.
„Folgende Situation. Sie hätten die beiden nicht erschossen, sondern es irgendwie geschafft, sie zu entwaffnen und zu verhaften. Rein theoretisch. Hätten sie es dann verdient, zu sterben?“
„Hätte es was gebracht?“
„Nun, sie hätten nie wieder jemanden töten können.“
„Sie wären lebenslänglich im Knast gelandet. Da hätten sie höchstens andere schwere Jungs getötet. Und die kümmern mich nicht wirklich.“
Morris versuchte, die Antworten zu verarbeiten. Er beugte sich wieder vor, faltete die Hände und stützte sein Kinn darauf ab, während er grübelte.
„Okay“, sagte er schließlich. „Dann folgende Situation: Die beiden hätten nicht mitbekommen, dass Sie in der Nähe sind. Ich weiß aus den Berichten, dass Sie sich ordnungsgemäß als Polizist zu erkennen gegeben haben. Aber darum geht es hier nicht. Die schweren Jungs bedrohen andere, und Sie sind in unmittelbarer Nähe, aber für die nicht zu erkennen und haben eine Waffe. Schießen Sie?“
„Natürlich“, antwortete Jeremy ohne zu zögern.
„Warum?“
„Um das Leben Unschuldiger zu retten.“
„Und das kümmert Sie dann nicht, dass Sie dafür jemanden erschießen müssen?“
Jeremy wurde es langsam unbehaglich. Es kam ihm vor, als drehe man sich hier im Kreis, immer wieder um das alte leidige Thema herum. Mit dem Polizeipsychologen lief es damals genauso. Nur, dass der nicht ganz so forsch war. Dafür hatte der sich mehr Zeit gelassen, was Jeremy auch nicht so geheuer gewesen war. In seinen Augen waren die nach solchen Situationen obligatorischen Versetzungen in den Innendienst und die Pflichtsitzungen beim Seelsorger überflüssig.
„Nein“, antwortete er schließlich mit fester Stimme. „Es kümmert mich nicht. Natürlich wäre es mir am liebsten, niemand würde sterben. Aber wenn ich vor die Wahl gestellt werde, ob jetzt Mörder oder Unschuldige sterben sollen, und genau das wurde ich in jenen Situationen, dann erschieße ich den Mörder. Ohne zu zögern. Und am Abend gehe ich ins Bett und schlafe beruhigt, weil ich weiß, dass ich den Unschuldigen das Leben gerettet habe.“
Morris lehnte sich zurück und lächelte zufrieden.
„Mister Hagen, Sie wissen, warum Sie hier sind?“
„Ja. Weil man mir diesen Job angeboten hatte. Wenn ich mich richtig erinnere, dann kam das Angebot sogar von Ihnen persönlich.“
„Das ist richtig. Und wissen Sie, wie ich auf Sie gekommen bin? Ihr Captain hat Sie mir ausdrücklich empfohlen.“
Das war Jeremy in der Tat neu. Er neigte noch nie dazu, sich zu viele Gedanken zu machen. Zu viel zu hinterfragen führt nur zu Paranoia, hatte sein Vater immer gesagt. Je weniger man weiß, um so leichter lässt es sich leben. Daher hatte er sich auch nie gefragt, wie Morris vor ein paar Wochen auf ihn kam, als er ihm das Jobangebot per Mail zugeschickt hatte.
„Sie werden sich vielleicht wundern, warum ich Sie so intensiv zu den beiden Vorfällen befragt habe“, sagte Morris. „Nun, ich wollte von Ihnen persönlich wissen, wie Sie dazu stehen. Ihr Captain hat mir nämlich zusätzlich zur Empfehlung Ihre Akten zugeschickt, inklusive der Berichte des Psychologen. Danach sind Sie für die Tätigkeit, für die wir Leute suchen, hervorragend geeignet.
Und damit kommen wir direkt zu Ihrem neuen Aufgabengebiet. Ihnen ist bekannt, dass wir hier auf Hawaii die nationale MODAPS-Quarantänestation haben?“
„Ja.“
„Sehen Sie, viele Kranke, die wir auf der Insel aussetzen, sind nicht damit einverstanden. Es gibt immer wieder Fluchtversuche. Die Navy patrouilliert zwar mit mehreren Schiffen um die Insel herum, aber es gelingt immer wieder Einzelnen, unentdeckt die weite Strecke auf die Nachbarinseln Maui, Lana’i oder sogar hierher nach O’ahu zu schwimmen oder mit einem kleinen Boot zurückzulegen.
Diese armen Seelen können zwar nichts für ihre Krankheit, aber sie können sehr wohl etwas dafür, wenn sie die Quarantänebestimmungen vorsätzlich umgehen. Und auch, wenn sie es nicht wollen, so sind sie doch sehr gefährlich. Bedenken Sie, man weiß immer noch nicht, wie MODAPS genau übertragen wird, und auch von einer Heilung sind wir noch weit weg.
Ihre Hauptaufgabe wird es sein, diese Infizierten aufzuspüren und festzusetzen. Und nun kommen wir zum Haken an der Geschichte. Der Grund, warum dieser Job so unangenehm ist, und warum Sie mir für diese Aufgabe als geeignet erscheinen. So eine Verhaftung hat sich noch nie als einfach herausgestellt, wenn es darum geht, dabei weitere Ansteckungen zu vermeiden. Insgesamt neun Polizisten, die eigentlich nur ihren Dienst tun wollten, landeten deswegen bereits selbst auf Moloka’i. Dies hätte vermieden werden können. Tödliche Gewalt ist daher das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, weitere Ansteckungen zu vermeiden.“
Morris machte eine Pause, damit Jeremy Zeit hatte, dies sacken zu lassen. Und Jeremy dachte auch scharf darüber nach, was Morris gerade gesagt hatte. Oder genauer, was dieser von ihm erwartete, wenn er den Job antrat. Er atmete tief durch und lehnte sich zurück.
„Sie erwarten von mir, dass ich Unbewaffnete töte“, sagte Jeremy.
„Nein. Die Kranken sind nicht unbewaffnet. Sie tragen das Virus in sich. Und das Tragische daran ist, dass sie mit dieser Waffe nicht wirklich umgehen können. Sie stecken Leute an. Unschuldige. Sie wollen es nicht, aber sie tun es. Es gab auch schon einen Präzedenzfall dazu. Der oberste Gerichtshof in Hawaii hat entschieden, dass alleine die Flucht von Moloka’i den Straftatbestand des versuchten Totschlags in einem besonders schweren Fall erfüllt.
Andererseits sind diese armen Seelen eh dem Tode geweiht. Sie zu töten würde bedeuten, ihr Leben nur um einige Monate zu verkürzen. Zum Teil leidvolle Monate. Sie kennen sicher die Berichte über die Krankheit, die Medien sind ja voll davon. Dann wissen Sie sicher auch, wie die letzten Tage im Leben dieser Kranken aussehen. Wissen Sie, Hagen, wenn ich das wäre, ich würde mir vielleicht wünschen, vorher getötet zu werden.“
Jeremy antwortete nicht. Er überlegte. Beide saßen sich einige lange Sekunden starrend gegenüber.
„Nun?“, fragte Morris. „Hätten Sie ein Problem damit, geflüchtete Kranke zu töten?“
„Unter diesen Umständen: nein“, antwortete Jeremy nach einigen weiteren Augenblicken.
„Aber so sind sie leider, die Umstände. Die Zusage hatten Sie ja schon, aber ich wollte es von Ihnen selbst hören, dass ich den richtigen Mann habe. Nun denn.“
Morris stand auf und reichte Jeremy die Hand. Jeremy tat es ihm nach.
„Willkommen auf Hawaii, Sergeant Hagen.“
Sie setzten sich wieder.
„Sie hatten vorhin angerufen, dass Sie etwas später kommen, weil Sie gerade gelandet wären. Dann nehme ich an, Sie haben noch nicht in einem Hotel eingecheckt?“
„Nein, noch nicht.“
„Sehr gut, denn Sie fliegen heute noch weiter. Ihr Einsatzgebiet wird die Insel Oahu sein. Ich werde einen Flug für Sie buchen lassen und die Kollegen vor Ort informieren. Ihr neuer Partner heißt John Oshiro, er wird Sie vom Flughafen abholen und Ihnen alles Weitere erklären.“
Jeremy fluchte innerlich. Er hatte mit Vielem gerechnet und noch mehr befürchtet, aber er hatte gehofft, erst mal nicht mehr fliegen zu müssen.
„Es wird spät werden. Ich werde noch ein Hotelzimmer brauchen“, sagte er.
„Nicht nötig. Sie bekommen für die ersten Wochen eine Dienstwohnung gestellt. Oshiro ist instruiert und er hat auch den Wohnungsschlüssel, er bringt sie direkt dorthin. Dann können Sie sich in Ruhe eine eigene Wohnung suchen.“
Das Gespräch war damit beendet. Morris begleitete Jeremy wieder zurück ins Foyer. Unterwegs führte Morris noch etwas Small Talk; er versuchte Jeremy von den Vorzügen Hawaiis zu überzeugen. Er lobte das Wetter, die Wellen und vor allem das Essen. Jeremy antwortete wortkarg, aber höflich. Statt über das Essen zu reden wäre ihm lieber gewesen, es zu sich zu nehmen.
Im Foyer verabschiedeten sie sich mit einem Handschlag, Jeremy nahm seinen hier in Verwahrung gegebenen Koffer wieder an sich, verließ das Gebäude, stieg in ein auf ihn wartendes Taxi und ließ sich zurück zum Flughafen fahren.
Kapitel 3
Wie befürchtet musste Jeremy am Flughafen erneut die ganze Sicherheitsprozedur über sich ergehen lassen. Er fragte sich, welchen Sinn und Zweck ein eigenes Insel-Terminal hat, wenn man eh die gleichen Sicherheitsbestimmungen brauchte wie bei Flügen zum Festland oder gar ins Ausland. Offenbar hatte sich die Angst vor Krankheit und Terrorismus in der Gesellschaft schon so stark ausgebreitet, dass sich sogar die einzelnen Inseln dieses Staates als vor den anderen zu schützenden Einheiten sahen.
Es gab einen Moment, da lief es Jeremy kalt den Rücken herunter, als ihm einfiel, dass auch Sam nach Maui wollte. Doch diesmal blieb er ihm erspart. Offenbar hatte Sam bereits einen früheren Flug genommen.
Jeremys Flug verlief ereignislos. Er dauerte nur etwas mehr als eine halbe Stunde. Da reichte die Zeit nicht mal, um Snacks und Tomatensaft zu verteilen. Was Jeremy bedauerte, denn er hatte immer noch Hunger. Auf der anderen Seite kam ihm der Flug in der kleinen Turboprop-Maschine auch zu lang vor. Das Flugzeug war ihm zu eng, zu klapprig und zu laut. Und dann war auch noch die Landung auf dem Flughafen in Kahului sehr hart.
Er hasste es so sehr zu fliegen, dass er sich im Vergleich dazu auf das erneute Durchlaufen der Sicherheitsprozedur fast schon freute. Einschließlich der in L.A. war das schon seine vierte an diesem langen Tag, der durch den Wechsel der Zeitzonen 26 Stunden hatte. Es war mittlerweile fünf Uhr am Nachmittag, in L.A. müsste es schon dunkel gewesen sein. Und Jeremy hatte noch immer nichts gegessen.
In der Ankunftshalle angekommen schaute er sich erneut nach einer Essensgelegenheit um. Er war dabei so sehr auf dieses Ziel fixiert, dass ihm beinahe der wohl auffälligste Anblick entgangen wäre: Mitten in der Halle stand ein etwa fünfzigjähriger übergewichtiger Asiate, gekleidet in ein Hawaiihemd und um seinen Hals hingen lose ein Mundschutz und eine Schutzbrille. Über seiner linken Schulter war eine Art Halfter angebracht, an dem sein Funkgerät hing. Jeremy hätte ihn ja gerne ignoriert, hätte dieser nicht ein Pappschild mit der Aufschrift „HAGEN“ vor seinen Körper gehalten. Jeremy seufzte kurz und ging dann auf den Mann zu.
„Sergeant Oshiro?“, fragte er ihn.
„Hagen? Jeffrey Hagen?“
„Jeremy.“
„Jeremy!“, wiederholte Oshiro und schüttelte ihm überschwänglich die Hand. „Ich bin John. Willkommen auf Maui. Hast du Durst?“
„Um ehrlich zu sein, ich habe seit heute Morgen nichts mehr gegessen.“
„Was magst du? Steaks? Burger? Fisch?“
„Das ist mir ziemlich egal. Hauptsache ich habe endlich was im Magen.“
„Ich habe Lust auf Pizza. Magst du Pizza? Ich kenne da einen guten Italiener. Ist das dein ganzes Gepäck?“
„Ja“, antwortete Jeremy, wobei er nicht den Eindruck hatte, dass es John auf die Antwort ankam, denn noch während der Frage drehte sich dieser um, um zu gehen.
„Commissioner Morris erwähnte eine Dienstwohnung für mich…“
„Ja, die ist hier in Kahului. Nicht weit weg von hier. Willst du erst dahin und deine Sachen ablegen? Ich habe den Schlüssel dafür.“
„Nein, erst was essen“, antwortete Jeremy.
Sie verließen das Flughafengebäude. Hier draußen wehte ein starker Wind. John griff in seine Hosentasche, nahm einen Autoschlüssel heraus und öffnete damit einen alten Dodge, der direkt vor der Tür stand, mitten im Halteverbot.
„Darf man hier stehen?“, wollte Jeremy wissen.
„HPD, Spezialeinheit“, antwortete John, zog sein Hemd leicht hoch und zeigte auf seine Marke, die vom Hemd verdeckt an seinem Gürtel hing. „Wir dürfen hier alles.“
John öffnete den Kofferraum, damit Jeremy seinen Koffer hineinlegen konnte.
„Honolulu PD? Gibt es hier auf den Inseln nur ein Departement?“
„Nein, hier ist das MCPD zuständig. Maui County. Aber wir unterstehen direkt Commissioner Morris. Dadurch gehören wir zum HPD.“
Sie stiegen ins Auto und fuhren los.
„Wir sind auch im ganzen Staat mit Sonderbefugnissen ausgestattet. Aber ansonsten arbeiten wir mit dem MCPD zusammen, wir haben uns dort auch immer zu melden und dort kriegst du dann auch deine Marke und deine Dienstwaffe. Und ein kleiner Tipp: Stell dich gut mit Captain Iz. Der hasst unsere Einheit. Er ist ein Arschloch wie alle anderen auch vom MCPD, aber er hat leider das Sagen, und wenn wir ihm blöd kommen dann legt er uns schon mal Steine in den Weg.“
„Iz?“
„Was?“
„Du sagtest ‚Captain Iz‘?“
„Ach so. Captain Stephen Kamaka. Wir nennen ihn Iz, nach Israel Kamakawiwo’ole. Wegen des Namens. Kamaka. Das ist schon fast die Hälfte von Kamakawiwo’ole.“
Jeremy senkte seinen Kopf und hielt sich seine linke Hand an die Stirn. Wieder einer, der das Offensichtliche erklären musste. Das hatte er jetzt nicht verdient, dachte er sich. Wieder erwischte er sich dabei, dass er sich Sam zurückwünschte.
„Da sind wir. Marco’s. Der hat die beste Fleischbällchen-Pizza auf der ganzen Insel. Das ist wie in Italien.“
Jeremy war sich nicht sicher, ob es in Italien solche Pizzen gab. John fuhr auf einen Parkplatz vor dem zweistöckigen Gebäude, in dessen Erdgeschoss sich das Restaurant befand. Die beiden stiegen aus dem Auto aus und gingen hinein.
„Wie geht’s, Marco?“, rief John in den Raum hinein. Jeremy konnte nicht erkennen, dass er eine bestimmte Person dabei ansprach. „Eine Pizza wie immer und ein Bier bitte. Ist mein Tisch frei?“
Ein Bediensteter des Lokals kam auf die beiden zu. Aber John wartete nicht auf ihn, sondern ging zielstrebig auf seinen Stammtisch zu. Jeremy fand dieses Verhalten etwas befremdlich. Er hätte so etwas vermutlich nie selbst gemacht, aber nach kurzem Zögern folgte er John. Sie setzten sich an einen Tisch in der hinteren Ecke des Raums.
„Erzähl mal was über dich“, sagte John.
„Da gibt’s nicht viel zu erzählen.“
„Natürlich nicht. Komm schon. Ich bin Bulle, genau wie du. Und ich merke, wenn mir was verschwiegen wird. Und du, mein Freund, kommst mir vor, als würdest du eine Menge verschweigen. Geschieden?“
Jeremy nickte.
„Sind viele hier. Auch weibliche Kollegen. Natürlich gibt’s auch viele, die Ehe und Arbeit unter einen Hut kriegen. Aber die Scheidungsrate ist dennoch hoch. Ich vermute mal, in L.A. war’s nicht anders.“
„Ja.“
„Du redest nicht viel, was?“
„Entschuldigung. Es war ein langer Tag und ich bin müde und hungrig.“
„Dafür sind wir ja erst mal hier. Iss was und trink was. Und danach bring ich dich in deine Wohnung. Ach ja, hier ist der Schlüssel“, sagte John und legte den Schlüssel auf den Tisch. Jeremy nahm ihn und steckte ihn ein.
„Willst du auch eine Fleischbällchen-Pizza?“, fragte John. „Die kann ich sehr empfehlen.“
„Danke, ich verzichte. Kann ich mal eine Karte haben?“
„Marco! Bring unserem Gast mal eine Karte. Und ein Bier, er ist bestimmt durstig.“
„Nein danke, kein Bier für mich!“, rief Jeremy dem Kellner hinterher, dem John gerade Beine machte. „Ein Wasser reicht.“
John schaute Jeremy verwundert an.
„Wie, kein Bier? Was bist Du denn für ein Bulle? Oder ist das was Kalifornisches, so wie der Vegetarismus. Bist du Vegetarier?“
Jeremy dachte zurück an seine Zeit in L.A. und an seinen Partner Hakeem. Ein junger Afroamerikaner, der sich seinen Weg aus der Gosse erkämpfen musste. Als Teenager noch ein Bandenmitglied, verwickelt in Raubüberfälle und Drogengeschäfte, fand dieser während einer Jugendstrafe zum Islam, änderte seinen Namen und sein Leben und wechselte die Seiten. Er war zehn Jahre jünger als Jeremy und zeigte ihm gegenüber sehr viel Respekt. Generell lebte Hakeem ein Leben in Demut und Respekt, und so benahm er sich auch. Er sprach wenig, trank nichts und wenn sie mal im Restaurant waren, dann wartete er, bis ihm der Kellner einen Platz zuwies. Jeremy vermisste ihn. Ein guter Junge. Dennoch musste er vor drei Jahren aus dem Dienst ausscheiden, nachdem eine Gesetzesänderung beschlossen wurde, nach der Muslime keine öffentlichen Ämter bekleiden durften.
„Nein, ich bin kein Vegetarier“, sagte Jeremy. „Ich habe früher auch das ein oder andere Bier getrunken. Aber mein Vater, er war auch Polizist, trank auch sehr viel und starb an einer Leberzirrhose. Darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Seit seinem Tod habe ich keinen Tropfen mehr getrunken.“
„Ah, die Leber. Das Schicksal eines Bullen. Alkohol- oder Bleivergiftung. Schnaps oder Kugeln. An einem von beiden sterben wir immer. Also wählst du die Kugeln?“
Jeremy antwortete ihm nicht. Nicht, weil ihm die Frage makaber vorkam, sondern weil John in der kurzen Zeit, die sie sich jetzt kannten, sehr viele Fragen stellte, auf die er eigentlich gar keine Antworten haben wollte. Stattdessen schaute Jeremy in die Karte und bestellte beim bemitleidenswerten Kellner, der gerade die Getränke brachte, einen Cheeseburger mit Speck und Barbecue-Soße.
„Was willst du über mich wissen?“, fragte John, nachdem er einen kräftigen Schluck von seinem Bier genommen hatte.
Nichts, aber du wirst es mir sowieso erzählen, dachte Jeremy.
„Was hat das mit dem seltsamen Outfit an sich?“, fragte er schließlich, auf die um Johns Hals hängende Brille und Mundschutz blickend.
„Das hier?“, fragte John, während er besagte Gegenstände anfasste. „Das ist psychologische Kriegsführung. Wenn wir einen Infizierten jagen, dann sind wir verpflichtet, Mund- und Augenschutz zu tragen. Wegen der Infektionsgefahr, falls wir mit seinem Blut in Kontakt kommen. Daran erkennt man uns Jäger der Spezialeinheit.“
„Und das muss man ständig um den Hals tragen?“
„Nein“, antwortete John ein wenig aufgeheitert. „Nein, ich mache das, damit man mich jederzeit als Jäger erkennt. Ich beobachte permanent die Leute um mich herum und achte darauf, ob sie nervös werden, wenn sie mich als Jäger erkennen. Das könnten dann Infizierte sein.“
„Nennen wir uns so? Jäger?“
„Ich nenne uns so. Wir sind Polizisten, haben keine spezielle Bezeichnung. Abgesehen davon, dass wir eine Spezialeinheit sind. Aber es klingt besser. Finde ich. Andere sehen das anders. Die Kollegen Kane und Jones zum Beispiel, beide auf O’ahu, beide Filmfreaks. Kane nennt uns Blade Runner, die Aufträge sind Skin Jobs, und die Infizierten sind Replikanten, die in Ruhestand versetzt werden. Für Jones sind wir Sandmänner, die die Läufer jagen, die nicht ins Karussell wollen. Letzteres ist aus Flucht ins 23. Jahrhundert.“
„Ich weiß, ich kenne den Film“, antwortete Jeremy. „Und daran erkennen wir die? Dass sie nervös werden, wenn sie uns sehen?“
„Nein, das mache ich. Ich mache mir einen Spaß daraus. Aber ich habe auch eine besondere Menschenkenntnis, weißt du? Eigentlich haben wir technische Mittel, um die zu jagen. Die Infizierten sind über Chips, Tätowierungen und auch über ihre biometrischen Daten erfasst. Anfangs dachte man, es reiche, die Leute auf Moloka’i auszusetzen. Man rechnete nicht damit, dass der Freiheitsdrang so groß ist, dass die die vielen Meilen offene See auf sich nehmen könnten, um zu fliehen. Mit den ersten Flüchtlingen rechnete man gar nicht. Erst, als sie da waren, wurde man sich bewusst, dass man etwas machen muss. Man hat es mit RFID-Chips versucht, die sie an unterschiedlichsten Stellen implantiert bekommen haben. Doch manche haben sie gefunden und sie herausgeschnitten. Dann hat man ihnen Zeichen tätowiert. Teilweise auch ins Gesicht, damit sie nicht überdeckt werden konnten. Doch auch da waren sie kreativ und haben Tribals daraus gemacht. Am effektivsten ist aber immer noch die Erkennung über die biometrischen Gesichtsmerkmale.“
John tippte mit dem Finger auf das Funkgerät auf seiner Schulter.
„Hier ist auch eine Bodycam drin, die live ins Revier nach Honolulu sendet. Bitte lächeln, du bist auf Sendung. Die und die Überwachungskameras, die überall auf den Inseln aufgestellt sind, bieten eine sehr gute Abdeckung. Selbst, wenn sie sich die Chips und Tätowierungen entfernen, sie müssen schon jeder Kamera entgehen, um nicht entdeckt zu werden. Das ist unmöglich.“
Das Essen wurde serviert. Ohne ein weiters Wort zu sagen rupfte John sich eine Ecke aus der vorgeschnittenen Pizza und biss direkt hinein. Guten Appetit, dachte sich Jeremy, ohne es allerdings auszusprechen. Vielleicht war es nicht ganz höflich von John, aber Jeremy wog die Unhöflichkeit Johns mit dessen neu gewonnener Schweigsamkeit ab und befand, dass ihm letzteres lieber war.
Jeremy biss in seinen Burger. Unter normalen Umständen hätte er gesagt, dass er sicherlich schon bessere gegessen hätte, aber in diesem Augenblick, nach so vielen Stunden, ohne etwas zu essen, schmeckte dieser Burger so gut wie kein anderer zuvor. Seit Sonnenaufgang in L.A. hatte er nichts mehr gegessen, und jetzt war es zwei Zeitzonen später wieder dunkel. Ein leckeres Abendessen und ein schweigsamer, weil essender John. So könnte es für heute bleiben, dachte sich Jeremy.
„Weißt du“, sagte John plötzlich während er noch kaute, dabei fielen ihm einige Krümel aus dem Mund, „ich war nicht immer Bulle. Ich war früher Lehrer.“
Der Anblick widerte Jeremy an. Immer mit geschlossenem Mund kauen, nicht schmatzen, und erst reden, wenn der Mund leer ist, brachte er sich die mahnenden Worte seiner Mutter in Erinnerung. In aller Ruhe schluckte er runter und trank ein Schluck Wasser.
„Ach ja?“, sagte er schließlich.
„Ja“, antwortete John, allerdings ohne abzuwarten, bis sein Mund leer war. „Ich war früher Lehrer. An der Roosevelt High in Honolulu. Für Englisch und Geschichte.“
„Und wie kamst du zur Polizei?“
„Pacific Airlines 235. Ich saß drin. Mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern.“
Jeremy lief es bei den Worten kalt den Rücken runter. Plötzlich hatte er keinen Appetit mehr. Er legte seinen Burger auf den Teller.
Pacific Airlines Flug 235 war das Anschlagsziel eines islamistischen Terroristen gewesen. Das Flugzeug sollte, von Honolulu aus kommend, im Anflug auf den Flughafen von Los Angeles durch eine Bombenexplosion zum Absturz über der Stadt gebracht werden. Die Bombe war im Schuh des Terroristen versteckt. Sie hätte nicht gereicht, um das Flugzeug zu zerstören, war aber stark genug, um ein Loch in den Rumpf zu reißen, das groß genug war, um die Integrität des Flugzeugs entscheidend zu schwächen.
Dieses Ziel hatte der Terrorist erreicht. Das Flugzeug trat in einen kaum zu kontrollierenden Sinkflug und kam mehrere Meilen vor der Landebahn runter. Womit der Terrorist aber nicht gerechnet hatte war die für L.A. ungewöhnliche Windrichtung. Der Anflug fand nicht wie üblich von Osten über die Stadt, sondern von Westen über das Meer statt. Dem Piloten gelang es tatsächlich, das Flugzeug zu wassern. Aber durch das Loch im Rumpf wurde es während der Wasserung in Stücke gerissen. Von den 238 Menschen an Bord konnten 18 gerettet werden, der Rest starb entweder während des Crashs oder ertrank.
Der Terrorist war da schon tot, er starb während der Explosion.
„Der Scheißkerl saß drei Reihen hinter uns“, erzählte John, immer noch mit vollem Mund. „Er war mir schon beim Check-In aufgefallen. Wie gesagt, ich habe da eine gute Menschenkenntnis. Hätte ich nur was gesagt. Aber er ist ja wie wir anderen auch durch die Sicherheitskontrolle. Auf die hatte ich damals noch vertraut. Woher sollte ich wissen, dass jemand eine Bombe an Bord schmuggeln kann? Und dann, während des Anflugs, schrie er plötzlich ‚Allahu akbar‘, es gab einen lauten Knall und dann blies der Wind durch die Kabine. Das kann man eigentlich nicht beschreiben. Sowas muss man erlebt haben.“
John guckte Jeremy an. Er bemerkte, dass Jeremy aufhörte zu essen. Und wie es schien blitzte seine Menschenkenntnis kurz durch, denn er legte seine Hand auf Jeremys.
„Nicht, dass ich dir das wünsche. Niemand sollte so etwas erleben. Ich meine nur, man kann es mit nichts vergleichen.“
Und dann biss er wieder in seine Pizza.





























