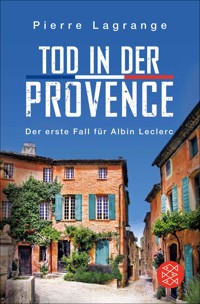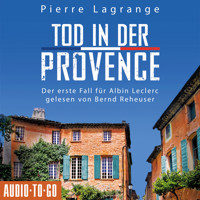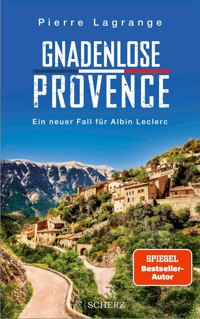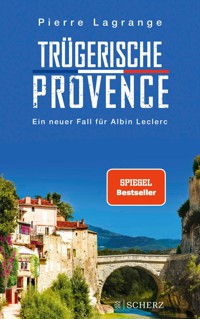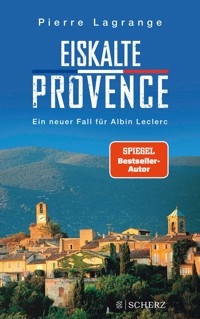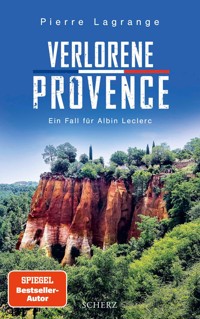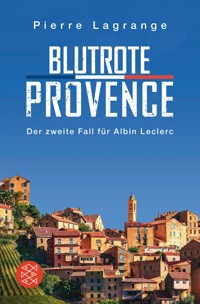
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Commissaire Leclerc
- Sprache: Deutsch
Sommer in der Provence. Ein dreifacher Mord. Commissaire Albin Leclerc ermittelt in seinem zweiten Fall. Drei Leichen liegen an einem Waldparkplatz bei Caromb. Die Feriengäste wurden mit einer seltenen Waffe hingerichtet. Die Polizei steht vor einem rätselhaften Fall, in den sich zu allem Übel Ex-Commissaire Albin Leclerc einmischt. War es das Werk eines Auftragsmörders? Geht ein Killer in der Provence um, der Touristen tötet? Leclerc erkennt Parallelen zu einem früheren Fall - und sticht in Begleitung von Mops Tyson in ein Wespennest...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Pierre Lagrange
Blutrote Provence
Roman
Über dieses Buch
Sommer in der Provence. Ein dreifacher Mord. Commissaire Albin Leclerc ermittelt in einem neuen Fall.Drei Leichen liegen an einem Waldsee bei Caromb. Die Feriengäste wurden mit einer seltenen Waffe hingerichtet. Die Polizei steht vor einem rätselhaften Fall, in den sich zu allem Übel Ex-Commissaire Albin Leclerc einmischt. War es das Werk eines Auftragsmörders? Geht ein Killer in der Provence um, der Touristen tötet? Leclerc erkennt Parallelen zu einem früheren Fall - und sticht in ein Wespennest...»So wird der Sommer spannend. Eine fesselnde Atmosphäre, ungewöhnliche Mordfälle und ein skurriler Fahnder mit seinem Mops Tyson bieten beste Unterhaltung.« NZZ
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Pierre Lagrange ist das Pseudonym eines bekannten deutschen Autors, der bereits zahlreiche Krimis und Thriller veröffentlicht hat. In der Gegend von Avignon führte seine Mutter ein kleines Hotel auf einem alten Landgut, das berühmt für seine provenzalische Küche war. Die Bände der Erfolgsserie um den liebenswerten Commissaire Albin Leclerc und seinen Mops Tyson sind im FISCHER Verlag erschienen.
Inhalt
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Leseprobe 3. Fall
1
2
3
Prolog
Sechzehn leere Metallhülsen standen auf dem wurmstichigen Holztisch. Akkurat aufgereiht wie kleine Soldaten, die darauf warteten, in den Krieg geschickt zu werden. Auf der Tischplatte befanden sich außerdem einige Verpackungen mit dunklen und hellen Sorten Pulver für die Treibladungen. Zudem eine Schachtel mit Zündplättchen. Parallel zu den messingfarben glänzenden Hülsen waren sechzehn spitze Geschosse aufgereiht. Sechzehn weitere kleine Soldaten, die ihrem Ziel entgegenfliegen und verheerenden Schaden anrichten würden. Zuvor mussten sie fest in die Hülsen gedrückt werden, nachdem die spezielle Pulvermischung hineingefüllt worden war. Am anderen Ende des Messingröhrchens brachte man die Zündplättchen an, auf die der Schlagbolzen traf und die dafür sorgten, dass das Pulver explodierte, wodurch die Geschosse auf eine Geschwindigkeit von rund sechshundert Metern in der Sekunde beschleunigt wurden. Nötig waren für die Herstellung einige spezielle Geräte auf der anderen Seite des Tisches, zum Beispiel die dort angeschraubte Wiederladepresse. Sie würde anschließend samt der anderen Werkzeuge und dem Rest Material spurlos auf dem Schrott verschwinden.
Es waren exakt sechzehn Geschosse und Hülsen, weil jeweils acht Patronen in ein Magazin passten, und mehr als zwei Magazine würde der Mann nicht brauchen, der jetzt summend zum Radio ging und es lauter stellte. Es war ein altes Gerät – einer jener Kästen, die vor Jahrzehnten in den Wohnzimmern standen und dort dekorativ auszusehen hatten. Es verfügte über große Tasten und Intarsienarbeiten aus Holz. Der Klang ließ nach all der Zeit nichts zu wünschen übrig. Warm und satt tönte die Stimme von Charles Trénet durch den Raum, der vom Meer sang, »La Mer«. Davon, wie es in der Sonne glitzerte und wie es bei Regen aussah. Ein Lied, das so rein war und beschwingt wie die Urlaubserinnerung an heiße Sommertage an der Küste.
Der Mann goss sich ein Glas Rotwein ein, nahm es hoch, schwenkte es und betrachtete die leicht ölige Flüssigkeit im Licht der Glühbirne. Das Lied war, dachte der Mann, so rein wie die Farbe des Blutes. Schließlich leerte er das Glas in einem Zug und machte sich an die Arbeit.
1
Die Krähe schreckte auf, als es mehrmals krachte. Mit kräftigen Flügelschlägen schraubte sie sich vom Haupt der Madonna hinauf in den tiefblauen Himmel über der Provence. Es knallte wieder. Die Krähe krächzte, flatterte höher und höher in die klare Morgenluft. Der Mont Ventoux mit seinem grauen Gipfel war zu sehen. Einige entfernte Ortschaften und, mehrere hundert Meter tiefer, der hellgrüne See inmitten des viel dunkleren Grüns der Wälder. Seine Oberfläche glitzerte wie eine Glasscherbe in der Sonne.
Die Krähe drehte einige Runden. Sie spähte panisch nach links und rechts, nach oben und nach unten. Sie kannte dieses dumpfe, satte Geräusch und wusste, dass damit Gefahr verbunden sein konnte. Manchmal, wenn es im Frühjahr oder Herbst derart knallte, fielen einige ihrer Artgenossen einfach vom Baum, aus dem Himmel oder blieben auf den Feldern liegen.
Nach einigen Minuten nahm die Krähe an, dass wohl alles wieder sicher war. Sie reduzierte Geschwindigkeit und Höhe. Die dunkelgrüne Fläche unter ihr lichtete sich. Die Wipfel der Pinien rückten näher. Zwischen den Bäumen kamen graue und ockerfarbene Felsen, steinige Wege und eine nicht asphaltierte Straße zum Vorschein. Die Krähe segelte im Wind, stellte dann ihre Flügel steil und flatterte gegen den Auftrieb an, um abzubremsen. Sie flog über das von der Sonne verblasste Dach der kleinen Bergkapelle. Es war ein einfacher Zweckbau – weder besonders groß noch besonders klein. Der Stirnseite mit dem Eingang war eine Art Überdachung vorgelagert, damit Wanderer bei Unwettern Schutz finden konnten. Die Wände bestanden aus schlichten Bruchsteinen, die grob verputzt worden waren. An einer Seite befand sich eine Sonnenuhr.
Die Krähe spreizte die Krallen. Sie glitt über die gebrannten Dachziegel hinweg, vorbei an dem kleinen Glockenturm der Kapelle und landete schließlich zielsicher dort, wo sie eben schon gehockt hatte: auf dem Haupt der fast lebensgroßen Marienstatue. Die Figur stand zwischen einigen spitz in die Höhe ragenden Zypressen vor der Kapelle auf einem gemauerten Sockel, der von einem gusseisernen Gitter umgeben war, damit niemand auf die Idee kam, die Mutter Gottes zu berühren.
Eine Weile ließ sich die Krähe die heiße Sonne auf die schwarzen Federn scheinen und wartete ab, ob sich nicht doch noch etwas regen würde. Aber alles blieb ruhig. Einige Zikaden zirpten. Eine Eidechse flitzte über die bröckeligen Felsen und begutachtete den roten Bach, der die Steine nass glänzen ließ.
Die Krähe blinzelte und ruckte mit dem Kopf herum. In ihren schwarzen Augen spiegelten sich ein recht großes Fahrzeug sowie ein eher kleines mit nur zwei Rädern. Das große hielt im Schatten nahe der Kapelle. Das kleine lag auf der unbefestigten Straße, die an dem Gebäude entlangführte. Das Tier zuckte und blinzelte erneut. Es nahm einen sehr vertrauten Duft wahr. Wieder ruckte der Kopf herum. Hoch und runter. Die Krallen machten tickernde Geräusche auf dem Stein. Die Krähe spreizte die Flügel, flatterte aufgeregt und legte sie wieder an. Sie reckte den Hals, gab ein Krächzen von sich und schien sich nicht entscheiden zu können, ob sie ihren sicheren Standort verlassen sollte. Doch die Gier war stärker, und das Risiko schien überschaubar zu sein.
Mit wenigen Flügelschlägen glitt die Krähe hinab und landete auf dem steinigen Boden im Schatten einer der Zypressen. Die Eidechse machte sich sofort aus dem Staub, aber an ihr schien der Vogel ohnehin nicht interessiert zu sein. Er betrachtete stattdessen den roten Bach, der träge und in zahlreichen Mäandern vor sich hinfloss. Es war nicht der einzige. Es war vielmehr ein wirres Geflecht aus Bächen, manche breiter, andere schmaler, das die hellen Steine rot einfärbte. Das war Blut. Die Krähe hatte keinen Zweifel. Ihre Witterung hatte sie noch nie getäuscht. Außerdem lag ein weiterer Geruch in der Luft: der Geruch nach Tod.
Das Tier drehte sich um die eigene Achse. Es balancierte über die Felsen, machte einige Hüpfbewegungen und fand sich schließlich auf der Brust eines Mannes wieder. Er war weder jung noch alt, die Haare leicht ergraut, und er lag auf dem Rücken. Seine muskulösen Beine wirkten wie verknotet. Die Arme waren zu den Seiten ausgestreckt. Er trug etwas Buntes, Hartes auf dem Kopf und ebenso bunte, enganliegende Kleidung. In der Brust befanden sich ein Loch und ein dunkelroter Fleck. Das galt auch für die Stirn des Mannes. Der Hinterkopf war nur noch rudimentär vorhanden und lag in einer blutigen, matschigen Masse, die an Substanzen erinnerte, die die Krähe manchmal am Straßenrand fand.
Ihr Kopf ruckte nach rechts. Vor dem großen Fahrzeug lagen zwei weitere Menschen am Boden, ein Mann und eine Frau, auf dem Bauch. Ihre Kleidung hatte sich mit Blut vollgesogen und klebte auf dem Rücken zwischen den Schulterblättern fest. Beide Köpfe sahen aus, als seien sie explodiert.
Die Krähe blickte daran vorbei. In einiger Entfernung nahm sie in der flirrenden Hitze über der Straße einen dunklen Punkt wahr, der sich entweder entfernte oder näher kam. So genau war das nicht zu erkennen. Das Funkeln und Blitzen der Brille des Mannes, auf dessen Brust sie hockte, war außerdem viel interessanter und lenkte sie ab. Sie pickte einmal in die Brust, dann ein weiteres Mal. Als sie sich sicher war, dass nichts geschehen würde, hopste sie voran und kletterte auf das Kinn des Mannes. Der Mund stand offen. Ihre Krallen griffen um die Unterlippe und die untere Zahnreihe. Mit dem Schnabel tickte sie gegen die Brille, bis sie dem Mann von der Nase rutschte. Seine Augen starrten in den Himmel. Eines war blutrot unterlaufen. Es sah wirklich verlockend appetitlich aus, fand die Krähe.
Und machte sich ans Werk.
2
Es gab ein leises Knacken, dem ein schlürfendes Geräusch folgte. Schließlich knackte es erneut, schlabberte und matschte. Für einen Moment stoppte Tyson mit dem Fressen und Trinken und starrte abwechselnd Albin und Matteo an, die zurückstarrten. Dann machte er sich wieder über den Futternapf und die Schale mit dem Wasser her.
Albin saß an einem Metalltisch im Schatten der Platane vor dem Café du Midi, dessen Fassade verwittert und dessen Fensterscheiben stumpf waren. Die von der Sonne verblichene Markise mochte früher einmal rot gewesen sein. Darunter führten ausgetretene Stufen hinauf zu einer Bar Tabac, in der es auch kleine Snacks und Kaffee gab. Einer stand gerade vor Albin, schwarz und stark in einer dickwandigen Tasse. Der Aschenbecher, in dem Albins Gitanes glimmte, war knallgelb und mit einer Werbung von Ricard bedruckt. An der gegenüberliegenden Straßenseite hielten zwei Lieferwagen. Ein Postauto und der Transporter eines Paketdienstes rauschten heran und stoppten neben der Boulebahn, die sich an das Café anschloss. Ein geschäftiger Morgen in einem kleinen Ort.
Matteo lehnte mit einem Wischtuch in der einen Hand an Albins Tisch und fuhr sich mit der anderen über die Halbglatze. Sein Hemd, das von einem gewaltigen Bauch ausgefüllt wurde, war fleckig, die Hose ebenfalls, und Matteos Doppelkinn war von grauen Bartstoppeln übersät. Er war nicht sehr groß. Aber neben Albin wirkten die meisten Menschen eher klein. Albin war ein normannischer Schrank mit zerknautschem Gesicht und fast weißem Haar.
Tyson fraß und trank weiter vor sich hin.
Matteo sagte: »Dein Hund hat die gleichen Tischmanieren wie du.«
»Immerhin hat er welche.«
»Wie kann man nur einen Mops besitzen?« Matteo betrachtete das Tier. »Ich kann mir nicht helfen, aber ich muss ständig an einen vernünftigen Hund denken, der zu heiß gewaschen wurde und dem jemand ins Gesicht getreten hat.«
Albin beugte sich schweigend nach vorn und nahm die Zigarette auf, um daran zu ziehen. Nun, er hatte sich das nicht ausgesucht mit dem Mops. Die Kollegen von der Polizei hatten ihm Tyson zum Ruhestand geschenkt. Damit Albin etwas zu tun hatte und ihnen nicht auf den Geist ging. Da hatten sie sich ziemlich vertan. Anfangs hatte Albin keinen Schimmer gehabt, was er mit dem Hund anfangen sollte. Inzwischen vertrat er die Auffassung eines deutschen Komikers, der gesagt hatte, dass ein Leben ohne Mops möglich, aber nicht erstrebenswert sei. Oder so ähnlich. Manchmal, auf langen Spaziergängen, unterhielt er sich sogar mit Tyson. Also: Nicht wirklich, nur in Gedanken. Immerhin besser, als vor die Wand zu starren und mit der Tapete zu reden.
Albin entließ einen Schwall Rauch in die Luft. Er legte die Gitanes zurück in den Aschenbecher, nahm die Kaffeetasse und trank einen Schluck. Der verdammt beste Kaffee, der südlich des Ventoux zu bekommen war. Nördlich davon war Albin ohnehin nicht sehr oft.
Er sagte: »Ohne das Spülmittel würde dein Kaffee nach nichts schmecken.«
Matteo schnalzte mit der Zunge. Er blickte auf, als die Kirchturmuhr schlug. Zehn Uhr an einem ganz normalen Morgen in der Provence. »Na ja«, entgegnete er und verscheuchte mit dem Wischtuch eine Fliege, »die Geschmäcker sind eben verschieden.«
»Stimmt«, erwiderte Albin und setzte die Tasse ab. »Hat dein Vater sicher ebenfalls gesagt, als er dich zum ersten Mal sah. Er hat dich doch mal gesehen?«
»Keine Witze über meinen Vater.«
»Keine Witze über meinen Hund.«
»Tyson ist ein Witz. Allein der Name.«
»Macht dein Vater immer noch Zwangsarbeit auf Guayana, oder wohnt er inzwischen wieder unter dieser Brücke?«
Matteo lachte und runzelte die Stirn. Er warf Albin einen Blick zu. Albin warf ihm ebenfalls einen zu und fragte sich, wie lange sie sich eigentlich schon kannten, Matteo und er. Jedenfalls konnte er sich nicht mehr an die Zeit erinnern, in der er Matteo nicht gekannt hatte.
Albin griff erneut nach der Zigarette und lehnte sich im Stuhl zurück, der unter seinem Gewicht ächzte. Er betrachtete die Straße und die Autos und vermisste darunter eine ganz bestimmte Art von Fahrzeug. »Sie sind spät heute Morgen. Irgendwas gehört?«
»Keine Ahnung«, erwiderte Matteo und stopfte sich das Wischtuch in die Gesäßtasche der ausgeleierten Hose.
»Sie sind sonst immer pünktlich. Kurz vor zehn ist ihre Zeit.«
»Meine Güte, sie werden schon noch kommen. Sie kommen immer.«
Albin stieß Rauch durch die Nase aus. Jeden Morgen kamen die Kollegen von der Polizei hier vorbei, die gerade auf Streife unterwegs waren. Sie legten am Café du Midi eine kleine Frühstückspause ein, tranken einen Kaffee und boten Albin damit eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich zu erkundigen, ob und was gerade so lief. Er war jahrzehntelang Ermittler bei der Kriminalpolizei in Carpentras gewesen und konnte sich einfach nicht damit abfinden, auf einmal zum alten Eisen zu gehören und von jedem Informationsfluss abgeschnitten zu sein. In den Ruhestand geschickt zu werden hatte sich für Albin angefühlt, als ob man ihm von Gesetzes wegen die Halsschlagader zudrückte, um die Blutzufuhr zum Gehirn zu unterbinden. Menschen verfügten einfach nicht über einen An- oder Ausschalter. Vor allem nicht Menschen wie Albin, die Zeit ihres Lebens hundertfünfzig Prozent gegeben hatten und mit fünfundsechzig Jahren immer noch mindestens die Hälfte der jungen Kollegen in die Tasche stecken konnten.
Als er erneut an der Gitanes zog, kamen sie schließlich doch. Ein Streifenwagen fuhr vor und hielt mit knirschenden Reifen in einer Parkbucht am Café.
»Na also«, meinte Matteo.
Er lehnte sich vor, blinzelte und versuchte zu erkennen, welche Besatzung heute unterwegs war. Schließlich gab er ein »Ah« von sich und setzte sich in Bewegung, um das herbeizuschaffen, was die betreffenden Kollegen für gewöhnlich bestellten. Soweit Albin wusste, wäre in jedem Fall ein schwarzer Kaffee ohne Milch und Zucker dabei. Denn so trank Caterine Castel, die gerade auf der Fahrerseite ausstieg, ihn am liebsten. Was Dodo meistens trank, der bereits auf dem Bürgersteig stand und die Beifahrertür zuwarf, hatte sich Albin nicht gemerkt – was auch für Dodos richtigen Namen galt. Jeder kannte ihn nur unter diesem Spitznamen.
Dodo war recht lang und schmal. Castel eher klein und drahtig. Ihre Haut war tiefbraun. Sie trug eine Pilotensonnenbrille mit grünen Gläsern und die schwarzen Haare sehr kurz geschnitten. Sie erkannte Albin und ging gemächlich auf ihn zu, ohne ihren Gesichtsausdruck auch nur einen Deut zu verändern. Diesen Ausdruck, der einem sagte: Leg dich bloß nicht mit mir an! Wobei sie für Albin gelegentlich eine Ausnahme machte. Castel war früher ebenfalls bei der Kripo gewesen, allerdings in Marseille, und aus irgendwelchen Gründen, die Albin noch herausfinden würde, mit Uniform und Streifenwagen in der Provence gelandet.
Castel tippte sich mit den Fingern grüßend gegen die Stirn, wobei die Innenseite ihres Handgelenks einen tätowierten arabischen Schriftzug offenbarte.
»Leclerc«, sagte sie. »Guten Morgen. Die Spinne wartet schon in ihrem Netz, hm?«
Albin lachte leise. Castel zog ihren Einsatzgürtel hoch, stemmte die Hände in die Hüften und verzog die Lippen zu einem amüsierten Lächeln. Dann ging sie in die Hocke, um Tyson zu begrüßen, der bereits mit fiependen Geräuschen und Schwanzwedeln auf sich aufmerksam machte.
»So ein guter Hund«, sagte Castel und kraulte Tyson zwischen den Ohren. »So ein feiner Hund mit so einem blöden Namen.«
»Ich hab den Namen nicht ausgesucht«, sagte Albin.
»Ich weiß«, erwiderte Castel.
»Ihr seid spät dran«, sagte Albin.
»Sind wir das?«
Tyson gab brummende und knurrende Töne von sich, während er sich auf den Rücken rollte, um sich von Castels kurzgeschnittenen Fingernägeln den Bauch bearbeiten zu lassen.
»Seid ihr aufgehalten worden?«, fragte Albin. »Oder ist irgendwo was los?«
Castel schwieg, lächelte und hatte nur Augen für den Hund.
»Also ist etwas passiert«, resümierte Albin, der Castels Schweigen als Zustimmung wertete. »Wo und was?«
»Darüber darf ich nicht reden, und das wissen Sie ganz genau, Leclerc.«
»Also ist es schlimm. Wie schlimm?«
Castel linste über den Rand der Sonnenbrille nach oben zu Albin, der den Blick interpretierte, nickte und fragte: »Wie viele Tote?«
Castel seufzte und stand wieder auf. Tyson wurschtelte sich zurück auf die Beine und schüttelte kleine Kieselsteinchen ab, die in seinem Fell hängen geblieben waren.
Castel sagte: »Sie geben nicht auf, oder?«
»Niemals.«
»Warum machen Sie sich nicht einen schönen Tag am Meer oder unternehmen eine Spazierfahrt?«
»Spazierfahrt?«, fragte Albin.
»Fahren Sie doch mal auf den Ventoux, was weiß ich, Leclerc. Caromb ist auch sehr schön.«
Albin verstand. Ein paar Tote in der Gegend von Caromb, das war los. Wo genau, würde er vor Ort sehen – Caromb war nicht sonderlich groß. Dort gab es einen kleinen Stausee, den Lac du Paty, ein beliebtes Ausflugsziel.
»Danke, Castel«, sagte Albin.
»Wofür?«, fragte sie unschuldig zurück.
»Dafür. Sie haben sich ein Eis verdient.«
Castel lachte hell auf. »Inzwischen dürften das schon zehn Eis sein, oder?«
»Na, na«, sagte Albin, drückte die Zigarette aus und fischte im Aufstehen den Autoschlüssel aus der Hosentasche, »nun werden Sie mal nicht unverschämt.«
3
Der Lac du Paty lag oberhalb von Caromb. Die Gemeinde hatte vor ein paar hundert Jahren beschlossen, den Fluss Brégoux aufzustauen, woraufhin ein Mathematikprofessor aus Avignon eine Mauer konstruiert hatte, die zwischen 1762 und 1764 erbaut wurde. Das Wasserreservoir sorgte dafür, dass unten im Ort Wein, Oliven, Obst und Feigen angebaut werden konnten. Insbesondere auf die Feigen bildete man sich etwas ein, vor allem auf die Sorte Noire de Caromb, um deren Produktion sich die der Bruderschaft Confrérie de la Figue Longue Noire de Caromb angeschlossenen Bauern kümmerten. Solche Bruderschaften gab es für alles Mögliche, auch für den Wein. Caromb lag im Anbaugebiet Ventoux.
Zum See gelangte man, wenn man von der Avenue Charles de Gaulle in den Chemin du Paty abbog, wo sich auch ein Hinweisschild auf den See befand. Die engen Serpentinen schlängelten sich zwischen dichtbewachsenen Felsen hinauf, bis man schließlich zu einem Parkplatz gelangte, wo es ein kleines Restaurant gab. Eher ein erweiterter Imbiss. An dem einen Ufer des Sees gab es einen aufgeschütteten Sandstrand. Auf der anderen Seite lagen die Leute auf den Felsen oder auf Kies unter Pinien. Früher, erinnerte sich Albin, hatte man auch auf der Staumauer in der Sonne gebrutzelt. Das war aber heute verboten. Vor allen an den Wochenenden kamen viele Familien her, um sich im türkisfarbenen Wasser eine Abkühlung zu verschaffen. Es wurde gepicknickt und vielleicht der eine oder andere Fisch auf den Grill gelegt, den man im See oder am Fluss geangelt hatte.
Außerdem sah man oft Touristen, denn der See hatte dafür gesorgt, dass Caromb sich nicht nur zu einem beliebten Naherholungsgebiet für die Einheimischen entwickelt hatte. Es urlaubten auch jede Menge Leute auf dem unten im Tal an der Hauptstraße Avenue Charles de Gaulle gelegenen Campingplatz Le Bouquier. Kurz vor der Einfahrt zum Campingplatz führte ein schmaler Schotterweg hinauf auf den Höhenzug, der den See einfasste. Wenn man sich nicht auskannte, würde man die Zufahrt ohne Zweifel verpassen. Lediglich ein kleines Kreuz an einer Ecke deutete darauf hin, dass es hier zur Kapelle ging.
Albin kannte sich aus und setzte den Blinker nach rechts. Sein Geländewagen rumpelte über den schmalen Schotterpfad, der zunächst an Oliven- und Feigenbaumplantagen entlangführte und schließlich durch dichten Pinienwald. Er schaltete in den zweiten Gang, als der Weg steiler wurde, und kurvte durch die Serpentinen. Nach dem zehnten Schlagloch warf er einen Blick in den Rückspiegel, um zu überprüfen, ob mit Tyson alles klar war, der es sich auf der Ladefläche auf seiner Decke bequem gemacht hatte. Die Rücklehnen der hinteren Sitze blockierten jedoch die Sicht. Andererseits beklagte Tyson sich nicht, warum sich also Sorgen machen? Außerdem hatte er reichlich Platz in dem SUV, den Albin kurz nach der Pension gekauft hatte, weil er nun Hundebesitzer war und Hundebesitzer größere Fahrzeuge benötigten. Sicher, manche fanden es übertrieben: ein SUV und ein Mops. Albin scherte sich nicht drum. Sollten die Leute doch denken, was sie wollten.
Zudem war der Wagen praktisch wegen der vielen Einkäufe. Seit er mit Veronique zusammen war, die im Ort gegenüber von Matteos Café einen Blumenladen führte, galt Albin als Stammkunde im Supermarkt und auf dem Wochenmarkt. Früher hatte er sich vor allem von Nahrung aus Dosen, der Tiefkühltruhe und von seinen heißgeliebten Fertiggerichten für die Mikrowelle ernährt. Was Veronique, die ein wenig jünger war als Albin und sich für Anfang sechzig spektakulär gehalten hatte, nicht länger tolerierte. Ihr Ziel war, Albin das Kochen beizubringen. Weswegen auf dem Beifahrersitz ein Korb mit einer Einkaufsliste lag: Heute Abend sollte es mit Spinat gefülltes Brathuhn geben, und Albin musste dazu Tomates à la Provencale beisteuern. Was ihn laut Veronique nicht überfordern würde: Man musste nur Tomaten halbieren, abtropfen lassen und an der Schnittfläche in Olivenöl anbraten. Dann gab man kleingehackte Petersilie und Knoblauch in die Pfanne sowie ein paar Löffel Semmelbrösel, füllte die Persillade zusammen mit den Tomaten in die Gratinform, und ab mit dem Ganzen in den Ofen. Na ja, Ravioli aus der Dose waren einfacher zuzubereiten, aber diese Zeiten schienen endgültig vorbei zu sein.
Nach einigen Minuten erreichte er die oberhalb des Stausees gelegene Chapelle du Paty, die ein häufiger Zielpunkt für Wanderer, Radler und Mountainbiker in der Gegend war. Heute schien sie jedoch vor allem ein Zielpunkt für Polizei- und Notarztfahrzeuge, diverse private Dienstwagen sowie einen Kombi des Rechtsmedizinischen Institutes zu sein. Sie belagerten die Kapelle geradewegs, vor deren Stirnseite pfeilgerade Zypressen in den Himmel wuchsen, um deren Stämme rotweißgestreiftes Polizeiabsperrband gezogen war. Im Schatten unter den Bäumen nahe der Kapelle sah Albin ein großes Wohnmobil und einige Kriminaltechniker in faserfreien Overalls, die damit beschäftigt waren, Koffer aus ihren Autos auszuladen.
Albin stoppte den SUV mit knirschenden Reifen und stellte den Motor aus. Er beobachtete, wie ein Mann auf den Wagen zukam und dabei eine hilflose Geste mit beiden Armen Richtung Himmel machte. Der Mann in heller Jeans, T-Shirt und Turnschuhen war ohne Zweifel Theroux, gut zu erkennen an seiner übergroßen Pilotensonnenbrille, mit der er stets wie ein Pornostar aus den Siebzigern wirkte. Seinen Dienstausweis hatte er wie eine Kette um den Hals gehängt. Zwei Streifenpolizisten kamen mit ihm, und als Albin ausstieg, hörte er Theroux sagen: »Nein, lasst mal, das ist nur Leclerc, ich kümmere mich schon darum.« Worauf die Uniformierten nickten und sich wieder entfernten.
Albin ging um den Wagen herum, öffnete die Heckklappe und hob Tyson heraus. Dann schloss er die Klappe wieder und drehte sich um.
Theroux stand direkt vor ihm und sagte: »Albin, das kann doch wohl nicht wahr sein. Kannst du nicht irgendetwas Sinnvolles tun, statt uns dauernd auf die Nerven zu gehen? Fahr mit Tyson ans Meer oder geh spazieren, oder …«
»Was ist passiert?« Albin sah zur Kapelle hin und erkannte drei auf dem Boden liegende Körper, über die Tücher gebreitet worden waren. Er sah ein Mountainbike und außerdem jede Menge getrocknetes Blut auf den hellen Steinen.
Theroux erwiderte: »Du weißt, dass du hier nichts zu suchen hast! Ich muss dich bitten …«
»Ausgerechnet am Lac du Paty! Wo du hier dauernd mit der Familie herkommst. Dann noch an der Kapelle. Den Leuten ist nichts mehr heilig.«
Theroux nickte.
»Also: Was ist passiert? Beziehungsdrama?«
Theroux trat von einem Bein aufs andere. Er blickte an Albin vorbei, seufzte schwer und starrte zu Boden. Dann sah er wieder auf und erklärte: »Drei Tote. Zwei Männer, eine Frau. Jeweils einen Schuss ins Herz und einen in den Kopf.«
»Scheiße«, sagte Albin.
Und Tyson sah aus, als nickte er.
»Wurde etwas gestohlen?«, fragte Albin.
»Scheint nicht so.«
Albin nickte verstehend. Die Frage hätte er sich sparen können. Denn das Problem war Folgendes – das wusste Theroux, das wusste Albin, und das wussten mit Sicherheit alle anderen ebenfalls: Ein Schuss ins Herz und einen in den Kopf, das wies auf eine professionelle Handschrift hin. Hier ging es um gezielte Tötungen. Bei einem stinknormalen Raubüberfall ballerte ein Täter für gewöhnlich deswegen drauflos, weil er sich den Weg freischießen musste, Widerstand brechen oder sich Respekt verschaffen. Den Kerlen ging es schließlich darum, Beute zu machen und damit abzuhauen. Von einem solchen Täter war nicht zu erwarten, dass er sich Zeit nahm, ordentlich zu zielen – wozu auch? Sein Motiv war die sogenannte Stoppwirkung, und es war ihm völlig gleichgültig, ob er jemanden tötete oder verletzte. Hauptsache, dieser Jemand blieb liegen, rief keinen an und stellte sich ihm nicht in den Weg. Schoss jedoch ein Mensch einem anderen Menschen genau ins Herz und außerdem noch in den Kopf, ging es um mehr. Dann wollte er seine Opfer hundertprozentig töten und sich außerdem doppelt absichern. Tat ein Schütze das in drei Fällen – nun, das konnte man nur als eiskalt und berechnend bezeichnen. Hier war ein Täter am Werk gewesen, der sich auskannte und mit Vorsatz gehandelt hatte. Keine Frage. Hier war es ums Töten gegangen.
»Identitäten bekannt?«, fragte Albin.
Theroux verneinte. Er zog aus der Gesäßtasche seiner Jeans eine Snack-Salami, öffnete die Verpackung und biss ein Stück ab. Tyson fing sofort an zu sabbern, bellte und starrte Theroux bettelnd an. Dieser jedoch ignorierte den Hund und erklärte: »Wir wissen noch nichts, Albin. Wir stehen ganz am Anfang. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Männer und eine Frau. Der eine Mann ist offenbar ein Mountainbiker. Die anderen beiden waren mit dem Wohnmobil unterwegs.«
»Wer hat sie gefunden?«
Theroux seufzte und fuchtelte mit der Wurst herum. Tyson folgte jeder Bewegung mit dem Blick, zerrte an der Leine und winselte leise. »Ein anderer Mountainbiker«, erwiderte Theroux. »Jemand, der hier regelmäßig entlangfährt. Ihm fiel das Wohnmobil auf, dann die Leichen. Er hat uns verständigt.«
»Dann schauen wir uns das doch mal an«, sagte Albin.
Theroux sah Albin an, als habe er nicht mehr alle Tassen im Schrank. »Was?«
»Ich will mir das mal ansehen, rede ich Chinesisch? Hier, halt mal.« Albin streckte Theroux Tysons Leine hin. Tyson fiepte, immer noch fixiert auf die Salami.
Theroux machte ein genervtes Geräusch und ignorierte die Leine. »Hallo? Das ist ein Tatort, und du wirst ihn nicht betreten. Du solltest ihn nicht mal sehen und nicht einmal die gleiche Luft einatmen, wie …«
»Theroux!«, rief jemand. Einer von den Kriminaltechnikern. »Kommst du jetzt mal bitte herüber, oder brauchst du es schriftlich?«
Theroux blickte hinter sich. »Ja. Nein«, rief er gestikulierend zurück. Er wendete sich wieder zu Albin und tippte ihm mit dem Finger auf die Brust. »Du bewegst dich keinen Zentimeter, klar? Am besten, du setzt dich wieder in deinen Wagen und fährst zurück und …«
»Theroux!«, riefen die Techniker.
»Ja, meine Güte«, erwiderte er, warf Albin einen letzten scharfen Blick zu und ging dann in Richtung Wohnmobil.
Albin blieb stehen, wo er war. Er fasste in die Hosentasche und zog sein Handy hervor. Es war ein brandneues Smartphone, mit dem man alles Mögliche anstellen konnte, bloß noch nicht zum Mond fliegen. Das heißt: vermutlich nicht, vielleicht gab es aber doch einen Knopf dafür. Oder eine App, wie man das im Fachjargon nannte.
Eigentlich machte sich Albin nichts aus derlei Technik. Vor mehr als zehn Jahren hatte er ein skandinavisches Handy gekauft und damit stets in ausgezeichneter Tonqualität telefoniert. Es war leicht gebogen gewesen, fast wie eine Banane, und Theroux hatte gesagt, das sei das gleiche Modell wie die, die sie in »Matrix« verwendet hätten. Albin hatte damals kein Wort verstanden, inzwischen aber nachgegoogelt und herausgefunden, dass »Matrix« ein Film mit Keanu Reeves war.
Allerdings hatte das alte Gerät inzwischen den Geist aufgegeben und Veronique Albin daraufhin dieses nagelneue Digitaldingsbums aufgeschwatzt, mit dem man sogar ins Internet gelangen, filmen und fotografieren konnte. Schon sehr praktisch, da konnte man sagen, was man wollte. Zwar besaß Albin auch eine kleine Digitalkamera, aber die war nun überflüssig und die Auflösung des Handys ohnehin viel besser. Musste man sich mal vorstellen: Foto- und Film-Telefone!
Außerdem bot das Smartphone einige weitere Vorteile. Das Display war sehr groß und in Farbe, so dass alle Tasten gut lesbar waren, und man konnte die Schrift vergrößern, was sie leichter lesbar machte.
Außerdem trug man stets ein Navigationsgerät in der Tasche mit sich herum, das einem Satellitenaufnahmen und Luftbilder von allen Orten dieser Welt in Sekundenschnelle verschaffte und sogar dreidimensionale Ansichten lieferte. Für die meisten Menschen war das mittlerweile selbstverständlich. Für Albin war es wie ein Abstecher ins Wunderland gewesen, und er hatte zu Veronique gesagt, dass man sich überhaupt nicht darüber wundern müsse, dass die Einbruchsraten steigen, wenn jeder derlei detaillierte Informationen zur Verfügung habe und seine Taten minutiös planen könne.
»Albin«, hatte Veronique vorwurfsvoll geantwortet, »jetzt tu doch nicht so weltfremd.«
Dabei war er nicht weltfremd. Er wusste durchaus, dass es so was seit einigen Jahren gab. Klar. Aber das eine war, um die Wunder der modernen Technik zu wissen. Das andere war, sie am eigenen Leib zu erfahren. Es machte eben einen gewaltigen Unterschied, ob man selbst zum Mond flog oder bloß darüber las. Natürlich, Albin gefielen die guten alten und verlässlichen Dinge besser als die flache kabellose neue Digitalwelt. Er las Bücher und Zeitungen, weil er dem gedruckten Wort vertraute und nicht den flüchtigen Worten im Internet, die sich in permanenter Veränderung befanden und von jedem Blödmann dort eingestellt werden konnten. Papier hingegen war verlässlich. Mit einem iPad konnte man sich nicht den Hintern abwischen. Auch nicht, wenn sie dafür irgendwann eine App entwickelten. Nein, Albin war weder ein Technologiefeind noch ein Ignorant.
Es war vielmehr so: Albin hatte sich in den vergangenen Jahren nicht um den Fortschritt gekümmert, sondern andere Dinge im Fokus gehabt. Währenddessen war die Karawane an ihm vorbeigezogen. Und nun, ja, nun erkannte er, dass um ihn herum eine Parallelwelt entstanden war und er offenbar zum alten Eisen gehörte. Was er nicht zulassen wollte. Er und rostig? Von wegen. Also hatte er gelernt, wie man das verdammte Smartphone verwendete, seine Funktionen nutzte und wie man damit das komplette Internet bediente, falls man das so ausdrückte.
Albin klemmte sich Tysons Leine zwischen die Knie und weckte das Smartphone auf, wobei er das mobile Gerät wie eine Tafel Schokolade in den Händen hielt. Das Hintergrundbild zeigte eine jüngere Frau mit einem kleinen Mädchen auf dem Schoß. Das Bild war auf einem Spielplatz entstanden. Beide lachten. Das eine war Albins Tochter, das andere seine Enkelin. Sie lebten in Paris. Mit beiden hatte er seit Jahren nicht gesprochen.
Er drückte mit dem Daumen auf das Symbol für die Fotofunktion. Schließlich nahm er das Handy hoch, suchte sich den passenden Bildausschnitt und machte ein paar Aufnahmen vom Tatort, zoomte mal hier und mal dort etwas näher heran und blickte erst auf, als die zwei uniformierten Polizisten von eben wieder an die Absperrung kamen und fragten, was, zum Teufel, er da mache.
»Bilder vom Himmel«, erwiderte Albin. »Und von der Madonna. Ich bin Hobbyfotograf.«
»Veralbern kann ich mich selber«, sagte der Fülligere von beiden.
Albin warf einen Blick auf die Namensschilder oberhalb der Brusttaschen der Polizisten. Der stämmige hieß Perault, der andere Fabius. Die Namen sagten ihm etwas.
Fabius fragte anerkennend: »Ist das das neue iPhone?«
Albin nickte und fotografierte weiter.
»Hat mehr Megapixel als manche Leute Gehirnzellen«, bemerkte Fabius.
Albin lachte.
Perault meinte: »Ist mir egal, wie viele Megapixel das Ding hat. Bitte hören Sie damit auf, Leclerc. Es ist doch armselig, wenn jemand wie Sie zum Gaffer mutiert.«
Albin fragte: »Perault. Sind Sie der Junge von Henri Perault?«
»Ja, und?«
»Und Sie, Fabius? Der Sohn von Laurent Fabius?«
»Das ist richtig«, erwiderte Fabius.
»Perault und Fabius, ich kenne Ihre beiden Väter. Waren gute Männer. Streifenpolizisten, wie sie im Buche stehen, solche gibt es heute gar nicht mehr. Die hätten niemals ältere Spaziergänger schikaniert, sondern ihnen freundlich über die Straße geholfen.«
»Leclerc, wir …«
Albin stellte die Handykamera in den Videomodus um. Er sagte: »Ich habe gerade die Aufnahmetaste gedrückt und könnte den Film auf Facebook schicken.«
Perault fragte: »Wozu?«
Albin hatte nur eine vage Vorstellung davon, was Facebook war und wie es funktionierte. Veronique war dort Mitglied und verschickte oft Bilder mit Sinnsprüchen, lustige Aufnahmen von Tyson oder kommunizierte darüber mit ihrer Familie. Sie hatte einmal versucht, es Albin zu erklären, und ihm Facebook gezeigt. Im Wesentlichen hatte Albin nur drollige Tiervideos gesehen und spaßige Bilder von Prominenten und sich gefragt, wozu das gut sein sollte. Aber natürlich wusste er, wozu die sozialen Medien heute imstande waren – zum Beispiel, um die Polizei zu diffamieren.
Albin erwiderte: »Ich sage Ihnen, wozu. Polizei belästigt einen älteren Spaziergänger und Hobbyfotografen und setzt ihn unter Druck. Unter diesem Motto könnte ich das Video verposten. Ihre beiden Väter würden sich die Haare raufen, wenn sie noch welche auf dem Kopf hätten.«
»Leclerc«, sagte Perault und machte einen Schritt auf Albin zu, »man nennt es nur Posten, nicht Verposten, und jetzt lassen Sie das bitte.«
Albin zögerte. Dann stellte er die Beine etwas auseinander, worauf Tysons Leine zu Boden fiel. Wie ein geölter Blitz schoss der Mops los, an den Polizisten vorbei in Richtung Theroux, immer dem Geruch der Salami folgend.
»Verdammt, der Hund wird den ganzen Tatort durcheinanderbringen«, sagte Albin, tauchte unter der Absperrung hindurch und folgte Tyson.
Die beiden Polizisten brüllten, er solle gefälligst stehenbleiben und zurückkommen, doch er kümmerte sich nicht um sie. Nach einer Weile schienen Perault und Fabius zu beschließen, dass sich irgendwer anderes um den unerwünschten Eindringling und seinen kläffenden Köter kümmern sollte. Vielleicht hatten sie auch zu viel Respekt vor Albin, um ihm nachzugehen und am Kragen zu packen. Jedenfalls folgten sie ihm nicht.
Albin ging an der Madonna und der Kapelle vorbei. Er schlängelte sich wie ein Slalomläufer durch die auf dem Boden angebrachten Markierungen der Spurensicherung und bewegte sich in Richtung des Wohnmobils. Nach seiner Einschätzung handelte es sich um ein durchschnittliches Modell. Weder alt noch neu, noch groß, noch klein oder besonders teuer. Auffällig war allenfalls, dass die Kennzeichen keine französischen waren, sondern deutsche.
Albin warf einen Blick auf die abgedeckten Leichen, schwenkte dabei das Smartphone auf die Körper als auch auf das Mountainbike und filmte weiter. Schließlich erreichte er das Wohnmobil, in dem sich einige Spurenanalytiker aufhielten. Sie sahen auf, als er in das Innere blickte. Er nickte ihnen zu. Sie konnten ihn offensichtlich nicht zuordnen und nickten zurück, bevor sie sich weiter mit der Arbeit befassten. Albin erkannte jede Menge in Beweismittelbeutel verpackte Gegenstände. Er sah einige Flaschen Wein auf einer Anrichte stehen. Manche waren leer, andere nicht. Er hielt mit dem Smartphone drauf, bevor er wieder einen Schritt zurücktrat, um die rostroten Blutflecken an der Seitenverkleidung des Wohnmobils zu betrachten. Als habe jemand eine Suppenkelle voller Bolognesesoße dagegengeschleudert, fand Albin. Er runzelte die Stirn und überlegte, dass ihn das ganze Szenario an etwas erinnerte, aber es wollte ihm nicht einfallen, an was. Schließlich ging er um das Fahrzeug herum – und stockte.
Albin sah zwei Gruppen von Menschen. Etwas weiter links standen Polizisten in Zivil und in Uniform, die sich im Schatten der Bäume mit einem älteren Mann unterhielten, der rote Radfahrer-Bekleidung trug und ein teuer aussehendes Mountainbike am Lenker festhielt. Der knallenge Bodysuit mit kurzen Ärmeln und Beinen ließ ihn etwas lächerlich aussehen – das taten diese Dinger mit den meisten Menschen, fand Albin. Noch alberner sah man aus, wenn man sie wieder auszog, weil der Schnitt dafür sorgte, dass man bis zu den Ellenbogen, den Knien und bis zum Kehlkopf knallbraun war und der Rest des Körpers kalkweiß. Allerdings wirkte der Mann recht muskulös für sein Alter. Kantig und schneidig. Das Haar war grau, kurzgeschnitten und scharf gescheitelt, sein Mund nur ein schmaler Strich. Aus strahlend hellen Augen sah er Albin einmal kurz an, bevor er sich wieder den Polizisten zuwandte. Vermutlich, dachte Albin, handelte es sich um den Finder, den Theroux erwähnt hatte. Den Mann, der die Toten entdeckt hatte.
Die andere Gruppe war es jedoch, die Albin hatte stocken lassen. Da war zum einen Theroux, der sich bewegte, als stünde er auf heißen Kohlen. Tatsächlich versuchte er gleichzeitig, Tyson von seinem Unterschenkel zu lösen, als auch nach Tysons Leine zu fassen. Beides gelang ihm nicht. Weiter befanden sich dort zwei Männer in weißen Overalls, die Albin als die Einsatzleiter der Spurensicherung identifizierte und die sich, augenscheinlich schlecht gelaunt, Theroux’ Tanz ansahen. Albin konnte ihnen die miese Stimmung nicht verübeln – Albin wusste, dass man sich bei diesem Wetter in diesen Overalls wie ein Brathähnchen im Backschlauch fühlte. Na ja, aber das Kernproblem war dieser andere Mann, der ebenfalls Theroux’ Gezappel beobachtete, dann aber Albin entdeckte und in der Bewegung gefror. In einem Comic hätte man wohl Blitze gezeichnet, die Staatsanwalt Luc Bonnieux aus den Augen schossen.
Albin steckte das Handy wieder ein. »Tyson!«, rief er und schlug sich auffordernd auf die Oberschenkel. »Kommst du wohl her?«
Tyson kam nicht. Stattdessen näherte sich Luc Bonnieux mit forschem Schritt.
Bonnieux mochte Anfang fünfzig sein – ein vitaler und kerniger Typ Mann, dem man auf den ersten Blick ansah, dass er ein Alphatier war. Ein Karrieretyp, der bereits sehr weit gekommen war, aber dem Zenit seiner Möglichkeiten noch entgegenstrebte. Seine Haut war stets gut gebräunt und die leicht schütteren schwarzen Haare teuer frisiert. Hinter der randlosen Brille blickten seine Augen meist kalt, abschätzend und etwas angeödet, was ihm insgesamt eine leicht überheblich wirkende Aura verlieh. Albin konnte ihn nicht ausstehen, was fraglos auf Gegenseitigkeit beruhte. Heute trug er einen blaugrauen Sommeranzug und hielt das Sakko in der Hand. Das weiße Kurzarmhemd war scharf gebügelt. Der blaue Schlips saß akkurat. Seine blankpolierten Schuhe waren staubig. Als er vor Albin zum Stehen kam, nahm dieser den Hauch von einem zitronigen Aftershave wahr.
»So eine Freude und Ehre«, sagte Albin. »Der Herr Staatsanwalt persönlich.«
»Leclerc«, zischte Bonnieux.
»Mein Hund ist mir entwischt. Er liebt Theroux, wissen Sie?«
»Das ist ein Tatort, und Sie haben an einem Tatort nichts verloren, wie ich Ihnen bereits mehrfach erklären musste. Sie setzen sich einfach …«
»Ich will nur den Hund …«
»… über alles hinweg und denken, für Sie gelten Sonderregeln. Aber Sie sind raus, kapieren Sie das endlich! Ich kann bis zu einem gewissen Grad ja nachvollziehen, dass Sie sich immer noch zugehörig fühlen, aber – Mann, Sie sind Privatier und Rentner, und ich werde Ihnen per einstweiliger Anordnung und Androhung von empfindlichen Geld- oder sogar Haftstrafen verbieten, künftig polizeiliche Absperrung im Umkreis von mehreren hundert Metern …«
»Mein Hund …«
»Meine Güte, jetzt lassen Sie mich doch mit Ihrem Hund in Ruhe!«
Albin schwieg. Musterte Bonnieux. »Sie spucken beim Sprechen«, sagte er und ging dann an Bonnieux vorbei und auf Theroux und die anderen zu.
»Leclerc«, rief ihm der Staatsanwalt hinterher. »Ich lasse das nicht mehr durchgehen, verstanden? Das war die letzte Warnung!«
Albin marschierte schweigend weiter und schob das Handy zurück in die Gesäßtasche. Schließlich bückte er sich, nahm das Ende von Tysons Leine auf, zog ihn daran von Theroux’ Bein zurück und sagte: »Nun ist aber gut, Tyson.«
»Meine Fresse«, schimpfte Theroux und nickt in Richtung von Staatsanwalt Bonnieux. »Da hast du dir jetzt schön was eingebrockt, Albin.«
Albin zuckte mit den Achseln. Er streckte die freie Hand zu den beiden Kriminaltechnikern aus, um sie zu grüßen. Der mit der Glatze war Bruno Grinamy, ein kleiner drahtiger Kerl und leidenschaftlicher Angler, der kurz vor der Rente stand. Der andere war Kevin Toullardin, hager und hochgewachsen mit einer Nerd-Brille, den Grinamy vermutlich beerben würde. Sie nannten ihn den »Star«, weil er bei einer Real-Crime-Sendung über die Serienmorde an rothaarigen Frauen aufgetreten war und davon berichtet hatte, wie sie mit geologischem und topografischem Profiling gearbeitet und Geräte eingesetzt hatten, mit denen man den Boden wie mit einem Radar abtasten konnte. Eigentlich alles Albins Idee, aber: egal.
»Beißen die Fische?«, fragte Albin an Grinamy gewandt und schüttelte ihm die Hand.
»Wie verrückt«, erwiderte Grinamy.
»Könnte mal eine Forelle gebrauchen.«
»Sag nur Bescheid.«
»Leclerc!«, blaffte Bonnieux, der wieder im Anmarsch war. »Schluss jetzt.«
Albin nickte allen zu. »Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Viel Erfolg noch«, sagte er und griff dann Tysons Leine fester, um mit ihm zurück zum Wagen zu marschieren.
Er warf erneut einen Blick zu der anderen Gruppe, um sich das Gesicht des Radfahrers einzuprägen, schlängelte sich zwischen den Markierungen der Spurensicherung hindurch und hielt Tyson an der kurzen Leine, als sie die Leichen passierten – zwei lagen dicht am Wohnmobil, der Mountainbiker ein wenig entfernt. Albin wünschte Fabius und Perault an der Absperrung einen guten Tag, tauchte unter dem Flatterband hindurch und öffnete mit der Fernbedienung die Heckklappe des SUV. Er hob Tyson auf die Ladefläche – die zu hoch war, als dass der Hund selbst hätte reinspringen können, aber das hatte Albin beim Kauf nicht bedacht –, löste die Leine und steckte ihm ein Leckerchen zu. Schließlich schloss er die Heckklappe wieder, ging um den Wagen herum, setzte sich ans Steuer, ließ den Wagen an und fuhr los. Als er nach einigen Minuten wieder auf der Landesstraße angekommen war, setzte er den Blinker nach links. In diesem Moment fiel ihm ein, woran ihn das gesamte Szenario erinnert hatte.
4
Albin stand am Spülbecken und wusch die Tomaten. Danach legte er sie auf ein Brettchen und zerteilte sie in der Mitte. In der Küche war es eng. Albin füllte den größten Teil davon aus. Seit er mit Veronique zusammen war, hatte sich hier einiges getan. Zum Beispiel war die Mikrowelle verschwunden. Früher hatte sich Albin darin rasch seine Fertiggerichte gemacht.
Außerdem gab es eine Reihe neuer Töpfe und Pfannen. Veronique hatte die, die sie bei Albin vorgefunden hatte, mit einer gelupften Augenbraue aussortiert und neue angeschafft, die ein kleines Vermögen gekostet hatten. Was auch für die Messer und das Besteck galt. Veronique hatte sich in dieser Hinsicht als wenig kompromissbereit erwiesen und Albin außerdem dazu genötigt, eine neue Sitzgarnitur fürs Wohnzimmer anzuschaffen. Sie hatte gesagt, dass in seiner alten ein Bandscheibenvorfall sozusagen mit eingebaut wäre – obwohl sich Albins Bandscheiben in einem tadellosen Zustand befanden.
Also hatte Albin eine neue Couch gekauft, die nun an dem kleinen Tisch vor dem Fernseher stand und etwa die Hälfte der zur Verfügung stehenden Quadratmeter in Anspruch nahm. Das Wohnzimmer war, wie der Rest der Wohnung, nämlich nicht sehr groß und eher schmal. Es befand sich in einem alten Wohnhaus in einer Seitenstraße, dessen Front meist im Schatten lag. Dafür strahlte die Sonne fast rund um die Uhr auf die Terrasse mit dem kleinen Garten, den Veronique ebenfalls auf Vordermann gebracht hatte, weil sie fand, dass man einen so hübschen Garten nicht dermaßen verwahrlosen lassen konnte.
Albin hatte sie einfach machen lassen. Er war immer schon der Meinung gewesen, dass man Fachleute nicht einschränken sollte, sondern ihnen Raum zur Entwicklung geben, um später selbst von den Resultaten zu profitieren. Und es stand vollkommen außer Frage, dass sich Veronique in häuslichen Dingen erheblich besser auskannte als Albin. Gegen sie war er ein Dilettant – und seine Wohnung inzwischen kaum noch wiederzuerkennen, die sich, nachdem er sie von oben bis unten neu hatte anstreichen müssen, von einem dunklen Loch in etwas verwandelt hatte, das man durchaus fotografieren und auf irgendetwas mit Insta- ins Internet stellen konnte, wie Veronique es immer ausdrückte. Was auch immer sie damit meinte.
»Das machst du sehr gut«, sagte sie jetzt direkt neben ihm, womit sie Albins neuerworbene Künste am Schneidebrettchen kommentierte, und schenkte ihm ein Lächeln. Sie war gerade damit beschäftigt, das Huhn vorzubereiten.
»Ich mache wirklich Fortschritte«, erwiderte Albin. »Dieses Mal sind die Finger an der Hand geblieben.«
Veronique lachte hell auf. Albin liebte diesen Klang. Es war der Klang von etwas, das in den letzten Monaten sehr vertraut geworden war. Veroniques Nähe. Albin empfand es geradezu als ein Geschenk, in seinem Alter noch einmal das erleben zu dürfen, was man gemeinhin als Schmetterlinge im Bauch bezeichnete. Ein neuer Frühling – ausgerechnet, wenn man im Herbst seines Lebens angekommen war.
Albin hatte dabei festgestellt, dass es ziemlich gleichgültig war, ob man sechzehn oder sechzig war – es fühlte sich immer gleich an. Jedenfalls soweit er sich erinnerte, und Albin meinte, sich noch gut an das erste Mal zu erinnern. An die kleine Isabelle mit den Korkenzieherlocken aus der Nachbarschaft und wie er etwa eine Stunde lang schwitzend und mit klopfendem Herzen mit sich gerungen hatte, ob er es nun wagen sollte, sie zu küssen oder nicht. Und das, obwohl er sich damals für den coolsten Burschen weit und breit hielt, den absolut nichts aus den Socken hauen konnte.
Der Unterschied zu damals war, dass man im Alter nichts mehr überstürzte. Dass man sich Zeit mit allem ließ, diese Zeit auskostete. Man musste sich und dem anderen nichts mehr vormachen oder sich gespielt wegen irgendetwas zieren und desinteressiert geben, um Interesse auf sich zu ziehen. Das war der Jugend vorbehalten. Im Alter wusste man, wer man war und was man wollte und was nicht. Was sich mit sechzehn völlig anders verhielt. Mit sechzehn glaubte man zwar, längst alles zu wissen, aber man hatte doch eher keine Ahnung von gar nichts und begann gerade erst damit, über den Rand des Tellers zu linsen, den man für die Welt hielt. Mit sechzehn änderte sich oftmals alles im Wochentakt. Gefühle, Geschmäcker, Vorlieben, einfach alles. Später änderte sich kaum noch etwas. Dennoch: Der Kitzel und das warme Gefühl im Herzen waren heute das Gleiche wie damals. Der ganze Rest aber hatte eine andere Qualität. Eine viel tiefere und unaufgeregte – vielleicht deswegen, weil man wusste, wie schnell alles wieder vorbei sein konnte und dass die Schmetterlinge nicht ewig fliegen. Ein Glück, wenn sie das überhaupt taten. Man hoffte nicht mehr auf die alles überwältigende romantische und emotionale Flutwelle, weil man wusste, dass derlei Tsunamis eher selten waren. Im Unterschied zu früher reichte es einem in einer Beziehung inzwischen vollkommen aus, wenn man sich gegenseitig wirklich mochte und respektierte, sehr gut miteinander auskam und das Leben gemeinsam genoss, weil einer den anderen gut ergänzte. Aber vielleicht waren es genau diese Dinge, die das ausmachten, was man gemeinhin Liebe nannte. Zudem änderte sich im Alter das Selbstbild und die Erwartungen an andere Menschen – fort vom romantischen Idealismus hin zum Realismus. Und Albin war fraglos kein Märchenprinz in strahlend weißer Rüstung, der einen Schimmel mit wehender Mähne ritt. Er war ein großgewachsener Rentner mit einem kleinen Hund.
Veronique buffte Albin mit dem Oberarm an. »Worüber denkst du nach?«
»Über dich.«
Sie lächelte. »Warum?«
»Wie lange willst du den Blumenladen noch führen?«
»Bis ich umfalle. Wieso?«
Albin zuckte mit den Achseln. Veroniques Blumenladen mitten im Ort war ein ausgesprochen hübsches Geschäft. Es befand sich im Erdgeschoss eines uralten Wohnhauses und mit Holz eingefasster Fassade, deren hellblauer Anstrich pittoresk verwittert war. Im Inneren zeigten die Wände das rohe Mauerwerk, und alles stand voll mit Blumen, die auf verblassten Regalen in Eimern oder aus Latten zusammengenagelten alten Weinkisten standen, an denen der Zahn der Zeit erheblich genagt hatte. Hatte Albin zumindest so lange gedacht, bis Veronique ihm erklärte, was »Shabby Look« bedeutete und dass man künstlich gealterte Dinge für Spottpreise in Online-Versandhäusern bestellen konnte, falls man auf ein nostalgisch anmutendes Interieur Wert legte.
»Ich beneide dich«, sagte Albin und zerschnitt einige weitere Tomaten. »Du hast eine Aufgabe.«
»Die hast du ebenfalls«, erwiderte Veronique. »Du musst dich um Tyson kümmern, und du solltest dich außerdem um deine Tochter und deine Enkelin kümmern.«
»Du weißt, dass sie nichts von mir wissen wollen.«
»Und du weißt, dass das nach wie vor eine sehr bequeme Ausrede ist, um deiner Verantwortung aus dem Weg zu gehen.«
Wiederum zuckte Albin mit den Achseln. Einerseits hatte Veronique recht. Andererseits hatte sie gut reden, denn mit ihrer Familie kam sie ausgezeichnet klar und stand in regem Kontakt, wozu sie oft ihr Handy oder ihren Tablet-Computer benutzte, den Albin einmal fast mit dem Schneidebrettchen verwechselt und sich dafür einen Rüffel eingefangen hatte. Veronique war mit beiden Geräten verwachsen wie ein Teenie, dachte Albin manchmal, wenn er sie beim Tippen beobachtete und dabei, wie sie über Dinge lächelte, die ihm verschlossen blieben.
Albins Tochter hieß Manon. Seine Enkelin Clara. Sie lebten, wie Albins Exfrau, in Paris. Der Kontakt war vor einigen Jahren abgebrochen. Manon hatte sich in diesen Autoverkäufer verliebt und lebte mit ihm zusammen. Der Kerl war nach Albins Meinung ein Psychopath und schlug Manon. Gar kein Zweifel. Albin war lange genug Polizist gewesen, um die Ausreden von Frauen in Fällen häuslicher Gewalt zu kennen, die Art von Verletzungen, die sie dabei erlitten, sowie die erlogenen Erklärungen dafür. Trotz ihrer Bitten, sich aus ihrem Leben herauszuhalten, war Albin nach Paris gefahren und hatte sich den widerlichen Kerl vorgeknöpft. Beim letzten dieser Gespräche war der Typ, also … Er war mehr oder weniger die Treppe auf eine sehr ähnliche Art und Weise hinabgestürzt wie angeblich zuvor Manon. Eine billige Reaktion von Albin, ja. Eine, für die er sich längst verfluchte, denn er hatte dem Irren damit in die Hände gespielt und ihm ein Druckmittel gegeben. Der Kerl hatte Albin mit Anzeigen und einstweiligen Verfügungen gedroht, was zugleich Albins Suspendierung bedeutet hätte.
Manon weigerte sich seither, mit ihrem Vater zu reden oder Kontakt zu Clara zuzulassen – wer weiß, dachte Albin manchmal, ob nicht vielleicht eher das Schwein von Autoverkäufer dahintersteckte. Andererseits war Manon stur und nachtragend. Das eine hatte sie von Albin, das andere von ihrer Mutter, die ebenfalls kein Wort mehr mit Albin sprach.
»Jetzt bist du wieder ganz still«, sagte Veronique und legte das Huhn in eine Backform.
»Hm?«
»Du wirst jedes Mal stumm wie ein Fisch, wenn ich das Thema anschneide.«
»Welches Thema?«
Veronique verdrehte die Augen und ging zum Ofen. »Ruf sie an! Schreib Briefe! Schick E-Mails!«
Na ja, dachte Albin, ganz so war das ja nicht. Er hatte immer wieder angerufen, es dann aber irgendwann bleiben lassen. Jedes Jahr schickte er zu Manons Geburtstag eine Karte und außerdem ein Geschenk für die Kleine zu deren Geburtstag und zu Weihnachten. Es kam niemals eine Antwort.
Veronique sagte: »Setz dich einfach darüber hinweg, dass sie keinen Kontakt will. Melde dich. Du wirst merken, dass am Ende Blut dicker ist als Wein.«
»Wein«, sagte Albin. »Genau. Ich hole mal welchen.«
»Du weichst aus, Albin. Aber ich werde nicht müde, dir damit auf den Wecker zu gehen. Ich nerve dich so lange damit, bis du dich wie ein anständiger Mensch verhältst. Eine Tochter braucht ihren Vater. Eine Enkelin braucht ihren Opa. So einfach ist das.«
Albin schob die Tomaten beiseite und legte das Messer ab, um in den Keller zum Weinregal zu gehen. Kurz blieb er hinter Veronique stehen, um ihren Hintern mit seinen großen Händen zu umfassen.
Er sagte: »In welch großartiger Stimmung muss Gott gewesen sein, als er sich diese Form ausgedacht hat.«
»Finger weg, während ich koche, du Macho«, herrschte Veronique ihn an.
Albin nahm die Finger fort und vergrub sie in der Hosentasche. Er senkte den Blick, schob die Unterlippe nachdenklich vor. Er blickte zu Tyson, der auf dem Teppich lag und Albin mitleidig ansah. Albin zuckte mit den Achseln. Schließlich ging er nach unten, wo er sich für einen St. Estèphe entschied und sich später fragte, warum eigentlich, denn er hatte seit Jahren keinen mehr getrunken. Er dachte an die leeren Weinflaschen im Wohnmobil und an die Toten bei der Kapelle sowie daran, woran ihn der Fall erinnerte: an die anderen Toten, die man vor einigen Jahren unter ähnlichen Umständen gefunden hatte.
5
St. Estèphe. Der Name hatte Klang, überlegte Albin, während am anderen Morgen der samstägliche Verkehr an ihm vorbeirauschte, und betrachtete das Foto auf seinem Handy. Er hatte es gestern geschossen, als er das Wohnmobil an der Kapelle betreten hatte. St. Estèphe war nicht mehr als ein Kaff mit gerade mal zweitausend Einwohnern. Es lag in Aquitanien in der Region Gironde etwas abseits vom Fluss auf der Médoc-Halbinsel, die vom Delta der Gironde einerseits und der Atlantikküste mit ihren endlosen Stränden andererseits umfasst wurde. Wenn man von St. Estèphe im Bordeaux sprach, meinte für gewöhnlich niemand den Ort an sich. Man meinte vielmehr das, wofür der Ort als Taufpate stand, nämlich die Anbauregion und den Wein, der dort hergestellt wurde.
Albin kannte sich ein wenig mit Wein aus. Er empfand sich als eher anspruchslosen Mann, aber auf seine Zigaretten ließ er nichts kommen, und beim Wein stellte er sich an. Also: Nicht, dass er eine Wissenschaft daraus machte oder einen Mordszinnober wie manche Ausländer und andere Möchtegerne anstellten, wenn sie eine Flasche vom Guten öffneten. Doch er schätzte bei Wein wie beim Tabak Qualität, und wie das dann eben so ist mit Dingen, an denen einem etwas liegt: Nach ein paar Jahrzehnten konnte man ein Lexikon mit seinem Wissen darüber füllen.
Paulliac war neben St. Estèphe die nächste Appellation im Médoc, zu denen noch St. Julien und Margaux zählten – und Paulliac war wiederum ein sehr kleiner Ort. Er lag unmittelbar am Ufer der Gironde und verfügte über ein hübsches Boulevard am Quai Antoine Ferchaud, wo sich Weinladen an Weinladen und Cafés, Bistros und kleine Restaurants unter Markisen aneinanderreihten. Meist war Paulliac von Touristen und Weingroupies überlaufen – was man ihnen nicht verübeln konnte. Im Hinterland und bis herunter nach Bordeaux gab es zahlreiche namhafte Topweingüter, schier endlose Weinfelder und dazwischen jede Menge beeindruckende kleine Schlösschen und Gutshäuser. Château Estournel, Château Labory, Château Margaux und, auf der anderen Seite des Flusses, Pomerol und Saint-Emilion – allesamt Namen, die man sich auf der Zunge zergehen lassen konnte. Aber auch der Rest, die Mittelklasse, war nicht zu verachten.
Es gab Hunderte Weingüter, von denen man die meisten persönlich aufsuchen, probieren und sich dann den Kofferraum vollladen konnte. Von den Médocs gefielen Albin die St. Estèphes am besten, weil sie nach seiner Meinung kräftiger und herzhafter schmeckten als alle anderen und damit denen etwas näherkamen, die er in der Provence gewohnt war, wo es natürlich ebenfalls Hunderte Weingüter gab, darunter auch sehr berühmte – wenngleich, da musste man sich nichts vormachen, man sich eher nicht mit dem Bordeaux messen konnte.
Der Wein, dessen Etikett Albin auf dem Handydisplay betrachtete, war der Hammer. Wie er schmeckte, wusste Albin nicht. Aber ihm war klar, dass es sich um ein Spitzenerzeugnis handelte, nämlich um einen Château Cos d’Estournel von 2008. Weine wie dieser waren durchaus Wertanlagen, wusste
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: