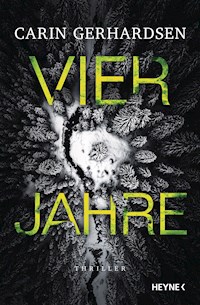4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Sjöberg
- Sprache: Deutsch
In Stockholm werden mehrere Katzen getötet - und niemand in Kommissar Sjöbergs Team ahnt, zu welchem Albtraum sich diese Meldung entwickeln wird. Doch als den Ermittlern klar wird, dass derselbe Täter auch eine angesehene Stockholmer Psychologin ertränkt hat, ist dies erst der Anfang einer brutalen Mordserie. Kurz darauf wird ein Mann in den Tod gestoßen. Die Spur führt in beiden Fällen in die familiäre Vergangenheit der Opfer. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn der Mörder hat sein nächstes Opfer bereits im Visier ...
Über diese Serie
Hammarby, mitten in Stockholm: Hier ermittelt Kommissar Conny Sjöberg mit seinem Team. Dabei ist der sympathische Familienmensch Sjöberg immer wieder mit menschlichen Abgründen konfrontiert ...
Mit dieser Serie erlangte die Schwedin Carin Gerhardsen ihren internationalen Durchbruch: Die Schweden-Krimis wurde in über 25 Sprachen übersetzt, jedes Buch erreichte Platz 1 der schwedischen Bestseller-Charts.
Alle Schwedenkrimis um Conny Sjöberg:
1: Das Haus der Schmerzen
2: Du bist ganz allein
3: Und raus bist du
4: Falsch gespielt
5: Vergessen wirst du nie
6: In deinen eiskalten Augen
7: Blutsbande
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverWeitere Titel der AutorinÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumZitatApril 2012, MontagmorgenApril 1982Die Nacht von Montag auf DienstagMai 1989DienstagvormittagJuni 1989DienstagnachmittagDie Nacht von Dienstag auf MittwochJuni 1989MittwochvormittagAugust 1995MittwochnachmittagAugust 1995MittwochabendAugust 1995Die Nacht von Mittwoch auf DonnerstagDonnerstagmorgenDonnerstagvormittagDonnerstagnachmittagDie Nacht von Donnerstag auf FreitagFreitagvormittagFreitagnachmittagFreitagabendSamstagvormittagSamstagnachmittagSamstagabendSonntagvormittagSonntagnachmittagMontagvormittagMontagnachmittagMontagabendDie Nacht von Montag auf DienstagDienstagmorgenDienstagnachmittagWeitere Titel der Autorin
Das Haus der Schmerzen
Du bist ganz allein
Und raus bist du
Falsch gespielt
Vergessen wirst du nie
In deinen eiskalten Augen
Über dieses Buch
In Stockholm werden mehrere Katzen getötet – und niemand in Kommissar Sjöbergs Team ahnt, zu welchem Albtraum sich diese Meldung entwickeln wird. Doch als den Ermittlern klar wird, dass derselbe Täter auch eine angesehene Stockholmer Psychologin ertränkt hat, ist dies erst der Anfang einer brutalen Mordserie. Kurz darauf wird ein Mann in den Tod gestoßen. Die Spur führt in beiden Fällen in die familiäre Vergangenheit der Opfer. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn der Mörder hat sein nächstes Opfer bereits im Visier …
Über die Autorin
Carin Gerhardsen, geb. 1962, ist in Katrineholm aufgewachsen und lebt nun in Stockholm. Vor dem internationalen Durchbruch als Autorin arbeitete die Mathematikerin mit großem Erfolg in der IT-Branche. Mit der Serie um Kommissar Conny Sjöberg erlangte die Schwedin Carin Gerhardsen ihren internationalen Durchbruch: Die Schweden-Krimis wurde in über 25 Sprachen übersetzt, jedes Buch erreichte Platz 1 der schwedischen Bestseller-Charts.
C A R I N G E R H A R D S E N
BLUTSBANDE
Aus dem Schwedischen vonThorsten Alms
S C H W E D E N - K R I M I
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2014 by Carin Gerhardsen
Titel der schwedischen Originalausgabe: »Tjockare än vatten«
Originalverlag: Norstedts, Sweden
Published by arrangement with Nordin Agency AB, Sweden
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Lukas Weidenbach
Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.deunter Verwendung von Motiven von © Shutterstock
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-0770-1
be-ebooks.de
lesejury.de
Gebrochen flieht die Welle von dem Strand,Schneeweiße Wasserlilien hängen noch im Sand,Zeugen von der Tiefe Rätselhaftigkeit.
Carl Snoilsky
April 2012, Montagmorgen
Ihr Leben war stets von Wasser umgeben gewesen, dachte Lillemor. Von Katzen und von Wasser. Katzen im Wasser. Tote Katzen, Tod im Wasser. Warum das so war, konnte sie nicht genau sagen, aber sie erinnerte sich daran, wie es angefangen hatte. Und jetzt lag sie direkt am Wasser und lauschte dem friedlichen Gluckern der Wellen am Bootsrumpf. Das wohlbekannte Geräusch dieses mächtigen Elements, das ihr eigenes Leben bestimmt und das vieler anderer dabei zerstört hatte.
Rickes zum Beispiel. Der neugierige braune Burmakater mit den Bernsteinaugen, der sich vom Stadtteil Aspudden bis zu einer Regentonne im Aprilvägen im Stadtteil Midsommarkransen hatte locken lassen, in der er schließlich ertränkt wurde.
Und auch das seines Besitzers. Ein pensionierter Gießer, der seinen Augenstern jeden Tag kurz vor dem Schlafengehen hinausließ, weil er es mit seinem Rollator nicht schaffte, mehr als einmal am Tag das Haus zu verlassen. Ein Mann, der schon vorher einsam genug gewesen war, der jetzt aber auch den letzten Rest Liebe verloren hatte, den das Leben ihm hatte bieten können.
Nein, die Gründe dafür, dass es sich so entwickelt hatte, waren Lillemor immer noch nicht ganz klar. Aber an den Anfang erinnerte sie sich so genau, als wäre es erst gestern gewesen. Es begann an einem Frühlingstag vor fast genau dreißig Jahren.
April 1982
Es war einer dieser strahlend schönen Frühlingstage, an denen die Waldböden von Buschwindröschen überschwemmt waren, die Vögel wie besessen zwitscherten und das Sonnenlicht überall glitzerte, weil alles noch feucht war von dem Schnee, der gerade erst geschmolzen war. Lillemor war sechs Jahre alt. Sie saß auf ihren Handschuhen auf dem kalten Fels und knabberte Kekse. Wafers, wie Mama sie nannte. Zwei Waffeln, die von einer dünnen Schicht Zitronencreme zusammengehalten wurden. Mama hatte in der Frühlingswärme die Jacke ausgezogen, sich daraufgesetzt und den Blick auf das sich leicht kräuselnde Wasser gerichtet, während sie mit der Hand über ihren wachsenden Bauch streichelte. Tor jagte dem abgehärteten Kater hinterher, der geduldig versuchte, seinen Schwanz aus dem festen Griff des Vierjährigen zu befreien.
»Lass Trisse jetzt in Ruhe, Tor«, sagte Mama müde. »Er möchte lieber auf Lillemors Schoß liegen und sich sonnen.«
Lillemor war eigentlich gar nicht ihr richtiger Name. In Wirklichkeit hieß sie Freja, aber das wusste kaum jemand. Stattdessen wurde sie Lillemor genannt, »Kleine Mama«. Alle sagten, dass sie wie ein Abbild ihrer Mutter sei, und dazu noch so vernünftig, dass sie auf ihren kleinen Bruder aufpassen konnte, als wäre sie seine Mutter. Ein beflissenes Kind, dachte sie als Erwachsene über die kleine Lillemor. Altklug und beflissen. Eine Petze, fand Tor. Aber Lillemor wollte ihm nichts Böses, sie übernahm einfach nur die Verantwortung für sein Wohlbefinden und für das ihrer Mutter.
Tor hörte nicht, sondern verfolgte den langmütigen Hofkater weiter. Mama seufzte hörbar und kam mühevoll auf die Beine. Lillemor vermutete, dass sie Tor einfangen wollte, und stand kurzerhand selbst auf, um ihr zu helfen.
»Ich gehe mal kurz hinter den Busch«, sagte Mama und deutete mit einer Geste auf die Buschwindröschen.
»Was willst du da?«, fragte Lillemor.
»Pinkeln. Ich behalte euch aber die ganze Zeit im Auge.«
Sie drehte sich um und ging. Lillemor folgte ihr mit dem Blick und würde sich für immer daran erinnern, wie ihre Mutter, leicht verdeckt von einem Weidenbusch, in die Hocke ging und sie aus einem Meer aus weißen Blüten anlächelte. Es war doch ein Lächeln?
»Geh zu Lillemor, Tor, dann bekommst du etwas Süßes!«, rief sie.
»Ich will nichts Süßes«, antwortete der Junge unbeschwert, immer noch im Galopp hinter dem Kater auf dem Felsen her.
»Wafers!«, versuchte Lillemor. »Ich habe Wafers und etwas zu trinken. Komm doch mal.«
Tor bemühte sich nicht einmal, darauf zu antworten, sondern machte einen Hechtsprung in Richtung des Katers und landete direkt auf ihm. Trisse zappelte und versuchte sich loszureißen, aber der Vierjährige war stark und hartnäckig, hatte die Arme um ihn geschlungen und dachte gar nicht daran, ihn loszulassen. Bald hatte er sich mit dem wütenden Tier in den Armen hingestellt.
»Er wird dich kratzen«, ermahnte ihn Lillemor. »Du tust ihm weh.«
Was stimmte, denn der Kater fauchte und zeigte die Zähne, während er in einer Art Würgegriff vor Tors Brust hing und seine Hinterbeine in der Luft baumelten.
»Er soll baden«, sagte Tor und ging mit entschlossenen Schritten die rutschigen Felsklippen hinunter.
»Nein, Tor, das will er nicht! Geh nicht bis zum Wasser runter, das dürfen wir nicht!«
»Ich will ja nicht baden«, antwortete Tor ungerührt, mittlerweile ganz nah am Wasser. »Trisse kann ja Katzenschwimmen.«
Und dann schickte er das Tier mit aller Kraft, die ein Vierjähriger aufbringen kann, auf eine kurze Luftreise in das kalte und dunkle Wasser.
»Mama!«, rief Lillemor. »Mama! Tor hat Trisse ins Wasser geworfen!«
Wo ihre Mutter sich in diesem Augenblick befand und was sie darauf antwortete, hörte Lillemor nicht. Der Kater landete seltsamerweise mit den Pfoten voran und mit dem Kopf Richtung Ufer an der Stelle, wo der Fels im Wasser versank. Dort waren die Steine nass und uneben, und seine erste Berührung mit der Oberfläche sah schmerzhaft aus. Trisse unternahm einen erbärmlichen Versuch, auf den Felsen zurückzuspringen. Vielleicht war eines seiner Beine bei der Landung oder schon während der unbarmherzigen Behandlung davor verletzt worden; vielleicht war die Klippe zu glitschig oder das Wasser schockartig kalt. Sie wusste nicht, woran es lag, aber die ganze Bewegung war kraftlos, und er schien zu resignieren, als er hilflos nach hinten rutschte, hinein in das unwirtliche Wasser.
Lillemor stiegen die Tränen in die Augen, als sie zusah, wie der geliebte Kater im Wasser verschwand. Für einen Moment überlegte sie, zum Ufer zu laufen und zu versuchen, ihn zu erreichen, aber jetzt hörte sie hinter sich das Stampfen von Gummistiefeln auf feuchter Erde und wusste, dass Mama auf dem Weg war, die Situation in Ordnung zu bringen.
»Mama!«, schrie sie aus vollem Hals. »Trisse!«
Worte, die sie immer und immer wieder rief, während ihre Mutter über die Felsen rannte und der Kater wieder an der Wasseroberfläche auftauchte. Nur ihretwegen stürzte sich ihre Mutter wagemutig die glatten Felsen hinunter, um ihr geliebtes Haustier zu retten, das würde Lillemor niemals vergessen. Auch nicht, wie die Hoffnung in ihr aufflammte, als der Kater fauchend wieder auftauchte, während ihre Mutter wie ein Geschoss das letzte Stück bis zum Wasser zurücklegte. Nein, erst später verstand Lillemor, dass diese letzte und gefährlichste Etappe den Felsen hinunter keine Absicht gewesen war, sondern dass sie ausgerutscht sein musste. Als Mama mit den Füßen voran ins Wasser tauchte, dachte Lillemor, dass ihre Mutter eine Heldin war, die sich sogar ins eiskalte Wasser stürzte, damit Lillemor endlich aufhören konnte zu weinen. Bei dem dumpfen Schlag, mit dem der Kopf gegen den Fels schlug, hoffte Lillemor nur, dass es nicht allzu sehr wehtat, und betete zu Gott, dass Trisse nur noch ein einziges Mal an die Wasseroberfläche käme, damit Mama ihn einfangen konnte. Trisse schaffte es, aber Mama tat komischerweise nichts, um ihn zu erreichen. Sie trieb mit geschlossenen Augen auf dem Rücken, ein Stückchen vom Ufer entfernt, während der Kater endgültig unter der Wasseroberfläche verschwand.
Tor stand mittlerweile ruhig und schweigend ganz nahe am Wasser und beobachtete seine Mutter, während sie sank. Lillemor sah nach dem Kater. Als ihr aufging, dass auch ihre Mutter in der Tiefe verschwand, war es schon zu spät. Lillemor sank heulend auf die Klippe und schlang die Arme um die Knie, sah immer noch auf das Meer, als würde sie auf ein Wunder hoffen. Tor stand regungslos etwas versetzt vor ihr und tat dasselbe. Vermutete sie. Denn nach einer Ewigkeit drehte er sich um und sagte mit einem Blick, der nichts anderes als Abscheu zeigte:
»Petzen ist dumm!«
Eine Wahrheit, die sie für den Rest ihres Lebens mit sich tragen würde. Wenn es denn eine Wahrheit war – es kam darauf an, was man daraus machte. Aber dass es riskant war, sich zu verplappern, würde sich noch mehr als einmal zeigen. Das erste Mal an diesem hinreißend schönen Apriltag.
Die Nacht von Montag auf Dienstag
»Kein Problem, ich bin auf dem Weg vom Training nach Hause … Die haben rund um die Uhr geöffnet. Ich … Na klar, ich kümmere mich drum … Am Samstag? Das schaffe ich leider nicht. Ich arbeite den halben Tag, und dann bin ich eingeladen zum … Aha? Nein, nicht diese Kajsa … Tatsächlich? Wie lustig! Helena und ich haben ihn letzte Woche gesehen … Nein, das war eher letztes Jahr zu Weihnachten … Jeden zweiten Dienstag …«
Sie drehte sich um, während sie weitersprach, und sah, dass der Mann verschwunden war. Er musste nach rechts in den Lotterivägen abgebogen sein, was ihr die Möglichkeit gab, einen Augenblick stehen zu bleiben. Erst als sie sich vergewissert hatte, dass sie nicht beobachtet wurde, hörte sie auf zu sprechen, stellte die Sporttasche auf den nassen Asphalt und steckte das Handy wieder in die Tasche. Sie erlaubte sich, eine Weile durchzuatmen, die Schleierwolken vor dem Halbmond über Hägerstensåsen zu betrachten und die Einsamkeit zu genießen. Ganz im Gegensatz zu den meisten Situationen in ihrem Leben war sie ihr in diesem Moment willkommen. Obwohl die Nacht kalt war, hing der Frühling in der Luft, und der Wind führte all die Düfte der Natur mit sich, die so lange geschlummert hatten. Aber zu dieser Jahreszeit erwachte nicht nur die Natur, sondern auch die Menschen fanden langsam aus ihrem Winterschlaf. Bald war es wieder Zeit für Verabredungen in sommerlichen Kleidern mitten in Stockholms unzähligen Straßenrestaurants. Aber für sie brachte dies nichts Gutes mit sich. Sie hatte ja niemanden, mit dem sie über einen Cafétisch hinweg in der Nachmittagssonne Vertraulichkeiten austauschen konnte.
Sie nahm einen neuen Anlauf, hängte sich die schwere Tasche über die andere Schulter und setzte sich in Bewegung. Sie überquerte den verlassenen Sparbanksvägen und ging wieder ein Stück zurück, bog nach rechts in den offensichtlich wohlhabenden Bezirk um den Förskottsvägen ab und betrachtete die dreistöckigen Häuser auf beiden Straßenseiten, während sie weiterging. Alte Mietshäuser, die in Eigentumswohnungen verwandelt worden waren, mit rot oder gelb verputzten Fassaden und abwechselnd grünen und roten Balkons. Die Lichter waren bereits überall gelöscht, mit Ausnahme der einen oder anderen Nachtlampe. Ungefähr wie erwartet also, wenn man bedachte, dass es drei Uhr nachts war, eine Zeit, zu der die meisten in einem solchen Wohngebiet angesichts des folgenden Arbeitstags im Bett lagen und schliefen. Wachsam ging sie zwischen zwei Häusern auf der linken Seite der Straße hindurch. Der Hof war hübsch und aufgeräumt mit einem geharkten Kiesgang zur Eingangstür hin, Tonnen für die Mülltrennung, Berberitzensträuchern und Rasenflächen. Sie schlich sich weiter zu der kleinen Waldpartie hinter den Häusern, sah sich um – nichts Lebendiges in Sicht. Und dort, an der Giebelseite eines der Häuser, fand sie, was sie gesucht hatte. Dicht an der Ecke, unter einem Fallrohr, das ein paar Meter über dem Boden endete, stand eine voluminöse Regentonne aus Plastik, die beinahe bis zum Rand mit schmutzigem Wasser gefüllt war. Sie stellte ihre Sporttasche ab und ließ ihren Blick ein letztes Mal nach rechts und links schweifen, bevor sie sich bückte und den Reißverschluss so weit aufzog wie möglich. Als sie die zwei Plastiktüten aufgeknotet hatte, steckte sie die Hände hinein, zog das Tier vorsichtig heraus und legte es neben der Tasche auf den Boden. Behutsam streichelte sie das schwarze Fell, bevor sie die Katze hochhob und sie vorsichtig über den Rand der Regentonne hängte, mit dem Gesicht und den weißen Vorderpfoten im Wasser.
»Vergib mir, kleine Miezekatze«, flüsterte sie, »aber du wirst nichts spüren.«
*
Gisela Bohn war wie gewohnt sehr früh aufgewacht. Es war schon viele Jahre her, dass sie einmal nach vier Uhr morgens aufgestanden war. Sie war sich nicht ganz im Klaren darüber, ob es an dem Schleudertrauma lag, das sie erlitten hatte, oder daran, dass sie einfach zu viel des Elends dieser Welt auf ihren Schultern tragen musste. Vermutlich war es eine Kombination aus beidem. Dieser ständige, bohrende Schmerz im Nacken und im Rücken und das menschliche Leiden, das in der Klinik von einem Klienten nach dem anderen auf ihr abgeladen wurde. Aber sie hatte sich längst von dem Gedanken verabschiedet, mehr als vier Stunden pro Nacht schlafen zu können, und nutzte die unvergleichliche Ruhe der frühen Morgenstunden stattdessen dazu, ein langes, heilendes Bad zu nehmen und die latenten Sorgen mit einem guten Buch zu verdrängen. Es gab nichts Schlechtes, was nicht auch etwas Gutes mit sich brachte. Wegen ihrer anteilnehmenden Art war sie eine hoch geschätzte Psychologin und wegen ihres Engagements und ihres geringen Ruhebedarfs eine sehr geschätzte Babysitterin für die einzige Tochter ihrer einzigen Tochter.
Saga war fünf Jahre alt und jetzt für einige Tage im Einfamilienhaus ihrer Großmutter in Svedmyra, während die Eltern ihren zehnjährigen Hochzeitstag in New York feierten. Sie war ein lebhaftes und neugieriges Kind, das gegen sieben Uhr abends völlig erledigt ins Bett fiel. Danach schlief sie mehrere Stunden ruhig, aber in den frühen Morgenstunden träumte sie am intensivsten, und es konnte passieren, dass sie im Schlaf sprach. Nicht selten setzte sie sich im Bett auf und konnte dann wohl artikulierte Sätze formulieren, die gleichzeitig einen vollkommen unzusammenhängenden Wortsalat bildeten. In ihrer Eigenschaft als Psychologin und Großmutter hatte Gisela möglicherweise einen Vorteil, aber nicht einmal ihr gelang es, mehr als winzige, zusammenhängende Fragmente herauszuhören.
Dieses Mal war Saga seltsamerweise schon vor Mitternacht unruhig geworden, hatte sich im Bett hin und her geworfen, während die Worte förmlich aus ihr herauspurzelten. Gisela hatte immer wieder nach ihr gesehen, und einmal hatte das Mädchen mitten auf dem Boden des Gästezimmers gestanden und mit einem scheinbar bewussten Blick wild gestikuliert, während sie entweder mit sich selbst, mit ihrer Großmutter oder mit einer imaginären dritten Person etwas verhandelte, was unmöglich zu deuten war. Gisela betrachtete das Spektakel mit gemischten Gefühlen. Natürlich war es ein lustiger Anblick, aber es ging auch immer mit einem gewissen Unbehagen einher, wenn man mit Menschen zu tun hatte, die sich außerhalb ihres eigenen Selbst befanden. Und in diesem Fall musste Gisela wohl auch einen Teil der Schuld auf sich nehmen. Sie hatte einen alten Kinderbuchklassiker herausgesucht und der Enkeltochter vor dem Einschlafen »Harold und die Zauberkreide« von Crockett Johnson vorgelesen. Ein großartiges kleines Bilderbuch aus den Fünfzigerjahren, das in der ganzen Welt geliebt wird. Sie selbst öffnete es mit einer gewissen Hassliebe, damals wie heute. Es war zwar ein Meisterwerk, aber war es auch ein Kinderbuch? Na ja … Sie selbst hatte es immer für ziemlich schrecklich gehalten. Mitten in der Nacht aufzuwachen und sich in eine vollkommen leere Welt hinauszubegeben, bewaffnet allein mit einem Stück Kreide – konnte das etwas anderes sein als ein Albtraum? Eine Sichtweise, für die ihr nie Verständnis entgegengebracht wurde, weder von Kindern noch von Erwachsenen. Erst jetzt vielleicht, falls die kleine Saga möglicherweise ihre Auffassung teilte.
Darüber dachte Gisela nach, als sie kurz vor vier endgültig aufstand. Saga, die schließlich bei ihr im Bett gelandet war, schlief jetzt ganz ruhig, und Gisela hatte die vage Hoffnung, dass es trotz – oder vielleicht auch wegen – der unruhigen Nacht noch eine Weile dauern würde, bis das Mädchen aufstand. Ihr selbst fiel es schwer, dieses verdammte Harold-Gefühl abzuschütteln. Das Gefühl, dass sie allein in einer großen und fremden Welt war – womit sie sich eigentlich wohlfühlte, vielleicht nicht tagsüber, aber während dieser gesegneten Morgenstunden. Aber jetzt war sie mit dem Gefühl erwacht, sich selbst in Harolds Welt zu befinden, mit den leeren Straßen zwischen den unbewohnten Hochhäusern und den unheimlich wirkenden Bäumen im kalten Licht des Mondes.
Leise schlich sie sich aus dem Zimmer, um Saga nicht zu wecken, ließ die Tür aber einen Spalt offen, damit sie sie hören konnte, wenn etwas sein sollte. Im Stockfinstern tapste sie die Treppe hinunter, durch den Flur und das Wohnzimmer bis in die Küche. In dem schwachen Licht, das von der Straßenbeleuchtung durch das Fenster fiel, sah der Raum farblos aus. Die Kiefernholzstühle am Küchentisch wirkten mit ihren geraden, hohen Rücken irgendwie autoritär und verurteilend, die Spüle hatte verschwommene Konturen, so dass man sie für ein Tier halten konnte, das dort lag und ihr auflauerte. Die Ecke neben dem Küchenfenster lag in vollständiger Dunkelheit. Der Zeitungskorb auf dem Boden und das Wandregal mit den Kochbüchern flossen zu einer kompakten und bedrohlichen Gestalt zusammen. Gisela Bohn hatte keine Angst vor der Dunkelheit, aber die unruhige Nacht und die schreckliche Welt, die der kleine Harold mit seiner Kreide anschaulich gemacht hatte, hatten ihre immer wieder unterbrochenen Träume geprägt und sich in ihr festgesetzt. Sie befand sich allein in einem Universum aus Leere und Schatten, und dieses Gefühl mochte sie überhaupt nicht. Als sie gerade das Licht über der Arbeitsplatte anschalten wollte, hörte sie ein Geräusch aus dem Wohnzimmer. Oder kam es aus dem Flur?
Es kam natürlich von oben. Sagas Schlaf war gestört worden, als Gisela das Schlafzimmer verlassen hatte – das Mädchen vermisste sicherlich die Wärme und die Gegenwart der Großmutter. Ohne Licht zu machen, verließ Gisela die Küche und ging durch das Wohnzimmer in den Flur. Sie warf einen Blick auf die Haustür, doch die war geschlossen, und alles sah in Ordnung aus. Als sie nach dem Treppengeländer griff und den Fuß auf die erste Stufe setzte, hörte sie erneut dieses Geräusch, diesmal kam es von hinten, bildete sie sich ein. Sie drehte sich um, doch ihre Augen konnten nichts anderes erkennen als das gewohnte Bild. Sie ließ ihren Blick vom Flur in die Dunkelheit des Wohnzimmers wandern. Dachte, dass es nur eine Sache gab, die schlimmer war, als allein in einer öden Welt zu sein: das mulmige Gefühl, nicht allein zu sein. Sie blieb eine Weile regungslos stehen und hielt die Luft an. Keine Bewegung, keine Geräusche. Doch, da war es wieder. Aber dieses Mal war sie sicher, dass das Geräusch aus dem Obergeschoss kam. Als ihr Blick auf die kleine Schattengestalt am oberen Ende der Treppe fiel, zuckte sie zusammen.
»Was machst du, Oma?«, fragte die kleine Saga.
Blöder Harold, dachte Gisela. Nie wieder.
»Bist du wach, mein kleiner Schatz? Das ist viel zu früh für dich.«
»Ich habe etwas gehört.«
»Das war ich. Ich wollte mich in die Badewanne legen«, antwortete Gisela und ging die Treppe hoch.
»Ist es noch Nacht?«
»Ja, es ist immer noch Nacht. Und du musst noch schlafen, damit du in ein paar Stunden ausgeruht zum Kindergarten gehen kannst.«
»Warum machst du das dann nicht?«
»Wenn man älter wird, schläft man nicht mehr so lange. So ist es einfach.«
Sie streichelte das vom Schlaf zerzauste Haar ihrer geliebten Enkeltochter und schob sie sanft ins Schlafzimmer und zurück ins Bett, in der Hoffnung, dass es gut genug war, auch wenn sie selbst nicht mehr darin lag.
»Kochst du jetzt Kaffee, Oma?«
»Nicht jetzt sofort, aber …«
»Doch, bitte.«
»Warum?«
»Es riecht so gut.«
»Und dann kannst du besser einschlafen?«
»Mhm.«
»Eine Tasse Kaffee wäre jetzt tatsächlich nicht verkehrt.«
Gisela küsste die Kleine auf die Stirn, saß noch eine Weile auf der Bettkante und streichelte ihre Wange, bis ihre Atemzüge tiefer wurden. Dann schlich sie sich wieder aus dem Zimmer und ging hinunter in die Küche, wo sie zuerst die Lampe über der Arbeitsplatte und dann die Kaffeemaschine einschaltete. Die Tasse Kaffee konnte warten, bis sie fertig gebadet hatte, aber sie konnte durchaus nachvollziehen, dass der Duft allein schon die Welt zu einem besseren Ort machte. Geblendet von der Küchenbeleuchtung ging sie mit einem leichten Schaudern in den Flur zurück, dieses Mal mit etwas schnelleren Schritten. Sie zeichnete einen langen, geraden Weg, damit sie sich nicht verirren konnte, dachte sie, während sie sich zwang, auf ihrem Weg am Wohnzimmer vorbei keine nervösen Blicke nach rechts oder links zu werfen. Auch in der Dunkelheit des Flurs sah sie sich nicht um, als sie die Tür zum Badezimmer im Erdgeschoss öffnete. Sie schaltete die Deckenbeleuchtung ein, beugte sich zum Badewannenhahn und drehte ihn auf. Die angespannte Stille wurde vom alles übertönenden Geräusch des brausenden Wassers unterbrochen. Vor ihrem inneren Auge sah sie das Bild von sich selbst in Form einer weiblichen Strichfigur mit einem Stück Kreide in der Hand, wie sie zwei zylinderförmige geometrische Figuren vor einem weißen Hintergrund zeichnete. Davon gingen viele schnell gezogene Striche in verschiedene Richtungen aus. Strahlen. Licht. Darunter eine Anzahl waagerechter Linien, die von senkrechten gekreuzt wurden: Quadrate in einem einfachen Karomuster. Kacheln, weiße Kacheln. Und dann, vor diesem Hintergrund, ein Rechteck mit deutlicher markierten Konturen. Ein liegendes Rechteck aus weißen Kacheln vor weißen Kacheln. Am einen Ende eine Figur, die wie ein umgedrehtes »L» mit rundlichen Ecken aussah, aus denen Strahlen strömten. Mehr Licht? Nein, Wasser. Und was dann?
Neonröhren. Weiß gekachelte Pritschen vor weißer Kachelwand. Wasserhahn. Alles in Weiß mit roten Details. Was dann?
Ein Obduktionstisch.
Reiß dich zusammen. Eine normale Badewanne in einem gewöhnlichen Badezimmer. In die sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben nicht hineinlegen wollte.
Der beinahe ohrenbetäubende Lärm, mit dem das Wasser in das Emaillebecken rauschte, hallte zwischen den Wänden. Gisela stand auf, und damit das Mädchen nicht wieder aufwachte, schloss sie die Tür zum Badezimmer, während sich die Wanne füllte. Das Geräusch zerrte auf eine Weise an ihren Nerven, die sie nicht gewohnt war. Sie schienen blank zu liegen, und Gisela wollte, dass dieses Geräusch endlich vorbei war. Doch sie riss sich zusammen und ertrug den Lärm. Die Unlust. Zog sich das Nachthemd und die Unterhose aus, faltete beides zusammen und legte den kleinen Stapel ordentlich auf die Bank. Sie stellte sich vor den Spiegel und betrachtete eine etwas faltige Einundsechzigjährige. Ein bisschen zu mager, ein bisschen zu blass, mit deutlichen Spuren, die davon zeugten, dass sie zu lange allzu großen Belastungen ausgesetzt gewesen war. Sorgfältig kämmte sie ihr langes, graues Haar, das zu färben sie sich standhaft geweigert hatte, seit es vor vielen Jahren seinen Glanz und seine dunkelbraune Farbe verloren hatte. Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung fasste sie es schließlich in einer Hand zusammen und knotete es mit der anderen zu einem dicken und perfekt geformten Dutt oben auf dem Kopf. Anschließend reinigte sie die Bürste mit der linken Hand und warf eine Handvoll Haare in die Toilette. Mittlerweile war die Wärme in der Badewanne auf das gewünschte Niveau gestiegen.
Sie drehte den Hahn zu, öffnete die Badezimmertür und lauschte. Kein Laut war zu hören; die Enkeltochter schien dort oben endlich zur Ruhe gekommen zu sein. Ganz gleich, ob jetzt der Duft des Kaffees die Ursache dafür gewesen war oder eher die Erschöpfung nach einer anstrengenden Nacht. Gisela ließ die Tür einen Spalt offen und stieg – nach wie vor mit einem unbestimmten Gefühl des Unbehagens und einem ganz deutlichen Gefühl der Verlassenheit – über die Badewannenkante und setzte die Füße in das warme Wasser. Sie ging in die Hocke, hielt sich an den Kanten fest und ließ sich vorsichtig in die Wanne sinken, damit die Haut sich an die hohe Temperatur gewöhnen konnte. Sie holte tief Luft, atmete langsam aus und schloss für eine Weile die Augen, während der Schmerz in ihrem Nacken nachließ.
Sie öffnete die Augen wieder, als das Schloss klickte.
Zwischen ihr und der geschlossenen Tür stand plötzlich eine ältere Version ihrer selbst. Das war ihr erster Gedanke. Der zweite war, dass die schwarz gekleidete Frau mit den langen grauen Haaren eine furchteinflößende Hexenmaske trug. Die Angst packte sie, schnürte ihr die Kehle zu, sodass ihr Atem stockte. Mit aufgerissenen Augen saß Gisela wie versteinert in der Badewanne, ohne einen Ton herausbringen oder einen Gedanken fassen zu können. Nachdem eine gefühlte Ewigkeit vergangen war, machte die unheimliche Gestalt einen Schritt in ihre Richtung. Gisela rührte sich nicht vom Fleck. Ein weiterer Schritt, und sie war vollkommen gelähmt. Erst beim dritten und letzten Schritt begannen sich ihre Gedanken zu sortieren.
Sie würde sterben.
Gisela war sich jetzt vollkommen im Klaren darüber, dass ihre letzte Stunde geschlagen hatte. Das Einzige, was sie vor sich hatte, war ein schrecklicher und qualvoller Tod, und die kleine Saga würde diejenige sein, die sie fand. Und diese entsetzliche Erkenntnis brachte ihren Körper dazu, aus dem gelähmten Zustand zu erwachen, brachte Gisela dazu, sich mit aller Kraft aus der Wanne zu stemmen. Aber die eingedrungene Frau war schon über ihr. Zwei schwere Hände landeten auf ihren Schultern, und sie war vollkommen chancenlos, als sie in die Wanne zurückgedrückt wurde. Sie bekam keinen Laut heraus, bevor sie wieder auf dem Rücken lag, und kräftige Hände, die auf ihrem Brustkorb lagen, sie unter Wasser drückten. Zuerst versuchte sie sich freizustrampeln, aber ihre verzweifelten Versuche waren hoffnungslos, weil der ganze Oberkörper unter Wasser gedrückt wurde. Schließlich ergab sie sich, erlaubte es ihrem Körper aufzugeben und umarmte den kommenden Tod. Und erst jetzt, als das Leben aus ihr herauszurinnen begann und das Wasser still über ihr lag, sah sie das Lächeln.
Gisela Bohn war sehr müde, und die Sicht durch das Badewasser war verschwommen, aber in den Augen des Todes spielte zweifellos ein spöttisches Lächeln.
*
Als Saga den Fuß auf die oberste Stufe setzte, hörte sie, wie unten die Badezimmertür geschlossen wurde. Sie hatte wohl noch eine Weile geschlafen, obwohl es sich nicht so anfühlte, und während der Zeit hatte ihre Oma fertig gebadet. Schade. Saga hatte eigentlich fragen wollen, ob sie gemeinsam baden könnten. Während sie vorsichtig nach unten ging – mit jedem Schritt immer nur eine Stufe und die Hand am Geländer, damit sie nicht in der Dunkelheit stolperte – hörte sie Omas Schritte von unten. Wie sie vom Badezimmer durch den Flur ging und den Schlüssel von der Kommode nahm, bevor sie zur Haustür ging. Saga vermutete, dass sie die Zeitung holen wollte, wie sie es immer tat. Als sie den Fuß der Treppe erreicht hatte und mit ihren nackten Füßen auf dem kalten Steinboden stand, konnte sie ihre Oma in der dunklen Ecke vor der Tür stehen sehen. Ihr langes Haar, das in dem Lichtstreifen, der durch das kleine Fenster in der Haustür hereinfiel, ein bisschen aufleuchtete.
»Ist jetzt schon Morgen, Oma?«, fragte Saga. »Müssen wir los zum Kindergarten?«
*
Noch eine ruhige Nacht ging zu Ende. Es war nach wie vor beinahe windstill, und nur wenn eines der wenigen nachtaktiven Fahrzeuge vorbeituckerte, schaukelte das Boot ein wenig und verursachte ein quietschendes Geräusch in der Vertäuung.
Lillemor wusste nicht, ob sie das Wasser liebte oder hasste. Es hatte ihr sehr wehgetan, erschreckte sie aber nicht im Geringsten. Im Wasser fühlte sie sich unsterblich. Dass sie früh erfahren hatte, welche Kräfte das Wasser haben konnte, schreckte sie nicht ab, es forderte sie nur zum Kampf heraus. Sie würde niemals diesem Element zum Opfer fallen; dagegen konnte man sich wehren. Man hielt sich von ihm fern, wenn es bedrohlich war, und wenn einem das nicht gelang, sollte man gut vorbereitet sein. Und sie hatte geübt. Sie hatte geübt, schnell zu schwimmen, weit zu schwimmen und vor allen Dingen: unter Wasser die Luft anzuhalten. Als Kind hatte sie Geschichten über Perlentaucher in südlichen Gefilden gehört, die länger als sieben Minuten unter Wasser bleiben konnten. In diesen sieben Minuten tauchten sie darüber hinaus in große Tiefen hinab und wieder hinauf, ohne das Bewusstsein zu verlieren. Sie selbst hatte es nie in die Tiefe gezogen, es ging ihr nur um die Zeit. Ihr primäres Ziel bestand darin, länger unter Wasser zurechtzukommen als alle anderen. Vielleicht nicht gerade im Vergleich mit den Perlentauchern in der Südsee, aber zumindest, wenn es die Leute in ihrer Umgebung betraf.
Schon bald nachdem sie Waise geworden war, begann sie zu trainieren. Mit dem Bild ihrer Mutter vor Augen erreichte sie schnell eine Minute, bald auch zwei. Als sie die Dreiminutengrenze erreichte, gelang es ihr, diese noch ein bisschen weiter zu dehnen, aber mit drei Minuten und zwanzig Sekunden gab sie sich schließlich zufrieden. Keiner der anderen kam auch nur in die Nähe dieser Zeiten, und das Wasser war ein mächtiger Freund geworden, der ihr niemals schaden würde.
Mittlerweile hatte sie insgesamt eine etwas reifere Einstellung gegenüber Gefahren, aber die Faszination, die das Wasser in ihr auslöste, wollte niemals vergehen. Sowohl als Kind als auch als Erwachsene konnte sie stundenlang dasitzen und aufs Meer hinausstarren, auf einen von Stockholms Wasserarmen, einen kleinen Binnensee, einen Fluss oder einen plätschernden Bach.
Sie musste plötzlich wieder an die Katzen denken, worauf sich ihr Magen verkrampfte. Die erste Katze war in Västberga zu Hause gewesen und hieß Pascal. Er war ein grau gestreifter norwegischer Bauernkater gewesen, der sehr gesellig und an das Leben im Freien gewöhnt gewesen war. Seine Besitzerin war eine alleinerziehende dreifache Mutter, deren Mann erst vor Kurzem bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen war. Die drei Töchter, die alle noch im Kindergartenalter waren, waren außer sich vor Trauer. Erst hatten sie ihren Vater verloren, und jetzt war ihre Katze zuerst misshandelt und dann in einem Blumenkübel am Bäckvägen in Hägerstensåsen ertränkt worden. Lillemor litt mit der Familie, aber was hätte sie tun sollen? Jetzt gab es kein Zurück mehr.
Aber im frühen Sommer des Jahres, in dem sie dreizehn geworden war, hätten Dinge anders laufen müssen, das war ihr mittlerweile klar.
Lillemor hatte keinen Vater, bei dem sie nach dem Tod der Mutter hätte wohnen können. Sie war groß genug, um zu begreifen, dass es natürlich irgendwo einen Vater geben musste, aber wer es war, das war ein Geheimnis, das die Mutter mit ins Grab genommen hatte. Ebenso, wer der Vater des Kindes in ihrem Bauch war. Zumindest Lillemor wusste es nicht. Tor dagegen hatte einen Vater. Nicht auf dem Papier, aber Mama hatte ihm erzählt, dass er Yngve hieß und keine Kinder mochte. Dass er ein Arschloch war und keine Verantwortung übernehmen wollte, dass er gar nicht nett zu ihr und auch nicht nett zu Tor gewesen war. Es wäre besser, keinen Vater zu haben als diesen verdammten Yngve. Soll er doch in der Hölle verrotten.
Es gab unterschiedliche Höllen. Eine von ihnen war zu Hause bei Tante Nettan, wo Tor und Lillemor als Pflegekinder untergebracht wurden, nachdem ihre Mutter ertrunken war. Tante Nettan war mit Onkel Örjan verheiratet, der Seemann war und nur selten nach Hause kam. Aber wenn er zu Hause war, dann für eine längere Zeit, in der er sich eigenen Aktivitäten widmete oder aber überhaupt nichts tat. Wenn Lillemor ihn sah, saß er meistens vor dem Fernseher, mit den Füßen auf dem Tisch und einem Bier in der Hand, völlig uninteressiert an allem, was mit Hausarbeit oder Familienleben zu tun hatte. Tante Nettan und Onkel Örjan hatten zwei Kinder, Björn und Fredrik. Sie waren Zwillinge und im selben Alter wie Tor. Darüber hinaus waren alle drei Klassenkameraden und wurden mehr oder weniger als Drillinge betrachtet. Die Jungen teilten sich ein Zimmer; die Zwillinge schliefen in einem Etagenbett und Tor auf einer Matratze auf dem Boden. Es konnte Stunden dauern, bis sie am Abend zu Ruhe kamen, und Lillemors Zimmer lag direkt daneben. Dort lag sie und fühlte sich einsam und ausgeschlossen, während sie ihren Gesprächen zuhörte, bis sie einschlief. Sie musste mit ansehen, wie sich ihr geliebter Bruder immer mehr in Richtung der Zwillinge orientierte und immer weniger ihr eigener Bruder war. Aber sie konnte ja eigentlich keine Ansprüche stellen an ein Kind, das keine Eltern mehr hatte und als Vierjähriger zur Waise geworden war. Er passte sich sehr viel besser an die Umstände an, als sie selbst dies konnte, und Lillemor konnte nicht anders, als ihn dafür zu bewundern. Er wuchs und nahm immer mehr Platz ein, steckte sich sein Revier in der neuen Familie ab, und niemand schien etwas dagegen zu haben. Er war einer von ihnen – sie war und blieb eine Fremde. Ein Eindringling. Ein ungebetener Gast, der seinen Platz nicht kannte, sondern immer nur forderte und forderte.
Lillemor weinte sich in den ersten Jahren ein ums andere Mal in den Schlaf. Sie vermisste ihre Mutter und das Leben, das sie geführt hatten, bevor der Unfall alles auf den Kopf gestellt hatte. Aber sie machte nicht Tor für das verantwortlich, was passiert war, dieser Gedanke wäre ihr nie gekommen. Er war nur ein lebhaftes Kind, das nicht über die Konsequenzen seines Handelns nachdenken konnte, selbst wenn sie schrecklich waren. Allerdings verletzte es sie, wenn er auf Aufforderung der Zwillinge immer wieder erzählte, wie es zu dem Unfall ihrer Mutter gekommen war. Wenn er es auf irgendeine Weise wieder einmal schaffte, die Schuldfrage in Lillemors Richtung zu drehen. Klar konnte das Katzenvieh schwimmen, das konnte Tiger ja auch. Genau wie alle anderen Katzen, soweit es die Intelligenzija im Jungenzimmer wusste. Wäre die Petze Lillemor nicht gewesen, wäre es nie so schlimm geworden. Typisch Mädchen, wegen des kleinsten Mists nach Mama zu rufen. Seht, was dann passiert ist. Wenn man petzt, kann das Schlimmste passieren. Jemand kann sterben. Katze, Mensch oder beides.
Jungs seien eben Jungs, meinte Tante Nettan, als Lillemor sich über die Herzlosigkeit der Jungen beklagte. Und hätten sie nicht vielleicht auch recht? Petzen sei eben unanständig. Und sie sei eben die kleine Kopie ihrer Mutter, Lillemor. Mit kaum verhohlener Verachtung spuckte Nettan den Namen aus. Übereifrig und quengelig – das sei Lillemor eben –, und sie heule wie ein altes Scheunentor. Dabei sei sie doch jetzt ein großes Mädchen. Mit den kleinen Jungs sei es etwas anderes. Von ihr werde einfach mehr erwartet, das sei doch nicht so seltsam? Und überhaupt solle sie froh sein, dass sie hier überhaupt wohnen dürfe, das sei ja auch nicht selbstverständlich. Ein bisschen Dankbarkeit in Form von Hilfsbereitschaft und besserer Laune wäre angebracht, statt dieser hinterlistigen Miene und dieser schrecklichen, manipulativen Art, die sie an den Tag lege. Petzen sei ungehörig, und jetzt habe sie es schon wieder getan. Ob sie denn nichts gelernt habe! Bald würde wahrscheinlich der arme Tiger den Löffel abgeben, so wie Lillemor die ganze Zeit herumlief und alle verpetzte.
Tante Nettan wusste gar nicht, wie recht sie damit hatte.
Mai 1989
Lillemor war dreizehn und die Jungen elf, als die Schule im Frühjahr einen Wandertag anberaumte, der allerdings am Mittag schon endete. Auf dem Programm stand ein Orientierungslauf. Die Wettervorhersage hatte Regen angekündigt, aber es wurde ein warmer und sonniger Vormittag, und nach einem schönen Frühling war der Boden trocken. Die Gummistiefel, in die die meisten von ihnen am Morgen gestiegen waren, hatten sich als überflüssig herausgestellt.
Die Kinder wurden in Dreiergruppen in den Wald geschickt, ausgerüstet mit einem Fresspaket, einer Karte und einem Kompass. Tor war wie immer mit Björn und Fredrik zusammen, Lillemor mit zwei gleichaltrigen Mädchen. Einige Male während des Wettbewerbs hatten sich Lillemors Wege mit denen von Tor und den Zwillingen gekreuzt. Sie waren laut und wild, nahmen weder den Wettbewerb noch die Orientierungsübung besonders ernst. Statt zu versuchen, die Kontrollpunkte zu erreichen, hatten sie zumeist miteinander herumgealbert oder mit denjenigen, denen sie unterwegs begegnet waren. Es war zwar gut, dass Tor sich angepasst und einen Platz in seinem neuen Umfeld gefunden hatte, aber Lillemor mochte es nicht, wie diese Jungen ihre Umgebung ständig mit harten, unanständigen Worten oder mit Faustschlägen schikanierten. Wenn es nicht um ihren Bruder gegangen wäre und um ihre Nähe zu ihm, hätte sie mehr als gerne in einer anderen Familie gelebt und Tante Nettan nicht länger mit ihrer Existenz behelligen müssen.
Als sie und ihre Mannschaftskameradinnen ins Ziel gekommen waren und ihre Butterbrote gegessen hatten, begann sich die große Kinderschar aufzulösen. Tor und die Zwillinge waren noch nicht im Ziel aufgetaucht, und Lillemor wusste, dass es unangenehme Konsequenzen haben würde, wenn die Lehrer, die vor Ort waren, gezwungen wären, den ganzen Nachmittag nach ihnen zu suchen. Darum trennte sie sich von ihren Freundinnen und ging stattdessen in den Wald zurück, um nach den Jungen zu suchen.
Das Gebiet, in dem sie sich bewegt hatten, war im Grunde nicht besonders groß. Ein elektrisch beleuchteter Pfad, den sie schon öfter entlanggelaufen war, um ihre Lungenkapazität zu erhöhen, schlängelte sich durch das Gelände. Wenn sie sich an die Laufspur hielt, konnte sie sich nicht verirren, auch wenn sie die Karte und den Kompass bereits abgegeben hatte. Außerdem hatte sie eine ziemlich klare Vorstellung davon, wo die Jungen sich vermutlich aufhielten. Wenn sie denn überhaupt noch im Wald waren und nicht auf den Wandertag gepfiffen hatten und in die Stadt verschwunden waren. Was sie schon mehr als einmal getan hatten, als es ihnen zu langweilig geworden war, die Schulbank zu drücken. Wenn sie allerdings noch im Wald waren, dann wahrscheinlich unten am Bach. Ein Ort, den sie nicht hatten besuchen dürfen, als sie noch kleiner gewesen waren, und an dem sie deshalb jetzt den größten Teil ihrer unbeaufsichtigten Zeit verbrachten. Ein reißender und steiniger kleiner Wasserlauf mit teilweise bis zu vier Meter hohen, steilen und felsigen Uferböschungen. Ein Heiligtum im Wald, das sich, soweit Lillemor es verstand, besonders dafür eignete, Krieg zu spielen, Insekten zu quälen, Pornozeitschriften durchzublättern und mit Streichhölzern, Knallern, Zigaretten und anderen verbotenen Dingen zu experimentieren.
Sie folgte der Laufstrecke, bis sie die Ecke erreichte, die dem Bach am nächsten lag. Dort blieb sie stehen und meinte, tatsächlich in einiger Entfernung Stimmen zu hören. Sie verließ die mit Holzspänen bedeckte Spur und schlug sich geradewegs in die Heidelbeersträucher – doch, da waren tatsächlich Leute am Bach. Sie entdeckte zwei Gestalten, die sich ein Stück vor ihr zwischen den Bäumen bewegten. Eine gelbe und eine olivgrüne. Als sie genauer hinsah, bemerkte sie, dass sie liefen – dass sie auf sie zuliefen. Eine von ihnen erkannte sie wieder: Es war Björn mit seinem senfgelben T-Shirt, und jetzt warf er sich auf den anderen Jungen. Es sah aus, als würden sie irgendein gewalttätiges Spiel spielen, bei dem sie so taten, als würden sie kämpfen – den Unterschied hätte man ohnehin kaum ausmachen können. Jetzt erblickte sie auch Tor und Fredrik, die aus den Schatten auftauchten. Gemeinsam packten sie den Jungen mit der grünen Regenjacke an Armen und Beinen und schleppten ihn mit vereinten Kräften zurück zum Bach. Was hatten sie vor – war das Spiel oder Ernst? Vermutlich wussten sie nicht einmal selbst, wo die Grenze verlief.
Im Laufschritt und von Baum zu Baum, um nicht entdeckt zu werden, eilte Lillemor durch das Gestrüpp hinüber zum Bachlauf. Die Jungen verschwanden mit ihrer Beute hinter einem Hügel, Lillemor jagte ihnen hinterher. Jetzt konnte sie in einiger Entfernung das Geräusch der Stromschnellen ausmachen, das Dröhnen, mit dem sich das Wasser in seinem Vorwärtsdrang gegen die Felsbrocken stürzte. Hier oben war die Strömung nicht so bedrohlich, die Böschungen nur ein, zwei Meter hoch, ohne Felsen, grasbewachsen und weich.
Als sie den Hügelkamm erreicht hatte, auf dem sie die Jungen zuletzt gesehen hatte, hielt sie inne. Sie waren nicht mehr als zehn Meter vor ihr: Björn und Fredrik hatten ihr den Rücken zugewandt, vornübergebeugt und mit den Händen auf den Knien. Tor lag auf dem Bauch im Moos und sah zum Bach hinunter. Der vierte Junge war nicht zu sehen. Was war passiert? Ihr Bruder und ihre Cousins hatten ihn doch nicht etwa die Böschung hinuntergeworfen? Wenn doch, wäre es zwar nicht besonders gefährlich, aber trotzdem. Dort unten strömte der Bach, und er war voller spitzer Steine und großer, moosbewachsener Felsblöcke.
Und voller Wasser.
Nein, Lillemor ging davon aus, dass der Junge sich befreit hatte und davongelaufen war. Jetzt stand Tor auf und nahm seine Cousins mit bis zu dem Pfad, der zum Wasser hinunterführte. Er lag nicht mehr als fünfzig Meter weiter oberhalb an dem Hang, aus dem der Bach entsprang. Lillemor blieb auf dem Hügel hocken und sah ihnen nach, bis sie hinter der Uferböschung verschwunden waren. Danach schlich sie sich vor bis zur Kante und entdeckte den Jungen im selben Moment, als die drei ihn unten erreichten. Er lag völlig regungslos und mit geschlossenen Augen im flachen Wasser auf dem Rücken – so viel konnte sie sehen, bis Tor und die Zwillinge sich in ihr Blickfeld stellten, Seite an Seite am Ufer, direkt vor dem Jungen mit der grünen Regenjacke. Lillemor wurde von weit entfernten Erinnerungen überrollt: Vogelgezwitscher, der Duft der wiedererwachten Vegetation, die Sonne, die im Wasser glitzerte – all das in scharfem Kontrast zu der Stille und dem drückenden Gefühl, dass alles in eine Katastrophe gemündet war.
»Scheiße«, sagte Björn. »Wir müssen ihn rausziehen.«
»Er ist tot«, stellte Tor nüchtern fest.
»Ich laufe und hole Hilfe«, sagte Fredrik mit zitternder Stimme.
»Er ist tot«, wiederholte Tor, immer noch mit dem Blick auf dem Jungen im Wasser. »Kapierst du das nicht?«
»Wir fassen gar nichts an«, sagte Björn und warf Tor einen fragenden Blick zu.
»Genau.«
»Ich habe nichts getan«, sagte Fredrik, und Lillemor konnte seiner Stimme anhören, wie nahe er den Tränen war.
Fredrik war der weichere der Zwillinge, und er hatte nicht dieselbe Kontrolle über seine Gefühle wie die anderen beiden. Er zog sich ein paar Schritte zurück, drehte sich um und begann den Pfad hinaufzulaufen.
»Es war ein Unfall!«, rief Björn ihm nach. »Wenn du etwas sagst, landen wir alle im Gefängnis!«
»Wenn du etwas sagst, bist du tot!«, verdeutlichte Tor, ohne den Blick vom leblosen Gesicht des Jungen loszureißen.
Lillemor fragte sich, was sich in seinem Inneren abspielte, ob sich seine Erinnerungen ebenso meldeten wie bei ihr, ob seine Tatenlosigkeit im Grunde eher Unwille war oder ob sie eher ein Zeichen von Angst oder von Faszination war. Sie wusste, dass Menschen manchmal noch wiederbelebt werden konnten, nachdem sie zwanzig Minuten im Wasser gelegen hatten, also beschloss sie, das Kommando zu übernehmen.
»Wir müssen ihn rausziehen!«, schrie sie, und konnte gerade noch sehen, wie Tor und Björn zusammenzuckten und ihre Gesichter zu ihr drehten, bevor sie zu laufen begann.
Sie lief zu dem Pfad und stieß dort auf einen panischen Fredrik, der kaum mehr als einen kurzen Blick mit ihr wechselte, bevor er sich aus dem Staub machte. Eine Minute später traf sie auf Björn und kurz danach auch auf Tor, der ebenso hastig davoneilte.
»Was habt ihr getan? Habt ihr ihn runtergeworfen?«, rief sie, als sie sich auf dem Pfad begegneten.
»Wir haben nichts gemacht«, hörte sie Tor hinter sich antworten, während sie weiterlief. »Er ist selber schuld.«
Lillemor überlegte, wie viel Zeit vergangen sein mochte, als sie ins Wasser stieg, um den leblosen Körper an Land zu zerren. Zwei Minuten? Drei? Noch gibt es Hoffnung, dachte sie, als ihr plötzlich klar wurde, wem dieses blasse Gesicht gehörte. Der Junge im Wasser ging in die fünfte Klasse und war ziemlich groß für sein Alter – etwas, was er öfter ausnutzte, und immer mit einem gemeinen Grinsen. Es war Danne, um den sie während der Pausen und auf dem Schulweg einen weiten Bogen machte. Danne Bengtsson, der ihr hässliche Sachen zurief, an die sie am liebsten nicht denken wollte, und der immer und überall auftauchte und Körperteile betatschte und begrabschte, die niemand anfassen durfte. Und jetzt stand sie hier und hatte die Macht. Über sein Leben. Oder seinen Tod.
Als sie eine Weile später ihren Blick auf den Hügel richtete, aus dem der Bach entsprang, sah sie etwas, das sich zwischen den Bäumen oberhalb der Böschung bewegte. Irgendetwas leuchtete orange im Wald und war zweifellos in ihre Richtung unterwegs. Einer der Lehrer natürlich, der mit aller Wahrscheinlichkeit nach Danne Bengtsson suchte, der seinen Kameraden abhandengekommen war. Lillemor reagierte sofort und wusste, was sie zu tun hatte. Sie erhob sich aus der Hocke und rannte zum Pfad und den Hügel hinauf. Als sie den Kamm erreichte, war er schon so nahe, dass sie ihn erkennen konnte: einer der Sportlehrer an der Grundschule – der jüngere von beiden, mit dem Bart.
»Ein Junge aus der Fünften ist in den Bach gefallen!«, brüllte sie durch den Trichter, den sie mit den Händen um ihren Mund geformt hatte. »Ich glaube, er ist ertrunken!«
Der Lehrer war stehen geblieben, um ihr zuzuhören, aber jetzt nahm er Tempo auf und pflügte in rasender Geschwindigkeit durch das Gestrüpp.
»War es die Björnbande?«, rief er, als er sich der Stelle näherte, an der Lillemor stand.
Diesen Begriff hatte Lillemor noch nicht gehört, aber sie verstand, wen er meinte, und schüttelte den Kopf. Als er an ihr vorbeikam, klopfte er ihr auf den Rücken, ohne abzubremsen, und befahl ihr, die Beine in die Hand zu nehmen und Hilfe zu holen.
»Ich wollte ihn retten!«, rief Lillemor ihm nach, und mit einer Hand in der Luft zeigte er, dass er sie verstanden habe.
Vielleicht war es auch eine Bestätigung dafür, dass sie korrekt gehandelt hatte – das hoffte sie zumindest aus dem Winken herauslesen zu können.
Es herrschte ein enormer Betrieb. Die versprochenen Regenwolken rollten schließlich doch noch über den Wald, und Lillemor musste den Nachmittag im verregneten Zieleinlauf verbringen, während immer mehr Leute aus allen Richtungen heranströmten. Rettungspersonal, Notärzte und Polizei, Lehrer, Eltern, Journalisten und Neugierige wirbelten um sie herum. Viele hatten wichtige Dinge zu tun, kluge Worte zu sagen. Manche weinten und jammerten, andere trösteten und unterstützten. Lillemor saß etwas abseits auf einem Stein und betrachtete den Zirkus. Die klugen Worte schienen nicht für sie bestimmt – Lillemors Anteil an den Ereignissen war schnell vergessen gewesen. Der Einzige, der ein paar Worte mit ihr gewechselt hatte, war der erkältete Polizist in dem durchnässten Mantel gewesen. Er hatte wissen wollen, was sie gesehen und wie sie gehandelt habe. Ob sie Beobachtungen gemacht habe, die für die Ermittlungen interessant sein könnten.
Das hatte Lillemor nicht. Bei ihrem Spaziergang durch den Wald habe sie den Jungen mit der grünen Regenjacke auf dem Rücken im Bach liegen sehen. Sie habe das seltsam gefunden und sei dorthin gelaufen, um ihn an Land zu ziehen und zu beatmen. Da habe sie den Lehrer oben im Wald entdeckt, ihm das Wenige erzählt, was sie wusste, und die Verantwortung für den Jungen ihm überlassen, während sie nach oben gelaufen sei, um Hilfe zu holen. Eine Aussage, an der sie unerschütterlich festhielt, auch bei späteren Vernehmungen.
Lillemor traf ihren Bruder und ihre Cousins an diesem Tag nicht mehr. Als sie zur Schlafenszeit nach Hause kam, lagen sie schon in ihren Betten. Unschuldig wie kleine Lämmer waren sie ohne Proteste ins Bett gekrochen, und als sie selbst unter die Decke schlüpfte, konnte man nicht einmal ein Flüstern aus dem Jungenzimmer hören. Als sie am nächsten Morgen aufwachte, waren sie bereits zur Schule gegangen, aber in der Mittagspause standen sie vor ihr, packten sie und zogen sie zu den Fahrradständern hinter der Turnhalle. Sie hatte diese Konfrontation zwar befürchtet, hatte sich aber nicht wirklich auf diese Begegnung mit den drei unberechenbaren Radaubrüdern vorbereiten können.
»Du hättest nicht petzen sollen«, sagte Björn und drückte sie mit den Händen um ihren Hals an die Ziegelwand.
»Ich habe nicht gepetzt«, antwortete Lillemor gefasst.
»Und wer hat dem Sportlehrer Bescheid gesagt? War das vielleicht jemand anderes, obwohl alle sagen, dass du es warst?«
»Er hat mich unten am Bach entdeckt, was sollte ich da sagen? Dass ich diesen toten Jungen direkt vor mir nicht gesehen hätte?«
»Und was hast du gesagt?«, fragte Tor und musterte sie mit seinem harten, durchdringenden Blick.
Björn ließ sie los, und sie sank an der Wand zusammen. Fühlte sich plötzlich noch angreifbarer, seit sein Griff sie nicht mehr vor den anderen schützte. Tor trat ihr ans Bein und forderte eine Antwort.
»Ich habe gesagt, dass er in den Bach gefallen ist«, sagte Lillemor leise. »Dass er vielleicht ertrunken ist.«
»Wie soll er denn da ertrunken sein?«, fragte Fredrik mit einem Grinsen. »Sein Kopf war doch noch nicht einmal unter Wasser.«
»Doch, das war er!«, keifte Björn und schlug seinem überraschten Bruder mit der Faust in den Bauch.
»Oh, Scheiße …«, jammerte der und klappte zusammen.
»Hast du etwas von uns gesagt?«, fragte Tor ungerührt weiter.
»Nein«, antwortete Lillemor wahrheitsgemäß.
»Was hat der Lehrer gesagt? Hat er gesagt, dass er uns gesehen hat?«
Lillemor schüttelte den Kopf.
»Er hat mich nach der Björnbande gefragt«, räumte sie mit einem ängstlichen Blick auf Björn ein. »Ich habe gesagt, dass ihr nichts damit zu tun hattet. Dass Danne vermutlich einfach nur in den Bach gefallen wäre.«
»Die Björnbande? Was sagst du jetzt, du kleiner Scheißer«, antwortete Björn mit einem Lachen und ließ seine Hand über den Hinterkopf seines Bruders gleiten, der sich nach dem Schlag immer noch nicht wieder aufgerichtet hatte.
»Du hättest nicht petzen sollen«, sagte Tor scharf, ohne größere Notiz davon zu nehmen, was seine Cousins taten.
»Ich habe nicht gep…«
»Du hättest einfach weggehen sollen«, fiel ihr Tor ins Wort. »Du hättest dich nicht die ganze Zeit in alles einmischen sollen.«
Und dann packte er sie an der Nase und drehte sie um. Es tat so weh, dass die Tränen zu rinnen begannen, obwohl sie nicht weinte.
»Das war doch euretwegen«, murmelte Lillemor hinter den Händen, die sie automatisch vor die Nase und den Mund geschlagen hatte. »Ich wollte nicht, dass euch etwas Schlimmes passiert.«
»Pass bloß auf, dass das Katzenvieh nicht plötzlich den Arsch zukneift«, höhnte Fredrik, der nach der harten Behandlung plötzlich wieder obenauf war. »Blöde Petzliese.«
Dann verpasste er ihr eine Breitseite auf den Oberschenkel und machte sich davon. Pass lieber auf dich selbst auf, wollte Lillemor ihm nachrufen. Tiger ist deine Katze, nicht meine. Aber das wagte sie natürlich nicht.
»Quasselschlampe«, sagte Björn und folgte dem Beispiel seines Bruders.
Tor blieb noch ein paar Sekunden lang vor ihr stehen und sah sie mit einem Blick an, der ein Loch durch sie zu brennen schien.
»Du solltest verdammt vorsichtig sein«, fauchte er und richtete zwei Finger direkt auf ihre Augen.
Dann verließ auch er sie und ging zu seinen Cousins, die ein Stück weiter auf ihn warteten.
Tiger verschwand schon in der folgenden Nacht. Zwei Tage später fand ein Nachbar ihn in einem aufblasbaren Planschbecken. Nach der genauen Todesursache wurde nicht weiter gesucht. Aber Ertrinken war wohl die naheliegendste Erklärung.
Die Zeit nach dem aufsehenerregenden Ereignis war intensiv. Man jagte einen Mörder, nichts anderes. Eine bösartige Person, die einem Kind das Leben genommen hatte, um sich zu amüsieren. Der dem mittlerweile beinahe heiliggesprochenen Daniel Bengtsson eine ernste, aber nicht lebensbedrohliche Schädelverletzung zugefügt, sich damit aber nicht zufriedengegeben hatte. Ein kaltblütiger Mörder, der den Zwölfjährigen demnach mit Vorsatz im Bach ertränkt hatte – in einem Wasserlauf, der so flach war, dass kein Kind von Daniels Statur darin ertrinken konnte. Es sei denn, er war in einem betäubten Zustand mit dem Gesicht nach unten darin gelandet, oder er hatte das Pech, ausgerechnet dort ohnmächtig zu werden, wo in einem einzigen kleinen Loch in diesem Abschnitt des Baches das Wasser tief genug zum Ertrinken war. Was ziemlich unwahrscheinlich schien, weil die Kriminaltechniker vor Ort zu der Erkenntnis kamen, dass diese Vertiefung im Bach zu weit von dem Stein entfernt war, den sowohl der Rechtsmediziner als auch die forensischen Experten als Ursache für die Schädelverletzung ausgemacht hatten. Der Junge hätte sich nach dem Schlag auf den Schädel niemals aus eigener Kraft dorthin bewegen können. Und das Mädchen, das ihn gefunden hatte, und der Lehrer, der versucht hatte, ihn wiederzubeleben, waren sich einig, dass Daniel Bengtsson auf dem Rücken mit dem Gesicht unter Wasser in genau dieser Vertiefung gelegen habe.
Dienstagvormittag
Kriminalinspektorin Petra Westman stand mit einem Lächeln auf den Lippen am Fenster ihres Büros in der Polizeistation an der Östgötagatan 100 und freute sich darüber, dass sie ein paar Minuten zuvor zu eben diesem Dienstgrad befördert worden war. Etwas, das sie später ihrem Kollegen und Lebensgefährten, Kriminalinspektor Jamal Hamad, an den Kopf werfen wollte. Aus dem einfachen Grund, dass er ebendies ein gutes Jahr zuvor bei ihr getan hatte und seitdem kaum einen Tag verstreichen ließ, ohne darauf hinzuweisen. Na ja, ›an den Kopf werfen‹ war unter den gegebenen Umständen vielleicht nicht der passende Ausdruck, aber im Augenblick hatte sie keine bessere Formulierung auf Lager. Die Aussicht über den Hammarbykanalen in seiner ganzen Frühlingspracht ließ ihr Lächeln nur noch breiter werden. Unglaublicherweise war es April geworden, was bedeutete, dass ein langer und anstrengender Winter vergangen war. Es konnten in nächster Zeit zwar immer noch Schnee und Hagel fallen, aber zumindest das Licht war gekommen, um zu bleiben. Unten bei der Tullgårds-Schule waren die Goretex-Overalls verschwunden, und die Weiden unten am Kai würden in absehbarer Zeit in einem kräftigen Grün ausschlagen.
Nicht alles war indessen rosaschimmernd, auch wenn Westman sich gerne an das Positive klammern wollte. Das Jahr, das vergangen war, seit sich Jamals Exfrau einen Platz in ihrem Leben geschaffen hatte, war turbulent gewesen. Im Februar 2011 hatte Lina Hamad Kontakt zu ihrem Ex-Mann aufgenommen und berichtet, dass sie von jemandem verfolgt werde, der allem Anschein nach Jamal sei. Jamal war überzeugt davon gewesen, dass dies alles nur erfunden war; dass es in Wirklichkeit Lina war, die ihn stalkte, und nicht umgekehrt. Schon allein die Tatsache, dass sie weiter in der Straße wohnte, in der sie gemeinsam gelebt hatten, erschien ihm verdächtig. Dass sie seinen Nachnamen nach ihrer kurzen Ehe behalten hatte, ließ ihn schaudern. Dass sie schließlich bei ihren ehemaligen Schwiegereltern eingezogen war, machte ihn krank. Natürlich hatte er massiven Widerstand dagegen geleistet und versucht, ein ernstes Wort mit seinen Eltern zu reden, aber ohne Erfolg. Für seine Mutter war Lina der Traum einer Schwiegertochter gewesen. Auch sein Vater hatte eine Schwäche für sie, auch wenn es eher so aussah, als hätte er diesem äußerst seltsamen Arrangement in erster Linie aus Angst vor dem Temperament seiner Frau zugestimmt. Als nicht ganz unerwartete Konsequenz dieser Entscheidung hatte Jamal damals beschlossen, seinen Fuß nicht mehr in die Wohnung seiner Eltern zu setzen, bis Lina wieder ausgezogen war. Was Petra an und für sich nicht im Geringsten störte, weil sie ziemliche Schwierigkeiten mit Jamals Mutter hatte.
Allerdings war sie längst nicht so überzeugt wie Jamal, was Linas Absichten betraf. Sie war ihr bei einer Gelegenheit begegnet, und da hatte sie einfach nur verletzlich, traurig und ängstlich gewirkt. Dass sich hinter diesen Tränen eine geistesgestörte Stalkerin verstecken könnte, konnte sie kaum glauben, obwohl es natürlich nicht undenkbar war. Aber Petra war der Meinung, dass Lina genau wie alle anderen so lange unschuldig war, bis das Gegenteil bewiesen wurde, und sie glaubte erst einmal daran, dass Lina aus reiner Verzweiflung zu Jamals Eltern gezogen war. Aus Furcht davor, dass der Mann, der sich als Jamal ausgab, die Nachstellungen intensivieren würde, und weil sie ansonsten keine Familie oder nahen Freunde hatte.
Offensichtlich hatte der Umzug seinen Zweck erfüllt. Lina schien ihren Verfolger abgeschüttelt zu haben, der zwar weiter Geschenke und Dienstleistungen in ihrem Namen und an ihre alte Adresse bestellte, aber die rein physischen Schikanen hatten aufgehört. Keine Brände im Flur mehr, keine gewalttätigen Zusammenstöße im Treppenhaus und keine toten Vögel im Briefkasten. Das musste den mutmaßlichen Stalker ziemlich frustriert haben, aber er hatte keine andere Wahl gehabt, als in Deckung zu bleiben, bis sie an einem Tag im Februar an ihren Arbeitsplatz zurückkehrte. Während der zwölf Monate, die sie bis dahin bei Familie Hamad gewohnt hatte, war Lina wegen Depressionen krankgeschrieben gewesen und hatte die Wohnung selten verlassen. Aber je gesünder sie wurde, desto mehr exponierte sie sich, und die Provokationen nahmen wieder zu. Dieses Mal in Richtung ihrer aktuellen Adresse, wovor Jamal gewarnt hatte. Lina wollte ihre Gastgeber dieser Belastung nicht aussetzen, weshalb sie überlegte, in ihre alte Wohnung zurückzuziehen – aber sie weigerten sich, das zu akzeptieren. Sie diskutierten hin und her, ohne dass Lina mit ihrem Umzug richtig in Gang kam, bis die Schikanen im März plötzlich aufhörten, genauso schnell, wie sie begonnen hatten. Zwei Wochen später zog sie zurück in ihre eigene Wohnung. Nach einer weiteren Woche hatte sie ihren Rucksack gepackt und war nach Südamerika gereist. Um »sich selbst zu verwirklichen«, wie Jamal es nicht ohne Häme ausdrückte. Aber mit guter Stimmung und Vertrauen in die Zukunft, wenn man seinen Eltern glauben wollte, bei denen sie am Tag vor der Abreise zum Abschiedsessen gewesen war.
Jetzt wäre also alles Friede, Freude, Eierkuchen, wenn es nicht in Petras und Jamals Beziehung geknirscht hätte. Oder eher in Jamals Beziehung zu allen Menschen in seiner Umgebung. Dieses Jahr mit Lina in der eigenen Familie hatte ihn griesgrämig und gereizt gemacht. Seine Schwestern fanden, dass er illoyal gegenüber Lina und seinen Eltern sei, und hatten mehr oder weniger mit ihm gebrochen. Seine Mutter Maryam spielte aus denselben Gründen die Märtyrerin, und sein Vater Iliyas hob zwar verzweifelt die Arme und rollte mit den Augen, konnte seinen Sohn aber nicht vor den Frauen in der Familie verteidigen. Petras und Jamals Standpunkte in der Stalkingfrage waren zwar diametral entgegengesetzt, doch konnte sie damit leben, während Jamal sich von allen Seiten im Stich gelassen fühlte.
Jamal hatte Lina geraten, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Dass dieser Ratschlag jedoch so krass auf ihn selber zurückprallen würde, hatte er nicht ahnen können. Allerdings hatte er auch das ultimative Pech, dass Holgersson den Fall übernahm – ein aufgeblasener, rassistischer und entsprechend hohlköpfiger Bodybuildertyp, der sich unendlich amüsiert darüber zeigte, einen Kollegen mit arabischen Wurzeln unter die Lupe nehmen zu dürfen. Seine miserablen Ermittlungen hatten einen einzigen Hinweis zu Tage gefördert, der auf Jamal zeigte: dass seine Kreditkartennummer benutzt worden war, um über das Internet einen Blumenstrauß zu bestellen. Holgersson hatte seine Chance gesehen und ein großes Vergnügen darin gefunden, ihn erkennungsdienstlich zu erfassen und ihm eine Speichelprobe für die DNA-Analysedatei abzunehmen. Eine erniedrigende Behandlung, bei der Jamal in seiner Eigenschaft als einzig Tatverdächtiger für ein Verbrechen, dass eine Haftstrafe von mehr als zwei Jahren zur Folge haben konnte, ein Polizeifoto von sich machen lassen und Fingerabdrücke abgeben musste. Etwas, das weder der Staatsanwalt Hadar Rosén noch Kriminalkommissar Conny Sjöberg verhindern konnten, da dieses Verfahren absolut gestattet, wenn auch in diesem Fall moralisch fragwürdig gewesen war.