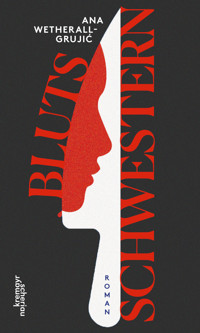
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Blut ist dicker als Wasser. Ein feministisches Roadmovie zwischen Wien und dem Balkan. Übel zugerichtet muss Ljiljana untertauchen. Ihre erfolgreiche Schwester Sanja überredet sie, in die alte Heimat Serbien zu verschwinden. Doch statt Zuflucht und Hilfe zu finden, geraten die beiden in eine Fehde zwischen einer Mafia-Patin und ihren Widersachern. Die höllische Gewalt droht die Schwestern in tiefste moralische Abgründe zu reißen – nur die Verbindung zueinander kann sie noch retten. Der kraftvolle Debütroman von Ana Wetherall-Grujić zerschmettert das Klischee der unterwürfigen, friedvollen Frau. Schnörkellos und mit bitterbösem Humor erzählt sie von Schwesternschaft, Heimat und kaltblütiger Rache. ",Ich kann nicht zurück', sagte sie leise. Sie konnte nicht lauter sprechen, jedes Wort schien neue Wunden in ihrer Kehle aufzureißen. Ein noch tieferer Schmerz überlagerte den körperlichen: Angst. Sie fürchtete sich vor der Polizei, vor ihrer Zukunft. Wenn sie ehrlich war, fürchtete sie sich aber auch vor sich selbst: Wie hatte sie das Messer nehmen können?"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ANA WETHERALL-GRUJIĆ
BLUTSSCHWESTERN
Roman
In diesem Roman gibt es explizite
Beschreibungen von Blut, psychischer
und physischer Gewalt, die einige
Personen als verstörend oder belastend
empfinden könnten.
Wie immer alles
für Tanja und Marina
1
»Wasch das Blut ab!«, sagte Sanja, ohne den Blick von dem zweistöckigen Haus abzuwenden, das aus einem Architektur-Bildband der 1980er gefallen zu sein schien. Sie reichte ihrer Schwester eine Wasserflasche. »Und zieh dich um!«
»Ich habe nichts mit«, sagte Ljiljana. Sie nahm die Flasche in die gesunde, linke Hand. Im Krankenhaus hatte sie sich nur die Jeans angezogen und ihre Jacke übergeworfen. Sie hatte kein Oberteil, das sie statt des fleckigen Krankenhaushemdes hätte anziehen können.
Sanja antwortete nicht. Sie starrte immer noch auf das Haus. Eine Zornesfalte hatte sich zwischen ihren Augenbrauen gebildet. Ljiljana wollte noch etwas sagen, aber als sie ansetzte, verschränkte Sanja die Arme vor der Brust. Ljiljana klemmte die Flasche zwischen den geschienten Arm und ihre Taille und versuchte mit der anderen Hand den Schraubverschluss aufzudrehen.
»Gib her!«, sagte Sanja, öffnete die Flasche und reichte sie ihrer Schwester.
Ljiljana hatte sich noch in der Nacht auf einer verlassenen Toilette irgendwo in Ungarn gewaschen, während Sanja draußen ihre Handys mit einem Stein zerstört hatte. In der flirrenden Hitze Serbiens hatten sich Reste von getrocknetem Blut mit Schweiß vermischt und Ljiljana wieder eingesaut. Während sie sich mit dem bisschen Wasser wusch, stieg Sanja ins Auto. Auf dem Beifahrersitz lag die Jacke ihrer Schwester. Billiges Lederimitat, das eng geschnitten war. Sie würde weder die Flecken noch das Hemd verdecken. Sanja griff auf den Rücksitz und bekam den steifen Stoff ihres Trenchcoats zu fassen. Sie hatte ihn trotz der Eile bei ihrer Flucht nicht einfach auf den Rücksitz geworfen, sondern zuerst das Innenfutter nach außen gedreht, damit er nicht dreckig würde.
»Hier, versuch den«, sagte sie beim Aussteigen. Ihre Schwester wirkte verloren in dem Mantel. Er reichte ihr fast bis an die Schienbeine. Aber er verdeckte immerhin das Hemd. »Sieht okay aus«, log Sanja. Ihr Blick wanderte vom Mantel zu Ljiljanas Gesicht.
Gleich würde Sanja einen Witz über ihr Gesicht machen. Sie würde irgendetwas Sarkastisches sagen, irgendetwas Geistreiches. So ging Sanja, so war ihr Vater mit Problemen umgegangen: darüber scherzen und sie bloß nicht an sich heranlassen. Das Witzchen würde sie ein bisschen verletzen, aber Ljiljana freute sich fast darauf, weil sie wusste, dass ihre Schwester danach wieder ein bisschen mehr sie selbst wäre. Sie wäre nicht mehr der verbissene Zombie, der die ganze Nacht über neben ihr am Steuer gesessen und stur auf die Straße gestarrt hatte, ohne ein Wort zu sagen. Der selbst dann nicht mit ihr gesprochen hatte, als er im Morgengrauen in einem verlassenen Waldstück geparkt und den Sitz zurückgeklappt hatte. Erst als Sanja sich weggedreht hatte, war Ljiljana aufgegangen, dass sie schlafen wollte, bevor sie weiterfahren würden.
»Lass uns reingehen«, sagte Sanja und deutete in Richtung Haus. Ljiljana nickte und folgte ihr. Sie hatten vor der Einfahrt am Straßenrand geparkt. Aber sie hätten auch mitten auf der Fahrbahn stehen bleiben können: Ihnen war seit mindestens einer Stunde kein Auto mehr begegnet. Die wenigen anderen Häuser in der Umgebung waren verlassen und verfallen. Das Gras reichte schon fast bis zu den Fenstern.
Das Gebäude vor ihnen war von einem rostigen Zaun umgeben, der irgendwann rot gewesen sein musste. Sanja konnte nicht erkennen, wie weit er hinter das Haus reichte, weil das weitläufige Grundstück über einen Abhang nach unten an den Waldrand und aus ihrem Blickfeld führte. Keine Klingel. Nichts rührte sich. Nichts war zu hören. Kein Fernseher, kein Geschirrklappern, keine Tiere.
Sanja öffnete das Tor und sie betraten einen gepflegten Garten. Auf dem Weg waren sie an vielen Häusern und Vorgärten vorbeigekommen, die man in Wien wohl eher Hütten oder Schrottplätze genannt hätte. Hier gab es kein Gerümpel, keinen ausgetretenen Schlamm und auch keine zerfledderten Hühner. Der tiefgrüne Rasen war penibel geschnitten, vor der Haustür hatte jemand zwei Blumenbeete so angelegt, dass sie das gleiche Muster aus bunten Blumen zeichneten. Links von ihnen stand eine Laube, überwachsen von Weinreben. Rechts eine Scheune aus hellem, lackiertem Holz.
Hier gab sich jemand Mühe, stellte Sanja fest, als sie über kunstvoll angeordnete Steinplatten den Vorgarten querten. Und hatte Geld. Dieser Rasen musste ständig bewässert werden, damit er so grün blieb.
Sie hielten vor der Eingangstür. Sanja ging im Kopf noch einmal durch, was sie sagen wollte. Sie klopfte. Nichts.
»Hallo?«, sagte sie laut und freute sich, dass zumindest dieses Wort auf Serbisch gleich war wie im Deutschen. Ihre Stimme krächzte über dem A. Ljiljana dachte an früher, als ihre Schwester sich heiser geschrien hatte. Heute wirkte sie beherrscht. Ljiljana fragte sich, ob Sanja in ihrem Leben mit jemandem so laut stritt, wie sie es mit ihrer Mutter getan hatte.
»Hier drüben, Mädchen!« Die Stimme kam von hinter dem Haus. Sanja und Ljiljana gingen über das Gras um das Haus herum. An der Ecke zog Sanja ihre Schwester an ihrem gesunden Arm und schritt voraus. Das Grundstück fiel hier tatsächlich steil ab. Vor dem Abhang wurde aus einem Viereck im grünen Rasen ein brauner, umgegrabener Acker. Dort stand eine alte Frau. Sie sah aus wie eine Kartoffel mit Zahnstochergliedmaßen. Ausgerissene Pflanzen lagen zu ihren Füßen, die in klobigen Gummistiefeln steckten. Sie trug eine zerschlissene Hose und ein Oberteil, das so ausgeblichen war, dass Sanja nur raten konnte, welche Farbe es einmal gehabt hatte. Sie hatte die erdigen Hände in die Seiten gestemmt und blinzelte unter dem grell gemusterten Kopftuch zu den Schwestern rüber.
»Wir suchen die Hexe«, sagte Sanja ohne eine Begrüßung. Innerlich verfluchte sie ihr eingerostetes Serbisch. Sie hatte seit Jahren ihre Muttersprache nicht mehr gesprochen. Es fühlte sich an, als müsste sie für jedes Wort ganz tief in sich graben.
»Ah, meine Liebe, hier gibt es keine Hexen«, antwortete die alte Frau. Ihre Stimme hatte den Klang eines Kupferkessels, der mit Stahlwolle gereinigt wurde.
»Der Mann an der Tankstelle meinte, die Hexe wohne am Ende des Dorfes«, sagte Sanja. Sie lächelte ein falsches Lächeln und hoffte, dass sie höflich wirkte. »Und das hier ist das Ende des Dorfes.«
Die Alte lächelte ebenfalls. Besser gesagt: Sie bleckte die Zähne. Sie beugte sich wieder zu ihren Pflanzen und sagte, Wurzeln ausreißend: »Ihr seid hier falsch.«
Ljiljana sah Sanja an. »Wir brauchen Ihre Hilfe«, sagte sie. »Wir können Sie auch bezahlen.« Doch die Frau reagierte nicht. »Lass uns gehen«, flüsterte Ljiljana ihrer Schwester auf Deutsch zu. Die Alte wollte sie nicht hier haben. Ljiljana wollte lieber noch einmal zur Tankstelle fahren und selbst mit dem Mann sprechen. Sanja hatte ihn vielleicht falsch verstanden. Sie drehte sich um und ging wieder zurück in den Vorgarten.
Sanja blickte ihrer Schwester nach. Ljiljana hatte den geschienten Arm an die Brust gepresst. Fuck, sie sollte sie zu einem Arzt bringen. Sie wollte der alten Frau klarmachen, dass das hier kein Witz war. Aber ihr fehlten die Worte. Sie spuckte auf den Boden und eilte ihrer Schwester nach.
»Die Hexe wohnt fünf Kilometer von hier, wenn ihr der Straße weiter folgt«, hörte sie die alte Frau hinter sich, »aber so wie das Mädchen aussieht, braucht sie einen Arzt.«
Sanja drehte sich um und wollte gerade antworten, dass es diese dämliche Fotze einen Scheißdreck anging, was sie brauchten, da rief Ljiljana: »Vielen Dank!«, und sah aus dem Augenwinkel, wie ihre Schwester sie wütend anfunkelte. Scheiß drauf, sagte sich Ljiljana. Sanja würde jetzt nicht explodieren. Ljiljana wollte die Alte zum Abschied versöhnlich und extra breit anlächeln. Sie dachte zu spät daran, dass das nicht ging. Sie spürte, wie ihre Lippe aufriss und ihr warmes Blut über das Kinn tropfte. Sie wandte sich um, wollte am liebsten zum Auto rennen, hatte aber Mühe, sich überhaupt fortzubewegen. Ihr Arm schmerzte. Sie konnte sich nicht aus dem Mantel befreien. Sie zerrte daran und versuchte gleichzeitig das Blut von ihrem Kinn aufzufangen.
»Argh!«, rief Ljiljana. Sanja kam hinter ihr her. »Hey, warte, ich helfe dir«, sagte sie.
Ljiljana bewegte sich wie ein riesiger Vogel mit einem gebrochenen Flügel. Sie warf ihrer Schwester einen bösen Blick zu, doch die Wut verging, als sie Sanja ansah. Zum ersten Mal seit gestern Abend lächelte sie. Ein richtiges Lächeln, nicht das falsche, das sie der Kartoffelfrau gezeigt hatte.
»Geh scheißen, Sunny!«, nuschelte Ljiljana hinter ihrer Hand, die das Blut stoppte, und ärgerte sich, dass es sie freute, dass ihre Schwester lächelte.
Sanja lachte jetzt und wickelte den Arm ihrer Schwester aus dem Mantelknoten, den sie selbst gebildet hatte. Sie ging zum Auto, legte den Mantel wieder auf den Rücksitz, dann nahm sie einen Zipfel des Krankenhaushemds, um ihn an die blutende Lippe ihrer Schwester zu drücken.
»Versuch das nächste Mal nicht zu lachen, wenn du einen Burberry-Mantel trägst«, sagte sie und zwinkerte ihr zu.
Ljiljana nahm den Zipfel von der Lippe und beugte sich zum Seitenspiegel des Wagens. Seit gestern Nacht ließ sie jeder Blick in den Spiegel erschrecken. Nicht nur, dass sie vom Mund abwärts mit ihrem eigenen Blut verschmiert war. Die linke Gesichtshälfte war rohes, glänzendes Fleisch. Das linke Auge zugeschwollen, die Lippe gerade wieder aufgerissen. Sie bekam schwer Luft durch die geschwollene Nase, die nicht mehr blutete, aber ihr einen spitzen Schmerz direkt ins Gehirn zu senden schien, wenn sie sie auch nur berührte. An den besten Stellen war die Haut ihres Gesichts dunkelrot und glänzend. An den schlimmsten schimmerte sie schwarz.
»Warum wische ich das Blut eigentlich weg?«, fragte sie eher sich selbst als Sanja. Hier gab es keinen Schönheitspreis zu gewinnen. Dennoch tupfte sie sich das Blut vom Gesicht.
»Weil du ein hübsches Mädchen bist«, sagte Sanja. »Du siehst nur gerade nicht so aus«, wollte sie hinzufügen. Sie sah, wie ihre Schwester sich im Seitenspiegel betrachtete, und fragte sich, ob sie selbst auch so traurig war, wenn sie ihr Gesicht betrachtete.
Das Schreckliche war nicht die zerfetzte Seite. Es war der Kontrast zur anderen Hälfte ihres herzförmigen Gesichts: Das große, grüne Auge, die hohen Wangenknochen und die verspielten Grübchen um ihre von Natur aus kirschroten Lippen. Ljiljana sah aus wie eine Puppe, die in ein Säurefass getaucht worden war. Sanja wollte ihre Schwester nicht fragen, was sie über ihr Gesicht dachte. Also stieg sie ins Auto.
Sanja sah konzentriert auf die Straße, während sie das Auto zwischen riesigen Schlaglöchern und zerbeulten Straßenbegrenzungen hindurchsteuerte. Um sie herum wurden aus vertrockneten Gräsern karge Büsche und dann ein Wald. Je dichter die Bäume und das Buschwerk, desto schmaler und verwilderter der Weg vor ihnen. Äste schleiften über das Autodach. Das Geräusch hatte Ljiljana kurz aus ihren Gedanken gerissen. Frühe Kindheitserinnerungen waren in ihr hochgekommen. Sie dachte an Urlaube, als sie in einem kleineren, billigeren Auto mit Sanja hinten gesessen hatte. Ihre Eltern hatten vorne alte serbische Radiosender gesucht, die sie mit der Zeit vor dem Krieg verbanden. Sanja hatte immer Kopfhörer im Ohr gehabt, weil sie mit serbischer Musik nichts anfangen konnte. Ljiljana hatte aus dem Fenster geschaut und sich vorgestellt, in den verlassenen Häusern am Wegesrand zu wohnen.
»Gott verfickte …«, rief Sanja aus. Ihre Stimme brach nicht, obwohl sie laut war. Bald wäre sie wieder ganz die Alte, dachte Ljiljana zuerst. Und dann, dass die Welt unterging, wenn ihre Schwester auf Serbisch fluchte.
Sanja stoppte abrupt, zog die Handbremse an und stieß gleichzeitig die Autotür auf. Sie verfing sich in Dornenbüschen, die den Boden bedeckten. Hinter ihr war der Wald, der so dicht emporragte wie eine grüne Wand, vor ihr eine Anhöhe. Zuerst ein Grasstück voller Wildblumen und hinter einem verrosteten Zaun ein Rasen, der viel zu grün und gepflegt für Serbien war.
Und da stand die Alte. Sie schaute zu ihnen herab. Grinste. »Ihr habt ja ganz schön lange gebraucht«, sagte sie und lachte ihr Kupferkessellachen.
2 Jugoslawien, 1989
Milena hasste den Jungen von dem Moment an, als er ihr die Tür aufmachte. Er sah dumm aus. Sein Mund stand offen, sein Gesicht war verschmiert und Milena war sich sicher, dass die Hand, mit der er die Türklinke hielt, klebrig war. Obwohl er Milena gerade mal bis übers Knie ging, erschien er plötzlich riesengroß.
»Warum bist du hier?«, fragte er sie. Er sprach die Worte nicht klar aus und sabberte beim Reden. Als hätte er etwas im Mund und die Wörter müssten sich erst daran vorbeidrängen.
Milena überlegte, einfach ins Haus hineinzugehen. Sie hatte Angst, dass sie hier jemand stehen sah. Irgendetwas raschelte rechts von der Tür im Garten. Was, wenn jemand hier arbeitete? Was sollte sie sagen, warum sie vor Nikolina Jovanovićs Haus stand? Sicher nicht, um sich eine Schale Zucker auszuleihen.
»Ich muss mit deiner Mama reden. Ist sie da?«, antwortete Milena. Der Junge schaute sie noch einen unendlichen Moment lang skeptisch an, drehte sich dann ohne ein Wort zu sagen um und ließ Milena ins Haus.
Er kniete jetzt vor der Couch, auf der Milena in der Wohnküche Platz genommen hatte. Sie fragte sich bereits zum zweiten Mal, ob etwas mit ihm nicht stimmte. Er starrte sie an. Seine dunklen Augen waren leer, seine Hände tatsächlich verschmiert. Milena zwang sich zu einem Lächeln, das hoffentlich höflich war, und suchte etwas, woran sie ihren Blick heften konnte, um sich zu beruhigen. Sie dachte über den ersten Satz nach. Wie würde sie anfangen? Was würde die Alte haben wollen? Sie griff nach dem Packen Geld. Würde es reichen?
»Bleib konzentriert«, befahl sie sich. Sie sah aus dem riesigen Fenster. Der Wald kam ihr dunkel und unheimlich und unendlich weit vor. Er zog sich bis zum Horizont. Sie hatte oft im Wald gespielt, als sie klein war. Sie erinnerte sich an die frische Luft, sogar im Sommer, wenn alles vor Hitze flirrte. Daran versuchte sie zu denken: kühle Luft, Vogelsingen und das Rascheln der Tiere.
»Kiki, geh dich waschen.« Diese Worte rissen sie aus ihren Gedanken. Nikolinas Schwester Dragica stand in der Tür. Sie hielt zwei Mineralwasserflaschen im Arm. Der kleine Junge sprang auf und lief seiner Tante entgegen. Er wollte nach ihr greifen, aber sie ging an ihm vorbei und zeigte aus dem Zimmer.
»Geh dich waschen!«, wiederholte sie. »Komm schon! Du siehst aus wie ein Schwein. Mach dich sauber, dann gehen wir später zusammen in den Garten.«
Milena war überrascht, wie Dragicas Stimme klang. Wie zwei Löffel, die aneinanderrieben: rau und hell zugleich. Sie hatte Dragica noch nie so lange am Stück sprechen hören. Das Einzige, was Milena wusste, war, dass sie in der Stadt als Ärztin arbeitete und im Sommer mit ihren Schwestern in das Haus kam. Dort blieb sie auch, ging nur manchmal abends spazieren. Wenn sie am Haus von Milenas Familie vorbeikam, nickte sie und grüßte knapp.
»Guten Tag, Milena«, sagte Dragica auch jetzt. Sie sah ihr in die Augen, bevor sie in den hinteren Bereich des Zimmers ging, in dem sich eine moderne Küchenecke befand. Milena saß in der anderen Hälfte der Wohnküche auf einer Couch. Gegenüber an der Wand stand ein dunkles Holzregal mit einem ausgeschalteten Fernseher und Büchern. Ablenkung bot ihr nur der Blick aus dem Fenster.
Dragica stellte die Mineralwasserflaschen in einen eingebauten Kühlschrank. Die weiße Front war die einzige helle Fläche in der ansonsten olivgrünen Küche. Der Herd war kein Monstrum, das man mit Holz befeuern musste, wie im Haus ihrer Eltern, sondern ein Elektrogerät, kaum breiter als der Kühlschrank. In ihrem hellblauen Leinenkleid passte Dragica perfekt hinein: »Die moderne Frau in ihrer modernen Küche« wäre die Überschrift in einem Einrichtungskatalog.
»Wie geht es deinen Eltern?«, fragte sie Milena, ohne sich ihr zuzuwenden.
»Gut«, antwortete Milena. Sie faltete die Hände und schickte ein Stoßgebet zu Gott, dass ihre Eltern nie erfuhren, dass sie hier war. Dann sah sie wieder in den Wald hinaus. Sie versuchte die beruhigenden Gefühle an ihre Kindheitsausflüge durch das kühle Grün heraufzubeschwören. Die Gedanken an ihre Eltern waren stärker. Sie hatten ihr schon immer verboten in das Nachbarhaus zu gehen. Selbst als sie ganz klein war. »Dort ist es gefährlich«, hatten sie sie gewarnt. Was machte sie hier eigentlich? Warum war sie so dumm gewesen hierherzukommen?
Der kleine Junge störte sie auf. Er warf sich mit seinem ganzen Gewicht gegen die Tür, als er hereinkam, und sie schloss sich mit einem Knall hinter ihm. Er tapste auf Milena zu.
»Fertig!«, sagte er und ließ sich auf den Boden vor der Couch plumpsen. Gesicht und Haare waren jetzt komplett nass, genau wie seine Hände.
»Komm her!«, sagte Dragica und kniete sich in der Küche hin. Er stand auf und lief zu ihr. Seine Schritte waren selbstbewusst, aber wackelig.
»Zeig mal!«, sagte Dragica. Er wedelte mit den Ärmchen. Mit ernstem Gesicht inspizierte sie das Kind.
»In Ordnung«, sagte sie. Der Junge kicherte. Dragica gab ihm einen Kuss auf den Kopf und verwuschelte sein dunkles Haar. Weil es noch nass war, stand es wirr in alle Richtungen ab. Er lächelte und lief wieder zurück zu Milena. Bevor er bei ihr war, öffnete sich die Tür. Er erschrak und fuhr herum. Das Lächeln verschwand aus seinem Gesicht.
»Milena«, sagte Nikolina und kam herein. Eigentlich loderte sie ins Zimmer. Nikolina war wie Flammen ohne Ruhe. Ihr Haar, ihre Kleidung waren ständig in Bewegung. Ihr rotes Kleid war fast bodenlang und weit geschnitten. Ihre schlanke Figur wurde nur dann erkennbar, wenn sich das Kleid in der Bewegung an ihren Körper drückte. Die langen schwarzen Haare schwangen offen über ihren Rücken. Sie ging zu Dragica in die Küche und kramte in einer Schublade. Als sie sich in einen Stuhl neben Milena fallen ließ, hatte sie ein silbernes Zigarettenetui in der einen und ein abgeschlagenes Plastikfeuerzeug in der anderen Hand. Sie zündete sich eine lange Zigarette an.
»Also, was ist los?«, fragte sie und blies den Rauch aus ihren Mundwinkeln in einer langen Wolke aus. Milena war zu überrascht, um gleich zu antworten. Sie hatte Nikolina noch nie aus der Nähe betrachten können. Manchmal hatte sie sie mit dem Auto ankommen sehen, aber nie war sie mit Dragica spazieren gegangen. Milena hätte sie gerne länger nur angesehen. Aber der kalte Ausdruck in den schwarzen Augen ließ sie schaudern.
»Ich brauche deine Hilfe«, sagte sie.
»Konstantin, raus hier!«, sagte Nikolina. Wenn Dragicas Stimme das Reiben zweier Löffel war, war Nikolinas eine Klinge, die dir ein Räuber in einer dunklen Gasse an die Kehle hielt. Sie klang, als hätte sie ihrem Kind schon gesagt, dass es rausgehen sollte. Dabei hatte sie es bisher gar nicht angesprochen. Der Junge zuckte zusammen, dann verzog er das Gesicht zu einer Fratze. Er schluchzte auf.
»Konstantin«, sagte Nikolina barsch. Er atmete ein und seine kleine Hand wanderte zum Mund. Er schluchzte nicht mehr, aber Tränen liefen ihm noch übers Gesicht.
»Kiki, jetzt raus, verdammt noch mal!« Nikolina deutete mit ihren langen Fingern zur Tür. Er musste auf die Zehenspitzen steigen, um sie zu öffnen. Bevor er die Klinke runterdrücken konnte, sprang sie schon auf. Ein braun gebranntes Gesicht erschien im Türrahmen.
»Hallo kleiner Mann, wohin soll’s denn gehen?«, hörte Milena. Mit einem sehnigen Arm hob Diana das Kind hoch. Sie musste draußen gewerkt haben, denn in der anderen Hand baumelte Gemüse. Nikolinas zweite Schwester trat ein und mit ihr der Duft von frischen Frühlingszwiebeln. Im Gegensatz zu den beiden trug sie kein Kleid. Ihr ausgewaschenes T-Shirt entblößte eine Schulter, als sie das Kind auf ihrer Hüfte absetzte. Die Shorts waren so kurz, dass Milena Schlammspritzer auf ihren Oberschenkeln entdecken konnte. Diana schien es nicht zu stören, dass sie im Vergleich zu den anderen Lumpen trug. Sie war zu beschäftigt, den Jungen mit den grünen Enden der Zwiebeln zu kitzeln. Er lachte.
»Hallo Milena!«, sagte Diana fröhlich und lächelte sie breit an. Sie reichte Dragica die Zwiebeln und ließ sich auf die Couch neben Milena fallen. In der Küche verzog Dragica angewidert das Gesicht.
»Ihr werdet doch nicht ohne mich Kaffee trinken?«, sagte Diana verspielt. Sie setzte Konstantin mit dem Gesicht zu ihr auf den Schoß.
»Bring ihn raus«, sagte Nikolina. »Wir haben etwas zu besprechen.«
»Er ist zu klein, um allein draußen zu sein«, sagte Diana lachend.
Der Junge strahlte sie an, während sie ihm den Kopf massierte. Sie zwirbelte sein immer noch feuchtes Haar zu zwei kleinen Hörnern. »Das stimmt, oder?«, säuselte sie und kitzelte ihm den Bauch. »Du bist kein Erwachsener, Kiki. Du bist ein Zweijähriger und so sollte man dich auch behandeln, oder, Schatz?«
Nikolina warf Diana einen kalten Blick zu. Sie reagierte jedoch nicht, sondern spielte weiter mit dem Kind. Nikolina sah wieder Milena an, nickte ihr zu. Milena war unsicher, was sie tun sollte.
»Wie kann ich dir helfen?«, fragte Nikolina ungeduldig. Sie verzog das Gesicht genervt, als das Kind vor Lachen quiekte.
»Ich muss hier weg. Nach Österreich oder Deutschland. Irgendwohin. Du kennst doch Leute, die so was machen«, sagte Milena. Es war das erste Mal, dass sie es laut ausgesprochen hatte, und für einen Moment hatte sie Angst, dass ihre Eltern sie gehört hatten.
»Hm«, machte Nikolina und zog an ihrer Zigarette. Sie fixierte Milena. Nicht nur ihr Gesicht, sondern alles. Milena schämte sich für ihre beste Bluse. Neben den Frauen, selbst neben Diana, kam sie sich schäbig vor. Noch einmal zog Nikolina an ihrer Zigarette. »Nein«, sagte sie. »Ist grade nix zu machen.«
»Ich kann dich bezahlen«, sagte Milena schnell. Sie griff in ihre Gesäßtasche und zog einen abgegriffenen Umschlag heraus. Er war ganz warm von ihrem Körper. Sie öffnete ihn mit zittrigen Händen.
»Ich habe 3000«, sagte sie. Als Nikolina nicht reagierte, fügte sie hinzu: »Bitte!«
Nikolina warf einen Blick auf den Umschlag.
»Du meinst, deine Eltern haben 3000«, sagte sie. Milena schluckte.
»Bitte«, sagte sie noch einmal, flehend.
Nikolina erhob sich. Milena blieb sitzen. Sie starrte auf das Geld in dem weißen Umschlag mit den speckigen Rändern. Er war ganz tief im Schrank ihrer Eltern versteckt gewesen. Zwischen schwerer Bettwäsche hatte er gelegen. Sie hatte ihn erst beim dritten Durchsuchen gefunden. Ihr Herz hatte gerast, aus Angst, dass ihre Mutter hereinkommen und sie wühlen sehen würde.
»Was glaubst du, was ich hier mache?«, fragte Nikolina. Sie hatte sich ans Fenster gestellt und sah raus auf den Wald.
»Mafia«, wollte Milena sagen. Das sagten zumindest ihre Eltern immer. Flüsternd, selbst wenn sie ganz allein im Zimmer waren. Manchmal hatte ihre Mutter »Hexe« hinterhergesagt und sich dann bekreuzigt. Ihre Nachbarin war die Mafia, ihre Nachbarin war eine Hexe. Was das genau bedeutete, hatte Milena lange nicht gewusst. Nur, dass sie nie mit den Menschen sprechen durfte, die in teuren Wagen vor dem schicken Nachbarhaus hielten. Dass sie die Frauen, die in dem Haus lebten, nur grüßen, aber sich nicht mit ihnen unterhalten durfte.
In letzter Zeit waren immer mehr Autos vor dem Haus stehen geblieben, die nicht teuer waren. Manche von den Besuchern kannte sie. Der Schuster aus dem Nachbardorf, der ihre Schuhe neu besohlt hatte. Die Mutter eines ehemaligen Schulkollegen. Die Menschen, die ausstiegen, waren nervös. Sie sahen sich nicht um, als glaubten sie, niemand könnte sie sehen, wenn sie niemanden sahen. Wenn sie wieder aus dem Haus traten, schienen sie aber erleichtert zu sein. Salih hatte gesagt, dass Nikolina Leute über die Grenzen schmuggelte. Dass sie ihnen half zu flüchten. Als Milena ihn gefragt hatte, warum sie Hexe genannt wurde, hatte er nur mit den Schultern gezuckt. »Ich schätze, weil sie so aussieht wie eine«, hatte er dann gesagt. Milena hatte so laut gelacht über seine trockene Art, dass er mitlachen musste. Sie hatten sich nicht zurückhalten müssen: Der Wald hatte die Geräusche ihrer Freude geschluckt.
»Du hilfst den Menschen«, sagte Milena in Richtung Nikolina, die immer noch aus dem Fenster blickte. Mit den langen Haaren und den wehenden Gewändern sah sie aus, als wäre sie aus einem Märchenbuch gestiegen. Aber aus einem, in dem selbst die Hexen wunderschöne Frauen waren.
Nikolina lachte humorlos auf. »Schmeicheleien helfen dir hier nicht«, sagte sie. Milena schoss für einen Moment in den Kopf, dass Nikolina ihre Gedanken lesen konnte und nicht bloß auf ihre Worte reagierte.
»Bitte, Nikolina«, sagte Milena. Sie spürte, dass ihr die Tränen kamen. Nikolina sah sie genauso angewidert an wie das Kind, als es gelacht hatte. Sie würde ihr nicht helfen. Milena wollte nicht weinen. Sie wollte hier stolz rausgehen und eine andere Lösung suchen. Aber sie hatte keine Alternative. Die Tränen flossen. Milena drückte sich die Hände auf die Augen, damit es aufhörte.
Da spürte sie eine Hand auf dem Knie. Diana beugte sich über die Couch und sah Milena ernst an.
»Was ist denn los mit dir, Milena?«, fragte sie ruhig. Der Junge hielt sich wie ein Äffchen an ihr fest.
»Sie sagt, sie muss hier weg, die Arme. Aber hier wollen alle weg, weil sie denken, der Krieg kommt. Aber der Krieg wird nicht hierherkommen«, sagte Dragica fast spöttisch. Sie kam mit einem Tablett aus der Küche. Darauf standen Mokkatassen, ein Teller mit Keksen und ein Glas Wasser. Sie reichte Milena das Glas, ohne sie anzusehen. »Wir sind hier weiß Gott zu weit weg von jeder Großstadt, die auch nur ein bisschen wichtig oder zumindest aufregend wäre«, sagte sie und hockte sich auf einen Schemel an der Wand. Sie tunkte ein Stück Würfelzucker in ihren dunklen Kaffee und biss ab.
Milena musste an ihre Mutter denken, die ihren Kaffee genauso trank. Sie musste daran denken, dass sie sie nie mehr wiedersehen würde, wenn sie wegginge. Aber sie konnte nicht hierbleiben. Sie hatte keine Alternative.
Milena wischte sich mit den Händen die Tränen aus dem Gesicht. Sie trank in großen Schlucken von dem Wasser. Sie spürte eine zweite Bewegung auf ihrem Knie und sah, dass der Junge es seiner Tante gleichtat und sie berührte. Er lächelte sie an. Milena schluchzte auf. Sie stellte das Wasser ab und musste wieder weinen.
»Milena, jetzt beruhig dich. Was ist los mit dir? Ist was passiert?«, fragte Diana. Milena sah nach draußen. Erinnerte sich, wann sie zuletzt dort gewesen war. Wie dunkel es war, wie laut plötzlich alle Geräusche waren. Dass sie aber keine Angst gehabt hatte. Salih hatte ihre Hand gehalten, als er sie immer tiefer reingeführt hatte. Er hatte die Hand auch nicht losgelassen, als er sie geküsst hatte auf einer Lichtung.
»Ich bin schwanger«, sagte sie, ihren Blick fest auf den Wald gerichtet.





























