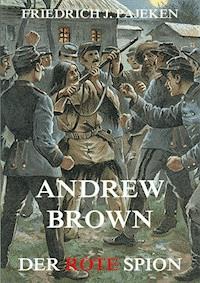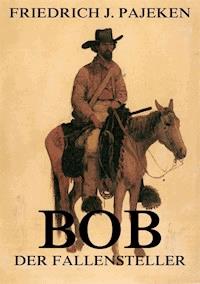
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine Erzählung aus dem Westen Nordamerikas. Die Serie "Meisterwerke der Literatur" beinhaltet die Klassiker der deutschen und weltweiten Literatur in einer Sammlung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bob der Fallensteller
Friedrich Joachim Pajeken
Inhalt:
Friedrich Joachim Pajeken – Biografie und Bibliografie
Bob der Fallensteller
Vorwort.
Die Fallensteller.
Bobs Flucht
Bei den Arapahoes-Indianern.
In Cheyenne.
Andrew Brown der Fuchs.
Zwischen Leben und Tod
Old Tex der Indiantrader.
Auf dem Kriegspfade.
In höchster Not
Treue Freunde
Vater und Sohn.
Friede und Arbeit.
Bob der Fallensteller, F. J. Pajeken
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849632939
www.jazzybee-verlag.de
Friedrich Joachim Pajeken – Biografie und Bibliografie
Deutscher Kaufmann und Schriftsteller, der Abenteuerromane für Jugendliche verfasste, geboren am 5. März 1855 in Bremen, verstorben am 8. November 1920 in Hamburg. Pajeken war der Sohn des Kapitäns und Kaufmanns Eduard Pajeken. An der Handelsschule erlernte er den Beruf eines Kaufmanns. 1876 wurde er als Kaufmann nach Ciudad Bolivar am Orinoko geschickt, wo er in den nächsten drei Jahren Erfahrungen im Überseehandel sammelte. Seinen dortigen Aufenthalt nutze er für zahlreiche Streifzüge durch das Land. Nebenbei befasste er sich eingehend mit den in Bolivien lebenden Indianern. Um auch noch die nordamerikanischen Indianer kennenzulernen, begab er sich für zwei Jahre auf die „Hollers Ranch“ am Brod River in den Bighorn Mountains und knüpfte gute Kontakte zu den dort lebenden Indianern. Von diesen erhielt er, aufgrund seiner etwas gelblichen Hautfarbe und seiner Leistungen als guter Jäger, den Ehrennamen „Yellow Eagle“. Nach seiner Rückkehr nach Bremen betrieb er von 1883 bis 1889 ein Agentur- und Kommissionsgeschäft und war Mitglied in mehreren Vereinen. Sein Talent für das Geigespiel brachte ihm das Dirigentenamt des dortigen Dilettantenorchesters ein. 1889 ließ er sich in Hamburg nieder und heiratete im Folgejahr die Sängerin Agnes Winkelmann, die ihm zwei Söhne gebar. In der Hansestadt begann auch seine schriftstellerische Laufbahn. 1897 zog er nach Berlin und blieb bis 1917. Danach kehrte er abermals nach Hamburg zurück und starb dort 1920 im Alter von 65 Jahren. Nach seinem Tod gerieten seine Bücher weitgehend in Vergessenheit, so dass Pajeken heute als Jugendbuchautor kaum mehr bekannt ist. In seinen zahlreichen Jugendbüchern arbeitete er seine eigenen abenteuerlichen Erfahrungen in Amerika auf, mit denen er die vorherrschenden romantischen Vorstellungen zu revidieren versuchte. Daneben wandte er sich auch anderen Kulturkreisen zu. Seine Bücher erwiesen sich als eine beliebte Lektüre für Jugendliche und machten ihn rasch populär, so dass er, in schneller Folge, immer neue Bücher folgen ließ. Neben seinen eigenen Werken fertigte er auch Bearbeitungen für die Jugend von Gabriel Ferrys Waldläufer, von Thomas Mayne Reids Skalpjäger, von Campes Robinson Crusoe und von anderen Autoren an.
Wichtige Werke:
Bob der Fallensteller, 1890Aus dem Westen Nordamerikas, 1890Im Wilden Westen Nordamerikas, 1891Das Geheimnis des Karaiben, 1891Bob der Städtegründer, 1891Jim der Trapper, 1892Ein Held der Grenze, 1893Das Vermächtnis der Invaliden, 1893Bob der Millionär, 1894Andrew Brown, der rote Spion, 1894Mita-hasa, das Pulvergesicht, 1895Der Mestize und drei andere Erzählungen aus Nord- und Südamerika, 1896Am Orinoko, 1896Martin Forster, 1898Bill der Eisenkopf, 1899Wunderbare Wege, 1901Der Schatz am Orinoko, 1902Ein Held wider Willen, 1904Der gespenstische Reiter, 1907Verloren und gerettet, 1908Das Geheimnis des alten Hauses, 1909In der Mumienstadt, 1909In Sturm und Not, 1910Jagdabenteuer in den Tropen, 1911Schicksals Walten, 1912Der Teufel vom Minnetonka-See, 1912Auf eigene Faust, 1915Die Rache des Emmaranus, 1918Im Urwald, 1920Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Im Gesamten ist dieser Text zu finden unter http://de.wikipedia.org/wiki/Pajeken.
Bob der Fallensteller
Eine Erzählung aus dem Westen Nordamerikas
"Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt." –
Vorwort.
Mir ward diese Gunst reichlich beschert. Ich habe die Tropenländer Südamerikas und einen großen Teil Nordamerikas kennen gelernt und im jahrelangen Aufenthalte unter Ansiedlern und Indianern mannigfaltige Erfahrungen gesammelt, die ich euch gern in lebensvollen Bildern entrollen möchte.
Fern von der gebildeten Welt, hoch in den Bighorn Mountains (Wyoming territory), unweit der Quelle des Powder River erbaute ich im Jahre 1879 meine Blockhütte. Von hier aus durchstreifte ich zu Pferde die wilden, herrlichen Berge, die weiten, im Winter traurig öden, im Sommer gras- und blumenreichen Prärien. Mit Trappern (Fallenstellern) und Ranchern (Viehzüchtern), den Pionieren des Westens, schloß ich Freundschaft; aber auch mit verwegenen Gesellen, die in dem von Weißen wenig bevölkerten Lande eine Zuflucht gefunden hatten, traf ich oft zusammen. Ich nahm Anteil an ihren mannigfachen, bunten Erlebnissen und Abenteuern. Mitten in den unsicheren, oft genug auch zuchtlosen Verhältnissen dieses Landes im fernen Westen lernte ich erst die Segnungen des festgeordneten, vaterländischen Lebens schätzen und verstehen.
Kaum fünfzehn englische Meilen von meiner Blockhütte entfernt befand sich ein Lager der Arapahoes-Indianer. Mit diesen sowie später mit den Crows, Shoshonees, Sioux und anderen Stämmen gelang es mir, mich vertraut zu machen. Wochenlang wohnte ich in ihren Dörfern.
Was mir fesselnd und lehrreich erschien, habe ich wahrheitsgetreu in die nachfolgende Erzählung eingeflochten. Die darin auftretenden Personen habe ich zumeist selbst gekannt. Jede Uebertreibung ist streng vermieden.
So ist denn in dieser Erzählung das Leben im wilden Westen vollkommen der Wirklichkeit entsprechend geschildert. Möge mein Buch euch Freude machen und sich unter euch viele Freunde erwerben!
Der Verfasser.
Erstes Kapitel.
Die Fallensteller.
Vom dreiundvierzigsten Grad nördlicher Breite bis weit nach Norden hin erstrecken sich im Territorium Wyoming die steilen Bighorn Mountains. Wild sind die Bergformen von Süden nach Norden durcheinandergeworfen. Ueberall sieht man zerrissenes Gestein, Schluchten, senkrecht abfallende Felswände, schmale Täler, durch die hier und dort in vielen Krümmungen ein kleiner Fluß braust, an dessen Ufern Gestrüpp und in den tiefer gelegenen Gegenden langes Präriegras wuchert. Auf den Höhen fristet die Pechtanne kümmerlich ihr Leben. Der Salbeibusch, zufrieden mit wenig Nahrung, taucht seine Wurzeln in das geringe Erdreich. Nur da, wo die umliegenden Höhen im Winter Schutz gegen die schneidend kalten Winde bieten, begegnet man in den Bergen kleineren mit Gras bewachsenen Strecken.
So kahl aber auch die Natur diese Berge ausgestattet hat, die Felsmassen in ihrem seltsamen und riesenhaften Bau ersetzen mit ihrer erhabenen Wirkung alles Fehlende.
Der Morgen graut.
Am östlichen Horizonte zeigt sich das erste Tageslicht, und mit Gedankenschnelle überhaucht rosiger Schimmer die schneebedeckten Spitzen der Berge.
Durch eine tiefe Schlucht wälzt sich schäumend der Powder River über mächtige Steinblöcke und Geröll.
Auf scheinbar unzulänglichen Wegen kommt von dem scharfzackigen Felsgrat ein Rudel Hirsche herab, den Durst in der silberhellen Flut zu löschen. Furcht kennen die Tiere nicht, denn sie werden wenig in dieser menschenarmen Wildnis verfolgt. Ohne Zögern nähert sich ein Tier nach dem andern dem Flußufer. Es senkt den Kopf zum klaren Wasser herab und schlürft in langen Zügen die ersehnte Labe. Mit Wohlbehagen und in sicherer Ruhe gibt sich die ganze Herde dem Genusse hin.
Prächtige Gestalten sind darunter. Hier und da hält ein Hirsch wohl eine Weile im Trinken inne. Mit leichter Anmut hebt der kräftige Nacken das vielzackige, schwer lastende Geweih. Stolz schaut das Tier sich nach allen Seiten um, als sei es sich seiner Schönheit voll bewußt.
Immer heller wird es im Osten. Der Gluthauch auf den Kuppen der Berge ist verblaßt. Goldig glänzt und flimmert der Schnee in der Morgensonne.
Da plötzlich kracht ein Schuß durch die stille Natur. Ein vielfaches Echo klingt überall von den Felswänden zurück. Getroffen bricht ein Tier der Herde zusammen. Die übrigen Hirsche stutzen einen Augenblick, dann eilen sie, das Geweih in den Nacken gelegt, in langen Sätzen davon, und bald sind sie dem Auge entschwunden.
"All right!" tönt jetzt eine tiefe Stimme von der andern Seite des Flusses her, und eine kräftige Gestalt arbeitet sich durch Gestrüpp und über Felsblöcke zum Ufer hinab. Die gewaltige Anstrengung erheischt gebieterisch eine kurze Erholung. Hoch aufgerichtet blickt der Jäger mit Wohlbehagen nach dem erlegten Tiere hinüber.
Ein langer, aschblonder Bart, dem Kamm und Bürste gleich fremd sind, umrahmt das wetterharte Gesicht, aus dem die dunkelbraunen Augen jagdeifrig hervorblitzen. Ein Lederanzug, an den Aermeln und Beinkleidern mit Fransen geschmückt, umhüllt den stahlnervigen Körper. Ein breitrandiger, grauer Hut, von dem hinten ein paar goldfarbige Troddeln herunterhängen, ist auf dem blonden, leicht gelockten Haupte nach hinten gerückt und läßt die hohe Stirn frei, auf der sich eine rote Narbe dicht unter den Haarwurzeln von einer Seite zur andern zieht. Im breiten Ledergurte stecken die Patronen, und in starken Scheiden hängt vorn das Jagdmesser, hinten der mächtige Revolver herab. Die abgeschossene Büchse hält der Mann in der Faust.
"Gut getroffen, Jim!" ruft er aus. "Nicht für einen Cent Leben ist mehr in dem Tiere. Nimm dir ein Beispiel daran und krüppele das Wild künftig nicht mehr so toll, wie du es zu tun pflegst."
"Du hast gut reden, Charley," ließ sich jetzt eine zweite Stimme vernehmen, und noch eine Gestalt, in gleicher Weise gekleidet, kam langsam herbei. "Du wartest, bis dir etwas regelrecht zu Schuß kommt, mich aber treibt der Teufel der Leidenschaft, blind dazwischen zu schießen."
"Yes, Sir! Gerade als wenn unsere Patronen in Cheyenne auf der Straße lägen," fügte der erste lachend hinzu.
Beide Männer traten an das Flußufer. Sie fanden dort bald eine seichtere Stelle, und nachdem sie ihre umgeschlagenen, langen Stiefelschäfte über die Knie gezogen hatten, wateten sie durch das Wasser und näherten sich der erlegten Beute.
Charley betastete die Seiten und Schenkel des Hirsches. "Ein Prachttier ist es!" sagte er erfreut. "Damit reichen wir eine Zeitlang aus, wenn uns die verdammten Wölfe nicht wieder bei Nacht und Nebel das Beste fortholen. Aber wartet, Bestien! Ich hänge den da so hoch, daß euch schon das Springen danach vergehen soll."
"Besser ist es, wenn wir uns hier nicht allzulange unnütz aufhalten," meinte Jim, während Charley die Stelle genau untersuchte, wo seine Kugel eingedrungen war. "Kommen wir zu spät zu unseren Biberfallen, so haben die Tiere Zeit, sich mit scharfem Biß zu befreien, und wir finden nur Beine und Füße vor. Darum laß den Hirsch! Er läuft uns nicht mehr fort. Komm erst zu unserem Handwerk! Hoffentlich hat es sich heute nacht gelohnt!"
"Hast recht, Bruder! Gehen wir!"
Die Männer schritten durch das Wasser zurück und wandten sich einer roh zusammengelegten, kleinen Blockhütte zu, welche nicht weit von dem Flusse entfernt, an eine Felswand gelehnt, stand und von einigen kahlen Bäumen und von Buschwerk umgeben war. In der Nähe suchten zwei Pferde, an lange Stricke gebunden, ihr nur sehr spärlich vorhandenes Futter.
Während Jim sich nach ein paar Kloben Holz umsah, trat Charley in die Behausung, aus der er gleich darauf mit zwei Flaschen zurückkam, von denen er eine dem Bruder reichte. Dann machten sich beide auf den Weg. Ueber Felsgeröll, zwischen Gestrüpp und vereinzelten Haufen trockenen, gelben Präriegrases, dessen lange Halme im kalten Morgenwinde rauschten, gingen sie weiter den Fluß hinauf bis zum Ausgange der Schlucht.
Bevor der Powder River hier zwischen den Felsen seinen Lauf bergab nahm, strömte er durch ein weites, von hohen Bergen umgebenes Tal. Durch unzählige Biberdämme wurde der Fluß dort in viele Arme geteilt und bekam so mehr das Aussehen eines Sees, aus dem die einzelnen Stücke Land, mit Buschwerk und Schilf bewachsen, kleinen Inseln gleich hervorschauten.
Bei dieser Biberstadt hatten sich die beiden Trapper Jim und Charley bereits im Herbst niedergelassen. Jetzt stand das Frühjahr vor der Tür, und noch immer war der Fang so ergiebig, daß keiner von den Brüdern an einen Wechsel des Aufenthaltes dachte, wozu sie sonst gewöhnlich mehrere Male im Winter gezwungen wurden.
Charley betrat gleich am Ausgange der Schlucht das Wasser, das hier und da mit einer dicken Eiskruste bedeckt war, und watete langsam darin entlang. Jim ging noch weiter den Fluß hinauf.
Schon in der ersten Falle saß, mit den Hinterfüßen gefangen, ein großer Biber. Wütend fletschte er die Zähne, als der Trapper ihm näher kam und mit dem Kloben Holz zum Schlage ausholte. Auf die Nase getroffen, war das Tier sofort tot. Charley packte es und warf es samt der Falle an das Ufer.
"Nummer eins!" rief er vergnügt, während er die Beine des Bibers aus dem Schlage entfernte. Vorsichtig spannte er die Falle von neuem auf und senkte sie nahe dem Ufer in das Wasser. Rund um sie steckte er eine Anzahl kleiner Stäbchen, so daß deren Enden sich etwa eine Handlänge unter der Oberfläche des Wassers befanden. In die Flasche tauchte er dann einen Stab und steckte diesen am Ufer vor der Falle in das Erdreich.
Bevor Charley sich zu dem nächsten Schlage begab, betrachtete er einen Augenblick sein Werk mit Wohlgefallen. Er hatte diese Fangart selbst erfunden und war nicht wenig stolz darauf, da sie sich sehr gut bewährte.
Von dem starkriechenden Bibermoschus auf dem Stabe am Ufer angelockt, nähert sich der Biber schwimmend. Plötzlich fühlt er die um den Schlag gesteckten Stäbchen. Er meint, Grund unter sich zu haben, und senkt die Beine nach unten auf den Teller der Falle. Diese schlägt bei der Berührung zu, und der Biber ist gefangen.
Das Fortschreiten auf dem unebenen Boden des Flusses war recht mühsam. Oft reichte das Wasser dem Trapper bis über die Knie. Besonders vor den von den Bibern aus Holzstücken und Gestrüpp aufgebauten Dämmen war es sehr tief. Die Kälte des Wassers ließ sich an den dichten Dunstwolken erkennen, die von den nackten, muskulösen Armen Charleys aufstiegen, an denen dieser die Aermel hoch emporgestreift hatte.
Doch der Fang war ergiebig, und zufrieden sang der Trapper, an seine beschwerliche Arbeit gewöhnt, ein lustiges Lied. Jim folgte in der Ferne seinem Beispiel.
Neun Biber lagen bald getötet auf dem Lande beieinander, und schmunzelnd machte sich Charley daran, den Tieren das Fell abzustreifen.
Nach einiger Zeit kam auch Jim mit fünf Fellen herbei, und nachdem die Brüder von den Körpern der Biber einige fette Schwänze abgetrennt hatten, die sie trotz des Trangehaltes als besondere Leckerbissen ansahen, warfen sie die Tiere abseits vom Fluß auf einen Haufen und wanderten wohlgemut nach ihrer Hütte zurück.
Sie waren noch nicht weit gegangen, als Charley mit den wunderbarsten Grimassen von einem Bein auf das andere zu hüpfen begann. Dabei stieß er bisweilen einen leisen Pfiff durch die Zähne.
"Du tanzt ja heute wieder wie ein Waschbär", sagte Jim, der den seltsamen Sprüngen seines Bruders eine Weile lächelnd zugeschaut hatte.
"Die Füße! Die Füße!" versetzte Charley mit kläglicher Miene. "Seitdem sie mir vor drei Monaten erfroren sind, verursachen sie mir Höllenqualen, sobald sie kalt werden."
"Du kannst noch von Glück sagen, daß du sie nicht ganz verloren hast," tröstete Jim. "Rieb ich sie dir nur eine halbe Stunde später mit Schnee ein, hättest du keine Stiefel mehr nötig gehabt."
Charley blickte sinnend vor sich hin, dann meinte er: "Ich glaube, in meinem Leben bin ich nicht so sehr erschrocken wie an jenem Morgen, als die Dinger auf einmal weiß wie Kreide vor mir lagen, nachdem du sie von den Stiefeln befreit hattest. Hauptsächlich der eine Fuß schimmerte so unangenehm gelblich. Wir hatten damals aber auch eine Kälte, daß selbst die Biber den Fluß nicht mehr von Eis freihalten konnten."
Mittlerweile waren die Brüder bei ihrer Behausung angekommen. Dort lagen starke Reifen bereit, in die sie die Felle ausspannten, um sie nachher zum Trocknen aufzuhängen.
Noch waren sie emsig damit beschäftigt, als plötzlich das Geräusch von aufschlagenden Pferdehufen hörbar wurde. Hastig griffen beide Trapper an den Revolver.
"Sind es die Rothäute, jage ich sie zum Teufel," brummte Jim. "Bei ihrem letzten Besuch haben sie hübsch unter unseren Vorräten aufgeräumt, und zum Tauschen hatten sie nichts mitgebracht."
Ein lauter Pfiff tönte jetzt durch die Luft, vom Echo der Berge vielfach wiederholt.
"Es ist Bill mit seiner Bande," sagte Charley ruhig und nahm seine Arbeit wieder zur Hand.
Gleich darauf erschienen sechs Männer auf schnaubenden Pferden. In ihrer Mitte ritt ein Knabe von sechzehn Jahren.
Es waren verwegen aussehende, bärtige Gestalten mit breitrandigen, grauen und schwarzen Hüten, denen eine lange Feder als Schmuck diente. Beinahe alle trugen wie die Trapper ein Lederhemd mit den langen Fransen an den Aermeln. Quer auf dem Sattel lag vor jedem eine kurze Büchse. Den Oberkörper des Knaben umhüllte eine dicke Wolljacke. Sein blondlockiges Haupt war unbedeckt.
"Halloo, old boys (Halloh, alte Jungens)!" rief der erste Reiter, ein schlankgewachsener Mann mit schwarzem, auf die breiten Schultern herabhängendem Haar und mächtigem Schnurrbart, indem er dicht vor den Trappern sein Pferd anhielt. "Habt wohl nicht vermutet, daß ich so bald schon wieder bei euch einkehren würde? Und nun bringe ich euch gar Besuch." Er zeigte auf den Knaben, der schüchtern seine großen, blauen Augen zu den Brüdern aufschlug. – "Den Jungen müßt ihr bei euch aufnehmen. Ich kann ihn auf meinem nächsten Streifzug nicht gebrauchen, obgleich seine Anlagen nicht schlecht sind, denn wir trafen ihn, wie er als Pferdedieb an einen Baum geknüpft werden sollte."
Der Knabe erbleichte und schaute zu Boden.
Charley erhob sich und musterte den angebotenen Gast mit scharfem Blick.
"Was sollen wir mit dem Jungen?" wehrte Jim ärgerlich ab. "Wir lassen lieber die Hände von solchem Gesindel. Nehmt ihn nur wieder mit, Bill!"
"Oho! Gesindel?" rief der Anführer, und seine Augenbrauen zogen sich finster zusammen. "Ihr rechnet mich und meine Leute doch nicht etwa auch dazu? Was der Knabe tat, tun wir ebenfalls. Ohne Pferde vermögen wir das Land nicht zu durchstreifen. Doch wir nehmen stets vom Ueberfluß. Kann mir oder meinen Leuten jemand nachweisen, daß ich einen armen Teufel je um einen Cent kränkte? Auch ich betreibe mein Handwerk ehrlich wie ihr. Ziehe ich die Grenze zwischen Mein und Dein etwas weiter, ist das eine Sache, über die unsere Ansichten vielleicht verschieden sind. Das aber sage ich euch: wollt ihr meine Freunde bleiben, behaltet den Jungen hier!"
"Wie nennt er sich?" fragte Charley.
"Bob ist mein Name," erwiderte der Knabe zaghaft anstatt des Führers. "Nehmt mich bei euch auf! Gern will ich arbeiten, soweit meine Kräfte ausreichen, und euch in allem behilflich sein."
"Von selbst geht der schlaue Biber nicht in die Falle. Unser Handwerk muß man kennen," brummte Jim.
"Habt Ihr es nicht auch einst erlernen müssen?" fragte der Knabe und schaute mit flehendem Blick auf den Trapper. "An Ausdauer soll es mir nicht fehlen, auch werde ich keine Mühe scheuen."
Die Antwort gefiel Charley augenscheinlich. Er wollte reden, doch Bill kam ihm zuvor.
"Junge, steige ab und reiche den beiden Männern die Hand! Du bleibst hier! Ich will es, und das genügt!" rief der Anführer und rückte ungeduldig auf seinem Sattel hin und her. "Macht doch nicht so viel Umstände, boys!" wandte er sich an die Brüder. "Taugt er nichts, jagt ihn zum Teufel, aber nach Westen, nicht nach Osten! Sonst fassen sie ihn vielleicht noch einmal beim Rockkragen. Wenn ich die Post anhalte und sämtlichen Passagieren ihr überflüssiges Geld abnehme, brauche ich nicht so viel Zeit, als wenn ich mit euch zu verhandeln habe. Ich wiederhole es: der Knabe bleibt hier bei euch! Jetzt macht mit ihm, was ihr wollt! Mir fehlt die Zeit, mich hier noch länger aufzuhalten." Kurz wandte er sein Pferd. "Auf Wiedersehen, boys!" Und so rasch es der steinige Boden erlaubte, ritt er mit seinen Begleitern auf dem Wege zurück, den er gekommen war.
Scheu blickte Bob den Reitern nach. Als sie verschwunden waren, atmete er erleichtert auf.
"Wollt ihr mich bei euch behalten?" fragte er dann schüchtern.
Jim schwieg trotzig und nahm seine Arbeit wieder auf.
"Vorläufig magst du absteigen und bleiben," sagte Charley freundlich. "Das weitere wird sich finden."
Erfreut sprang der Knabe aus dem Sattel. Er erfaßte die Hand des Trappers, und mit Tränen in den Augen sprach er: "Zürnt mir nicht, daß die Leute mich zu euch brachten! Da es aber geschehen ist, jagt mich nicht wieder fort! Treu und ehrlich will ich euch dienen und bemüht sein, euch stets meinen Dank zu beweisen."
"Ehrlich?" meinte Jim spöttisch. "Den Gaul hat dir wohl gar der frühere Eigentümer geschenkt?"
"Sattle dein Pferd ab und binde das Tier dort bei den unseren fest!" sagte Charley rasch, bevor Bob etwas erwidern konnte. "Dann komm zu mir! Ich will sehen, ob deine Finger nicht gar zu ungeschickt sind." Der Trapper ließ sich bei seinem Bruder nieder und nahm von neuem Fell und Reifen zur Hand.
"Hast du etwa die Absicht, den Knaben zu behalten?" fragte Jim, als Bob sich mit dem Gaule entfernt hatte.
"Mir tut der Junge leid," entgegnete Charley ausweichend. "Wer kann wissen, welch kummervolle Vergangenheit hinter ihm liegt. Er hat ein freies, offenes Auge und macht den Eindruck eines Verbrechers gewiß nicht. Wir sollten es wenigstens mit ihm versuchen. Damit wirst du doch einverstanden sein?"
Der Bruder antwortete nicht. Er summte leise eine Melodie vor sich hin, was er gewöhnlich zu tun pflegte, wenn er recht ärgerlich war.
Als Bob gleich darauf zurückkam, unterrichtete Charley ihn im Ausspannen der Felle und wies ihn darauf hin, daß die Hauptkunst dabei darin bestände, die Haut soviel wie möglich auszudehnen, da das Fell nach dessen Größe bezahlt werde.
Aufmerksam horchte der Knabe auf alles, was ihm gesagt wurde. Dann begann er selbst einen Versuch zu machen. Und mit Vergnügen sah sein Lehrmeister, daß er einen gelehrigen Schüler vor sich hatte.
Bald waren alle Felle in die Reifen gespannt und zum Trocknen an die Hütte und die danebenstehenden Bäume aufgehängt. Die Trapper gingen nun mit ihrem Gast zu dem erlegten Hirsche, der an Ort und Stelle ausgeweidet und dann in die Nähe der Hütte gebracht wurde. Dort zog man ihn mit einem Strick an einem Baum so hoch, daß die Wölfe auch im Sprunge die ihnen sonst so willkommene Beute nicht erreichen konnten.
Auch bei dieser Beschäftigung zeigte Bob in jeder Weise seinen guten Willen, und da es mittlerweile Mittag geworden war, und die Trapper alles Nötige für die Bereitung des Mahles herbeischafften, bat der Knabe sie, ihnen diese Arbeit abnehmen zu dürfen.
Lächelnd gab Charley seine Einwilligung.
Jim stopfte sich eine kleine Pfeife und setzte sich in einiger Entfernung auf einen Baumstumpf, von wo er dem jugendlichen Koch mit spöttischen Blicken zusah, indem er dichte Rauchwolken vor sich hinblies.
Behend sprang Bob mit einem Eimer zum Flußufer und holte Wasser. Dann zündete er ein Feuer an und stellte einen Kessel darauf, den er vorher mit Speck ausgerieben hatte. In ein Blechgefäß schüttete er Mehl, etwas Backpulver und Salz. Das rührte er mit Wasser zu einem Teig, den er in den Kessel tat. Diesen bedeckte er mit einem eisernen Deckel, auf den er glühende Kohlen legte. Von dem Hirsch hatte man vorher ein großes Stück Fleisch geschnitten. Der Knabe zerlegte es in mehrere Teile und warf sie, mit Salz bestrichen, in eine Pfanne mit kleingehacktem Speck, die er vorher auf das Feuer gestellt hatte. Behutsam wandte er die Fleischstücke von einer Seite zur anderen.
"Das Kochen und Braten kennst du, wie ich sehe," meinte Charley schmunzelnd, der den geschickten Bewegungen des Knaben mit Aufmerksamkeit folgte.
Bob war sichtlich erfreut über die Anerkennung, die ihm zuteil wurde.
"Das Erlernen der Kochkunst wurde mir nicht schwer, weil es mir Vergnügen machte," erwiderte er lächelnd. "Eine große Kenntnis gehört ja auch nicht dazu, da hier in den Bergen die Gerichte mehr oder weniger doch stets dieselben bleiben. Hat man lange genug gebratenes Fleisch gegessen, so ißt man es zur Abwechslung gekocht."
"Da hast du wohl recht. Für den Koch ist der Unterschied nicht groß. Aber in dem Fleisch selber besitzen wir eine hinreichende Auswahl. Wir haben hier Antilopen, Bären, Büffel, Rehe, Hirsche, Bergschafe, soviel wir wollen, um uns von den erlegten Tieren immer nur die schmackhaftesten Stücke nehmen zu können. Dazu kommt von Zeit zu Zeit ein fetter Biberschwanz, der gewiß nicht zu verachten ist. Ich sollte denken, das sei eine reiche Speisekarte für den Winter. Im Frühjahr, wenn wir von hier aufbrechen und in die tiefer gelegenen Gegenden ziehen, gibt es dann auf den Prärien die großen Hasen, Puter, Hühner, Präriehunde und allerlei Hochwild."
Des Knaben Augen glänzten. Er dachte an die Jagd auf alle diese Tiere.
Jim erhob sich jetzt von seinem Sitze und ging zu den Pferden. Er band seinen und des Bruders Gaul los und führte die beiden Tiere zum Trinken an den Fluß.
Charley wußte, daß Jim das Pferd des Knaben absichtlich zurückließ, um diesem zu zeigen, daß er für ihn nicht vorhanden sei. Auch Bob erkannte die Absicht des Trappers, und sein soeben noch frohes Lächeln verschwand aus seinem Gesichte. Selbst als Charley den Gaul nahm und ihn zum Fluß brachte, wollte die zufriedene Miene nicht wieder zurückkehren.
Nach einer Weile war das Mahl hergerichtet. Der Knabe hatte sich überzeugt, daß auch sein Brot ausgebacken war, da an dem Holzspan, den er hineinstieß, der Teig nicht mehr haften blieb.
Die Brüder setzten sich an das Feuer und begannen zu essen. Bob mußte von Charley wiederholt aufgefordert werden, bis er sich ebenfalls auf seinen Blechteller etwas Fleisch legte und von dem Brote ein Stück abbrach.
"Hast deine Sache gut gemacht, mein Junge," sagte Charley, als alle gesättigt waren, und klopfte dem Knaben vertraulich auf die Schulter. Langsam folgte er Jim in die Hütte.
Während die Brüder sich der Ruhe hingaben, machte der Knabe Wasser heiß und reinigte das gebrauchte Kochgerät. Dann nahm er die große Axt und spaltete Holz. Dabei dachte er mit Kummer daran, daß der eine Trapper ihm so wenig geneigt war. "Wie gern bliebe ich hier," seufzte er. Aber durfte er hoffen, diesen Wunsch erfüllt zu sehen, wenn Jim seine Ansichten nicht änderte? Er nahm sich vor, nachher doppelt aufmerksam gegen ihn zu sein. Vielleicht vermochte er ihn zu überzeugen, daß er es wirklich ehrlich meinte und gern tun wollte, was nur in seinen Kräften stand. Mit diesen Gedanken versuchte er sich zu trösten und arbeitete rüstig weiter.
Nach etwa einer Stunde hörte er die Brüder in der Hütte laut miteinander sprechen. Dann öffnete sich die kleine, aus Baumrinde verfertigte Tür, und Jim kam zum Vorschein.
Er trat auf den Knaben zu und fragte barsch: "Wie lange treibst du dich bereits hier im Lande umher?"
"Es mögen fünf Monate sein," antwortete Bob freundlich.
"Hinreichend Zeit, um aus einem gesitteten Menschen ein Vagabund zu werden."
Der Knabe errötete bis an die Schläfen, schaute aber mit seinen großen, blauen Augen frei zu dem Trapper auf, und sagte fest: "Ich habe ein ruhiges Gewissen. Ich tat nichts, was einem Menschen das Recht gäbe, mich einen Vagabunden zu schelten."
Der offene Blick und die freie Rede des Knaben machten Jim verlegen. Er beschäftigte sich mit seiner Pfeife, ohne etwas zu erwidern.
"Ihr seid nicht damit einverstanden, daß ich bleibe," fuhr Bob dringender fort. "Ich habe Euch doch nichts zuleide getan. Stoßt mich nicht noch einmal in die Wildnis hinaus! Nehmt mich gnädig auf! Mein ganzes Leben lang will ich Euch dafür dankbar sein!"
Jim wandte sich ab. "Es will mir nicht in den Sinn," brummte er.
"Weil du ein Starrkopf bist," rief Charley unwillig, welcher jetzt hinzutrat.
Der Bruder schwieg, doch summte er als Zeichen seines Aergers wieder eine Melodie vor sich hin. Dann zündete er seine Pfeife an, ging nach der Hütte, nahm dort die Flasche mit dem Bibermoschus nebst einem Kloben Holz und wanderte nach dem aufwärts am Fluß gelegenen Ausgange der Schlucht.
Einen Augenblick sah ihm Charley kopfschüttelnd nach, dann holte auch er sich Flasche und Holzkloben, und zu dem Knaben gewandt sagte er freundlich: "Komm mit mir, mein Junge! Ich will dir zeigen, wie einer der ältesten Trapper in den Bighorn Mountains seine Fallen stellt."
Hierbei zeigte Bob abermals, daß er geschickte Hände besaß. Charley bemerkte das bald. Er ließ sich keine Mühe verdrießen, seinem Schützling alles ausführlich zu erklären, der ihm auch gespannt zuhörte. Ein großes Vergnügen hatte Charley an der Freude des Knaben, die dieser laut äußerte, als in einer Falle an einem Ufervorsprunge ein gefangener Biber zappelte. Bob ließ das Tier, nachdem man es getötet hatte, nicht mehr aus der Hand, bis alle Schläge besichtigt und in Ordnung gebracht waren. Dann unterwies ihn Charley, wie dem Biber regelrecht das Fell abzuziehen sei, und beantwortete gleichzeitig die vielen Fragen, die ihm der Knabe wißbegierig stellte.
Mehrere Stunden vergingen, bevor die beiden wieder nach der Hütte kamen. Jim war schon dort. Er saß auf dem Baumstumpf und rauchte.
Bob holte einen Reifen herbei und spannte das Fell des gefangenen Bibers aus.
Als dies geschehen war, nickte sein Lehrmeister zufrieden mit dem Kopfe. Ihm war in Gegenwart des Bruders die Lust zum Sprechen vergangen, doch führte er jetzt einen Vorsatz aus, den er während des ganzen Nachmittags mit sich herumgetragen hatte. Er schenkte dem Knaben einen alten, abgelegten Hut, der für dessen Haupt wohl etwas reichlich groß war, aber dennoch immerhin seinen Zweck erfüllte.
Dankbar nahm Bob die Gabe in Empfang. Ihn freute beides: Geschenk und guter Wille, und mit froher Miene beschäftigte er sich wieder damit, Holz zu spalten.
So kam der Abend heran.
Der Knabe bereitete wie am Mittag das einfache Mahl. Schweigend wurde dasselbe von den dreien verzehrt. Dann reinigte Bob die Kochgeräte und brachte alles in die Hütte.
In der Nähe derselben zündete Charley ein Feuer an. Die Sonne war schon vor einer Weile hinter den hohen, westlichen Bergen verschwunden. Wieder leuchteten die schneebedeckten Kuppen in purpurner Glut, während es in der Schlucht bereits stark dunkelte.
Der Knabe führte die drei Pferde zum Fluß, und nachdem sie sich satt getrunken hatten, band er sie von neuem an einer anderen Stelle fest, wo sie für die Nacht genügend Futter finden konnten.
Jim war unterdessen an das Feuer getreten. Charley hoffte, daß der Bruder jetzt reden würde. Doch dieser rollte einen Holzblock herbei und ließ sich abermals stumm darauf nieder.
Nun aber riß Charley die Geduld, und zornig sagte er: "Schäme dich, Jim! Das habe ich nicht von dir erwartet. Nicht wie ein Mann, wie ein eigensinniges Kind handelst du. Anstatt dich zu überzeugen, daß der Junge tauglich ist und uns sogar von Nutzen sein kann, gehst du ihm aus dem Wege. Ich aber habe ihn geprüft und gefunden, daß wir eine Sünde an uns und an ihm begehen, wenn wir ihn wieder fortschicken. Ich wünsche daher, daß er bei uns bleibt. Jetzt kennst du meine Meinung, und ich will hoffen, daß die deinige ähnlich lautet." Auch Charley nahm einen Holzblock und setzte sich darauf.
"Meine Meinung ist, daß wir die Katze lieber nicht im Sack kaufen," erwiderte Jim nach einer kurzen Pause doch etwas kleinlaut. "Wir sind bis heute ehrliche Leute geblieben, weil wir mit keinem Gesindel Freundschaft geschlossen haben. Der Hehler ist so gut wie der Stehler, heißt es. Daran dachten wir bisher. Wer weiß, was der Junge außer dem Pferdediebstahl verbrochen hat. Seit fünf Monaten treibt er sich hier im Lande umher, wie er mir sagte, da wird es ihm vorher anderweitig doch wohl nicht mehr geheuer gewesen sein."
"Es ist gut, daß du da bist," wandte sich Charley hastig an den Knaben, der soeben von den Pferden zurückkam. "Es ist nicht Brauch hier im Lande, daß man jemanden nach seiner Vergangenheit fragt. Mich verlangt es auch wenig danach, zu wissen, woher du stammst, was dich zum Pferdestehlen und dann zu den Wegelagerern brachte. Aber mein Bruder wünscht genaue Auskunft darüber, bevor er sich bereit erklärt, dich hier bei uns aufzunehmen. Ich bitte dich daher, erzähle uns offen und ehrlich dein vergangenes Leben! Verhehle uns nichts, auch wenn du etwas begangen hast, was das Licht scheut! Willst du das tun, mein Junge?"
Bob war sichtlich verlegen geworden. Unschlüssig rückte er den Hut von einer Seite zur andern. Endlich sagte er: "Das ist eine lange Geschichte."
"Das schadet nicht," drängte Charley. "Bis zum Schlafengehen dauert es doch noch eine Weile. Nimm hier Platz bei uns und. sprich es dir vom Herzen herunter, als erzähltest du es dir selbst!"
Noch eilten Augenblick zögerte der Knabe. Dann holte er tief Atem, und fest sagte er: "Gut! Es sei! Ich will euch alles berichten, wie es gewesen ist."
Zweites Kapitel
Bobs Flucht
Bob ließ sich ebenfalls auf einen Holzblock nieder. Nach kurzem Nachdenken begann er zu reden, zuerst nur zaghaft, aber seine Stimme wurde nach und nach fester.
"Mein Vater bekleidet einen kleinen Beamtenposten in Omaha. Unzufrieden mit seiner Tätigkeit ergab er sich bisweilen dem Trunke, und in seinem berauschten Zustande schlug und schalt er mich unbarmherzig und ohne Grund, so daß mir mein Dasein von Tag zu Tag unerträglicher wurde."
"Was sagte die Mutter dazu?" fragte Charley.
"Eine Mutter habe ich nie gekannt," entgegnete Bob wehmütig. "Mein Vater hielt eine Haushälterin. Von ihr hatte ich ebenfalls viel zu leiden. Doch das hätte ich schließlich wohl noch alles ertragen. Ich hoffte, meine Vaterstadt nach Beendigung der Schuljahre verlassen und auf einer Farm arbeiten zu dürfen. Das war seit früher Jugendzeit mein sehnlicher Wunsch. Das Leben in der freien Natur lockte mich, und ich benutzte jede freie Stunde, an die Ufer des gewaltigen Missouri oder vor die Stadt in den Wald hinauszulaufen. Dort vergaß ich bei all den Herrlichkeiten um mich her immer wieder meinen Kummer. So kam das Ende der Schulzeit heran. Da eröffnete mir mein Vater eines Abends, als er wieder berauscht heimkehrte, daß er eine Stelle für mich als Schreiber in seinem Bureau ausgewirkt habe; nach und nach könne ich dann dasselbe werden wie er, habe er doch ebenfalls klein, angefangen. Die Nachricht traf mich wie ein Donnerschlag. Mein Vater kannte meine Wünsche. Noch einmal trug ich sie ihm vor. Ich bat und flehte. Alles war vergeblich. Er wollte nichts davon wissen und meinte, ich müsse gleich etwas verdienen; das wenige Geld, das er bekäme, reiche schon lange nicht mehr aus, mich zu unterhalten. Auch sagte er, er ärgere sich schon, längst, auf den Vertrag eingegangen zu sein, was ich freilich nicht verstand. Die Haushälterin kam hinzu und unterstützte ihn noch in seiner Ansicht. Er schrie sich in eine regelrechte Raserei hinein, schlug und stieß mich zuletzt und brüllte unaufhörlich: "Du wirst Schreiber! Du wirst Schreiber!"
Dieses Wort lag mir wie Zentnerlast auf dem Herzen, als ich mich endlich allein in meinem Dachkämmerchen befand. Daß mir der Beruf, der meinen Vater mit Widerwillen erfüllte, auf keinen Fall ebenfalls das Leben verbittern sollte, stand bei mir fest. Ich lag während der ganzen Nacht wach und sann über einen Ausweg nach. Auch am folgenden Tage beschäftigte mich immer nur dieser eine Gedanke. Abends stand ich am hohen Missouri-Ufer und schaute den Passagieren zu, die in großen Booten von Council Bluffs über den breiten Strom nach Omaha gefahren wurden, und nun von hier mit der Bahn weiter nach dem schönen Westen wollten, von dem ich so viel gehört hatte. Wie herrlich mußte es dort sein und wie beneidete ich die Leute, die ungehindert dorthin reisen durften, während ich zu Hause bleiben und Schreiber werden sollte! Als ich nachts in meinem Bette lag und jämmerlich über die Schläge weinte, die mir der Vater unter wunderlichen Reden abends abermals verabreicht hatte, schoß mir plötzlich der Gedanke durch den Kopf, daß es bei der grundlosen, grausamen Behandlung keine Sünde sein könne, wenn ich auf und davon liefe. War es nicht der einzige Ausweg, den ständigen Quälereien zu entgehen? Auf einmal stand mein Entschluß fest. Ich wollte nicht länger in dem Hause bleiben, wo ich wie ein Sklave behandelt wurde. Fort wollte ich, hinaus in die Freiheit, auch nach dem fernen, schönen Westen."
"Das hätte ich ebenfalls getan!" schaltete Charley lebhaft ein. Und auch Jim nickte zustimmend mit dem Kopfe.
"Am nächsten Tage versäumte ich die Schule und lief an der Bahnstation umher, um eine kostenlose Reisegelegenheit auszukundschaften, denn ich besaß ja kein Geld. Mir erschien nur eins ausführbar.
Abends packte ich heimlich einige Sachen und etwas Mundvorrat in eine kleine Tasche. Dann verließ ich das Haus, in dem ich nur böse Stunden kennen gelernt hatte. Der Gedanke, meinen Vater nun vielleicht niemals wiederzusehen, ließ mich vollständig kalt, hatte ich den Mann doch niemals lieb gehabt. An der nur mäßig erleuchteten Station, von der der Zug erst später abfuhr, schlich ich zwischen den einzelnen Wagen umher. Ich fand einen beinahe gefüllten Gepäckwagen, dessen Tür nicht verschlossen war. Vorsichtig kroch ich hinein und versteckte mich hinter den Kisten und Koffern. Eine bange, Stunde verging; sie kam mir wie eine Ewigkeit vor.