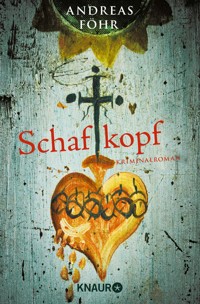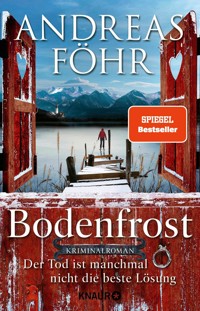
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Wallner & Kreuthner Krimi
- Sprache: Deutsch
In Bayern geht der »Harpunier« um – Fall 12 für die Kult-Kommissare vom Tegernsee! »Bodenfrost« ist der 12. Bayern-Krimi von Bestseller-Autor Andreas Föhr: Regio-Charme trifft intelligente Spannung mit hintersinnigem Humor. Nachdem Leonhardt Kreuthner einen peinlichen Vorfall mit dem neuen Polizeipräsidenten verursacht hat, wird er dazu verdonnert, den jährlichen Kindernachmittag der Miesbacher Polizei auf dem Gelände eines ehemaligen Bauernhofs zu leiten. Dort erklärt er Kindern typische Polizeisituationen. So auch, was passiert, wenn die Polizei zu einer Schlägerei gerufen wird. Zwei entsprechend dekorierte Schaufensterpuppen stellen die beteiligten Raufbolde dar. Allerdings findet eines der Kinder noch ein weiteres Opfer der vermeintlichen Schlägerei ganz in der Nähe. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei aber nicht um eine Schaufensterpuppe - sondern um das Opfer eines Mordes. Auf dem Bauch des Toten hat der Täter eine Zeichnung hinterlassen, mit der vor einigen Jahren ein Serienkiller mit dem Spitznamen "Der Harpunier" seine Opfer markiert hatte. Eine ungelöste Mordserie, die abrupt endete. Ist der Harpunier zurück? Kommissar Wallner, Kreuthner und die Polizei Miesbach bekommen alle Hände voll zu tun... Regio-Krimi aus Bayern mit Hirn und schwarzem Humor Andreas Föhr zeichnet seine Figuren ebenso liebevoll wie lebensecht, ohne sie ins Lächerliche zu ziehen. Seine lustige Krimi-Reihe besticht mit hoch spannenden, intelligenten Fällen und jeder Menge original bayrischem Lokalkolorit. Die kultigen bayerischen Regio-Krimis um Clemens Wallner, Leonhardt Kreuthner und Karla Tiedemann sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Prinzessinnenmörder - Schafkopf - Karwoche - Schwarze Piste - Totensonntag - Wolfsschlucht - Schwarzwasser - Tote Hand - Unterm Schinder - Herzschuss - Totholz - Bodenfrost
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Andreas Föhr
Bodenfrost
Der Tod ist manchmal nicht die beste Lösung
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Nachdem Leonhardt Kreuthner einen peinlichen Vorfall mit dem neuen Polizeipräsidenten verursacht hat, wird er dazu verdonnert, den jährlichen Kindernachmittag der Miesbacher Polizei auf dem Gelände eines ehemaligen Bauernhofs zu leiten. Dort erklärt er Kindern typische Polizeisituationen. So auch, was passiert, wenn die Polizei zu einer Schlägerei gerufen wird. Zwei entsprechend dekorierte Schaufensterpuppen stellen die beteiligten Raufbolde dar. Allerdings findet eines der Kinder noch ein weiteres Opfer der Schlägerei ganz in der Nähe. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei aber nicht um eine Schaufensterpuppe - sondern um das Opfer eines Mordes. In den Händen hält der Tote eine Sichel und Getreideähre. Der Fall gleicht bis ins Detail einer ungelösten Mordserie, die vor zehn Jahren ein plötzliches Ende nahm. Ist der »Schnitter« zurück?
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
Danksagung
Für Damaris
1
17. März
Der Tag war ungewöhnlich warm für Mitte März. Über die Berge blies der Föhn und fraß braune Flecken in die Schneedecke.
Die Drohnenkamera fasste die Zugspitze ganz im Westen ins Visier und schwenkte dann Richtung Osten, das Brauneck kam ins Bild, Fockenstein, Hirschberg, der Tegernsee mit Setzberg und Wallberg, dahinter mächtig aus dem Tirolerischen aufragend der Guffert, dann Bodenschneid, Neureuth und schließlich der Wendelstein mit dem Sendemast. Kindergeschrei drang zu der Drohne hinauf. Das freilich nur leise, denn das Mikrofon war nicht das beste, und die Drohne schwebte in fünfzig Metern Höhe. Unter ihr die Wiese um das Sackerer Gütl, mit einer Szenerie, auf die PHM Benedikt Schartauer per Fernsteuerung jetzt das Objektiv der Drohne richtete.
Das Sackerer Gütl war ein aufgelassener Bauernhof, den die Polizei heute für eine besondere Veranstaltung nutzte: den alljährlich stattfindenden Kindertag. Er sollte Kindern im schulpflichtigen Alter die Arbeit der Polizei näherbringen. Die Drohnenaufnahmen dienten als Doku-Material, das man später zu PR-Zwecken und für Schulungsmaßnahmen verwenden wollte.
Aus der Vogelperspektive konnte man gut sehen, wie die verschiedenen Stationen auf dem Gelände verteilt waren. Auf dem Schotterweg zum Hof gab es eine Radarkontrolle, bei der die Kinder selbst Messungen durchführen durften, während andere Kinder versuchten, mit dem Fahrrad auf Geschwindigkeiten zu kommen, die für eine Geldbuße reichten. Das gelang durchaus, denn man hatte ein Tempo-20-Schild aufgestellt. Es gab Stände mit illegalen Waffen, mit Drogen, dazu Streifenwagen, in die sich die Kinder setzen durften, Beamte und Pferde der Reiterstaffel aus München, eine Verkehrskontrolle an der Zufahrtsstraße und vieles mehr. Im Augenblick sah man von oben einen Polizisten vor einer Gruppe von Kindern und einigen Erwachsenen mit etwas hantieren, das sich bei näherer Betrachtung als Gasanzünder erwies.
»So, dann geh du mal her«, sagte Polizeihauptmeister Leonhardt Kreuthner zu einem etwa achtjährigen blonden Mädchen, dessen obere Schneidezähne die Größe von zwei Stück Würfelzucker hatten. »Wie heißt du denn?«
»Martha.«
»Und des is dein Papa?«
Das Mädchen nickte. Kreuthner wusste, wer der Vater war. Er hieß Sebastian Binger und war der Präsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Auch wenn er noch nicht lange im Amt war, verband ihn mit Kreuthner bereits ein ausnehmend unglückliches Vorkommnis, weshalb es Kreuthner geraten schien, für die Aufgabe, die jetzt anstand, Bingers Tochter zu wählen.
»Schau, du nimmst des jetzt und machst die Kerze an.«
Er drückte dem Mädchen den Gasanzünder in die Hand und geleitete sie zu einer seltsam anmutenden Vorrichtung. Es war eine lange Holzwippe. Auf der einen Seite der Wippe war ein kleiner Stein festgebunden, auf der anderen eine dünne Kerze befestigt. Die Seite mit der Kerze befand sich unten am Boden, während der Stein etwa einen Meter über dem Boden schwebte. Über der Kerze hing an einer Art Galgen ein kleines Häuschen. Es sah aus wie ein Vogelhäuschen, nur dass es ganz aus Stroh gefertigt war.
Das Mädchen drückte mit beiden Zeigefingern auf den Abzug, und schon machte es klack, und eine Flamme erschien am Ende des kleinen Rüssels. Bedächtig, ja nachgerade andächtig schritt die Kleine zur Kerze und entzündete sie. Kreuthner nahm jenes Leuchten in ihren Augen wahr, das sonst nur echten Pyromanen zu eigen ist, und er fragte sich, ob das eben für die Tochter des Polizeipräsidenten eine entscheidende Gabelung auf ihrem Lebensweg gewesen war.
»Danke, Martha. Das hast du super gemacht.« Er entließ die Kleine wieder in die Obhut ihres Vaters. »So«, sagte Kreuthner an seine Zuhörer gewandt. »Was is des jetzt?« Er blickte kurz in die Runde ratloser Gesichter. »Des erklär ich gleich. Es hat was zu tun mit dem …«, Kreuthner sah erneut in die Runde, aber niemand wagte den Satz zu beenden, »… dem Brandstifter. Ein Brandstifter ist einer, der wo umeinandgeht und Häuser anzündt, oder Heustadel oder irgendwas anderes.«
»Warum macht der das?«, wollte ein Knabe mit Undercut wissen.
»Sehr gute Frage! Warum macht der Brandstifter des?« Kreuthner verschränkte die Arme und blickte abermals ins Rund. »Wer von euch hat schon amal was angezündet?«
Etwas zögerlich gingen kleine Arme nach oben, erst zwei, dann mehr, schließlich war es die Mehrzahl der anwesenden Kinder. Die Blicke der zugehörigen Eltern zeugten von irritiertem Erstaunen.
»Und warum habt’s des g’macht?«
Verlegenes Lächeln und Getuschel war die Antwort.
»Na, weil’s Spaß macht, oder?« Er erntete heftiges Nicken aus fröhlichen Kindergesichtern. »Gell – wenn’s richtig brennt und kracht und die Funken fliegen, des ist halt a Gaudi. Und deswegen macht der Brandstifter des auch. Weil den freut’s, wenn’s brennt. Und oft is er auch dabei, wenn’s Feuer wieder g’löscht wird.«
»Bei der Feuerwehr?«, fragte ein Kind.
»Ja genau. Bei der Feuerwehr.«
»Jetzt verzählen S’ den Kindern doch nicht so was! Die Feuerwehr is zum Löschen da, net zum Feuerlegen«, meldete sich eine Frau.
»Was glauben Sie, wie viel Brandstifter bei der freiwilligen Feuerwehr san? Letztes Jahr hamma erst wieder einen erwischt. Ich nenn ihn mal Ignatz S. Jetzt komm, Nazi, hamma g’sagt, wieso hast denn des alles ozunden? Ja, hat er g’sagt, des wär immer so a tolles kameradschaftliches Erlebnis g’wesen, wenn s’ nachm Einsatz z’sammg’sessen san und ham g’redet und Bier getrunken.« Kreuthner wandte sich wieder seiner Wippe zu. »Und jetzt schauen mir mal, wozu des gut is.«
Die Kerze war inzwischen schon ein wenig heruntergebrannt.
»Mir müssen den Brandstifter ja überführen. Aber wenn ihn keiner g’sehen hat, wie er das Feuer legt, wird’s schwierig. Und manchmal sagt er auch: Ich war ja gar net da, wie des Feuer ausgebrochen is. Da war ich auf einer Party in München, und des können ganz viele Leute bezeugen. Und wenn er in München war, dann kann er ja net hier in Miesbach a Haus anzünden – oder doch?« Kreuthner sah jetzt in die Runde, Kinderaugen hingen an seinen Lippen. »Aber so schnell glauben mir dem Brandstifter nicht! Weil mir kennen ja unsere Pappenheimer. Vielleicht hat er so was benutzt.« Kreuthner deutete auf die Wippe mit der Kerze. »Eine Floriansschaukel. Warum Florian? Na, der heilige Florian is der Schutzpatron von der Feuerwehr. Und wenn man so eine Schaukel hernimmt, dann bekommt die Feuerwehr was zu tun. Und wie funktioniert des? Dazu schaun mir uns jetzt mal die Kerze an. Was passiert mit der Kerze?«
»Die wird kleiner«, sagte ein Kind.
»Richtig! Und wenn sie kleiner wird, dann wiegt sie auch weniger. Und irgendwann wiegt sie so wenig, dass sie leichter is wie der Stein am andern Ende. So a Brandstifter nimmt natürlich a dicke Kerze her. Da dauert des ein, zwei Stunden. Und in der Zeit is er schon in München auf der Party. Und hier in Miesbach …?«
Kreuthner wandte sich wieder der Kerze zu. Die hatte einen weiteren Teil ihrer Masse verloren, und es kam zögerlich Bewegung in die Wippe.
»Na? – Da tut sich doch was.«
Alle Kinder rückten näher und starrten gebannt auf die Kerze. Kreuthner hob die Hände und wandte die erhobenen Handflächen in Richtung seiner Zuschauer.
»Jetzt gehen mir mal bitte a Stückl zurück. Weil gleich passiert was. Bitte zurücktreten!«
Die Kinder taten wie ihnen geheißen. Inzwischen ging ein leichtes Zucken durch die Kerzenflamme, und mit einem Mal schwebte sie ganz langsam nach oben, während der Wippenarm mit dem Stein zu Boden sank. An ihrem höchsten Punkt war die Kerze nur noch wenige Zentimeter von dem Strohhäuschen entfernt, das innerhalb von Sekunden in Flammen aufging. Und nicht nur das: Kaum loderte die Flamme hoch, knallten auch schon einige kleinere Feuerwerkskörper, und Wunderkerzen versprühten Funken. Die Kinder lachten und klatschten verzückt in die Hände.
»Des is a Spaß, oder?«, freute sich Kreuthner mit seinem jungen Publikum. Die Begleitpersonen der Kinder schienen indes alles andere als verzückt und warfen ihm weiterhin irritierte Blicke zu. Der räusperte sich und sagte schließlich: »Aber ganz wichtig: Nicht zu Hause nachmachen, gell! Finger weg vom Feuer.«
»Wichtiger Hinweis und gerade noch rechtzeitig«, raunte Polizeipräsident Binger.
Die letzten verkohlt-glühenden Reste des Häuschens fielen zu Boden, und Kreuthner trat die Glut aus.
»Und jetzt, Kinder, jetzt schauen mir mal, wie’s bei einem richtigen Polizeieinsatz abläuft. Auf geht’s!«
Kreuthner ging Richtung des alten, leer stehenden Bauernhauses und bedeutete Schartauer, der immer noch mit der Drohne beschäftigt war, mitzukommen. Eltern und Kinder folgten ihnen. Auf dem Weg zum Haus passierte die Gruppe eine Apparatur aus Edelstahl.
»Was ist das?«, fragte ein Kind.
»Des is a Destille«, sagte Kreuthner. »Damit machen Leute Schnaps, aber das dürfen s’ eigentlich net.« Kreuthner verschwieg, dass er selbst aktiv war im Schwarzbrennergeschäft. »Da kommen mir dann als Nächstes hin.«
»Mir ham auch so was zu Haus«, sagte der Kleine.
»Ah so?« Kreuthner blickte zum Vater des Kindes.
»Geh, Maximilian, was verzählst denn da für G’schichten? Also wirklich!« Der Vater schüttelte lachend den Kopf und wandte sich Kreuthner zu. »Was er sich immer ausdenkt, der Bua. Kinder halt.«
»Ja, die kriegen mehr mit, wie man meint.«
»Des is net g’logen«, beharrte Maximilian. »Mir ham des auch.« Der Vater verdrehte die Augen. »Doch, im Keller!«, versuchte der Kleine, dem Gedächtnis seines Vaters auf die Sprünge zu helfen.
»Nein, Maximilian. Da verwechselst was. Mir müssen jetzt auch langsam gehen. Die Mama wartet schon mit’m Essen.«
Hektisch und mit einem unwilligen Sohn an der Hand verabschiedete der Mann sich. Kreuthner vermutete, dass er noch heute die Destille aus dem Keller entfernen würde. Gut so. Ein Konkurrent weniger auf dem Markt für Schwarzgebranntes. Binger warf Kreuthner ein kopfschüttelndes Lächeln zu. Ansonsten war’s ihm egal, dafür war der Zoll zuständig.
Sie kamen an dem Bauernhaus an. Dort waren zwei reichlich derangierte männliche Schaufensterpuppen platziert worden. Eine saß mit zerrissenem Hemd und zwei Pflastern im Gesicht auf der Bank, die andere hatte einen Verband um den Kopf und eine Schiene am linken Arm, beiden hatte jemand liebevoll einige Blessuren ins Gesicht geschminkt, und eine Puppe hatte ein Messer in der Hand.
»So, was hamma denn da?«, sagte Kreuthner zu Schartauer.
»Des war a Notruf«, sagte Schartauer. »Schlägerei vor einem Wirtshaus, mehrere Beteiligte. Da müssen mir hinfahren und erst amal schauen, wie die Situation is. Hier san zum Beispiel zwei männliche Verdächtige. Also verdächtig, dass sie eine Körperverletzung begangen haben.« Schartauer deutete auf das Messer. »In dem Fall sogar gefährliche Körperverletzung mit Messer. Da kommt man bis zu zehn Jahre ins Gefängnis.«
»Also die beiden da«, übernahm Kreuthner wieder, »ham irgendwen verhauen, und das darf man nicht! Hauen geht gar net. Des ham s’ euch sicher in der Schul g’sagt.«
»Und wen haben die verhauen?«, wollte ein etwa achtjähriges Mädchen wissen.
»Mei – entweder sich gegenseitig oder wen anders, und der andere … der is vielleicht schon im Krankenhaus.«
»Nein, der ist hier!«, meldete sich Martha, die Tochter des Polizeipräsidenten, und lachte Kreuthner stolz an. Sie stand fünf Meter entfernt vor der Tür, die ins Bauernhaus führte. Die Tür war geöffnet.
»Wer is da?«, fragte Kreuthner nach.
Martha senkte ihre Stimme und flüsterte in verschwörerischem Ton: »Na der, den sie verhauen haben.«
Kreuthner tauschte einen Blick mit dem Polizeipräsidenten, der seine Tochter anscheinend kurz aus den Augen verloren hatte.
Kreuthners Miene deutete an, dass er nicht wusste, wovon das Kind sprach, gefolgt von einem Blick, der sagte: Na gut, dann lassen wir ihr mal den Spaß.
»Soso!«, sagte Kreuthner, und: »Ja, dann schaun mir doch mal, wer das ist.« Er machte sich auf den Weg zur Tür.
»Wieso ist die Tür auf?«, wollte der Polizeipräsident wissen. »Es hieß doch, in den Hof darf keiner rein.«
»Keine Ahnung. Mir ham’s net aufg’macht«, sagte Kreuthner und dann zu Martha: »Bitte nicht da reingehen! Des is g’fährlich.«
Er leuchtete mit einer Taschenlampe in den dunklen Hausflur, es war aber nichts zu sehen. »Wo is da jemand?«
»In dem Zimmer«, flüsterte Martha aufgeregt und deutete auf eine zwei Meter entfernte Tür, die von dem Flur nach rechts abging.
Kreuthner betrat vorsichtig das Haus und sah sich um. Der Geruch von Staub und Schimmel erfüllte die Luft. Die Tür, auf die Martha gezeigt hatte, führte zur ehemaligen Wohnstube des Anwesens. In dem Raum war es dunkel, denn die Fensterläden waren zu. Kreuthner scannte das Zimmer mit der Taschenlampe ab und registrierte zwei kaputte Holzstühle, Massen von Spinnweben, einen ehemals prächtigen, jetzt verstaubten Kachelofen – und einen leblosen menschlichen Körper, der vor dem Kachelofen auf dem Boden lag. Der Polizeipräsident trat neben Kreuthner. In diesem Moment machte jemand die Fensterläden von außen auf, und Licht fiel auf die Szenerie. An den Scheiben drängten sich etliche Gesichter von Erwachsenen und Kindern.
»Was soll das denn sein?«, fragte der Polizeipräsident. »Hören Sie, Herr Kreuthner – das ist wohl kaum noch kindgerecht. Was haben Sie sich dabei gedacht?«
Kreuthner ging vorsichtig zwei Schritte in den Raum hinein, beugte sich nach unten und leuchtete dem auf dem Bauch liegenden Menschen ins Gesicht und fühlte den Puls am Hals. Dann ging er ebenso sorgfältig wieder zwei Schritte zurück und wandte sich Binger zu.
»Der g’hört net dazu«, sagte er leise.
Der Polizeipräsident warf einen besorgten Blick zu der Person auf dem Boden. »Aha … und wer ist das dann?«
»Der Mann heißt Vitus Zander. Er wurde heute Morgen als vermisst gemeldet und ist allem Anschein nach tot.« Kreuthner zückte sein Handy.
»Doch nicht der Zander von der Brauerei?«, hauchte der Polizeipräsident und sah aus, als sei ihm das namenlose Grauen begegnet.
»Der von der Brauerei.« Kreuthner wählte die Nummer der Polizeistation. »Mir sollten jetzt rausgehen, weil des is wahrscheinlich a Tatort.«
»Scheiße!«, sagte der Polizeipräsident.
2
15. Februar – 31 Tage vor dem Leichenfund
Isabell und Vitus nahmen in der Zirbelstube Platz. Am quadratischen Tisch und, wie jeden Abend, um genau 19 Uhr. Isabell saß auf der Bank, Vitus auf einem alten, kunstvoll gedrechselten Bauernstuhl ihr gegenüber. Den Zwiebelrostbraten und die Bratkartoffeln hatte Isabell bereits in der Küche auf Tellern angerichtet, dazu grüne Bohnen mit Speck. Neben Vitus’ Gedeck hatte Isabell ein Bierglas mit Gravur der Zanderbrauerei gestellt, daneben eine Flasche Export gleicher Provenienz, die sie unmittelbar vor dem Platznehmen aus dem Kühlschrank geholt und geöffnet hatte. Auch die Bierdeckel aus Kork trugen das Logo der Brauerei. Heute war das, was Vitus einen anlasslosen Wochentag nannte. Deswegen wurde auf förmliche Kleidung verzichtet. Das bedeutete für Isabell: blaues Hausdirndl mit blau-weiß gestreifter Schürze und flache Pumps von Jimmy Choo. Vitus legte Wert auf Schuhwerk der Oberklasse. Er selbst trug unter der weinroten Samtweste von Lodenfrey ein weißes Hemd mit seidenem Halstuch. An den Kleinigkeiten erkannte man den Mann von Stil, hatte Vitus Isabell schon frühzeitig beigebracht.
Man wünschte guten Appetit und machte sich gerade daran, den Zwiebelrostbraten zu schneiden, als Vitus innehielt. Isabell erstarrte ebenfalls in ihrer Bewegung und war beunruhigt. Vorsichtig blickte sie in Richtung ihres Ehemannes. Der hatte die Augenbrauen hochgezogen und drehte sein Messer so, dass sie die Klinge sehen konnte. Auf der Klinge befand sich ein winziger Essensrest, den die Spülmaschine offenbar nicht entfernt hatte. Isabell erschrak, als sie den braun-rötlichen Fleck sah.
»Das tut mir leid. Ich bring dir ein neues.«
Sie stand auf, nahm das Messer an sich und ging zu der antiken Anrichte, die neben der Tür stand. In der rechten Schublade befand sich das Besteck.
»Du musst jedes Besteckteil kontrollieren, wenn du es aus der Maschine nimmst. Ich weiß nicht, wie oft ich dir das schon gesagt habe. Stell dir vor, Mama und Vati wären heute zum Essen gekommen. Oder Gäste!« Aus dem letzten Satz klang der ganze Schrecken, den der bloße Gedanke an ein solches Szenario einflößte.
»Es tut mir leid«, wiederholte Isabell. »Ich war im Stress.« Sie legte Vitus vorsichtig ein neues Messer hin.
»Im Stress?«
»Als ich die Spülmaschine ausgeräumt habe, kam gerade ein Anruf. Und da hab ich wohl nicht so genau hingesehen.«
»Wieso hast du nicht gesagt, dass du beschäftigt bist und später zurückrufst?«
»Ja, hätte ich machen sollen.« Isabell nahm wieder Platz. »Kommt nicht wieder vor.«
Sie begannen kleine Stücke von ihren Bratenscheiben zu schneiden.
»Wer hat denn angerufen?«
»Hm …« Isabell hatte den Mund voll und beeilte sich, hinunterzuschlucken. »Emmy.«
»Ach … Emmy!« Wieder gingen Vitus’ Augenbrauen nach oben.
»Ja, wir – also, das wollte ich dir ohnehin sagen –, wir wollen am Freitag eine Bergtour machen.«
»Das wird aber nicht gehen.«
»Warum?«
»Weil Mama nach München fahren will. Zum Einkaufen.«
Vitus widmete sich seinem Essen, als sei das Thema damit ausgeredet und beendet.
»Aber … ich meine, muss ich da unbedingt mit?«
»Wie bitte?«
Isabell zuckte zusammen.
»Mama ist fast siebzig. Willst du ihr allen Ernstes zumuten, allein nach München zu fahren?«
»Ich würde ja mitfahren. Aber vielleicht finden wir einen anderen Tag. Emmy kann nur am Freitag.«
»Wenn ihr so dringend eine Bergtour machen wollt, dann kann sich Emmy ja verdammt noch mal auch nach dir richten. Abgesehen davon …« Vitus suchte Isabells Blick. Es dauerte eine Weile, bis sie es wagte, ihn anzusehen. »Abgesehen davon hatte ich schon mehrfach angemerkt, dass ich nicht besonders glücklich bin über deinen Kontakt mit Emmy. Hatte ich das nicht?«
Isabell schwieg.
»Emmy bezeichnet sich als deine Freundin. Aber sie verhält sich feindselig mir gegenüber, meiner Mutter gegenüber, das heißt deiner Familie gegenüber. Tun Freundinnen so etwas?«
»Sie hat das damals nicht so gemeint.«
»Sie hat mich zurechtgewiesen und wollte mir Vorschriften machen, wie ich mit dir zu reden habe. Das lasse ich mir nicht bieten, von niemandem.«
Isabell setzte zu einer beschwichtigenden Erwiderung an, doch Vitus gebot ihr mit einer Handbewegung zu schweigen.
»Um es mal deutlich zu sagen: Ich möchte gar nicht mehr, dass du mit ihr zu tun hast. Sie hetzt dich gegen deine Familie auf und will uns spalten. So jemand hat in unserem Freundeskreis nichts zu suchen.«
»Das heißt …«, Isabells Augen wurden feucht, »… ich darf sie gar nicht mehr sehen?«
»Das wäre in der Tat die beste Lösung. Und du wirst dich besser fühlen, glaube mir. Jemand, der ständig Gift verstreut, tut einem nicht gut.«
»Aber ich hab sonst niemanden, mit dem ich was machen kann.«
»Du hast niemanden? Mama, Vati, ich – sind wir niemand?« Vitus legte seine Serviette mit einem konsterniert wirkenden Kopfschütteln auf den Tisch und atmete durch. »Sehr interessant, zu erfahren, wie du über uns denkst. Wenn auch … ziemlich verletzend.«
»Nein, so hab ich das nicht gemeint …«
»Wie denn sonst? Deine Familie ist dir nicht genug. Das hast du gemeint.«
»Nein, das habe ich nicht gemeint. Ich … ich will doch nur eine Freundin haben. Nur eine.«
»Dann such dir eine, die dich nicht gegen deine Familie aufhetzt. Und jetzt würde ich gern essen.«
Vitus widmete sich mit Konzentration seinem Zwiebelrostbraten.
Isabell schnitt ein Stück Fleisch von ihrer Scheibe, starrte die goldbraun gerösteten Zwiebeln darauf an und bemerkte ein Zittern ihrer rechten Hand, mit der sie das Messer hielt.
Seit der achten Klasse kannte sie Emmy. Bis zu Isabells Hochzeit waren sie unzertrennbar gewesen, hatten jeden Urlaub, jede Reise miteinander verbracht, hatten zweimal pro Woche bei der jeweils anderen übernachtet, waren in der Familie der Freundin wie eine Tochter aufgenommen worden und hatten über Dinge geredet, die sie niemandem sonst auf der Welt anvertraut hätten. Ein aus dem Bauch aufsteigendes Gefühl schnürte Isabell die Kehle zu.
»Ich werde …« Sie setzte noch einmal ab, um ihre Stimme zu festigen. »Ich werde am Freitag die Bergtour machen. Mit Emmy.«
Vitus aß noch einen Bissen mit angemessener Ruhe, bevor er den Kopf hob und seine Frau ansah. »Wie bitte?«
Isabell nahm all ihren Mut zusammen und sagte: »Du kannst mich doch nicht einfach einsperren.«
»Mein Engel – niemand sperrt dich ein. Ich verlange lediglich, dass du dich von Personen fernhältst, die uns schaden wollen.«
»Emmy will uns nicht schaden.«
»Ich glaube nicht, dass du das beurteilen kannst. Du bist da emotional zu sehr involviert.«
Isabell sah ihm trotzig in die Augen.
»Nun gut. Offenbar sind wir dazu unterschiedlicher Meinung. Dann sage ich dir als dein Ehemann: Du wirst Emmy nicht mehr sehen. Ich habe es hiermit entschieden.«
Isabell liefen Tränen die Wangen hinab.
»Was ist?«, fragte Vitus.
Isabell sah ihn wütend und verheult an. »Das kannst du mir doch nicht einfach befehlen!«
»Natürlich kann ich das. Kraft meiner Position als dein Mann und als Haushaltsvorstand. Oder führen wir jetzt eine dieser Ehen, wo jeder tun und lassen kann, was er will?«
»Jeder nicht.« Isabell legte ihr Besteck zur Seite. »Nur du. Du kannst tun, was du willst. Ich nicht. Ich muss tun, was du willst.«
»Das ist so unverschämt und respektlos, dass ich gar nicht darauf eingehen sollte. Aber um des Friedens willen erklär ich es dir: Ich kann durchaus nicht tun, was ich will. Ich habe versprochen, für dich und unsere Familie zu sorgen. Und das tue ich jeden Tag, indem ich hart arbeite und Geld nach Hause bringe, von dem du dann schöne Dinge kaufen kannst, die die wenigsten Frauen sich leisten können. Natürlich könnte ich sagen, wozu das Ganze, ich leg mich lieber auf die Couch und seh fern oder geh Skifahren. Das mach ich aber nicht, weil ich Verantwortung habe. Für dich, für dieses Haus und für unsere gesamte Familie. Diese Verantwortung bringt es mit sich, dass ich hier die Entscheidungen treffe, denn ich muss die Konsequenzen dieser Entscheidungen ja dann auch verantworten.«
»Ah ja …« Isabells Kiefer mahlten. »Und ich darf gar keine Entscheidungen treffen?«
»Natürlich darfst du das. Für deinen Bereich. Was wird gekocht, wie dekoriere ich das Haus für Weihnachten. Und später, wenn wir Kinder haben, wirst du mehr Entscheidungen treffen müssen, als dir vielleicht lieb ist.«
»Aber mit wem ich befreundet bin, das ist nicht mein Bereich?«
»Nur so lange, wie diese Freundschaft nicht das Gesamte beeinträchtigt. Wenn das der Fall ist, muss ich einschreiten. Zum Wohle aller.«
»Aber du bestimmst ganz allein, was zum Wohl aller ist. Das … das finde ich nicht in Ordnung.«
»Nein?« Vitus lehnte sich zurück und musterte seine Frau auf eine Art, die den Klumpen in ihrem Magen noch härter werden ließ. »Das hörte sich bei unserer Hochzeit noch anders an.«
Isabell betrachtete jetzt verkrampft die Tischdecke.
»Wir hatten einander versprochen, eine Ehe zu führen, wie Gott sie vorgesehen hat. Mit klarer Verteilung der Aufgaben. Ich muss das nicht wiederholen, denn du weißt, was wir vereinbart haben. Willst du dein Eheversprechen widerrufen?«
»Ich will Emmy als Freundin behalten. Um mehr geht es doch gar nicht.«
»Ich habe dir erklärt, warum das nicht möglich ist. Und ich möchte nicht endlos darüber diskutieren. Wenn du diese Ehe willst, dann musst du akzeptieren, dass für die wichtigen Entscheidungen nun mal ich zuständig bin. Willst du diese Ehe?«
Isabell schwieg und wischte sich mit der Serviette Tränen aus dem Gesicht.
»Ich frage dich noch einmal: Willst du die Ehe mit mir?«
Isabell atmete einige Male tief in ihren Bauch. »Ich will nicht …« Sie stockte.
»Was willst du nicht?«
»Ich will nicht mit einem Mann verheiratet sein, der so was mit mir macht.«
»Bedauerlich, dass du es so siehst. Aber du wirst mir später dankbar sein, dass ich so entschieden habe.«
»Du bist …«, sie schluckte, »… du bist kalt und gefühllos.« Sie erwiderte wieder Vitus’ Blick und presste stumm die Lippen aufeinander.
»Kalt, gefühllos.« Vitus nickte bedächtig. »Hört sich fast so an, als wolltest du nicht mehr mit mir zusammen sein. Hört sich das nur so an, oder …?«
Isabell verschränkte die Arme vor der Brust und sagte weiterhin nichts.
»Muss ich deinem Schweigen entnehmen, dass unsere Ehe … am Ende ist?«
»Wenn du es sagst.« Isabell sah zum Fenster hinaus und presste ihre rechte Hand unter den linken Oberarm, damit Vitus nicht sehen konnte, wie sie zitterte.
»Woher der plötzliche Sinneswandel? Nur wegen Emmy?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Vielleicht stimmt es ja schon länger nicht mehr zwischen uns.«
»Und weil’s mal nicht stimmt, schmeißt du gleich alles hin.«
»Ich hab doch so oft versucht, auf dich zuzugehen. Immer wieder habe ich nachgegeben. Und wenn ich reden wollte, hast du gesagt, du willst nicht diskutieren, weil du das Familienoberhaupt bist und du entscheidest und Punkt. So war das nicht gedacht, als wir geheiratet haben.«
»Ich habe dir gesagt, dass ich eine traditionelle Ehe führen will, wie schon meine Eltern und Großeltern. Was kann man daran missverstehen? Natürlich habe ich als Mann das Sagen.«
»Ja, du hast recht. Ich hab dem zugestimmt. Aber ich hatte nicht gedacht, dass du …« Sie hielt inne und wischte sich erneut Tränen von der Wange.
»Dass ich was?«
»Dass du das so missbrauchst.«
Vitus lachte verhalten auf. »Missbrauchst! Wenn ich etwas entscheide, was dir nicht passt, dann missbrauche ich also meine Position. Kann man so sehen. Aber das ist doch wohl ziemlich naiv. Du hast doch nicht gedacht, dass ich immer nur Dinge entscheide, die dir Freude machen?«
»Ja, vielleicht war ich zu naiv. Vielleicht habe ich nicht wirklich überblickt, was diese Ehe für mich bedeuten wird. Tut mir leid. Aber was auch immer die Gründe sind – es war ein Fehler.«
Wieder nickte Vitus ernst und bedeutungsschwer. »Ah ja. Es war ein Fehler, mich zu heiraten. Das ist … starker Tobak. Und wie gedenkst du diesen furchtbaren Fehler zu korrigieren?«
»Du siehst gar keine Schuld bei dir?«
»Sind wir jetzt schon bei den Schuldzuweisungen?« Er schüttelte den Kopf. »Genau diese Art von Ehe wollte ich nicht führen. Man kommt zusammen – und wenn’s schwierig wird, trennt man sich wieder und schreit sich an und überhäuft sich mit Vorwürfen. Das ist so abgeschmackt! Ich wollte eine Ehe, in der wir füreinander da sind, und zwar bis der Tod uns scheidet, und dass dieser Satz keine hohle Phrase ist, von der man schon in dem Augenblick, in dem man es sich verspricht, davon ausgeht, dass es nicht so kommt. Ich wollte eine Ehe, in der man durch alle Stürme des Lebens gemeinsam geht – egal was passiert! Und wenn es schwierig wird – und in jeder Ehe wird es irgendwann schwierig –, dann kämpft man und kämpft und kämpft. Bis man es geschafft hat, die Probleme zu lösen.«
»Ich glaube, ich hab keine Kraft mehr zu kämpfen.«
»Das unterscheidet uns leider. Ich bin sicher, wir werden auch diese kleine Krise überstehen.«
Isabell stand auf und stellte sich mit verschränkten Armen vor ihren Mann. »Du glaubst, das ist eine kleine Krise?«
»Ich habe etwas entschieden. Es fällt dir schwer, es zu akzeptieren. Das kommt vor. Wir schlafen eine Nacht drüber, und morgen sieht die Welt schon wieder anders aus.«
»Die Welt sieht morgen noch genauso aus. Grau und deprimierend. Vitus …« Sie zog sich einen Stuhl heran und setzte sich neben ihn. »Sieh das doch ein. Wir haben uns völlig auseinandergelebt! Oder vielleicht hatten wir auch nie eine gemeinsame Basis und haben uns nur was vorgemacht.«
Er betrachtete sie lange und legte den Kopf etwas nach hinten. »Willst du etwa nach drei Jahren schon die Scheidung? Versteh ich das richtig?«
»Es wird nicht gut gehen. Du erwartest, dass ich mich bedingungslos unterordne.«
»Nun gut. Ich sehe unsere Krise, wie schon gesagt, nicht als so grundsätzlich.« Er nahm ihre Hand. »Aber wenn du gehen willst, dann kann ich dich nicht dran hindern. Nur solltest du ein paar Dinge bedenken.«
»Ich weiß, wir haben keinen Ehevertrag. Aber ich will nichts von deinem Geld. Ich komme allein klar.«
»Deine Eltern auch?«
Sie schwieg.
»Ich habe ihnen Geld geliehen. Ich habe es getan, weil niemand sonst einem Siebzigjährigen Kredit gibt. Und natürlich ist es meine Pflicht, mich um die Eltern meiner Frau zu kümmern. Das tue ich gern, und darüber habe ich nie ein Wort verloren. Wenn du allerdings nicht mehr meine Frau bist, dann entfällt diese Pflicht, das ist dir klar?«
»Aber es ist ein Kredit. Sie zahlen ihn doch zurück.«
»Wovon denn? Dein Vater hat keine Rente, weil er nie eingezahlt hat, und die Rente deiner Mutter – na ja. Nein, deine Eltern haben keinen einzigen Cent zurückgezahlt.«
»Ich dachte, sie bezahlen jeden Monat …«
»Ja, sollten sie. Tun sie aber nicht. Was mir im Übrigen das Recht gibt, den gesamten Kredit fällig zu stellen.«
»Das bedeutet …?«
»Dass deine Eltern den gesamten Betrag zurückzahlen müssen, was sie nicht können. Deswegen werde ich die Sicherheiten verwerten. Das Haus wird versteigert, und deine Eltern müssen sich eine andere Wohnung suchen.«
»Aber … wo sollen sie denn hin?«
»Das ist dann, wie gesagt, nicht mehr mein Problem. Es gibt Einrichtungen, in denen mittellose Bürger ein Unterkommen finden. Die sind dann etwas schlichter ausgestattet als ein Einfamilienhaus, aber sie haben immerhin ein Dach über dem Kopf. Oder du mietest ihnen eine Wohnung.« Ein Lächeln zuckte um seine Mundwinkel.
Isabell würde keine Wohnung für ihre Eltern mieten. Sie würde sich selbst keine leisten können. Ihre Eltern müssten in eine Obdachlosenunterkunft ziehen. Diese Häuser waren im Landkreis Miesbach vielleicht nicht ganz so trist wie in manchen anderen Gegenden des Landes. Aber Obdachlosigkeit war immer trist, und die Vorstellung, dass ihre Eltern dort bis zum Ende ihres Lebens dahinvegetieren mussten, ohne Aussicht, jemals wieder in einer schönen Wohnung zu leben … Isabells Herz stand für einen Moment still. Sie blickte ungläubig zu Vitus.
»Das würdest du nicht machen, oder?«
»Nenn mir einen Grund, warum ich’s nicht tun sollte.«
»Weil … weil es grausam wäre.«
»Das Leben ist zu Millionen Menschen grausam. Zu deinen Eltern ist es nur deshalb nicht grausam, weil ihr Schwiegersohn sich um sie kümmert.« Er nahm Isabells Hand. »Und das wird er weiterhin tun, denn er wird ihr Schwiegersohn bleiben.« Er küsste ihr die Hand. »Du musst eins verstehen: Wenn hier überhaupt jemand entscheidet, dass unsere Ehe zu Ende ist, dann bin ich das. Du hast gerade ein bisschen Schwierigkeiten, deinen Platz zu finden. Ich rate dir: Finde ihn. Und zwar schnell. Sonst muss ich die Zügel anziehen. Und ich schwör dir, das möchtest du nicht.«
Isabell sah Vitus in die Augen. Hass stieg in ihr auf und das Bedürfnis, ihn ins Gesicht zu schlagen, aber es war wie in ihren Träumen, wenn sie versuchte, sich gegen einen der Peiniger, die darin stellvertretend für Vitus vorkamen, zu wehren. Ihr Arm würde sich nur in Zeitlupe bewegen, und ihre Faust würde schon vom Stoff der Jacke gebremst werden, und sie wusste, dass sie vollkommen wehrlos war.
»Hol den Nachtisch«, sagte Vitus.
Hektisch machte sie sich auf den Weg in die Küche, um von ihm wegzukommen, und sei es nur für eine Minute.
3
28. Februar – 18 Tage vor dem Leichenfund
Es war ein früher Winternachmittag, als der leitende Kriminalhauptkommissar Wallner einen Anruf von seinem Großvater Manfred bekam. Er lebte mit ihm zusammen in einem kleinen Haus, das Manfred nach dem Krieg zum Teil eigenhändig gebaut hatte. Den allergrößten Teil seines Lebens hatte Wallner in diesem Haus mit seinem Großvater verbracht. Immer öfter dachte er daran, dass diese Zeit irgendwann zu Ende gehen würde. Manfred wurde in zwei Monaten 94 Jahre alt. Aber bis jetzt hatte er sich als erstaunlich widerstandsfähig erwiesen, auch wenn er nicht mehr sehr mobil war und sein Gedächtnis nachließ. Von Demenz war Manfred jedoch noch weit entfernt. Er vergaß einfach Dinge – wie jeder Jüngere auch, nur öfter.
»Wo bleibst denn?«, eröffnete Manfred das Telefonat.
»Hier, in meinem Büro«, sagte Wallner. »Und das auch für den Rest meines Arbeitstages. Deinem gereizten Ton entnehme ich aber, dass ich deiner Meinung nach woanders sein sollte.«
»Du sollst mich abholen. Ich komm sonst noch zu spät.«
»Du hast eine Verabredung?« Wallner war erstaunt, denn das kam nicht mehr oft vor bei Manfred.
»Ja, und zwar mit der Frau Dr. Kubelka. Das hab ich dir aber g’sagt.«
»Sagen wir mal: Du glaubst, du hast es mir gesagt. Hast du eine neue Ärztin?«
»Na, die is Wissenschaftlerin, und ich soll ihr bei ihrer Arbeit helfen.«
Wallners Erstaunen wuchs. »Okay … wie kommst du an den Job als wissenschaftliche Hilfskraft?«
»Des führt jetzt zu weit. Ich muss in zehn Minuten im Marktcafé sein.«
»Ich eile«, sagte Wallner und machte sich auf den Weg.
Die Wege in Miesbach waren nicht weit. Fünf Minuten später kam Wallner mit dem Wagen bei sich zu Hause an, fünf Minuten dauerte es, Manfred und den Rollator einzuladen, drei Minuten zum Marktcafé. Auf dem Weg erfuhr Wallner, dass Frau Dr. Kubelka Historikerin war und Zeitzeugen suchte. Ihr Interesse galt dem Alltagsleben in der Zeit des Nationalsozialismus.
»Zeitzeuge? Erinnerst du dich denn noch an viel?«
»Ich erinner mich an fast alles.«
Wallner versuchte den nächsten Satz herunterzuschlucken, aber er musste einfach raus: »Wahrscheinlich besser als an deine Termine.«
»Ich hab dir des mit dem Termin heut g’sagt!«, echauffierte Manfred sich erwartungsgemäß. »Bloß weil ich mal was vergessen hab, bin net immer ich derjenige, wo was vergisst. Du vergisst schon auch Sachen.«
Wallner kannte die Diskussion und bereute, dass er das Thema noch mal aufs Tapet gebracht hatte.
Als er Manfred die Tür zum Café öffnete, fiel ihm sofort Frau Dr. Kubelka auf, die bereits an einem Tisch saß. Allein. Er musste sie nicht kennen, es war offensichtlich, wer hier das Date von Manfred war. Gleichzeitig wurde Wallner klar, warum Manfred auf keinen Fall zu spät kommen wollte. Dr. Katharina Kubelka war Mitte dreißig und sah mit Brille, Kaschmirpullover und der Haarsträhne, die ihr lässig ins Gesicht fiel, ausgesprochen hinreißend aus.
»Vielen Dank fürs Herfahren. Ich komm ab hier allein zurecht«, sagte Manfred, auf seinen Rollator gestützt, und winkte Frau Dr. Kubelka zu, die jetzt aufstand und auf ihn zuging.
»Soll ich mich der Dame noch vorstellen?«, fragte Wallner.
»Passt schon«, sagte Manfred und meinte damit: Verschwinde endlich.
In diesem Moment brummte ohnehin Wallners Handy, sodass er sich mit Telefon am Ohr und einem kurzen, höflichen Lächeln in Richtung der herannahenden Wissenschaftlerin verabschiedete. Der Anruf kam von Karla Tiedemann, Wallners Chefin und Lebensgefährtin.
»Wo steckst du denn?«, fragte sie.
»Ich musste Manfred zu einem Date bringen. Was gibt’s?«
»Herr Zander ist hier auf der Polizeistation. Er will seine Frau als vermisst melden.«
»Was habe ich damit zu tun?«
»Nun ja, Herr Zander – wie soll ich sagen –, er hat den Eindruck, dass die Beamten, bei denen er zuerst war, der Sache nicht den nötigen Ernst beimessen.«
»Wie lange ist die Frau schon weg?«
Es folgte eine kleine Pause an Karla Tiedemanns Ende der Leitung. »Komm einfach her und hör’s dir an.«
Wallner war irritiert und genervt, als er sich auf den Weg zurück ins Büro machte. Vitus Zander war Geschäftsführer und Anteilseigner einer lokalen Brauerei und stand im Ruf, gute Beziehungen zu den Spitzen der Landespolitik zu pflegen. Karla kannte ihn noch aus ihrer Zeit im Innenministerium. Dort war Zander gelegentlich zu Besprechungen mit dem Minister oder einem Staatssekretär aufgetaucht. Ganz offensichtlich wollte der Mann nicht wie jeder Normalbürger behandelt werden, wenn er Hilfe von der Polizei brauchte. Wallner war klar: Für Karla ging es nicht darum, sich Zander gegenüber als devot zu erweisen. Sie verachtete das Selbstverständnis dieser Leute genauso wie er selbst. Aber Zander konnte viel Stress verursachen. Er würde den Staatssekretär anrufen, der würde dann bei ihr anrufen, sie musste erklären, warum man Herrn Zander nicht helfen konnte oder wollte. Ein Rechtsanwalt würde sich melden und noch mehr Zeit kosten. Da war es energiesparender, wenn sich der Leiter der Kriminalpolizei der verschwundenen Frau Zander annahm.
Wallner traf Zander und Karla in einem Besprechungszimmer. Nachdem Karla Wallner vorgestellt hatte, verabschiedete sie sich, denn es wartete angeblich ein wichtiges Telefonat auf sie.
»Erzählen Sie bitte einfach, was passiert ist«, sagte Wallner und legte sein Handy auf den Tisch. »Ich würde Ihre Aussage gern aufnehmen. Es sei denn …«
»Nein, ich bestehe darauf. Das kann später noch als Nachweis dienen.«
Wallner tippte auf die Aufnahmefunktion und überlegte, was Zander später wohl würde nachweisen wollen. »Also, Herr Zander, der Reihe nach. Was ist passiert?«
»Ich bin heute Nachmittag so gegen vierzehn Uhr nach Hause gekommen. Meine Frau Isabell war nicht da, was sehr ungewöhnlich ist. Vor allem, weil sie mir nicht Bescheid gesagt hat, dass sie das Haus verlässt.«
»Das tut sie sonst?«
»Ja. Und zwar immer. Umgekehrt weiß auch Isabell immer, wo ich mich befinde. Wir halten das so in unserer Ehe. Es gibt uns einfach Sicherheit.«
Wallner nickte und fand solches Verhalten nicht unbedingt üblich, aber auch nicht völlig ungewöhnlich. »Was haben Sie gemacht?«
»Mir war schon beim Heimkommen aufgefallen, dass Isabells Wagen nicht in der Garage stand. Ich habe dann festgestellt, dass ihr Wagenschlüssel nicht da ist. Also habe ich versucht, sie anzurufen. Es ging aber nur die Box dran.«
»War das Handy an?«
»Ja. Aber sie ist wie gesagt nicht drangegangen.«
Wallner schaute auf sein Handydisplay. Bis jetzt hatte er noch nichts gehört, was ein Tätigwerden der Polizei rechtfertigen würde.
»Ihre Frau ist seit eineinhalb Stunden weg?«
»Ich weiß, dass die Polizei bei Erwachsenen frühestens nach vierundzwanzig Stunden anfängt zu suchen. Aber dieser Fall liegt anders. Dass ich meine Frau nicht erreichen kann, hat es noch nie gegeben in den drei Jahren, die wir verheiratet sind. Das ist derart ungewöhnlich, dass ich befürchten muss, ihr ist etwas zugestoßen.«
»Sie können ihr Handy nicht orten?« Wallner vermutete, dass das bei der im Hause Zander obwaltenden gegenseitigen Kontrolle der Fall war.
»Im Prinzip ja. Aber …«
»Aber?«
»Die Suchfunktion ist ausgeschaltet.«
Wallner staunte – oder auch wieder nicht. Die ganze Geschichte hatte einen merkwürdigen Geruch.
»Und es kann nicht sein, dass Ihre Frau die Funktion ausgeschaltet hat?«
»Das halte ich für äußerst unwahrscheinlich.«
»Möglich«, sagte Wallner. »Nur, wenn sie die Funktion ausgeschaltet hat, dann spräche das ja dafür, dass sie nicht gefunden werden will – oder was sollte das sonst für einen Sinn haben?«
»Isabell würde so etwas nicht machen. Es sei denn …« Vitus Zander schien mit einem Mal in finstere Gedanken zu verfallen.
»Ist Ihre Frau suizidgefährdet?«, kürzte Wallner die Sache ab.
»Sie … sie hat eine dunkle Seite in sich. Von Zeit zu Zeit leidet sie unter Depressionen. Das scheint in der Familie zu liegen. Ein Cousin von Isabell hat sich vor ein paar Jahren das Leben genommen.«
»Das würde natürlich zusammenpassen – dass Ihre Frau wegfährt, ohne Ihnen Bescheid zu sagen, und dass sie die Handyortung abschaltet. Ich hoffe, es ist nicht so. Aber … hat sich Ihre Frau in letzter Zeit auffällig benommen?«
»Es gab mal einen Streit zwischen uns wegen ihrer Freundin Emmy. Sie versucht, Isabell und mich auseinanderzubringen. Isabell will das nicht wahrhaben. Aber deshalb bringt sie sich doch nicht um!« Zander sah Wallner verzweifelt an.
»Schauen Sie, Herr Zander – es ist, wie Sie sagen: Wenn Erwachsene verschwinden, wartet man in der Regel einen Tag. In den meisten Fällen hat sich die Sache dann erledigt, weil die Person wieder da ist oder sich zumindest gemeldet hat. Eine Ausnahme gilt, wenn der begründete Verdacht auf ein Verbrechen vorliegt oder die Gefahr eines Suizids besteht. Wenn Sie mir also sagen, dass Ihre Frau suizidgefährdet ist, werden wir sie natürlich zur Fahndung ausschreiben.«
»Ja, tun Sie das! Es gibt nur eine Erklärung für ihr Verschwinden: Isabell will sich etwas antun.« Mit einem Mal wurde Zanders Ton leise, fast flüsternd. »Ich bitte Sie inständig! Tun Sie etwas, bevor es zu spät ist.«
Kurz darauf saß Wallner bei Karla Tiedemann im Büro. Auf ihrem Computerbildschirm war ein bayerisches Haus vor Bergkulisse zu sehen.
»Ich kann nicht nachprüfen, ob die Frau suizidgefährdet ist«, sagte Wallner. »Aber im Zweifel müssen wir davon ausgehen.«
»Kann natürlich sein, dass sie sich einfach abgesetzt hat.«
»Ich hab Anweisung gegeben, dass ich zuerst mit der Frau reden will, wenn sie sie finden. Dann werden wir ja erfahren, ob sie wirklich zu ihrem Mann zurückwill.«
»Und wenn wir sie nicht finden, geht der Zirkus mit Herrn Zander weiter.«
»Wahrscheinlich. Aber dann fasse ich ihn nicht mehr mit Glacéhandschuhen an. Wir haben hier ja noch was anderes zu tun.« Wallner warf einen Blick auf das Foto auf dem Bildschirm. »Was ist das? Immoscout?«
»Das ist ein Haus bei Fischbachau.« Karla drehte den Bildschirm zu ihm. Wallner kam mit seinem Bürostuhl neben seine Freundin gerollt. »740000. Und hat ein abtrennbares Apartment.«
»Oh … schön.« Wallner war etwas überrascht. Er wusste nicht, dass Karla aktiv auf der Suche nach einem Haus war. Sie hatten zwar darüber geredet, dass sie zusammenziehen wollten. Aber irgendwie hatte er das Thema immer wieder weggeschoben. »Der Preis wär ja okay. Muss man da viel renovieren?«
»Man müsste nur die Wände streichen und könnte einziehen. Aber – schau selber …« Karla klickte durch die Fotos, die das Innere des Hauses zeigten. Es waren entweder Teppichböden oder hässliche Fliesen aus den Achtzigerjahren zu sehen, das Bad datierte offenkundig ebenfalls aus dieser Zeit. Nur die Küche machte einen neuen und stilistisch durchaus ansprechenden Eindruck.
»Neue Fliesen, neue Bäder, neue Böden«, sinnierte Wallner. »Dann sind wir bei 800000, wenn wir nicht das Allerteuerste nehmen. Wird eng, aber ginge noch.«
»Gefällt’s dir?«
»Ja. Der Garten ist hübsch. Und sieht ruhig aus.«
Karla betrachtete Wallner forschend. »Aber?«
»Nichts aber. Es ist nur … Ich weiß, wir haben schon drüber gesprochen. Aber irgendwie hab ich nicht weiter über das Thema nachgedacht. Deswegen trifft’s mich jetzt etwas unvorbereitet.«
»Es trifft dich? Wie ein Schicksalsschlag?«
»Nein. Da hab ich mich falsch ausgedrückt.« Wallner hielt inne und nahm Karlas Hand. »Du weißt, dass ich nichts lieber täte, als mit dir zusammen dieses Haus zu kaufen, einzurichten und darin alt zu werden. Ich bin mir halt nur noch nicht im Klaren, wie ich das mit Manfred angehen soll.«
»Er hätte eine eigene kleine Wohnung. Das wäre gar kein Problem.«
»Ja … das wäre ideal.«
»Aber?«
Wallner wand sich und suchte nach den rechten Worten. »Manfred wird vierundneunzig. Er lebt, seit ich denken kann, in unserem Haus. Er hat es zum großen Teil mit eigenen Händen gebaut. Soll ich ihm wirklich zumuten, auf seine letzten Jahre noch einmal völlig woanders zu wohnen?«
»Was sagt denn Manfred dazu?«
Wallner atmete tief durch und sagte: »Keine Ahnung.«
»Hast du ihn noch nie danach gefragt?«
Wallner schwieg. Karla drehte sich zu ihrem Computer um und klickte die Webseite mit dem Haus weg.
»Ich hab mich bisher davor gescheut. Weil ich meinen Großvater nicht unter Druck setzen will. Aber du hast ja recht. Ich muss das klären. Und wir werden eine Lösung finden.«
»Vielleicht ist es ja wirklich zu viel verlangt von jemandem …«
»Ich klär das, und du machst mal einen Besichtigungstermin. Das Haus gefällt mir. Und die Küche können wir ja aus dem alten Haus mitnehmen.«
»Was?« Fassungsloses Entsetzen sprang aus Karlas Augen.
»Ich hab ’n Spaß gemacht. Hör auf mit der Schnappatmung.«
Sie legte ihre Arme um Wallners Hals und lächelte ihn geheimnisvoll an. »Ich glaub’s dir mal. Und Manfred nehmen wir mit zur Hausbesichtigung.«
Sie gab Wallner einen Kuss auf den Mund.
»Stör ich?«, kam es von der stets offenen Bürotür. Dort stand Kreuthner.
»Na ja – wir wollten gerade intim werden. Aber komm ruhig rein.« Wallner rollte mit seinem Bürostuhl wieder von Karla weg.
Kreuthner blieb, wo er war, und lehnte sich mit einer Schulter gegen den Türstock. »Die Zanderin is weg?«
Die Meldung war an alle Streifenpolizisten in Bayern rausgegangen, nebst Personenbeschreibung, aktuellem Foto und Autokennzeichen.
»So ist es«, sagte Wallner. »Entweder hat sie genug von ihrem Mann oder sie will sich was antun. Was zutrifft, wissen wir nicht.«
»Wenn s’ abg’haut is, dann kann s’ natürlich irgendwo sein. Aber vielleicht is sie ja noch in der Gegend.«
»Richtig. Und was können wir für dich tun?«
»Ich will ja net unbescheiden sein, aber wenn die jemand finden kann, dann ich. Und in dem Fall hätt ich einfach gern, dass da auch für mich a bissl was rausspringt.«
Wallner sah Kreuthner reichlich irritiert an. »Willst du eine Fangprämie?«
»Nein, was anderes. Und des würd ich gern mit meiner Chefin besprechen.« Kreuthner wandte sich an Tiedemann. »Muss der dabei sein?«
Wallner war als Chef der Kripo nicht der Vorgesetzte von Kreuthner. Das war der Chef der Schutzpolizei Dieter Höhnbichler. Und dessen Chefin war Karla Tiedemann.
»Wie Sie gesehen haben«, sagte Tiedemann, »hatte ich mit Herrn Wallner gerade eine wichtige Besprechung. Aber ich höre mir gern an, was Sie zu sagen haben. Setzen Sie sich doch.«
Kreuthner nahm auf einem Besucherstuhl Platz. Wallner rollte mit seinem Bürostuhl seitlich von Kreuthner und machte damit gewissermaßen den Weg frei.
»Also, eigentlich«, begann Kreuthner, »geht’s um den neuen Polizeipräsidenten. Weil der hat, hab ich g’hört, Probleme mit Leut, wo – ich sag amal: anders arbeiten. Man könnt auch sagen, unkonventionell.«
»Oder kriminell«, warf Wallner ein.
»Lass ihn doch einfach mal.« Karla Tiedemann warf Wallner einen entsprechenden Blick zu.
»Ja, sorry. Ich halt die Klappe.«
»Danke«, fuhr Kreuthner fort. »Und angeblich hat er’s besonders auf mich abg’sehen. Ich weiß auch net, warum …«
»Na, den einen oder anderen Anlass haben Sie schon gegeben«, sagte Tiedemann.
»Ja, es hat immer wieder mal a Missverständnis ’geben. Aber eins müssen S’ zugeben: An meine Arbeitsergebnisse gibt’s nix zum Meckern.«
»Ich weiß nicht, ob man Methode und Ergebnis so scharf trennen kann – aber ja, Sie liefern immer wieder gute Ergebnisse ab. Was wollen Sie jetzt von mir?«
»Der Herr Zander is ja a hohes Tier. Der kennt auch den Innenminister, hab ich g’hört, und der hat ja den Polizeipräsident – wie heißt er?«
»Binger.«
»Der hat den ja zum Polizeipräsident gemacht. Und deswegen hätt ich gern Folgendes: Wenn ich die Frau Zander tatsächlich finde, dass der Herr Binger auch erfährt, wer des war. Weil ich hab eigentlich jetzt Feierabend. Aber – ich such sie trotzdem. Ich investiere Zeit und Arbeit und ich nutz meine Kontakte, wo ich in Jahrzehnte Polizeiarbeit aufgebaut hab. Und es wär schön, wenn der Polizeipräsident des erfährt, bevor er mich rausschmeißt.«
»Wenn es sich ergibt, Herr Kreuthner, sag ich’s ihm. Aber erst mal sollten Sie die Frau finden.«
»Und wenn du sie findest«, schaltete sich Wallner wieder ein, »sagst du mir bitte Bescheid. Herr Zander oder die Familie wird erst verständigt, wenn Frau Zander das ausdrücklich will. Alles klar?«
»Bin ja net erst seit gestern im G’schäft.« Kreuthner erhob sich von seinem Stuhl. »Dann schaun mir doch mal, wo die Dame steckt. Habe die Ehre!«
4
Kreuthner hatte zwar keinen Plan. Dafür aber die unerschütterliche Gewissheit, dass ihm schon etwas einfallen würde. Zu diesem Behufe suchte er nach Feierabend wie fast jeden Tag das Wirtshaus zur Mangfallmühle auf. Kreuthners Freundin Pippa war ebenfalls dort Stammgast und begrüßte ihn am Tresen mit einem Kuss.
»Und? Wie war dein Tag?«, fragte sie.
»Muss noch Überstunden machen.«
»Warum?«
»Du kennst doch den Zander.«
Pippa nickte.
»Dem seine Frau is verschwunden. Und es wär net schlecht, wenn ich sie finden tät.«
»Die kann doch irgendwo sein«, gab Pippa zu bedenken.
»Vielleicht. Aber die is psychisch a bissl labil. So Leut, die irren oft durch die Gegend oder bringen sich um.«
»Und wie willst du sie finden?«
»Muss ich noch überlegen. Is des okay, wenn ich dich heut Abend allein lass?«
»Kein Problem«, sagte Pippa. »Is ja net so, dass mir nur einmal im Monat ausgehen.«
Kreuthner stutzte. Pippas Ton hatte etwas Sonderbares an sich. »Wie meinst jetzt des?«
»Ich mein, dass mir fast jeden Abend hier sind.«
»Und?« Kreuthner sah sie fragend an, und als sie nichts sagte, fuhr er fort: »Is doch nett hier. Also, bis jetzt war’s das – oder nicht?«
»Mei – es is halt jeden Abend das Gleiche.«
Kreuthner dachte kurz nach. »So hab ich des noch gar net g’sehen. Is des schlimm?«
»Ich sag mal so: Am Anfang unserer Beziehung war irgendwie mehr los.«
Das war zweifelsohne richtig. Pippa war damals entführt worden, und Kreuthner hatte sich aufgemacht, sie zu befreien, was in einer nächtlichen Flucht durch die Berge endete, bei der sie fast erschossen worden wären. Das war natürlich schwer zu toppen. Aber Kreuthner musste sich eingestehen, dass es seither doch recht gleichförmig zuging in ihrer Beziehung.
»Hast schon recht«, sagte er. »A bissl Abwechslung könnt net schaden.«
»Dann lass dir mal was einfallen.« Pippa nahm ihr Bier von der Theke, sagte: »Ich schau mal zu den Nerds. Die machen sicher was Aufregendes«, und entschwand zu einem Tisch mit vier jüngeren Leuten, die in ihre Laptops vertieft waren.
Kreuthner sah ihr nach, dann wanderte sein Blick zu Joe Schinkinger, einem Mann, der auf die sechzig zuging und neben ihm am Tresen stand. Man kannte sich schon eine ganze Weile und hatte einiges miteinander erlebt.
»Is unser Leben wirklich so langweilig?«
»Sagen wir mal so …« Schinkinger fixierte sein Bierglas, offenbar um seine Gedanken zu sammeln. »Ich hab ja an ganz guten Überblick über euer Privatleben. Und da fängt’s im Grunde an. Ich hab den ja nur, weil ihr fast jeden Abend hier seid. Eine Frau möcht aber a Nest haben. Ein gemeinsames Nest, verstehst?«
»Aha …«
»Warum seid ihr nie bei dir?«
»Hast du a Ahnung, wie’s da ausschaut?«
»Ich kann’s mir vorstellen. Was ist mit der Wohnung von der Pippa?«
»Ja, da samma schon ab und zu. Also wenn’s amal intimer wird, wennst verstehst, was ich mein.«
»Und Abende da verbringen? Gemeinsam kochen und fernsehen?«
Harry Lintinger, der Wirt, stellte Kreuthner ungefragt ein Bier hin. »Servus. Wie geht’s?«
»Passt schon«, sagte Kreuthner und wandte sich wieder an Schinkinger. »So Abende vorm Fernseher, des is net meins. Ich bin lieber hier. Hier sind die Leut, wo ich gern um mich hab.«
»Aber so geht des net«, sagte Schinkinger. »Glaub’s mir. Ich war dreimal verheiratet. Ich kenn die Frauen.«
»Du bist verheiratet?«
»Nein, ich bin auch dreimal geschieden.«
»Ich will dir net zu nah treten, aber du hast es dreimal verzockt. Klingt net so, wie wennst du viel über Frauen g’lernt hättst.«
»Oh doch. Das hab ich. Ich habe mich nur dafür entschieden, das Gelernte nicht anzuwenden.«
»Aha – wieso?«
»Weil ich inzwischen weiß, dass Beziehungen nichts für mich sind. Aber bei dir is des was anderes. Die Pippa bedeutet dir was. Deswegen mein Rat: Profitiere von meiner umfassenden Kenntnis in Beziehungsfragen.«
Kreuthner blickte Schinkinger skeptisch an. »Also – was soll ich deiner Meinung nach tun?«
Schinkinger rückte ein wenig näher, um leiser sprechen zu können. »Nummer eins: Mach was nur mit ihr. Sie muss fühlen, dass sie etwas Besonderes für dich ist, net nur irgenda weiterer Spezl aus der Mangfallmühle.«
Kreuthner nickte nachdenklich. »Was Besonderes …«
»Unternimm was mit ihr. Theater, Kino, Reisen …«
»Sie hat mal g’sagt sie tät gern in die Oper gehen. Weil da war sie noch nie.«
»Wunderbar. Mach das. Und so ganz nebenbei bemerkt: Das Speziellste für eine Frau is natürlich – was …?«
Kreuthner dachte angestrengt nach. »A Besuch auf der Wiesn?«
»Nein, du Hornochse!« Schinkinger senkte verschwörerisch die Stimme. »Ein Heiratsantrag!«
»A Heiratsantrag …« Kreuthner überdachte die Implikationen einer solchen Aktion.