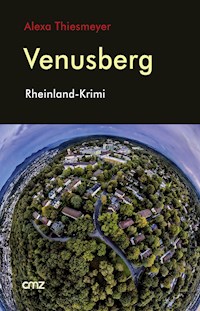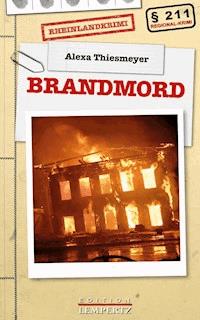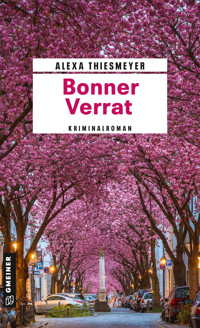
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bärbel und Malte ermitteln
- Sprache: Deutsch
Ministerlimousinen auf den Straßen, der Bundeskanzler als Nachbar und schillernde Staatsbesuche - all das sind für die Bonnerin Bärbel schöne Kindheitserinnerungen. Ein halbes Jahrhundert später will sie die Zeit bei einem Klassentreffen wieder aufleben lassen. Doch ihr ehemaliger Schulfreund Uwe reagiert nicht auf ihre Einladung und flieht sogar vor ihr. Mit ihrem Neffen Malte will Bärbel herausfinden, warum. Bald ahnt sie, dass Uwe einem Familiengeheimnis aus dem Kalten Krieg nachjagt, für das Menschen immer noch über Leichen gehen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Alexa Thiesmeyer
Bonner Verrat
Kriminalroman
Zum Buch
Gefährliche Spur Seit Jahrzehnten hat Bärbel Thorgast ihre Freunde aus der Schulzeit in Bonn nicht gesehen. Recherche im Internet, unzählige Telefonate, persönliche Treffen – sie hat keine Mühen gescheut, um sie aufzustöbern. Nun lädt sie zum Klassentreffen. Der Termin steht fest, der Raum ist gebucht. Aber warum meldet sich Schulkamerad Uwe nicht, an dem ihr besonders liegt? Warum sucht er das Weite, sobald er sie erblickt? Um herauszufinden, was dahintersteckt, spannt Bärbel ihren Neffen ein, den Studenten Malte. Gemeinsam folgen die beiden Uwe kreuz und quer durch die Stadt. Nach und nach begreifen sie, was Uwe umtreibt: Im Jahr 1963 verschwand sein Vater, Jurist im Kanzleramt. Zwölf Jahre später ertrank sein Bruder im Dornheckensee. Dessen Notizen mit Andeutungen über den vermissten Vater hat Uwe kürzlich im Nachlass seiner Mutter gefunden und sich sofort an Nachforschungen gemacht. Die Spur führt ihn weit in die Vergangenheit der früheren Bundeshauptstadt und zu Menschen, denen jedes Mittel recht ist, um zu verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt …
Alexa Thiesmeyer lebt mit Ehemann, Kindern, Enkeln und Vierbeinern in Bonn, wo sie aufgewachsen und zur Schule gegangen ist. In der ehemaligen Bundeshauptstadt hat sie auch ihr Studium und ihre Ausbildung zur Juristin absolviert. Bereits damals verspürte sie eine Neigung zum Strafrecht und zur Kriminalistik. Es folgten Stationen als freie Journalistin und Dozentin. Aus Begeisterung für die Bühne verfasste sie zudem zahlreiche Komödien, Sketche und Satiren für Theater im gesamten deutschsprachigen Raum. Seit 2007 widmet sie sich dem Schreiben von spannenden Kurzkrimis und Kriminalromanen mit Tatorten in und um Bonn.
www.alexa-thiesmeyer.de
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Daniel Abt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © dihetbo / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-6188-0
Zitat
… und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.
Johannes 8,32
FrüherApril 1963
Er musste jeden Moment auftauchen. Ernst Lehmann, Jahrgang 1920. An diesem Ort der Ruhe und Besinnung würde er den Weg heraufkommen, vor sich den Treffpunkt am Kreuzberghang, hinter sich die tiefer liegende Stadt.
Der junge Mann im schwarzen Regenmantel, der ihn am Grabmal eines Professors erwartete, kannte ihn von einem Foto. Lehmann würde die verdiente Ruhe finden und zur Besinnung nicht mehr kommen.
Das Wetter war perfekt. Bei Wind und Nieselregen hielt sich hier niemand ohne zwingenden Grund auf. Die Witwen und Witwer, die frische Blümchen für die Grabschalen brachten, kamen nur bei Sonnenschein. Die Gärtner hatten ihre Arbeiten beendet.
Auf dem Asphalt näherte sich der Wagen des Beerdigungsinstituts und fuhr an die Kapelle aus rotem Backstein heran. Auf die Minute pünktlich. Die beiden Jungs vom Institut, fügsame Angestellte, die sich gern was dazuverdienten, stiegen aus.
Sie öffneten die Hecktüren. Alles nach Plan.
Da kam er schon, Lehmann. Exakt wie auf dem Foto: schmales Gesicht, blasse Haut, dunkles Haar, offener Trenchcoat, weißes Hemd mit gestreifter Fliege. Die linke Hand hielt zur Tarnung ein paar Rosen, die rechte seine Aktentasche.
Lehmann wandte den Kopf nach dem schwarzen Wagen. Als der Sarg herauskam, schaute er weg und bog in den Seitenweg ein. So gehörte es sich, keine Neugier zeigen. Leute wie er waren gehalten, sich unauffällig zu benehmen. Auf Friedhöfen war das einfach, das Kommen und Gehen von Personen zu jeder Zeit normal.
Der junge Mann schob die Hand unter seinen Regenmantel. 20 Meter noch.
Es war ein guter Job, schnell erledigt, bester Lohn. Und immer an der frischen Luft.
Zehn Meter.
Sieben.
Fünf.
Lehmanns Schritte wurden langsamer. Suchend schaute er sich um. Eine Tür des Leichenwagens flog geräuschvoll zu. Das war der Moment.
Die nächste Tür. Gleichzeitig fiel der Schuss. Darauf der zweite. Kopf und Brust. Moderates Knallen. Kurzes Stöhnen. Lehmann brach zusammen. Zuletzt ein Knirschen auf dem Weg. Dann Stille. Die schallgedämpfte Beretta verschwand im Regenmantel, der Rosenstrauß im Grabschmuck des Professors. Den Pulvergeruch trug der Wind davon.
Einer der Jungs kam herbei. Unbewegtes Gesicht. Kein Wort. Packte schlicht mit an. Die paar Meter bis zur Kapelle. Lehmann war nicht schwer.
Der Sarg aus massiver Eiche stand im Innern, nicht weit von der Tür. Der zweite Junge zuckte zurück, als er Lehmann berührte, löste aber brav den Deckel. Zu zweit hoben sie die Frau aus dem Sarg und legten sie auf den Boden. Für die dünne Gestalt war das Nobelstück viel zu geräumig. Das würde sich jetzt ändern. Der untere Teil gebührte Lehmann.
Sie verzichteten auf das Schließen der Augen und das Falten der Hände, sie mussten sich beeilen. Auftragsgemäß kam die Aktentasche mit hinein, ihr Geheimfach enthielt, was Leute wie Lehmann brauchten und niemand finden sollte. Schnell in den Trenchcoat greifen, den Ausweis rausholen, einstecken, fertig.
Die Jungs sahen nervös zur Tür. Sie hatten ein passendes Brett besorgt, hinein damit, Laken und Kissen drüber, Frau oben drauf, Oberdecke glatt streichen. Bisschen eng, doch von Lehmann nichts mehr zu sehen. Deckel zu und Sargnägel rein. Wenn es nur nicht so krachen würde.
Ein Päckchen Roth-Händle mit gefalteten Scheinen wechselte den Besitzer. Alles erledigt. Lehmann würde ein schönes Begräbnis bekommen, in seinem Metier nicht selbstverständlich. Kränze und Blumengestecke, Lieder, Gebete und den Segen des Pastors, später einen Grabstein. Zwar würde nicht Ernst Lehmann daraufstehen, sondern Maria Neu, geb. Schneider, aber das spielte keine Rolle. Lehmann war nur ein Deckname.
Der junge Mann im schwarzen Regenmantel stieg den Hang hinauf zum Urnenhain, um zum oberen Ausgang des Friedhofs zu gelangen. Dankbar blickte er sich um. Durchs Astwerk schimmerte die Stadt herauf, die kleine Bundeshauptstadt, die ihm Arbeit und Brot verschaffte. Das Leben war hier so besonders. Mitten im kalten Krieg war ihm ganz warm ums Herz.
Dezember 1963
Fein gesponnener Nebel hing über dem Wasser. Wie durch einen Vorhang schimmerte die Sonne fahl durchs Himmelsgrau. Frachtschiffe tuckerten den Rhein hinauf Richtung Schweiz, andere nach Holland hinunter zum Meer. Gedrungene Schlepper zogen mehrere lange Kähne wie kräftige schnaufende Ponys.
Uwe war elf Jahre alt. Wenn er am Rhein war, schaute er immer nach den Flaggen am Heck der Schiffe. Der Kahn mit den Kohlehügeln, der tief im graubraunen Wasser lag, kam aus Belgien, der Tanker aus den Niederlanden. Stromabwärts wehte eine rote Flagge mit weißem Kreuz, ein Schweizer Kahn mit abgedeckter Ladung, einer Leine voll flatternder Wäsche und einem Hund an Deck, der aufgeregt bellte. Sein Kläffen galt vielleicht dem kleinen Fährboot, das sich durch die Wellen zum anderen Ufer kämpfte. Es schaukelte heftig, als hätte es kaum die Kraft, sich in der Strömung zu behaupten. Die Häuser und der Kirchturm von Beuel sahen aus wie stumme Zuschauer.
»Das alles habe ich früher sehr gemocht«, sagte Uwes Mutter. Sie stand neben ihm, sah ihn nicht an und schien mit sich selbst zu sprechen. »Den Fluss und die Stadt.«
Sie nahm etwas Weißes aus ihrer Manteltasche, einen Briefumschlag. Die Adresse war mit der Schreibmaschine geschrieben. Waltraud Ohlbruck, Kaiserstraße. War das ein Brief von seinem Vater? Uwe konnte sich das nicht vorstellen. Er hatte den Vater immer nur mit einem Füller und schwarzer Tinte schreiben sehen.
Seine Mutter drehte den Umschlag um. Die Rückseite war leer.Kein Absender. Sie streckte den Arm aus. Die Hand mit dem Brief schwebte über das Geländer des Uferwalls, gegen den glucksend das Wasser schwappte. Ein Stück weiter saßen fünf Möwen auf der oberen Querstange. Sie schrien nicht wie sonst, sie waren ganz still, als ob sie auf etwas warteten.
Uwe hielt nach dem Fährboot Ausschau. Es hatte die Überquerung geschafft und legte am Beueler Ufer an.
»Dein Vater kann Weihnachten nicht kommen«, sagte seine Mutter und zog den Arm mit dem Brief zurück.
»Schade.« Er biss sich auf die Lippe. Das Wort war falsch, klang schwach und hohl. Mit dem Kloß im Hals fand er kein besseres.
Er hatte seinen Vater so lange nicht gesehen. Wenn er sich sein Gesicht vorstellte, sah er nur eine helle ovale Scheibe vor sich und nichts darin. Manchmal schob sich das Gesicht seines Bruders davor. Walter war dem Vater ähnlicher als Uwe, war ebenso schmal und blass mit dunkelbraunem Haar. Aber auch Walters Gesichtszüge verschwammen in Uwes Kopf. Der Bruder war seit Monaten in Amerika.
»Kommt Papi an meinem Geburtstag?«
»Ich glaube nicht.«
Das hatte Uwe befürchtet. Trotzdem hatte er einen Rest Hoffnung gehegt. Damit war es vorbei. Plötzlich war ihm eisig kalt.
»Jochen hat gesagt, Papi ist … das Wort darf ich nicht.«
»Sag es ruhig.«
»Ein … Arsch. Weil er uns verlassen hat. Er hat eine andere Frau, sagt Jochen.«
»Das ist Unsinn.«
Sie blickte ihn an und nahm ihn kurz in den Arm. Ein Duft nach Wiesenblumen umfing ihn, ihre Haare kitzelten an seiner Wange. »Dein Vater war im Krieg an der Ostfront, Uwe, er hat Entsetzliches erlebt. Als wäre das nicht genug, haben die Nazis seine jüdischen Freunde ermordet und britische Bomber seine erste Frau getötet. Er kämpft für den Frieden und eine bessere, gerechtere Welt. Für unsere Sicherheit. Das ist schwierig, da muss die Familie zurückstecken. Er tut es für uns. Damit es nie wieder Krieg gibt. Verstehst du das?«
Die Schiffe schienen den Atem anzuhalten.
»Nein«, sagte Uwe.
Das kam ihm unangemessen laut vor, zudem ein bisschen böse und ungehorsam. Er verstand wirklich nicht, wie alles zusammenhing und warum sein Vater verschwinden musste, um einen Krieg zu verhindern. Er war sich nicht mal sicher, ob seine Mutter es verstand. Womöglich hatte sie das nur auswendig gelernt, so hörte es sich an.
Irgendwas hielt ihn davon ab, Fragen zu stellen. Vielleicht das düstere Geheimnis um Krieg, Bomben und Tod. Oder es lag an den Männern in den dunklen Anzügen, einer kleinen Gruppe, die an ihnen vorbei Richtung Bundeshaus ging.
Seine Mutter wandte ihr Gesicht dem Wasser zu, als wollte sie die Leute nicht sehen. Ihre schmalen Hände zerrissen den Brief in der Mitte, legten die Hälften übereinander und rissen ein zweites Mal. Die weißen Fetzen trudelten zum Wasser hinab, die Möwen flogen auf. Nur eine blieb sitzen und schaute Uwe an. Das würde er nie vergessen. Doch davon ahnte er noch nichts.
Erst Jahre später, nachdem die Sache mit Walter passiert war, meinte er, der Blick des Vogels hätte etwas bedeutet.
1
Bärbel
»Diesen Raum nutzen wir ausschließlich privat.« Der Mann mit dem grauschwarzen Haar, das im Nacken zu einem dünnen Pferdeschwanz zusammengefasst war, zog die Tür des Wintergartens langsam zu. Er hatte Bärbel nur einen kurzen Blick hineinwerfen lassen und die Hand nicht von der Klinke genommen.
Und damit sollte die Sache erledigt sein? Ging da nicht noch was?
»Ach, bitte, Herr Freiturm …« Bärbel, für die meisten Barbara oder Frau Thorgast, seufzte und schickte ein trauriges Lächeln hinterher. Sie wusste um dessen Wirkung. Ihre Ehemänner waren daraufhin regelmäßig eingeknickt. »Darf ich nicht doch hineingehen? Nur ganz kurz? Dieser unglaubliche Blick zum Garten …«
Die Tür mit dem querovalen Milchglasfenster im oberen Teil öffnete sich wieder. Bärbel trat über die Schwelle.
Ja, wirklich, dachte sie, dieser Raum muss es sein! Er war nicht groß, aber auch nicht zu klein. Hier wären sie ganz für sich. Sie hatte den Wintergarten, dem verschnörkelte Holzstreben und bunte Zierscheiben am Rand der Fensterteilungen eine besondere Atmosphäre verliehen, rein zufällig entdeckt, als sie zur Toilette gegangen war und die falsche Tür erwischt hatte. Und nun wollte sie nichts anderes für ihr Fest.
Es passte einfach alles: Das Restaurant »Der Rabe« in der Königstraße war nah am Zentrum, das Gründerzeithaus strahlte den Charme vergangener Zeiten aus und die Küche galt als hervorragend, wenngleich zu Preisen, die für Bärbel normalerweise nicht infrage kamen.
Immerhin hatte sie den Eindruck, dass ihr Vorhaben Herrn Freiturm, der anscheinend der Chef des Hauses war, faszinierte. Hut ab, Frau Thorgast,hatte er zu Anfang ihres Gesprächs gesagt. Es sei ungewöhnlich, sich nach mehr als fünf Jahrzehnten mit Menschen zu treffen, die man aus den ersten vier Schuljahren kannte und danach nie wiedergesehen hatte. Und dass sie solche Mühe darauf verwandt habe, diese Leute zu finden!
»War Ihre Schule hier in der Nähe?«, fragte er.
»Maarflach, Nähe Hofgarten, ›Volksschule‹ sagte man damals.«
Möglich, dass er das Bonn der 50er- und 60er-Jahre selbst kannte. In seiner Stimme schwang ganz leicht die rheinische Sprachmelodie mit, wie bei vielen Menschen, die hier geboren waren oder seit Langem hier lebten. Er musste mindestens Mitte 70 sein, die hellbraunen Augen und den Mund umgaben eine Menge feiner Fältchen. Ihre Großmutter hätte gesagt: Das ist einHerr – mit dieser edel gewölbten Stirn, den gepflegten schlanken Händen und der liebenswürdigen Art.
Bärbel trat ans Fenster. Der Wintergarten befand sich im Hochparterre, das Gelände dahinter lag anderthalb bis zwei Meter tiefer. Direkt am Haus war ein kleiner gepflasterter Hof, der um die Ecke herum verlief und dort mit der Einfahrt verbunden sein musste, die man von der Straße aus sah. Der Garten war kürzer als der, in dem sie unzählige Stunden ihrer Kindheit verbracht hatte, aber ähnlich angelegt: Im Vordergrund und an den Seiten Blumenbeete, in der Mitte eine ovale Rasenfläche, umgeben von einer niedrigen Buchsbaumhecke, drum herum ein schmaler Pfad und vor der Grenzmauer zum hinteren Nachbargrundstück eine dichte Reihe Sträucher.
Unter dem Obstbaum in der Mitte des Rasens saß ein hagerer Mann in eine Wolldecke gehüllt auf einem Gartenstuhl. Er mochte gut zehn Jahre älter sein als Freiturm und trug eine graue Walkjacke und eine altmodische braune Ohrenklappenmütze.
Trotz der Entfernung trafen sich ihre Augen. Er winkte Bärbel zu und erhob sich umständlich. Die Decke fiel aufs Gras. Er trat an den Rollator, der vor einer Lücke in der Hecke stand, und schob ihn aufs Haus zu. Bärbel hatte den Eindruck, dass er ohne diese Gehhilfe ausgekommen wäre. Vielleicht hatte er Angst zu stolpern.
»Mein Schwiegervater«, sagte Freiturm hinter ihr. »Ich fürchte, er kommt rauf. Er will immer wissen, was läuft.«
Aus der Düsternis des schmalen Flurs trat in goldfarbenen Ballerinas zunächst eine Frau an Freiturm heran, rotwangig und korpulent, mit tizianrotem Haar und großer Brille, bedeutend jünger als er, mit tief ausgeschnittener Schlabberbluse und fünfreihiger Perlenkette. Keine Dame, hätte Omi gesagt, auch wenn sie bemerkt hätte, dass die wurstigen Finger hübsche Brillanten trugen.
»Meine Frau«, erklärte Freiturm.
»Georg«, tönte es eindringlich, fast vorwurfsvoll aus dem Mund mit den kirschroten Lippen, »der Wintergarten ist für Familie und Freunde!« Das Ende des Satzes wurde von einem blubbernden Ton untermalt, als stiegen Luftblasen aus den Tiefen ihres Doppelkinns herauf.
»Das weiß Frau Thorgast, Anita.«
»Wir sind alle starke Esser und lieben guten Wein«, behauptete Bärbel kühn. »Das würde sich für Sie lohnen.«
Das kam ihr vor wie ein Wedeln mit Hunderteuroscheinen. Aber so falsch konnte es nicht sein. Ein Freund hatte gemeint, das Restaurant sei nicht gut besucht.
Aus dem Gastraum kam der Ruf, Frau Freiturm werde am Telefon verlangt. Eilig verschwand die Chefin im Flur.
»Wie viele seid ihr denn?«, wollte Georg Freiturm wissen.
»Elf«, erwiderte Bärbel und spürte, wie ihre Miene sich verfinsterte.
Es sollten zwölf sein! Dieses Dutzend war wenig genug. Von den 40 Mitschülern hatte sie nicht mehr aufgetan, abgesehen von dem Dreizehnten auf dem fernen Hawaii. Verbreitete Namen wie Hans Müller und Vornamen, zu denen ihr kein Nachname einfiel, hatten ihr nichts genutzt. Bei den Frauen waren die Ehenamen das Problem und Eltern, die man fragen konnte, lebten größtenteils nicht mehr. Dennoch hatte sie es geschafft, ein paar E-Mail-Adressen und Telefonnummern aufzutreiben. Sie hatte freudige Antworten von Menschen mit den unterschiedlichsten Biografien erhalten – von der kinderreichen Garten-Designerin bis zur preisgekrönten Wissenschaftlerin, vom politisch aktiven Elektriker bis zum Regisseur von Spielfilmen. Zehn Frauen und Männer hatten zugesagt und würden zum Teil aus Berlin, Hamburg und München anreisen. Nur von Uwe, an dem ihr besonders lag, war keine Reaktion gekommen.
»Vielleicht auch zwölf«, fügte Bärbel hinzu.
Ich kriege dich noch, Uwe Ohlbruck, dachte sie, obwohl ich nur eine Nummer habe, unter der ich dich nicht erreiche, und eine E-Mail-Adresse, an die ich vergeblich die Einladung und mein Foto geschickt habe.
Georg Freiturm lächelte. »Wenn Sie sich zuletzt mit zehn oder elf Jahren gesehen haben, erkennen Sie die anderen nicht wieder. Das sind Wildfremde. Aber die Idee ist schön, wirklich schön.«
Hinter ihm erschien geräuschlos wie ein Geist der Mann aus dem Garten im Türrahmen. Die hässliche Mütze hatte er abgelegt, das weiße Haar lag wie ein breiter Kranz um die kahle Mitte. Seine Augen hinter der randlosen Brille zogen sich zusammen. Das wirkte argwöhnisch. Vielleicht lag es nur daran, dass er aus dem dunklen Flur ins Tageslicht des Wintergartens blickte.
Für einen Mann seines Alters sah er richtig gut aus, fand Bärbel. Die leicht gebräunte Haut war erstaunlich glatt, die Gesichtszüge und die gebogene Nase waren scharf geschnitten, das magere Kinn und der schmallippige Mund wirkten energisch. Auch ein Herr nach Omis Maßstäben. Schwer vorstellbar, dass er der Vater von Anita Freiturm war, die wie ein Pudding zu zerfließen schien. Einzig die Nasen wiesen Ähnlichkeit auf, wenngleich seine hervorstach und ihre zwischen den aufgedunsenen Wangen fast versank.
Bärbel nickte ihm grüßend zu, bevor sie das Gespräch mit Freiturm fortsetzte. »Umso ärgerlicher, wenn man an einen der Mitschüler mit E-Mails und Anrufen nicht herankommt. Ich habe mich wirklich bemüht. Und ich gebe nicht auf. Das wäre der Zwölfte.«
Sieben Mal hatte sie angerufen, unzählige Male klingeln lassen. Einmal hob eine Frau ab und sagte, er sei nicht da, sie richte ihm aus, dass er zurückrufen solle. Aber er rief nicht zurück. Beim letzten Versuch bekam Bärbel das Gleiche zu hören und hatte den Verdacht, er sei im Hintergrund. Uwe, neben dem sie vier Jahre lang die Schulbank gedrückt hatte, ausgerechnet er sollte nicht zum Klassentreffen kommen? Das war unerträglich.
Georg Freiturm strich sich über die Stirn. »Will er nicht? Keine Lust?«
»Wenn jemand auf Hawaii lebt, verstehe ich, dass er nicht kommt«, sagte Bärbel. »Uwe wohnt aber hier in Bonn, und als pensionierter Lehrer müsste er Zeit haben.«
»Ah, Lehrer.«
»Clara-Schumann-Schule. Mathe und Physik.«
»Vielleicht kenne ich ihn. Meine Jüngste war zwei Jahre auf der Clara, ist ja quasi um die Ecke. Wie heißt er denn?«
»Uwe Ohlbruck. Wenn er keine Lust hat, soll er mir das sagen, statt sich am Telefon verleugnen zu lassen.« Eine Welle des wohlbekannten Unmuts überkam sie. »So muss ich ja denken, es steckt mehr dahinter.«
»Wie kommen Sie darauf?«, fragte Freiturm.
»Das ist nur so ein Gefühl.«
»Wollen Sie den Mann nicht lieber in Ruhe lassen?«
»Es würde mich ewig wurmen, nicht alles versucht zu haben«, entgegnete Bärbel.
Der Schwiegervater, der auf den Rollator gestützt mit unbewegtem Gesicht in der Tür stand, hüstelte. Er schien etwas sagen zu wollen. Georg Freiturm trat einen Schritt zurück, als wäre es selbstverständlich, dem älteren Mann die Bühne zu überlassen.
»Mein Name ist Rolf Plötting«, stellte der sich vor. »Ich habe den Laden hier aufgebaut.«
Seine Stimme klang überraschend jung. Bärbel konnte nicht heraushören, woher er stammte, und tippte auf Niedersachsen. Sie ging auf ihn zu und reichte ihm die Hand.
»Ein wunderbares Restaurant. Ich heiße Bärbel Thorgast.«
Plötting wandte sich seinem Schwiegersohn zu. »Sie bekommt den Wintergarten, Georg.«
Bärbel wäre ihm am liebsten um den Hals gefallen, fürchtete aber, Anita, die Tochter, käme angeschossen, um die Zustimmung zunichtezumachen.
»Oh, danke! Super.«
»Wir müssen nur eine Bedingung stellen«, fügte Plötting hinzu.
»Rolf …«, murmelte Freiturm mit gerunzelter Stirn.
»Sie müssen zwölf Menüs bestellen, Frau Thorgast.«
»Rolf, meinst du wirklich …«
»Sonst streikt meine Tochter. Schließlich könnten wir im Wintergarten 30 Menüs servieren.«
»Verstehe«, sagte Bärbel, obwohl sie es nicht verstand. War es so ein Unterschied, ob es elf oder zwölf Menüs waren? Und hieß es nicht eben, sie nutzten den Wintergarten nur privat, was zugleich bedeutete, sie verdienten sonst überhaupt nichts daran?
Rolf Plötting wendete den Rollator und schob ihn bedächtig den Flur entlang zum Gastraum, leise auftretend, wie er gekommen war.
Freiturm zuckte mit den Schultern. »Glückwunsch. Er ist der Hausherr und immer noch der Chef. Obwohl er das meiste uns überlässt. Ich bin für die Küche zuständig, Anita für alles andere. Rolfs Herz gehört dem Garten.«
»Der ist besonders schön.«
»Natürlich arbeitet er nicht mehr selber dort. Dafür hat er ein paar junge Männer. Die setzen auch im Haus alles instand. In einem Altbau fällt immer was an.«
Freiturm erkundigte sich nach dem gewünschten Termin. Sie vereinbarten, Mitte der Woche das Menü zu besprechen.
»Viel Erfolg mit dem Zwölften«, rief er Bärbel nach, als sie ihm die Hand gegeben und sich umgewandt hatte.
Unterwegs durch den schmalen Flur zum breiteren Eingangsbereich warf sie einen bewundernden Blick auf den fünfarmigen Kronleuchter aus blankem Messing, der an einer Kette von der Stuckdecke herabhing. Sie war zufrieden mit sich. Dieses Ambiente würde ihren Schulfreunden gefallen.
Auf der Schwelle zum Gastraum stand Rolf Plötting auf seinen Rollator gestützt und lächelte ihr zu. »Lebt denn wirklich einer auf Hawaii?«
»Jochen unterrichtet an einer Sprachenschule in Honolulu«, sagte Bärbel.
Da kam ihr eine Idee, die, für sich betrachtet, ganz harmlos war.
Malte
Er schreckte hoch. Was war das?
Sein Handy? Oh Mann, ja.
Seine Augen öffneten sich viel zu langsam, sein Körper war schwer wie Blei. Auf dem alten, aber zuverlässigen Wecker, der auf dem Bücherstapel neben dem Bett thronte, standen die Zeiger auf halb zwölf. Hä, wirklich? Scheiße.
Die jazzige Tonfolge, die irgendwo im Klamottenberg vor dem Schreibtisch klimperte, verstummte. Das war ihm sehr recht. Erst mal brauchte er einen Kaffee. Was allerdings bedeutete, dass er aufstehen und einen zubereiten musste. Das war im Moment nicht drin. Seine letzte Freundin hatte ihm jeden Morgen eine Tasse ans Bett gebracht, bevor sie ins Büro gegangen war, einfach großartig. Nach drei Wochen hatte sie die Schnauze voll gehabt und war nicht wiedergekommen. Obwohl ihre High Heels noch unter seinem Bett lagen.
In letzter Zeit verpennte er ständig, so ein Ärger. War im »Carpe Noctem« wohl ein bisschen spät geworden. Warum kamen nach Mitternacht immer die nettesten Leute durch die Tür? Die Vorlesung »Tragödienphilosophie bei Hegel und Hölderlin« konnte er heute jedenfalls knicken. Genau wie letzte Woche.
Er hätte sowieso keine Lust dazu gehabt. Hegel und Hölderlin kamen ihm vor wie langweilige Großonkel, denen er anstandshalber einen wöchentlichen Besuch abstatten musste. Das Philosophiestudium hatte er sich anders vorgestellt, irgendwie spannender. Schließlich ging es um die großen Fragen der Menschheit. Warum waren die so verdammt mühsam? Die ganze Ethik samt dem kategorischen Imperativ war ihm zu hoch, bei der Erkenntnisphilosophie fielen ihm die Augen zu und vor der Metaphysik gruselte es ihn. Das musste er nun trotzdem durchziehen, er hatte bereits ein Jurastudium abgebrochen. Wenn seine Eltern ihn so sehen könnten, um halb zwölf im miefigen Bett, am Boden löchrige Socken, umgekippte Bierflaschen und ein Haufen Pistazienschalen, dann wäre die Kacke ordentlich am Dampfen.
Und wer hatte eben angerufen? Wo war das Handy überhaupt?
Er rappelte sich auf, stolperte über die Flaschen und stürzte bäuchlings in die Klamotten der letzten drei Wochen. Da war das Ding, direkt unter ihm, in der Tasche seiner Lederjacke. Er rollte sich auf den Rücken und sah aufs Display.
Bärbel. Seine coole Tante Bärbel, die ältere Schwester seiner Mutter, ehemalige Bibliothekarin, Vorsitzende eines Würfelclubs und rund wie – nee, rund wie ein Fass sagten seine Freunde, er selbst würde sich niemals so abfällig über sie äußern. Denn Bärbel war die netteste Rentnerin, die man sich denken konnte. Vollschlank, musste man wohl sagen, vollschlank war sie und über ihre Speckpolster flossen Gewänder in den knalligsten Farben, als legte sie Wert darauf, nicht übersehen zu werden. Schöne Stoffe, starke Farben und gutes Essen waren für sie ein Ausdruck von Lebensfreude. Komisch, dass man in dem Alter noch so fidel sein konnte.
Er wählte ihre Nummer. »Du hast angerufen?«
»Hab ich dich geweckt?«
»Nee, bin seit 8 Uhr auf.«
»Und nicht in der Vorlesung?«
»Hegel und Hölderlin fallen heute aus.«
»Ich glaub dir kein Wort, Malte. Aber ich denke, dann hast du Zeit?«
»Öh …«
»Nimm dein kleines Auto und hol mich bitte ab. Sind 50 Euro okay? Plus Benzingeld.«
»Das klappt nicht, das Ding muss in die Werkstatt.«
Mit der kaputten alten Mühle kämen sie kaum bis zur Straßenecke. Den Fuffi hätte er allerdings gern. Er war blank bis auf 90 Cent. Seine Tante war so gut wie ein Job. Und häufig seine Rettung. Bärbel besaß keinen Führerschein, hatte marode Knie und stand ungern an der Bushaltestelle.
»Können wir uns ein Auto leihen?«, fragte er. »Von Knut, Kurt oder Klaus?«
Das waren ihre drei Verflossenen. Nur wusste Malte nie, wer welcher war und in welcher Reihenfolge Bärbel sie geheiratet und sich von ihnen getrennt hatte. Nicht nur die Namen, sondern auch die Herren selbst ähnelten einander fatal: drei mittelgroße Männer mit Bauch, schütterem Haar, einer Brille auf der Nase, einem Auto vor der Tür und anhaltender Zuneigung für Bärbel. Alle drei Nasen waren mehr oder weniger knubbelig, doch die Autos waren unterschiedlich.
Am frühen Nachmittag saß er am Steuer eines bronzefarbenen Opel Meriva. Er hatte ihn zuvor bei dessen Eigentümer Knut in Ippendorf abgeholt, der ihm eingeschärft hatte, vorsichtig zu fahren. Bärbel stieg vor dem Edeka-Markt am Poppelsdorfer Platz zu. Sie bewohnte eine Zweizimmerwohnung schräg gegenüber.
»Wohin?«, fragte Malte, während sie sich anschnallte.
»Bonner Norden. Buschdorf. Eine Reihenhausstraße.« Sie zeigte ihm den Zettel, auf dem sie Straße und Hausnummer notiert hatte, und schwenkte ihn wie einen Lottoschein mit sechs Richtigen. »Dort wohnt Uwe, den ich fürs Klassentreffen gewinnen will und von dem keine Antwort kommt. Bisher hatte ich seine Anschrift nicht, aber gestern fiel mir ein, dass ich Jochen in Honolulu danach fragen könnte.«
»Wieso weiß der in Honolulu besser Bescheid als du in Bonn?«
»Weil seine frühere Lebensgefährtin jetzt die von Uwe ist.«
»Hä?«
»Als sie mit Jochen liiert war, lebte der hier in Bonn. Auf einer Lehrer-Fortbildung lernte sie Uwe kennen und zog mit ihm zusammen. Pech für Jochen. Er bewarb sich an einer Sprachenschule auf Hawaii.«
»Liebeskummer?«
Bärbel nickte. »Sie schreiben sich noch jedes Jahr zu Weihnachten, diese Frau und Jochen, das habe ich ihm gestern entlockt. Deshalb hat er die Anschrift.«
»Du willst diesem Uwe also auf die Bude rücken? Der wird begeistert sein! Der lässt sich nicht überreden, da geh ich jede Wette ein.«
»Ich will ihn nicht überreden, sondern davon überzeugen, dass es gut ist, an dem Treffen teilzunehmen. Für uns alle und für ihn.«
Wozu das gut sein sollte, war Malte schleierhaft, doch er musste sich auf den Verkehr konzentrieren und beließ es dabei. Leute über 60! Der Verschleiß fing in den Knien an, dann kam der Kopf dran.
Die Stadt war verstopft, das war man in Bonn gewohnt. Vielleicht hätten sie über die Autobahn fahren sollen. Aber laut Bärbel, die ihre Verkehrs-App auf dem Handy befragte, sah es dort um einiges schlimmer aus.
»Wenn er nicht zu Hause ist, sitzt du umsonst im Stau«, sagte Malte.
»Das macht nichts. Ich werfe einen Brief ein und komme später wieder.«
Nach knapp 40 Minuten hatten sie es geschafft. Sie bogen in eine ruhige Anwohnerstraße ein.
»Nummer 28, das Haus mit den Primelpötten davor.« Bärbel raffte ihre vielfarbigen Stoffbahnen und stieg aus. »Ich klingele da mal.«
Malte blieb sitzen und ließ das Fenster herunter. Die Tür des Reihenhauses öffnete sich und eine junge Frau mit einem Baby auf dem Arm wurde sichtbar. Bärbel sagte »Guten Tag«, stellte sich vor und fragte nach ihrem Uwe.
»Ohlbruck? Der wohnt seit Wochen nicht mehr hier. Wir sind die Nachmieter.«
»Haben Sie seine neue Adresse?«
»Nicht direkt. Ich hab ihn gefragt, wo er hinzieht, und die Antwort war: nach Honolulu.«
»Nein!«
Bärbels Aufschrei hallte durch die Nachbarschaft. Ein Hund bellte, im Haus gegenüber ging ein Fenster auf. Ein Mann schaute herüber.
Sie kam zurück zum Auto. Der Stoff ihrer Jacke bebte, jedes ihrer Speckpolster schien in Aufruhr. Ihr Gesicht hatte rote Flecken, ihre Augen blitzten vor Ärger. Sie riss die Beifahrertür auf, ließ sich auf den Sitz fallen und bearbeitete hektisch ihr Handy.
So gefiel sie Malte überhaupt nicht. Er kannte seine Tante als coole Lady und das sollte bitteschön so bleiben.
»Hey, Bärbel«, sagte er in beschwichtigendem Ton.
Sie beachtete ihn nicht. Stierte auf die Windschutzscheibe und horchte ins Handy.
»Jochen?«
Oh, mein Gott! Rief sie den Klassenkameraden auf Hawaii an? Dort musste es mitten in der Nacht sein.
»Entschuldige, wenn ich dich geweckt habe, Jochen. Stell dir vor: Uwe wohnt hier nicht mehr! Hast du die neue Adresse? Nee? Frag seine Lebensgefährtin bitte danach, ja? Ruf mich zurück. Ich sitze im Auto und warte darauf.«
Aus Honolulu schien eine unwirsche Erwiderung zu kommen.
»Bei uns ist es Nachmittag, lieber Jochen«, sagte Bärbel im Ton einer sanften Fee. »Du bist jetzt sowieso wach.«
Anscheinend legte er ohne Verabschiedung auf. Bärbel ließ das Handy in ihren Schoß sinken und schwieg. Wie sie so in sich zusammengesunken dasaß und auf die Fahrbahn starrte, ähnelte sie einer brütenden Henne.
»Was für ein Käse«, murmelte sie schließlich. »Uwe ist nicht in Honolulu. Wenn er das wirklich gesagt hat, frage ich mich, warum.«
»Um vor neugierigen Weibern sicher zu sein«, meinte Malte und erwartete einen Puff in die Rippen. Aber der blieb aus. Sie seufzte nur und blickte einem Taubenpaar nach, das quer über die Straße flog und sich auf dem Dach einer Garage niederließ.
»Vielleicht wollte er Jochen besuchen und es ist ihm was dazwischengekommen«, bot Malte als Erklärung an.
Bärbel schüttelte den Kopf. »Jochen und er haben nichts mehr miteinander zu tun. Ist ja normal, wenn die Partnerin dem anderen den Vorzug gibt.«
»Oder ihm war danach, unter Palmen mal so richtig auszuspannen«, schlug Malte vor. »Endlose Strände, Sonne pur …«
Er wurde von Bärbels Handy unterbrochen.
»Ich stell das mal laut«, sagte Bärbel, »damit ich nicht alles wiederholen muss.«
»Mona sagt, er ist fast nie zu Hause«, ertönte eine raue Stimme, der man nicht anmerkte, dass sie von einer Insel im fernen Pazifik kam. »Er verkriecht sich in der Wohnung seiner Mutter, die vor Kurzem gestorben ist. Das hat ihn hart getroffen, meint Mona. Obwohl er die Wohnung nur ausräumen muss, bleibt er jeden Tag viele Stunden fort.«
»Adresse der Mutter?«
»Kaiserstraße. Das Haus, in dem er aufgewachsen ist. Das kennst du doch.«
»Los, Malte«, sagte Bärbel, als sie aufgelegt hatte. »Auf in die Südstadt! Ich erhöhe auf 70. Das ist ein toller Stundenlohn für einen Studenten, der sich bei Hegel nur gelangweilt hätte.«
»Mittlerweile läuft Erkenntnistheorie der Frühen Neuzeit. Die interessiert mich mehr.«
Natürlich käme er hoffnungslos zu spät. Also lieber die durchgeknallte Tante in die Kaiserstraße chauffieren und ein bisschen Geld verdienen.
In diese Richtung floss der Verkehr einigermaßen, sie brauchten keine 20 Minuten.
Bärbel deutete auf die Reihe von Gründerzeithäusern, deren Fenster auf die Bahnschienen blickten, wo gerade ein ICE vorüberraste. »Das Hellgraue mit dem Erker.«
Fast genau davor war neben einem Baum eine enge Parklücke frei. Malte hatte Mühe, den Meriva hineinzubugsieren, schaffte es jedoch nach einigen Versuchen. Er hätte sich über ein kleines Lob gefreut, aber Bärbel stieg in einem Tempo, das er ihr nicht zugetraut hätte, wortlos aus dem Wagen. Mit schwingenden Röcken eilte sie die Stufen zu einer Tür hinauf, die mit altem Schnitzwerk verziert war, und studierte die Klingelschilder. Mit ihrem rot lackierten Zeigefinger drückte sie auf einen der Knöpfe und wartete mit angespanntem Gesichtsausdruck.
Merkwürdig, wie verbissen sie ist, dachte Malte. Doch er erinnerte sich daran, dass einer ihrer Ex-Männer gesagt hatte, sie sei ungenießbar, wenn etwas nicht so liefe, wie sie es sich vorgestellt habe.
Nach einer Weile klingelte Bärbel noch einmal. Sie trat eine Stufe tiefer, legte den Kopf in den Nacken und blickte nach oben. Dann streckte sie den Arm aus und drückte erneut auf die Klingel.
Endlich kehrte sie zurück und ließ sich auf den Beifahrersitz sinken, die Lippen zusammengepresst, die Stirn zerknautscht. »Er ist da drin! Erster Stock.«
»Wie kommst du darauf?«
»Am seitlichen Erkerfenster hat sich die Gardine bewegt. Malte, wir warten hier.«
»Och, nee.«
»Detektive machen das auch so«, sagte Bärbel streng. »Irgendwann wird er rauskommen.«
»Detektive tragen nicht solche Klamotten wie du, Bärbel.«
»Woher soll er wissen, dass ich das bin? Anfang der Sechziger trug man so was nicht.«
Ach ja. Malte hatte das schwarz-weiße Klassenfoto und die dünne blassblonde Maus in der ersten Reihe gesehen. Spitzes Kinn, Brille, Strickjacke und kariertes Faltenröckchen. Die sah nicht aus wie der Entwurf für die spätere Bärbel. Nicht annähernd. Nur um den Mund herum lag schon damals etwas Entschlossenes.
»Der weiß inzwischen, wie du aussiehst, Bärbel. Du hast ihm ein aktuelles Bild geschickt.«
»Falls er sich das angeschaut hat.«
»Wenn er hinter der Gardine steht, weiß er jedenfalls, dass du hier im Auto sitzt und ihm auflauerst, und wenn er dir nicht begegnen will, kommt er nicht raus. Er hat dort ein Klo, Kaffee und alles, um eine dreitägige Belagerung auszuhalten, und wir haben hier nichts, um es auch nur bis zum Abend zu schaffen.«
»Fahr bitte in die Seitenstraße und halte dort, Malte. Dann denkt er, wir sind weg. Ich postiere mich an der Ecke und sehe ihn, wenn er aus dem Haus kommt. Auf den paar Metern wird er mir nicht ausweichen.«
Malte bog in die Nassestraße ein, sah aber keine Haltemöglichkeit. Ein Lastwagen belieferte gerade die Mensa.
»Ich steige aus und du fährst um den Block«, sagte Bärbel.
Malte lenkte den Meriva durch den Engpass neben dem Laster. Ein Stück weiter hielt er an.
Bärbel schien nervös, als sie ausstieg, und blieb mit ihrem weiten Rock an der Schiene ihres Sitzes hängen. Nachdem der Stoff mit vereinten Kräften gelöst war, verfolgte Malte im Rückspiegel, wie sie zur Kaiserstraße zurückging. Eine rundliche Frau mit kurzem silberblonden Haar und energischem Schritt, bunt wie ein Paradiesvogel und irgendwie schick. Eine Frau, die bestimmt jeder gerne traf – nur dieser Uwe nicht. Dem er allerdings dankbar war für die Scheine, die er ihm einbrachte.
Bärbel
Abrupt blieb sie an der Ecke stehen.
Quer über den Bürgersteig der Kaiserstraße ging ein schlanker Mann in einem braunen Sakko auf ein dunkelblaues Auto zu. Er öffnete die Fahrertür und blickte übers Wagendach. Genau in ihr Gesicht.
Sie hielt die Luft an, nicht imstande zu reagieren.
Über eine Distanz von vier, fünf Metern starrte er sie an. Im nächsten Moment kniff er die Augen zusammen. Ehe sie losspurten konnte, glitt er auf den Fahrersitz. Sie setzte sich in Bewegung, doch ihr linkes Knie meldete sich empört. Sekundenlang musste sie in einer starren Pose verharren, bis der Schmerz verebbte.
Die Zündung ertönte. Er fuhr los.
Bärbel atmete geräuschvoll aus. Ihr Herz pochte bis zum Hals. Das war er! Uwe. Sie hatte sein Gesicht vor ein paar Monaten in der Zeitung gesehen, nebst einem Bericht über seine Pensionierung. Das Blau der Augen war nicht so auffallend wie früher, aber die fast dreieckig anmutende Kopfform und der leicht gewellte graubraune Haarschopf über der niedrigen Stirn waren eindeutig. Ebenso klar war, dass er sie erkannt und daraufhin kräftig Gas gegeben hatte. Er war vor ihr geflohen.
Am Bordstein fuhr der Meriva vor. Malte beugte sich zum offenen Beifahrerfenster herüber. »Na?«
Sein spöttischer Gesichtsausdruck war nicht zu übersehen. Sicherlich entging ihm nicht, wie sehr die Wut in ihr brodelte.
Sie stieg ein. »Er ist Richtung Kaiserplatz. Fahr hinterher. Der bleibt gleich sowieso im Verkehr stecken.«
Malte startete aufreizend langsam.
»Mensch, Malte! Beeilung! Die Fahrbahn ist frei!«
»Ich mach keine Verfolgungsjagd, Bärbel. Schon gar nicht mit dem Auto von Klaus.«
»Der Meriva gehört Knut, und der hat bestimmt nichts dagegen.«
»Aber es ist sinnlos. Dieser Uwe will nichts von dir wissen, akzeptier das einfach mal. Allmählich wird die Sache lächerlich.«
»Du meinst, ich soll aufgeben?«
»Ja, natürlich.«
»Malte, du hast keine Ahnung, wie das damals war in dieser Stadt und dass alle sich freuen, darüber reden zu können. Nicht mit irgendwem, sondern mit denen, die dabei waren, auf dem Schulweg, beim Spielen auf dem Schulhof, im Eis-Lazzarin und im Turnverein.«
Dass eine Art Sammlerleidenschaft in ihr entbrannt war, mochte sie nicht zugeben. Sie wollte auf keinen der Mitschüler verzichten, die sie mühsam aufgespürt hatte, und auf Uwe erst recht nicht! Es war schmerzlich genug, Jochen aus Honolulu nicht dabeizuhaben. Nein, sie konnte Uwe nicht fallen lassen. In ihrer Erinnerung war er ein stiller Junge gewesen, kein Raufbold wie manch anderer. Einmal hatte er ihr einen nagelneuen Ratzefummel geschenkt, später oft sein Schinkenbrötchen mit dick Butter, eine Köstlichkeit, die es bei ihr zu Hause nicht gab. Von den Jungs war er der einzige gewesen, der sie zum Geburtstag eingeladen hatte.
»Das war eine wunderbare Zeit, Ende der 50er-, Anfang der 60er-Jahre. Und Bonn so gemütlich. O-Busse statt U-Bahnen, weniger Autos, Baustellen und Bürohäuser. Wo heute der öde Busbahnhof ist, traf man sich auf der Terrasse der Kaiserhalle, und vor unserem Haus bin ich dem Bundespräsidenten Heuss begegnet.«
»Hä? Weißt du, was für eine Zeit das war? Wenn du diese Jahre verherrlichst, weißt du nicht, was hier los war!«
Bärbel fuhr der Schreck in die Glieder – um ein Haar hätte Malte einen Linienbus gerammt, genau auf Höhe der verschwundenen Kaiserhalle. Der Busfahrer hupte anhaltend.
»Dass Bonn die Hauptstadt war, haben wir Kinder schon gemerkt«, erwiderte sie bebend. »Bundespräsident und Bundeskanzler hatten ihre Dienstsitze ja in unserer Straße und ihre schwarzen Limousinen fuhren oft bei uns vorbei. Unsere Mutter war Sekretärin im Auswärtigen Amt, unser Vater arbeitete für eine Zeitung, deine Großeltern also. Jedes Jahr besuchten sie den Bundespresseball, dort war die ganze Prominenz. Deine Oma hat mit Ministern getanzt, und auf einem Foto sitzt sie mit dem Weinglas neben Konrad Adenauer.«
»Na, prost! Hauptsache, der Wein schmeckt! Überall saßen alte Nazis, in der Bundesregierung, im Bundestag, in den Ministerien und der Justiz, sogar an der Spitze des Kanzleramts! Eurem Adenauer war das schittegal!«
»Halt!«, schrie Bärbel. »Der hat Vorfahrt!«
Malte trat auf die Bremse. Gerade noch rechtzeitig. Sein rundes Gesicht war puterrot. Er gab wieder Gas. Bärbel hielt sich am Griff über der Wagentür fest.
»Überall Scheinheiligkeit und Schweigen über das, was vorher war!«, wetterte Malte weiter. »Überall Nachrichtenhändler und Spione, gnadenlose Aufrüstung und Kalter Krieg – nachdem das Dritte Reich und der Zweite Weltkrieg keine zwei Jahrzehnte vorbei waren! Hat euch das Wirtschaftswunder so verblödet?«
Uwes dunkelblauer Wagen war nirgends zu sehen. Das störte sie im Moment weniger als Maltes Reaktion.
»Hör mal, wir waren Kinder und mit dem Wirtschaftswunder ging es bei uns zu Hause nicht so fix. Kein tolles Spielzeug zu Weihnachten, sondern was Neues zum Anziehen, wir mussten sparen. Bei Tisch wurde die Butter gekratzt, der Schimmel aus dem Brot geschnitten, was essbar war, warf man nicht weg. Strümpfe wurden gestopft, Hosen und Pullis geflickt. Morgens war es eiskalt im Zimmer, weil der Koksofen ausgegangen war. Doch die Staatsbesuche, die im offenen Wagen bei uns vorbeikamen, habe ich genossen, die hatten etwas Märchenhaftes. Dieser Glanz, den sie ausstrahlten! Der persische Schah und die schöne Soraya, da war ich noch winzig klein, aber mein Vater hat Fotos gemacht.«
»So einem wie dem Schah habt ihr zugejubelt, was?«
»Dann Präsident Eisenhower, John F. Kennedy, die Queen und Prinz Philipp, flankiert von den weißen Mäusen …«
»Du meinst Polizei auf Motorrädern«, knurrte Malte.
»Und wir mit Papierfähnchen am Straßenrand.«
»Da haben wir es: Sie haben euch abgerichtet. Manipuliert. Mit Fähnchen und blödem Pomp.«
»Ach, unsere Lehrer waren in Ordnung und unsere Mutter war sogar ein bisschen links, auch wenn sie nie darüber sprach, man merkte es manchmal.«
»Sie traute sich nicht, darüber zu reden, aus Angst, ihren Job zu verlieren! Was für eine wundervolle Zeit!«
Sie waren am Poppelsdorfer Platz angekommen. Malte hielt an dessen Ende, wo eine Seitenstraße von der Clemens-August-Straße abzweigte. Von hier aus hatte Bärbel nur wenige Schritte bis zu ihrer Wohnung, während er den Wagen hinauf nach Ippendorf bringen und mit dem Rad hinunter zu seinem Zimmer in die Lengsdorfer Uhlgasse fahren musste.
»Ich rufe Jochen in Honolulu an«, sagte sie gereizt. »Der versteht mich.«
»Bärbel, dort ist es noch keine 5 Uhr morgens. Du hast ihn schon um halb vier geweckt. Da wäre ich fertig mit der Welt.«
»Jochen ist Frühaufsteher.«
»Sicher?«
»Oder eher eine Nachteule. Ich ruf ihn morgen früh an, dann ist es Abend in Honolulu.«
»Lass doch den Scheiß.«
»Scheiß?«
Sie warf einen Fünfziger und einen Zwanziger in Richtung Lenkrad und stieg aus. Sie war sauer. Selbstverständlich war das für sie eine wunderbare Zeit! Zwar prahlten die Jungens mit den Atombomben der Amis, als hätten sie selbst daran mitgebaut, aber ansonsten machte der Kalte Krieg vor den Kinderzimmern halt, vor dem Schulhof mit den Hüpfekästchen aus Kreide und dem hellen Raum, wo Frau Schmitz mit ihnen Lieder sang. Während wenige Straßen weiter ein paar Opis das Land regierten.