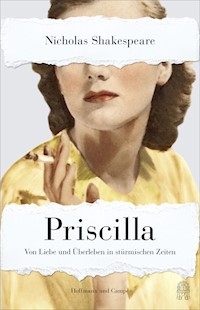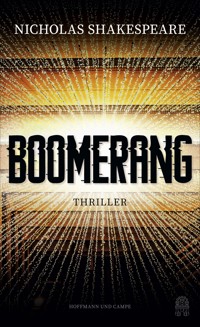
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was tust du, wenn du allein die Zukunft der Welt in den Händen hältst? Marvar, iranischer Atomphysiker am Oxforder Clarendon Labor, hat den Algorithmus für die perfekte Kernfusion gefunden. Ein Wissen, das in den richtigen Händen ein Segen, in den falschen ein Fluch ist. Schließlich könnte man damit sämtliche Energieprobleme der Welt lösen oder eine Waffe von größtmöglicher Vernichtungskraft bauen. Dann verschwindet Marvar plötzlich, nicht ohne zuvor seinem Freund Dyer, einem Journalisten, die Formel zu vermachen. Bald darauf gerät Dyer ins Visier unterschiedlichster Gestalten. Der britische Geheimdienst, Bankiers und Ölmanager mit Kreml-Verbindung – sie alle interessieren sich für ihn. Ein riskantes Versteckspiel beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Nicholas Shakespeare
Boomerang
Thriller
Aus dem Englischen von Anette Grube
Hoffmann und Campe
Für Roger und Ian Kellas
Das maßgebliche Selbst ist unschuldig, und wenn es seine eigene Unschuld erfährt, weiß es, dass es ewig leben wird.
John Updike nach William Blake
Prolog
Shula las die Textnachricht, und die Luft um sie herum wurde dünn. Warum schickte er ihr das? Sie waren übereingekommen, dass er genau das nie tun durfte.
Ihre erste instinktive Reaktion war, ihn anzurufen. In der Leere zwischen dem Wählen der Nummer und dem unverwechselbaren britischen Klingelton fing sie sich. Dumm. Dumm. Sie legte abrupt wieder auf. Ihr Bedürfnis, Rustums Stimme zu hören, reichte tiefer als ihr gesunder Menschenverstand.
Das Baby schlief noch, niemand sonst war im Zimmer, doch sie hatte das Gefühl, dass ihr Blicke folgten.
Sie schaltete das Handy aus und knallte es auf die kleine hölzerne Kommode. Ihre Bewegungen waren unsicher, fahrig, die Bewegungen einer jungen Frau, die gerade aufgewacht war und sich dabei zusah, wie andere ihr zusahen. Sie wusste, dass noch die harmloseste Verrichtung, wie etwa ihr Haar zu lösen, zu Daten würde.
Es war früher Samstagmorgen, und er hätte am Abend zuvor anrufen sollen. Sie hatte gewartet und war dabei eingeschlafen. Diese unbesonnene Textnachricht, so untypisch für ihn, verschlimmerte ihre Ahnung nur noch.
Sie nahm die Bürste und fuhr sich damit durchs Haar. Sie hatte nicht die Zeit gehabt, es zu waschen, dabei mochte das Baby den Geruch gewaschenen Haars, liebte es, nach den Strähnen zu greifen und sich in der schweren schwarzen Masse zu verstecken. Auch ihr Sohn hatte sich gern darin verfangen. Mit ihrer Abreise war sie abgeschnitten von der Körperlichkeit, die sie mit ihrem Erstgeborenen geteilt hatte, und sie musste die Sehnsucht nach ihrem Mann neu kanalisieren, die in ihrer Haut prickelte, wann immer sie an ihn dachte. Sie vermisste ihn akut und kämpfte dagegen an. Aber das war die Abmachung.
Und jetzt diese Textnachricht.
Sie versuchte, ihr robusteres Selbst heraufzubeschwören und es als kleines Spiel zu betrachten, so wie sie zu Beginn die Anrufe am Freitagabend behandelt hatte. Aber die Überwachung hatte die Art und Weise ihres Denkens verändert, sie war tief in ihr Privatleben eingedrungen. Die Männer in dem Auto, das immer draußen stand, wussten, was für Bücher sie las, welche Radiosender sie hörte, was sie aß.
Bedächtig legte sie die Bürste zur Seite und kämpfte gegen das kranke Gefühl, dass sie sogar ihre Gedanken hören konnten. Das Baby, das zugedeckt in seinem Bettchen lag, war ihr einziger Trost. Wenn es weinte, war die beste Zeit für subversive Gedanken. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass sie sich dieses ohrenbetäubende Kreischen anhören wollten.
Im Haus war es still. In Oxford wäre es kurz nach Mitternacht. In der Stadt draußen dämmerte der Morgen.
Sie ging zum Fenster, um die morgendliche Brise im Nacken, auf den Schultern zu spüren.
Sterne am klaren Himmel. Der Geruch nach scharfen Gewürzen. In den Ästen des kleinen Ahornbaums unten hängt ein roter Drachen. Zwischen dem Laub schimmert das schwarze Dach des Paykan im Licht der Straßenlampen. Ein zweites Auto steht daneben, neuer, größer, ebenfalls ohne Nummernschilder.
Plötzlich Schritte auf dem Dach, Rütteln an den Fensterläden, jemand hämmert unten gegen die Tür.
Das Baby rührt sich.
Ein zweites Hämmern an der Hintertür.
Erster Teil
1. Kapitel
Der Sportplatz war leer. Nur ein Elternpaar studierte an diesem kalten Nachmittag die Anschlagtafel in einem Glaskasten vor dem als »Rink« bekannten Schulgebäude. Ein kleiner untersetzter Mann in einer braunen Bomberjacke aus Leder und mit einem demonstrativ um den Hals geschlungenen blau-weiß gestreiften Schal und eine schlanke größere Frau in Jeans, die eine Pelzmütze mit Ohrenschützern trug.
Dyers Herz begann zu rasen. Gennadi und Katja. Ihre Besprechung musste beendet sein, und jetzt warteten sie auf ihren Sohn.
Um Katja und ihren Mann zu meiden, aber auch aus Gewohnheit wandte sich Dyer am Tor nach links und ging zur Sprunggrube.
Diese quadratische Einfriedung, drei mal drei Meter, war einer der wenigen Überreste der Schule, so wie Dyer sich an sie erinnerte. Eingegrenzt von einer niedrigen Ziegelmauer neben dem Zaun, war die mit Sand gefüllte Grube einen Kontinent entfernt vom Berufsverkehr auf der Banbury Road. Von hier reichte der Blick über die grasbewachsenen Spielfelder und das steinerne Kriegsdenkmal, über den Kricketpavillon bis zum Cherwell, verdeckt, aber angedeutet von einer Reihe kahler Ulmen. Zu Dyers Zeiten hatte ein blauer Kahn am Flussufer gelegen, dessen Unterdeck während Schwimmwettbewerben als Umkleidekabine diente. Doch der Kahn war nicht mehr da. Ebenso wenig der Kiosk und der Holzverschlag mit der kleinen Tischlerei, in der Dyer gelernt hatte, aus einer Sperrholzplatte eine Form auszusägen, die nahezu als Maschinengewehr durchgehen konnte. Dyer müsste nur den Blick zu der runden Gents-Uhr, die aussah wie eine kalte Wintersonne und deren Zeiger auf 4.03 Uhr standen, an der Mauer von »Slimy« Prentice’ Büro heben, und sein elfjähriges Selbst hätte augenblicklich gewusst, wo er war. Die Uhr und die Sprunggrube.
Irritiert sah Dyer, dass ein anderer Vater auf dem Platz saß, wo er seit Anfang Februar auf Leandro wartete. Ein großer übergewichtiger Mann Ende dreißig, vornübergebeugt, blasses braunes Gesicht, Brille, spärlicher Bart und dichtes ungekämmtes dunkles Haar, der einen langen offenen Mantel trug. Dyer kannte ihn nicht, aber er erkannte den kamelbraunen Mantel: genau das, was er selbst gern getragen hätte in diesem Klima, in dem ihn die Kälte immer noch überraschte. Dyer hatte ihn zwei Wochen zuvor während des Spiels gegen Summerfields aus der Ferne um den Mantel beneidet – ihm kam ein vages Bild des Trägers ins Gedächtnis, der plötzlich ein Notizbuch hervorzog und es wieder wegsteckte, nachdem er rasch etwas notiert hatte. Als Dyer das nächste Mal über das Spielfeld geblickt hatte, war der Mantel nicht mehr da gewesen.
Der Mann sah ihn nicht. Er saß da, die Knie gespreizt, die Füße in der Sandgrube, in der Dyer in Leandros Alter an einem sonnigen Tag mit einer Lupe gehockt und seine Initialen in einen Tennisball gebrannt hatte, neigte sich vor und zeichnete mit dem Zeigefinger etwas in den Sand. Er betrachtete es, was immer es auch war, und murmelte mit erhobenem Finger vor sich hin.
»Sind Sie Samirs Vater?«, fragte Dyer.
Der Mann hielt in seiner Bewegung inne. Er hob den Kopf. Seine Miene spannte sich an, als er Dyer näherkommen sah.
Mit der Hand verwischte er rasch die Zeichen im Sand. »Ja, so ist es.«
»Wir sind uns noch nicht begegnet. John Dyer. Leandros Vater.« Er hielt ihm die Hand hin.
Beim zweiten Versuch schaffte es der Mann aufzustehen. Er stampfte mit den Füßen auf, einmal, zweimal, dreimal. Dann schaute er auf seine Hand, die mit feuchtem Sand bedeckt war, und wischte sie am Mantel ab, bevor er Dyers nahm.
»Rustum Marvar.«
Dyer blickte nach unten. »Ich habe Sie gestört.«
»Nein, nein, ich habe an etwas gearbeitet.«
Dyer reckte den Hals. »Etwas Interessantes?«
Bevor Dyer herausfinden konnte, was es gewesen war, verwischte Marvar mit dem Fuß die letzten Spuren.
»Nur ein Problem«, sagte er, setzte sich schwerfällig wieder und starrte über die verlassenen Spielfelder, die Arme verschränkt.
Dyer, noch immer stehend, sah auf diesen großen, ernsten, klobigen Mann mit dem zerzausten Haar.
»Haben Sie das Problem gelöst?«
Als würde er einen Wein auswählen, ließ Marvar sich Zeit mit seiner Antwort. »Fast«, sagte er. »Fast.«
Der ehemalige Reporter in Dyer erkannte die Anspannung in Marvars Antwort. Vor langer Zeit hatte er in Belém den gleichen beherrschten Tonfall in Colonel Rejas’ Stimme gehört. Den Tonfall von jemandem, der etwas Aufregendes mitteilen wollte, sich jedoch nicht traute – bis Dyer eine Möglichkeit fand, sein Vertrauen zu gewinnen. Nicht, dass Rejas’ Geständnis, das er daraufhin ablegte, Dyers Karriere förderlich gewesen wäre. Dyer fiel der wilde Blick einer Phoenix-Mutter ein, die ihn mit Fragen zu Südamerika in die Mangel genommen und nachgehakt hatte, was seine größte Story gewesen war, und er hatte ihr erklärt, dass es eine Geschichte sei, die er nicht veröffentlicht habe.
Dyer war es gewohnt, Leute einzuschätzen. Er begriff sofort, dass er und Marvar sich sympathisch waren. »Ich habe Sie nicht oft am Spielfeldrand gesehen«, sagte er und setzte sich neben ihn.
Die Bemerkung löste etwas in Marvar aus. Er schaute wieder auf den Sand, seine massige Gestalt zitterte in dem weiten Mantel. »Und ich habe mich über mich selbst geärgert.« Er schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. Er habe Samir wegen der Arbeit nicht so oft beim Fußballspielen zusehen können, wie er gern gewollt hätte. Obendrein habe er einen neuen Chef, einen schwierigen Mann. In der Arbeit sei viel los, weswegen er unmöglich habe wegkönnen. Sonst hätte er bemerkt, dass Samir schikaniert wurde. Er blickte zu Dyer, die sanften hellbraunen Augen vergrößert von den Gläsern einer runden Nickelbrille.
Marvar war aufgeregt, und Dyer spürte, dass es nicht allein die erlittenen Demütigungen seines Sohnes waren, die in ihm arbeiteten.
»Sie dürfen sich keine Vorwürfe machen«, sagte Dyer sachlich. »Ich habe es auch nicht bemerkt – und ich war da.«
Ob Marvar das tröstete, war nicht zu erkennen. Er sprach zwischen tiefen Atemzügen, als wäre er gelaufen. »Als Samir mir erzählt hat … was dieser Junge … Wassili Petroschenko … ihm angetan hat … und Ihrem Sohn. Da bin ich hergekommen. Auf der Stelle! Ich habe mit … Mr Tanner gesprochen … So heißt er doch? Und jetzt spricht er mit unseren Jungs und mit dem anderen … alle zusammen. Aber reicht das? Kriegt er dann keine Wutanfälle mehr? Dieser Junge gehört zu einem klinischen Psychologen, nicht zu Mr Tanner! Leute, die andere schikanieren, haben Probleme. Ich kenne diese Sorte – und Sie auch.« Er kehrte zu seinem ursprünglichen Groll auf sich selbst zurück. »Nein, nein, ich hätte da sein sollen. Das heißt, ich hätte aufmerksamer sein sollen. Aber ich werde bald mit Samir wegfahren, irgendwohin, wo es schön ist, vielleicht das nächste lange Wochenende, und ich werde es wiedergutmachen. Ich werde meine Nachlässigkeit wiedergutmachen.« Als würde er jemand anderem ein Versprechen geben.
Dyer überlegte, ob er fragen sollte, wo Samirs Mutter war, doch es schien klüger, es nicht zu tun. Vielleicht saß Marvar im selben Boot wie Dyer. Die Menschen in Rio hatten nicht mit der Wimper gezuckt, doch in Oxford fiel Nissas Abwesenheit auf. Ältere Leute reagierten überrascht, wenn sie erfuhren, dass Leandros Mutter lebte, und sie zogen die Augenbrauen noch etwas höher, wenn sie herausfanden, dass sie außerdem mit jemand anderem Zwillinge bekommen hatte. Er spürte, dass sie ihn sofort neu einschätzten – mit Dyer konnte etwas nicht stimmen, wenn sie ihn verlassen hatte. Marvar war vielleicht ebenfalls ein alleinerziehender Vater mit einer turbulenten romantischen Vergangenheit.
Auf der niedrigen Mauer neben ihm erschauderte Marvar, neigte sich zurück und knöpfte seinen Mantel zu. Durch die kahlen Bäume funkelten die Lichter der Stadt. Er starrte sie an. Der Himmel war noch nicht ganz lichtlos. In der Ferne zogen dunkle Wolken vorbei.
»Zu meiner Zeit«, fühlte Dyer sich verpflichtet zu sagen, »kamen Eltern nie zu den Fußballspielen ihrer Kinder.«
Marvar wandte ihm das Gesicht zu. »Sie sind in diese Schule gegangen?«
»Ja, aber das ist eine Weile her.«
»Dann muss es Ihnen gefallen haben, sonst würden Sie Ihren Sohn nicht hierherschicken.«
»Gefallen?«, sagte Dyer. Er erinnerte sich. »Es ist etwas komplizierter als das.«
Gummisohlen klatschten auf Asphalt. Marvar schaute sich nervös um. Auf der anderen Seite des Zauns lief ein schwer atmender Jogger vorbei.
Marvar wandte sich wieder ihm zu. »Erklären Sie mir die Komplikationen. Nein, nein, es interessiert mich.« Er hob abwehrend die Hände. »Ich mache mir Sorgen um Samir … Es gibt so viel, womit er zurechtkommen muss.«
Bis jetzt hatte Dyer seine Motive, Leandro in die Phoenix zu schicken, für sich behalten. Marvars Miene – eine Mischung aus Zorn, Aufregung, Angst, Selbstbeherrschung – veranlasste ihn, sich zu öffnen.
2. Kapitel
Dyer war um vier Uhr an diesem erfrischend kalten Februarnachmittag stocksauer vor dem Tor der Schule eingetroffen. Seit siebzehn Monaten war er wieder in England. Seine Nachforschungen hatten in eine Sackgasse geführt. Das Wetter in Oxford, die Gespräche mit anderen Eltern bedrückten ihn.
Und jetzt war auch noch sein Sohn gemobbt worden.
Er dachte an Brasilien; die Hitze, die silberne Fläche des Ozeans, seine Jahre als Auslandskorrespondent …
Als Journalist musste man mit allen zurechtkommen, mit dem Terroristen und mit dem Polizisten, der ihn jagt. Aber diese wohlhabenden Leute aus der Mittelklasse, die bei weitem keine Idioten waren, verstand Dyer überraschenderweise nicht. Sie sprachen seine Sprache. Viele von ihnen hatten den gleichen Hintergrund und Bildungsweg wie er: Früher wären sie seine Leser gewesen. Doch ihre Ansichten über die Welt bestürzten ihn.
Seinem Sohn zuliebe hatte Dyer seinen Impuls unterdrückt, zu urteilen und zu flüchten. Dieses eine Mal versuchte er, es unkompliziert zu halten; mitzuspielen, hart zu arbeiten, ein engagierter Phoenix-Vater zu werden. Er schloss sein inneres Auge und knebelte seinen natürlichen Hang, auszusprechen, was er dachte.
Dyer sagte sich, dass er so reagierte, weil er älter und relativ spät Vater geworden war. Und er stammte aus Oxford – es hätte ihn überrascht, wenn auch nur die Hälfte der anderen Eltern einen britischen Pass besessen hätte –, das war zu »seiner Zeit«, wie er es nur ungern nannte, noch ganz anders gewesen; die andere Hälfte war zwar jünger als er, hatte aber wesentlich bessere Positionen und war wesentlich bessergestellt als er. Sie arbeiteten in London, im Fernen Osten, Asien, Afrika, für global agierende Firmen und Regierungen. Sie jetteten von den runden Ecken der Welt hierher, von Orten, von denen Dyer im Alter seines Sohnes lediglich dank seiner Briefmarkensammlung gehört hatte. Ein oder zwei hatten sogar Leibwächter.
An diesem Nachmittag war er bis um halb vier in der Taylorian Bibliothek gewesen. Bevor er sie verließ, bestellte er ein Buch über Portugals zufällige Entdeckung Brasiliens im Jahr 1500. Dann checkte er aus Gewohnheit noch die BBC-Nachrichten auf seinem Laptop.
Das große Drama des Augenblicks, das einen UN-Bericht zur Erderwärmung auf den zweiten Platz verdrängte, war eine Rede des neuen Amtsinhabers im Weißen Haus. Der amerikanische Präsident hatte es zu seiner Mission gemacht, eine nach der anderen jede Übereinkunft zu kündigen, die sein Vorgänger ausgehandelt hatte. Sein jüngstes Ziel: das über vier Jahre alte Atomabkommen mit dem Iran. Seine schrillen Anschuldigungen, dass der Iran sich nicht an die internationale Vereinbarung halte, hatte die Regierung in Teheran so verärgert, dass sie drohte, ihr Atomprogramm neu aufzulegen. Für diesen Fall versprach Israel Vergeltung zu üben, ebenso Saudi-Arabien.
Dyer spulte zurück zu dem Angebot, das ihm sein Chefredakteur zwei Jahrzehnte zuvor gemacht hatte: »Sie sind der Doyen der Lateinamerika-Korrespondenten – jeder weiß das. Aber die Buchhalter haben verfügt: Schließt Lateinamerika. Punkt. Sie können entweder Moskau haben oder den Mittleren Osten. Was soll’s sein?« Nachdem er eine Woche gezögert hatte, entschied sich Dyer weder für das eine noch das andere: Südamerika war die Quelle seiner Geschichten, die Welt, die ihm am Herzen lag.
Doch manchmal bedauert man seine Entscheidungen. In Momenten innerer Unruhe fragte sich Dyer unwillkürlich, was für ein Leben er geführt hätte. Vielleicht war es noch nicht zu spät, Leandro aus der Phoenix zu nehmen und mit ihm nach Teheran zu gehen, dachte Dyer wehmütig, als er merkte, dass er an der Bardwell Road vorbeigegangen war.
Er bog rechts in die Linton Road, wich einem Riss im Asphalt aus und ging rasch zur Schule.
An der Ecke wartete er neben einem altmodischen roten Briefkasten, bis ein großer schwarzer Lexus vom Bordstein weggefahren war. Als Junge hatte Dyer in dem Haus in seinem Rücken gewohnt, Ziegel und Gips, von der Farbe von Fieberbläschen und Wundpflaster. An wie vielen Sonntagmorgen hatte er rittlings auf diesem schiefen edwardianischen Briefkasten gesessen und darauf gewartet, dass die Singer Gazelle seiner Eltern heranrumpelte? Öfter als er zählen konnte.
Die genervt um sich blickende Mutter am Steuer des Lexus stieg aus, um ihrer Tochter mit dem Cello zu helfen. Kaum hatte sich das Auto vom Bordstein entfernt, überquerte Dyer die Straße.
Als die Zeitung das Büro in Rio schloss, war er geblieben, um sein Buch über die Kultur- und Sozialgeschichte des Amazonasbeckens fertig zu schreiben. Zu einem exorbitanten Preis von der Oxford University Press veröffentlicht, wurde es vom TLS und ein, zwei anderen anthropologischen Vierteljahresschriften wohlwollend zur Kenntnis genommen und wieder vergessen. Dyer war damit beschäftigt, Däumchen zu drehen, als seine Tante Vivien aus Lima anrief und ihn bat, eine Freundin von ihr zu besuchen, die in Rio für eine Kinderhilfsorganisation arbeitete.
Dyer konnte seiner Tante nichts abschlagen, einer einstigen Primaballerina, verheiratet mit einem pensionierten peruanischen Diplomaten, die das letzte Viertel ihres Lebens der Verbesserung der Lebensumstände von Straßenkindern in Lima gewidmet hatte. Das Ende vom Lied war, dass Dyer Viviens Freundin traf, nach einer Weile einen Job bei Ibeji annahm und in einer Favela arbeitete, die sich in einer smaragdgrünen Spalte unter den ausgebreiteten Armen der Christusstatue befand.
Er hatte Affären. Seine Tante war der Ansicht, dass er nach Astrud jemanden brauchte, der »viel runder« war. Dyer nahm seine Freundinnen mit nach Lima, damit Vivien sie bei selbst gebackenen Ingwerkeksen durchleuchten konnte. Doch Nissa stellte er ihr aus irgendeinem Grund nicht vor.
Sie hatten sich bei einer Party im »Museum von morgen« in der Guanabara-Bucht kennengelernt. Ihr verhangener Blick. Das Timbre ihrer Stimme. Nissa konnte einen Satz auf Brasilianisch beginnen und auf Französisch oder Englisch beenden und in allen drei Sprachen flirten. Zu allem bereit nahm Dyer sie mit zu sich nach Hause, als sie sich bei einer Fotoausstellung über die Sendero-Jahre erneut über den Weg gelaufen waren. Innerhalb eines Monats lebten sie in seiner Wohnung in der Nähe des Strands von Ipanema zusammen.
Fünfzehn Monate später kam Leandro auf die Welt. Nach dem, was mit Astrud passiert war, hatte Dyer sich gewappnet und geweigert, auf ein Wunder zu hoffen, bis sich zuerst ein Auge zitternd öffnete, dann das andere, und ihn zwei abgrundtiefe mitternachtsblaue Pupillen zum ersten Mal anschauten, einen schluchzenden Mann mittleren Alters.
Doch Leandros Geburt erfüllte Nissa nicht.
Wenn es sie nicht betraf, hatte Nissa eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Ein Baby war ein Konkurrent. Leandro war vier, als sie Dyer für einen englischen Anwalt, Nigel Trenchpain, verließ.
Dyers Verzweiflung war transparent, farblos.
»Ich dachte, sie sei anders«, sagte er zu Vivien.
»Das ist kaum jemand, mein Lieber.«
»Oh, Vivien«, sagte er. »Oh, Vivien.«
»Ist schon okay«, sagte sie und hielt seinen Kopf. »Ist schon okay.«
Nach einem kurzen und unerwartet einfachen Gerangel bekam er das Sorgerecht für seinen Sohn.
Leandro hatte das tiefe Lachen und die Mameluckenaugen seiner Mutter, wie antikes Glas, und die beunruhigende Hartnäckigkeit seines Vaters. Nachdem er das journalistische Dilemma rasch gelöst hatte, kam Dyers starrsinniger Zug zum Einsatz, mit dem er sich seine Unabhängigkeit bewahrte. Die BBC und der Economist boten ihm Korrespondentenstellen an, doch er lehnte ab. Dyers Leben konzentrierte sich auf seinen Sohn.
Seine Tage wurden freier, als Leandro in die Vorschule ging. Während hysterische Präsidenten mit Amtsenthebungsverfahren konfrontiert waren, verbrachte Dyer seine Vormittage damit, reichen Leuten Englischunterricht zu geben, und seine Nachmittage, Klebstoff schnüffelnden Waisen das Lesen und Schreiben beizubringen.
Zu welchem Zeitpunkt dämmerte es Dyer, dass Gott zwar einst Brasilianer gewesen sein mochte – wie Dyer bei seiner Ankunft in Rio fünfundzwanzig Jahre zuvor geglaubt hatte –, inzwischen aber die Nationalität gewechselt hatte? Es war eine Anhäufung einzelner Vorfälle, nicht eine plötzliche Erkenntnis, und sie schlich sich bei ihm ein wie die Idee für sein nächstes Buch. Unter den Art-déco-Armen von Christus dem Erlöser wurde in Dyers Favela jede zweite Woche ein Straßenkind umgebracht. Drogen und Klappmesser wurden in zwei Ranzen in Leandros neuer Schule gefunden. Sogar die Strände hatten angefangen zu stinken.
Rio. Es war wahr geworden für ihn. Eine großartige Stadt – eine große Einsamkeit.
Bei einem kalten und plötzlich geschmacklosen Bier in seiner Stammkneipe in der Joaquim Nabuco überkam Dyer unerwartet das dunkle Gefühl, dass er Leandro aus Brasilien herausschaffen musste, bevor sein Sohn oder er selbst ein Messer in den Bauch bekamen. In den fünf Jahren, seitdem Nissa ihn verlassen hatte, war kein Platz mehr für Leandro in ihrem neuen Leben gewesen, deswegen war es Dyer, der handeln musste.
Zum Glück hatte Dyer für schlechte Tage etwas zurückgelegt, und davon gab es trostlos viele in Oxford. Mit dem, was von der Abfindungssumme von der Zeitung noch übrig war, einem kleinen Erbe von seinem Vater und einem größeren unerwarteten Erbe von Vivien würde er seinem Sohn die Ausbildung ermöglichen können, wie er sie selbst durchlaufen hatte.
Mit Ende fünfzig besaß Dyer keine Immobilie, die er hätte vererben können, doch er konnte seinem einzigen Kind den unanfechtbaren Kickstart einer britischen Mittelklasseschulbildung geben – was alles war, das England dieser Tage noch zu bieten hatte, wie ihn Vivien bei einem ihrer letzten Telefongespräche erinnerte; sie starb mit achtundachtzig in ihrem Bett zu Hause auf der Klippe in Barranco, eine lodernde Fackel bis zu dem Morgen, an dem sie ihren letzten Atemzug tat. »Warum gehst du mit Leandro nicht nach Oxford?«, lautete ihre Frage, die sich Dyer in einem Augenblick bierseliger Verzweiflung ebenfalls stellte. Sowohl Vivien als auch seine Mutter, Viviens ältere Schwester, waren in die Phoenix gegangen, und die Erinnerungen an ihre Schulzeit waren ungewöhnlich positiv. Nach Oxford zu gehen wäre eine gute Entscheidung, sagte Vivien. Und er könnte dort für sein nächstes Buch recherchieren. »Und denk an das Fliegenfischen – ständig nörgelst du, dass es in Brasilien keine Kreidebäche gibt.«
Einmal ausgesprochen, war die Idee nicht mehr loszuwerden, ließ sich nicht mehr zurück in die Flasche drängen. Nigel war absolut dafür. Er kam aus Summerfields, dachte sogar daran, die Zwillinge … Nissa renovierte den Wochenendbungalow in Búzios und war zu abgelenkt, um sich Sorgen zu machen, weil ihr Sohn so weit wegziehen sollte. »Solange du mir jedes halbe Jahr schreibst, wie er sich macht. Früher habe ich es geliebt, wenn ein Brief von dir kam.« Sie hatte neulich ein Bündel Briefe von ihm gefunden, in einem großen Umschlag, auf dem »João« stand. »Ich habe die krakelige Handschrift gesehen und sofort gewusst, warum wir nicht mehr zusammen sind.« Aber sie habe sich über den Fund gefreut, sie wolle diese Briefe nicht missen, sagte sie.
Eine Woche nachdem Brasilien 7 zu 1 gegen Deutschland verloren hatte, buchte Dyer zwei Flüge nach London. Anfang September fand er ein kleines Haus zur Miete in Jericho hinter der Kirche St. Barnabas, das auf eine stillgelegte kleine Werft und den Kanal hinausging, und brachte Leandro nach Oxford. Als er ihre vier Koffer ins Haus trug und an das ruhige Leben dachte, für das er sich mit diesem Umzug entschieden hatte, war seine größte Sorge, dass er sich langweilen könnte.
Oxford war kein Ort zum Barfußlaufen. Die langen breiten unfreundlichen Straßen, der kalte Wind, der um seine Knöchel pfiff, das Essen, das wie die aufgewärmten Mahlzeiten seiner Tante schmeckte, die Sprache. »Daddy, was ist ein Busen?«, fragte Leandro zwei Wochen später in der Hoffnung, eine Reaktion zu provozieren. Verglichen mit Rio gab es nicht viel Einladendes für Dyers Augen oder Hände.
Das Tempo der Stadt war gehetzt. Die Leute gingen oder radelten zu Vorlesungen, zu Abendessen, die pünktlich mit einem lateinischen Gebet begannen. Nur Touristen oder Studienabbrecher oder Leute, die sich verlaufen hatten, trödelten. Dyer kam sich nahezu vom ersten Tag an vor, als hätte er sich verlaufen.
Sich anzupassen fiel ihm seltsamerweise schwerer als Leandro, den er mit vielversprechenden Aussichten nach England gelockt hatte. Sie würden sich einen Hund zulegen, er würde mit Leandro zum Fliegenfischen gehen, sie würden in einem Backsteinhaus wohnen. Und Leandro würde die Familientradition fortführen und in die Phoenix gehen.
Nur dass sich sowohl die Schule als auch Dyer verändert hatten. Er war ein anderer Mensch, sein Körper war stämmiger, seine Augen waren weniger blau, in seinem sich lichtenden braunen Haar waren weiße Strähnen, und seine Ideale waren angeschlagen; doch auf andere Weise war er unverändert. Jedes Mal, wenn er durch die neue Sicherheitstür ging, hatte er das Gefühl, er würde doppelt sehen, als klemmte die Instamatic seiner Kindheit und klickte immerzu auf dasselbe Negativ. Im Alter seines Sohnes hatte Dyer geglaubt, dass er zahllose Chancen hatte, so viele Versuche, wie er wollte – wie Leandros Digitalkamera, die ihm Nissa zum Abschied geschenkt hatte. Nach der Rückkehr nach Oxford hatte Dyer das Gefühl, seine Konturen verloren zu haben; er sah den Weg vor sich nicht, die Windschutzscheibe voller Reflexionen des Krimskrams auf dem Armaturenbrett, des Mülls aus dem Exil, der Heimkehr. Er kam sich vor, als wäre er auf einer anderen Straße, als befände sich das Lenkrad auf der linken Seite wie bei dem »kontinentalen« grünen Käfer, den er gebraucht in einer Werkstatt in Cassington gekauft hatte, weil er ihn an Brasilien erinnerte.
An diesem sibirischen Nachmittag flogen am reglosen grauen Himmel fünf Zugvögel über ihm nach Westen. Dyer tippte den Code ein und stieß die Tür auf, blickte hinauf zur Uhr. Mr Tanner hatte darum gebeten, Leandro und Wassili um sechzehn Uhr zu sehen.
3. Kapitel
Das Mobbing hatte in diesem Schuljahr angefangen, nachdem Leandro zwei Jahre vorzeitig in die Fußballmannschaft der Schule katapultiert worden war. Der neue Trainer hatte Dyer am Vorabend der Ankündigung angerufen und erklärt, dass er »die Dinge neu strukturieren« wollte. In seinen Augen war Leandro reif genug, um den Sprung zu machen; außerdem wäre er nicht der Einzige – Samir Marvar, ein weiterer talentierter Spieler aus Leandros Jahrgang, würde ebenfalls zur Mannschaft stoßen. (»Er ist eine Legende«, sagte Leandro. »Er kann den Ball vierundfünfzig Mal mit der Fußspitze kicken.«)
»Ich sollte es nicht sagen«, fuhr der Trainer fort, »aber die beiden haben das Zeug, es in die Auswahl aller Oxford-Schulen zu schaffen.« Er lachte, als Dyer erwiderte, er selbst habe es nicht weiter als bis in die zweite Kricketelf gebracht. »Der größte Kick für einen Vater ist es zu sehen, wie sein Sohn ihn übertrifft.«
Später meinte Dyer, einen Tritt dafür zu verdienen, dass er nicht sofort etwas gegen Wassili Petroschenko unternommen hatte.
Wassili fiel auf – ein schlaksiger russischer Junge im letzten Schuljahr, mit blondem, nahezu weißem Haar und rot geränderten grauen Augen. Groß für sein Alter – er war dreizehn – und irritierend selbstbewusst, hatte er in Umlauf gebracht, dass er ein sicherer Kandidat für den Posten des Mannschaftskapitäns war, da er in der letzten Spielzeit zwei Spiele für sie absolviert hatte. Zu sehen, dass sein Name auf der Liste für die zweite Elf beim Spiel gegen Summerfields stand, war ein demütigender Schock für ihn gewesen, auf den er schlecht vorbereitet war, und Wassili gab nicht sich selbst oder dem Trainer die Schuld, sondern denjenigen, die seinen Platz eingenommen hatten. Als Wassili die Mannschaftsaufstellung sah, las er anstelle seines Namens »Dyer, L« und »Marvar, S«.
Einzeln betrachtet, waren es unbedeutende Vorfälle. Wäre man sie einen nach dem anderen angegangen, wären Wassilis Wutanfälle zu managen gewesen. Da aber alle sie ignorierten, wurde eine abträgliche Beziehung normalisiert; und Dyer hatte zu seiner Schande dazu beigetragen, weil er seinem Sohn nicht geholfen hatte.
Nachdem er entdeckt hatte, dass er durch einen elfjährigen Jungen ersetzt wurde, ging Wassili mit Leandro auf den Schulhof und forderte von ihm, dass er vor den anderen auf den Fahnenmast kletterte. Nein, weigerte sich Leandro und wurde rot, das sei verboten, er bekomme Ärger mit den Lehrern. Aber Wassili drohte. Es sei eine Phoenix-Tradition, jeder, der zwei Jahre zu früh in die erste Elf komme, müsse auf den Mast klettern. Wenn Leandro es nicht täte, würde ihn die Mannschaft ins Klo sperren und ausziehen.
Als das Unvermeidliche passierte und Leandro auf den Asphalt stürzte und sich das Knie aufschürfte, kam ein Lehrer angelaufen und wollte wissen, was er sich dabei bloß gedacht habe.
Wassili stand daneben und blinzelte mit seinen grauen Augen. Leandro, dem das Blut vom Knie tropfte, schwieg.
Auf den gescheiterten Versuch, den Fahnenmast zu erklimmen, folgte ein Besuch bei der Schulschwester, und Leandro bekam sein erstes Minus.
Dyer machte keine Affäre daraus. Es war ein einzelner Vorfall. Allergisch gegen jede Art von Schikane empörte er sich um Leandros willen, doch er entschuldigte Wassilis Groll. Jungs sind Jungs. Leandro musste lernen, so etwas durchzustehen. Niemand war härter als die Jungs am Strand, an dem Leandro Fußballspielen gelernt hatte. Sein Sohn würde stärker daraus hervorgehen. Es hatte nichts mit Wassilis Mutter zu tun.
Leandro behielt für sich, was tatsächlich vor sich ging: Was Dyer als Ausrutscher interpretierte, war in Wahrheit der Anfang einer konzertierten Aktion einer von Wassili angeführten Gruppe, Leandros Selbstwertgefühl zu zerstören.
Leandros Geschichtslehrerin war es, die Dyer auf den Plan rief. Sie wandte sich plötzlich an ihn und sagte: »Ist mit Leandro alles in Ordnung?«
»Er hatte Ohrenschmerzen.«
»Nein, nein, das meine ich nicht.«
Dyer blickte sie rasch an. »Was dann?«
»Er scheint im Augenblick nicht gerade glücklich. Er ist sehr zurückhaltend. Am Anfang war er aufgeschlossener, und er ist kein schüchternes Kind.«
Leandros Leistungen hatten etwas nachgelassen. Während der Auslese zu Beginn des zweiten Jahres war er eine Klasse zurückgestuft worden. Er war überaus geschickt mit den Beinen, verfügte über eine rasche Auffassungsgabe, hatte jedoch Mühe mit Wordsworth und den Napoleonischen Kriegen. Dyer fragte sich, ob sein Unbehagen daher rührte.
»Leandro, gibt es irgendetwas, wobei ich dir helfen könnte?«
»Nein.«
»Bist du sicher?«
Schweigen.
Sein Sohn war zwar fleißig, aber auch launisch. Ihm war Dyers Neigung zur Verdrossenheit eigen, die zutage trat, wenn er Hunger hatte oder müde war oder eine Frage beantworten sollte, die ihm nicht passte.
»Leandro?«
»Dad … », sagte er warnend.
Es beunruhigte Dyer nicht nur, dass Leandro bestimmte Charakterzüge mit ihm gemein hatte, es machte ihn auch blind. Er schrieb das Verhalten seines Sohnes den langen Tagen in der Schule zu, Leandros Grippe, die ihm eine schmerzhafte Mittelohrentzündung eingebracht hatte, und seiner eigenen Malaise angesichts des winterlichen Winds, der an den Fenstern rüttelte, den kalten düsteren Nachmittagen – ein Wetter zum Lesen und Notizenmachen und sonst nichts.
Dyer begriff erst, was vor sich ging, als er eines Tages seinen Sohn abholte, sein Blick unwillkürlich auf der Suche nach Katja über den Schulhof schweifte und er einen gebeutelten Jungen auf sich zuwanken sah. Zuerst erkannte er ihn nicht, dann registrierte er die verwaschene Schuluniform. Dem Beispiel seiner Eltern folgend, hatte er sie gebraucht gekauft in einem Raum hinter dem Schulgebäude, der unregelmäßig geöffnet hatte und Personal einsetzte, das sich anerbot, die besten Sachen herauszusuchen. Als Dyer dort auftauchte, gab es nur noch ein paar übrig gebliebene Einzelstücke. Fast alle neuen Schüler trugen makellosen dunkelblauen Cordsamt; Leandros war verwaschen, gräulich wie der Februarhimmel.
»Leandro!«
Er biss sich auf die Lippe, seine Augen glänzten. Hinter ihm kickte eine Gruppe übertrieben konzentriert einen Fußball. Ein großer, hellhaariger Junge, der ihr Anführer zu sein schien, wandte sich Dyer zu und lächelte ihn an. Es war ein wissendes höhnisches Lächeln, das eine bösartige Energie verströmte und Dyer in die Favelas zurückversetzte.
Leandros Nase lief noch immer, als sie zu Hause ankamen. Es entsprach nicht seinem Wesen zu petzen, aber tropfenweise und in halben Sätzen spuckte er aus, was unmittelbar vor Dyers Ankunft passiert war. Wie die anderen Jungs Wassili angeschaut und gefragt hatten: »Darf Leandro mitspielen?« Wie Wassili sofort selbstzufrieden gesagt hatte: »Heute nicht, tut mir leid. Du bist scheiße beim Fußball. Komm wieder, wenn du es draufhast.«
An diesem Abend saßen sie lange zusammen. Niemand konnte es mit Dyer aufnehmen, wenn es darum ging, jemandem Informationen zu entlocken. Auf Leandros erste Geschichte folgte eine zweite. Und noch eine. Bis Dyer seinen Sohn als Gefangenen der Tupi-Indios vor sich sah, wie er klaglos die Bestrafung, die sie für ihre schlimmsten Feinde vorbehielten, über sich ergehen ließ, um den Hals eine pulsierende Kette giftiger Kröten, die begonnen hatten zu schrumpfen.
Dyer erfuhr, wie Wassili versucht hatte, Leandro im Schwimmbecken zu ertränken. »Er hat meinen Kopf unter Wasser gehalten und nicht mehr losgelassen. Seine Mutter hat direkt vor uns gesessen und es für einen Spaß gehalten.« Wie er, als Leandro zum Training kam und über das Absperrseil neben dem Spielfeld stieg, »es zwischen meinen Beinen nach oben gerissen hat«. Wie er seine Bosheit auf neue Höhen getrieben, Leandro zehn Minuten vor Trainingsbeginn der ersten Elf in einen Garderobenschrank gesperrt und auf beiden Seiten gegen den Schrank getrommelt hatte, bis es Zeit war zu gehen. »Du hast mich wegen meiner Ohren zum Arzt gebracht, und ich hatte wirklich höllische Schmerzen.«
Leandro war nicht Wassilis einziges Opfer. »Er quält auch Samir.« In seinem von Eifersucht angefachten Zorn musste Wassili nur sehen, wie Samir mit den Zehen kickte, um zu ihm zu marschieren und den Ball so weit wie möglich wegzuschießen. Zudem hatte er in einer Chat-Gruppe angedeutet und spekuliert, ob Leandro und Samir vielleicht schwul seien.
Dyer bedauerte zutiefst, dass er Wassilis Verhalten heruntergespielt hatte. Schuldgefühle überwältigten ihn, weil er seinen Sohn nicht beschützt hatte. Da Leandros Mutter neuntausend Kilometer entfernt lebte und kein mütterliches Interesse an ihm zeigte, war es erneut an Dyer, etwas zu unternehmen, auch wenn Leandro dagegen war. »Bitte, bitte nicht.« Aber auch das gehörte zur Schikane, dachte Dyer.
Zwischen Erkenntnis und Aktion lag Dyer mit geschlossenen Augen wach. Der Geruch, mit dem sie die Luft erfüllte. Wie Weizen. »Aber du hast keine Wahl, mein Lieber«, hörte er seine Tante wie in einem alten rauschenden Radio sagen. In den Favelas waren es die ganz Brutalen, die neutralisiert werden mussten.
Am Morgen rief Dyer in der Schule an und wurde zu Mr Tanner durchgestellt, dem Schülerbetreuer, der im Verfechten von Regeln einen schwarzen Gürtel besaß. Er reagierte supereffizient. »Ich möchte, dass Sie das alles aufschreiben.«
»Es hat einen Punkt erreicht«, fügte Dyer hinzu, »an dem etwas unternommen werden muss.«
»Und das wird es«, sagte Mr Tanner, ein jungenhafter Mann und guter Rugbyspieler. »Und das wird es.«
Schikane, erinnerte er Dyer überflüssigerweise, habe in der Phoenix absolut keinen Platz. Er kenne den »jungen Wassili« und betrachte ihn als »unerzogen«, und das in einem Tonfall, der »eingebildetes kleines Arschloch« nahe legte. Die Schnelligkeit, mit der Mr Tanner auf Dyers E-Mail reagierte, ließ darauf schließen, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelte, was er bei einem weiteren Telefongespräch bestätigte, als er einen anderen Jungen erwähnte, dessen Vater Beschwerde eingereicht hatte. Dyer vermutete, dass er sich auf Samir Marvar bezog.
»Ich möchte Folgendes vorschlagen«, sagte Mr Tanner. »Ich will die Jungs zusammenbringen, damit sie darüber sprechen, aber zuerst werde ich mich mit Wassili und seinen Eltern treffen.«
Die Straßenbeleuchtung ging an. Dyer schloss das Tor hinter sich, blieb einen langen Augenblick stehen und schaute zurück auf die Bardwell Road. Das war der Anfang, das war das Tor, von wo aus er aufgebrochen war, das Portal zur Welt jenseits davon. Er hatte gehofft, dass er dort draußen die Begeisterung und Erfüllung finden würde, die er sich für sich vorstellte, wenn er die Artus-Sage oder die Schatzinsel oder Grünmantel las. Er würde seiner Guinevere begegnen. Im richtigen Leben würde sie seine Schulter berühren. Du. Endlich.
Er drehte sich um – und da sah er Wassilis Eltern.
4. Kapitel
Ein Großteil von Dyers Schuldgefühlen hatte damit zu tun, dass er nicht Wassili, sondern Wassilis Mutter im Blick gehabt hatte. Die meisten russischen Mütter lebten in Moskau oder St. Petersburg und kamen einmal im Schulhalbjahr nach Oxford; Katja Petroschenko dagegen wohnte während des Schuljahrs in einer bewachten Wohnanlage gegenüber der Jamaica Road. Wenig war über sie bekannt. Die Geschichte, die über sie in Umlauf war, besagte, dass sie eine ehemalige Schönheitskönigin von Murmansk war und die englische Sprache auf idiosynkratische Weise beherrschte. »Was verflucht is Klopause?«, war ein Satz, der ihr zugeschrieben wurde.
Dyer hatte Katja im letzten Herbst kennengelernt. Er stand vor dem Rink, als er eine leichte Berührung spürte. Er drehte sich um und sah eine schöne Frau. So groß wie er, schlank. Das glatte blonde Haar zusammengebunden. Sie schien Dyer wiederzuerkennen.
»Sind Sie Leandros Vater?« Ihre Stimme tief, aber feminin.
Dyer lächelte.
Sie trug flache Schuhe und kein Make-up. Ihr Gesicht sah aus, als wäre es in einem kalten Fluss gewaschen. Sie hatte hohe Wangenknochen und einen leichten Pfirsichflaum auf der Oberlippe.
»Katja Petroschenko«, sagte sie. »Mein Sohn Wassili ist in Block A.«
Er blickte ihr ohne große Neugier in die Augen. Nach Nissa widerstand er schönen Gesichtern. Ihre Augen waren so grau wie die eines arktischen Wolfes. Sie wirkten wie Augen, die im Dunkeln gut sehen können.
Katja lobte Leandros Laufleistungen beim Sportfest im Juli.
Er merkte, wie er sich sofort entspannte. Einen Sohn zu haben, der schnell lief – das verlieh ihm eine Gesetztheit, auf die er stolz sein konnte.
Während ihrer zehnminütigen Unterhaltung sprachen sie über Leandro, der jeden Morgen am Strand von Ipanema gejoggt war; über Wassili, ebenfalls ein schneller Läufer und begeisterter Fußballspieler – »Er hofft, im nächsten Schuljahr Kapitän der Schulmannschaft zu werden« –, über Katjas abwesenden Mann Gennadi, ukrainischer Manager einer Ölfirma. Als sie seinen Job erklärte, wurde Dyer klar, dass er Gennadi bereits kennengelernt hatte – beim jährlichen Väterfrühstück des Direktors am Ufer des Cherwell; Dyer hatte ihn sich als erstaunlich kleinen Mann mit einem breiten schwarzen Schnurrbart und großen eckigen Zähnen gemerkt, der lange Strecken in der ersten Klasse flog und eine Sonnenbrille trug, obwohl es bedeckt war.
Was Katja betraf, hatte Dyer den Eindruck einer netten ausweichenden professionellen Frau, die wusste, dass sie aufgrund ihres guten Aussehens herausstach.
Die Zusammensetzung der Mannschaft war längst entschieden, als sie sich wiederbegegneten, zu Beginn des zweiten Halbjahrs im Februar. Katja schien übereifrig und lächelte, als sie Dyer in der Woodstock Road über den Weg lief. Zwei Tage hatte es geregnet; jetzt schien die Sonne. Sie war gut und teuer gekleidet. Perlengraue Jacke, brauner Kaschmirpullover. Ihr blauer Faltenrock war von der Farbe der Luftpostumschläge, die Dyer seinem Vater aus Brasilien geschickt hatte.
Er war erleichtert, dass sie das Thema Fußball nicht ansprach. Beide gingen in Richtung Schule, sie wollte mit ihm über die Phoenix sprechen. Katja schien fasziniert, als sie erfuhr, dass Dyer dort Schüler gewesen war.
Sie wirkte unbeschwert. »Entschuldigung, aber warum werden alle Lehrerinnen Ma genannt?«
Die Bräuche und Regeln der Schule verblüfften sie. Was war das, ein Minus? Was hieß »im Aus«? Und warum musste sie mit dem Taxi zu Boswell fahren, um ihrem Sohn ein Diabolo zu kaufen?
Sex. Der Ofen, der Dreck zu Gold schmilzt. Sie machte ihn mühelos schwindlig. Er spürte, wie er hart wurde, und versuchte, es zu vergessen, indem er jede ihrer Fragen gewissenhaft beantwortete.
Dyer wusste, wie es war, fremd zu sein. Getrieben von Pflichtgefühl und historischem Wissen entwirrte er für Katja die Ausdrücke und Traditionen, von denen der Ultraspin Diabolo nur ein weiterer Auswuchs war – und bereits von Gelstiften mit Apfelduft überholt wurde.
Wenn sie, während er sprach, auf seine Lippen schaute, als würde es ihr helfen, ihm zu folgen, kribbelten seine Lenden.
Sie gingen die Canterbury Road entlang, durch Park Town zur Phoenix, und Dyer erzählte ihr in seinem kontrazeptivsten Tonfall von Murmeln, Gummibällen, Kastanien (»Ich mag, wie Sie Kastanien sagen«), Modellbausätzen, Action-Man-Figuren, Stelzen, Flummis, Frisbees, Fidget Spinners – Trends, die Nachschub erforderten und Druck ausübten, von Ladenbesitzern zu kaufen, die genau wussten, wie man Phoenix-Mütter wie Katja mit der geeigneten Währung versorgte.
»Ich will da rüber«, sagte Dyer, als sie vor dem Schultor ankamen. Er deutete auf die Stelle, wo sich die erste Elf aufwärmte. Er konnte Leandro nicht ausmachen.
Sie sah ihn aus ihren grauen Augen an. »Danke«, mehr sagte sie nicht. Ihre Zähne waren so weiß wie Minzbonbons.
Dyer hatte die meiste Zeit geredet. Über Katja hatte er nichts erfahren, außer dass ihr Mann häufig nicht da war. Ihr Gesicht war hell, doch alles dahinter war ungewiss. Sein Blick hing hilflos an ihrer Oberlippe.
»Ich wohne gleich um die Ecke. Wollen Sie abends mal ins Bookbinders gehen?«
»Für ›eine Halbe Dunkles‹?« Sie sah ihn an.
»Oder auf einen Wodka, wenn Ihnen das lieber ist, in der Walton Street ist eine Cocktailbar.« Mit Absätzen wäre sie größer als er. In ihren flachen roten Schuhen konnte er ihr direkt in die Augen schauen.
»Mir wäre es lieber, englisches Bier zu probieren.«
»Dann auf ein Halbes, höchstens Anderthalbes. Während unsere Söhne ihre Hausaufgaben machen.«
Sie lächelte ihn zögernd, zurückhaltend an. Nicht das Lächeln einer freien Frau, sondern das breiter werdende Lächeln von jemandem, der frei sein wollte, vielleicht. »Na gut.«
Kalender wurden konsultiert, Telefonnummern ausgetauscht. Ein Plan wurde geschmiedet für den nächsten Dienstag, während ihr Sohn gegen einen Garderobenschrank trommelte, in dem Leandro eingesperrt war.
»… die Frauen entblößten ihre Geschlechtsteile in aller Unschuld und ohne Scham. Sie lachten und hatten großen Spaß.«
Er dachte an Katja am nächsten Tag in der Bibliothek, während er die Begegnung von Pedro Álvares Cabrals Matrosen mit den Tupi an der brasilianischen Küste transkribierte. Sie verdrehte die grauen Augen, um zu ihm aufzuschauen. Der dünne goldene Flaum auf ihrer Oberlippe. Sie war verheiratet, aber er phantasierte davon, mit ihr zu schlafen. Ihre Finger krallten sich ins Kopfkissen, er bestieg sie, der Walfischknochen ihres nackten Rückgrats, heisere Laute drangen aus seiner Kehle, aus ihrer.
Das war, bevor er Leandro abholte und sein Sohn weinend vom Tennisplatz auf ihn zulief. Und er herausfand, dass Katjas Sohn ihn mobbte.
Es gibt Dinge, die kann man jemandem nicht ins Gesicht sagen. Du bist ein Feigling. Du hast den falschen Weg eingeschlagen. Dein Sohn ist ein brutaler Kerl.
Katja rief an, nachdem Dyer die E-Mail an Mr Tanner geschickt hatte. Überhaupt nicht erfreut sagte sie: »Es klingt, als hätten unsere Jungs Probleme.«
»Ich weiß, sie werden sich aussprechen – mal sehen, wie sich die Sache entwickelt.«
Selbstverständlich hatte sie am Dienstag keine Zeit mehr, um sich mit Dyer im Bookbinders zu treffen. Ihr Mann kam aus Moskau, um mit Mr Tanner über die Angelegenheit zu reden. Er würde ein paar Tage in Oxford bleiben.
5. Kapitel
Als er neben Marvar auf der Mauer der Sprunggrube saß, erwähnte Dyer Wassilis Mutter nicht. Stattdessen sprach er von der Schwierigkeit, North Oxford Brasilien zu erklären, der Unsicherheit des Lebens in Rio, Viviens Erbe – gerade genug, um das Schulgeld zu zahlen; und dass Dyers Vater Leandro damals zur Taufe die Aufnahmegebühr geschenkt hatte, sonst wäre Leandro vielleicht nie angenommen worden.
»Hat sich die Schule sehr verändert?«, wollte Marvar wissen.
»Sie ist dieselbe und doch nicht dieselbe.«
»Was ist anders?«
Dyer dachte nach. »Wir sind im Fluss geschwommen. Es gab keine Security. Wir hatten keine Handys – wir haben einmal in der Woche nach Hause geschrieben.« Er lasse Leandro auch heute noch Dankesbriefe schreiben, sagte er. »Und sie war bei weitem nicht so international.«
Damals hatte sich Dyer ungewöhnlich sicher und mit seinen Mitschülern verbunden gefühlt, und weil seine Mutter und seine Tante die Schule absolviert hatten, meinte er, dass sie irgendwie vertrauenswürdig war. Doch nachdem seine Eltern gestorben waren und ihm keine Antworten mehr geben konnten, fand Dyer die Briefe, die er nach Hause geschrieben hatte, und staunte über eine Traurigkeit, die keine Worte fand, die langweiligen Aufzählungen von Filmtiteln und Sportergebnissen und die vielen Ich-hoffe-es-geht-euch-gut. Plötzlich hatte er Mitleid verspürt mit dem Jungen, der auf dem roten Briefkasten wartete, und an die Kriegswunden und imperialen Bestrebungen gedacht, die bedeuteten, dass seine Lehrer und Eltern immer nur ihr unzureichendes Bestes tun konnten … und er sich mit einem gewissen Anstand durchschlagen und mit Murmeln, Kastanien und modischen Spleens hatte zufriedengeben müssen.
»Was war mit dem Unterricht?«
»Es gab ein paar angemessene Werte«, sagte Dyer augenzwinkernd.
»Ja, aber was haben Sie wirklich gelernt? Was wurde Ihnen beigebracht, das Ihnen heute im Leben weiterhilft?«
Marvars Fragen hatten etwas Eigenartiges, das ihn veranlasste, mit Bedacht zu antworten. Es war, als wäre Marvar mit einem ähnlichen Problem konfrontiert und Dyer könnte ihm bei der Lösung helfen.
»Uns wurde beigebracht, dass jeder ein Talent hat«, sagte er, und ihm war sofort klar, wie banal es klang. »Es mag vor der Welt verborgen sein, aber man grabe tief genug – und man findet es.«
»Was ist Ihr Talent?«
»Oh, ich grabe noch.«
»Im Ernst?«
Dyer hatte mit niemand anderem in Oxford so gesprochen. Es war ernst gemeint, aber vielleicht war es nicht die ganze Wahrheit. Er fuhr mit einem kleinen Lächeln fort, wollte gehört werden und doch nicht wie sein alter Schuldirektor klingen, der etwas an den Mann zu bringen versuchte. »In meinem Fall war es wahrscheinlich mehr ein Instinkt als ein Talent. Ich habe gelernt, dass jede Tat eine Entscheidung zwischen Gut und Böse beinhaltet. Es geht darum, so gut wie möglich zu leben. Ich bin hier weggegangen mit dem Wunsch, jedes Mal, wenn ich vor einer Wahl stand, das Richtige zu tun – wenn es möglich war. Aber wollen wir das nicht alle?«
»Ich weiß es nicht, ist es so?«, sagte Marvar und stellte damit eine Gegenfrage, als hätte er Angst vor der Antwort. »Und jetzt, was lernen unsere Jungs jetzt?«
Dyers Antwort reifte seit siebzehn Monaten heran. Wie sich die Schule verändert hatte, faszinierte ihn. Als Vater eines Jungen dort – eines Schülers der dritten Generation – konnte er auf eine lange Zeit zurückblicken.
Das moderne Volk der Eltern von Phoenix-Schülern gehörte nach Dyers Ansicht zu einer mächtigen Loge, die das internationale Finanz- und Rechtswesen und die Politik bis in die tiefsten Ritzen infiltriert hatte. Diese Eltern kauften ausnahmslos alle Luxusmarken wie zum Beispiel Burberry. Trug man einen Burberry, war man sofort zehnmal mehr wert. Und was man damit tarnen konnte, war grenzenlos. In dieser Hinsicht hatte sich die Schule entgegen ihrem Ruf zu einem effizienten Waschsalon entwickelt. Sie lockte stillschweigend mit dem Köder, die eigene Herkunft – Schmutzflecken, die im Hintergrund und im Wohlstand lauerten – reinzuwaschen, um als umfirmierte mustergültige Exemplare der drei laut hinausposaunten Phoenix-Regeln wieder herauszukommen: »Sei rücksichtsvoll, sei rücksichtsvoll, sei rücksichtsvoll.« Die Leute wurden nie von heute auf morgen reich, ebenso wenig wie sie von heute auf morgen gut wurden. Nicht wenige Eltern aus dem Ausland, die, wie Balzac es nannte, »ohne offensichtlichen Grund ein großes Vermögen« besaßen, wuschen in der Phoenix ihre Kinder.
Zu Dyers Zeit waren die meisten Jungen und das Dutzend Mädchen nicht über die Midlands und erst recht nicht über Großbritannien hinausgekommen. Es waren die Söhne und Töchter der akademischen Mittelklasse, von Ärzten, Lehrern, Beamten, Diplomaten, Börsenmaklern, Anwälten. Eine kleine Schar verbrachte die Sommerferien in Frankreich. Aber »Ausland« war damals ein so fremdes Konzept für die Mehrheit wie moderne Vorstellungen von Reichtum es gewesen wären; es gehörte – anders als heute – noch nicht zum Einzugsgebiet.
»Mein Schulleiter hat Geographie unterrichtet«, erinnerte sich Dyer. »Der jetzige betritt nie ein Klassenzimmer.«
Mr Crotty bereiste fleißig den Globus, um Schüler aus genau den Ländern anzulocken, die einst, so hatte Dyer es gelernt, entweder Großbritanniens unverbrüchliche Feinde gewesen oder von Großbritannien besiegt worden waren. Dyer zählte sie auf. Deutschland, Russland, China, Japan, Italien, Frankreich, Holland, Spanien, Türkei, Argentinien, Indien …
»Und der Iran«, sagte Marvar und lächelte bedächtig. »Sie haben den Iran vergessen.«
Die Katze war aus dem Sack. »Sie sind aus dem Iran?« Beinahe hätte er hinzugefügt: von der Achse des Bösen.
Marvar machte eine Geste, stritt es nicht ab.
Dyer hatte vermutet, dass er aus Marokko oder dem Libanon war.
»Sie sagen, dass Summertown nichts über Brasilien weiß«, sagte Marvar und presste die Lippen aufeinander. »Versuchen Sie den Leuten mal zu erklären, dass Sie aus Teheran sind.«
Dyer richtete sich auf. Iran. Er hatte erst vor einer Stunde etwas über das Land gelesen. Es hätte ihn interessiert, mehr herauszufinden, doch Marvars Worte kamen stockend, sodass er ihm nur schwer folgen konnte.
Aus den wenigen Details, die Marvar preisgab, schloss er, dass er als Physiker im Clarendon-Labor arbeitete. Er war wie Dyer alleinerziehender Vater. Seine Exfrau lebte in Teheran, wo er studiert hatte. Dyer hörte die Sehnsucht in seiner Stimme, als er von Teheran sprach. Aber als Dyer sich nach der derzeitigen Situation dort erkundigte, wirkte Marvar unbeteiligt.
Er blickte ungeduldig zur Uhr hinauf.
»Zwanzig vor fünf. Sie lassen sich Zeit.« Er neigte sich vor und wischte ein paar Sandkörner von seinen Schuhen.
»Dann nehmen sie unsere Beschwerde ernst«, sagte Dyer.
»Sie folgen dem Protokoll. Sie nehmen es zu wörtlich. Ihnen ist nicht klar, dass es ein systembedingtes Problem ist. Es wird sich nicht ohne viel Arbeit lösen lassen.«
»Sie werden ihn im Auge behalten.«
Marvar schwieg. Er starrte auf den Sand, den er aufgewühlt hatte, als würde er noch immer an seinem Problem arbeiten.
Schließlich wandte er sich Dyer zu. »Gab es diese Schikane schon, als Sie hier zur Schule gegangen sind?«
»Himmel, ja.«
»Wurden Sie gemobbt?«
Dyer hatte bis zu dem Moment, als Marvar ihn danach fragte, nicht darüber nachgedacht und keine Antwort parat.
»Vermutlich.«
Er war sich bewusst, dass Marvar ihn mit seinen braunen Augen nervös taxierte. Wieder spürte er die Chemie zwischen ihnen; zwei alleinerziehende Väter, die an einem kalten Februarnachmittag auf einer Mauer nebeneinandersaßen und auf ihre Söhne warteten, die gemobbt worden waren, und sich fragten: Warum habe ich es nicht früher bemerkt?
Jetzt starrte Dyer auf die im Dunkeln liegenden Spielfelder. Das Fußballfeld war verschwunden, eine schwarze Fläche, getupft von ein paar orangefarbenen Lichtern.
Komisch, wie das Gedächtnis manche Dinge vergrub und andere im Scheinwerferlicht behielt. Er hatte geglaubt, dass er seine Kindheit hinter sich gelassen hätte, doch sie lauerte in der Dämmerung.
Es war gegen Ende seines zweiten Schuljahrs passiert. Damals waren nicht Diabolos und Gelstifte mit Apfelduft der letzte Schrei, sondern Modellflugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg – der noch nicht allzu lange zurücklag. Die Worte, die Dyer fand, um den Vorfall auszugraben, waren getränkt mit ätzenden Gerüchen nach Araldite-Klebstoff, Terpentin, Farben in winzigen Blechdosen.
Nachdem er quengelnd darauf bestanden hatte, erzählte er Marvar, schenkten ihm seine Eltern zu seinem elften Geburtstag einen Flugzeugbaukasten. In der Schachtel befanden sich drei Reihen grauer Bauteile aus Plastik, die herausgebrochen, penibel zusammengeklebt, dann mit der dazugehörigen Tarnfarbe gestrichen und mit Abzeichen versehen werden mussten, um deutlich zu machen, ob es ein Flugzeug der Alliierten oder der Achsenmächte war. Als er das letzte Abziehbild angeklebt hatte und dieses dreidimensionale Objekt, das er ganz allein zusammengebaut hatte, auf den Fingerspitzen balancierte, war Dyer erfüllt von dem großartigen Gefühl, etwas vollbracht zu haben. Er stellte das Flugzeug auf sein Briefmarkenalbum in den Schrank neben seinem Bett, holte es zuweilen heraus und ließ es in der Hand durch die Luft fliegen – und aus den Wolken auf einen nichts ahnenden imaginären Feind heruntersausen.
Eines Morgens öffnete er den Schrank, und das Flugzeug war verschwunden.
Nichts schien während der nächsten achtundvierzig Stunden leerer. Immer wieder schaute er nach. Verzweifelt fragte er bei den anderen Jungs in seinem Schlafsaal nach – Finnock, Garridge, Trundle, Stock, Croach – und stieß auf ausdrucksloses oder grinsendes Leugnen. Ein fehlendes Flugzeugmodell war eine zu belanglose Sache, um den Hausvorsteher damit zu behelligen, ein unnahbarer und geistesabwesender Mann, der in Singapur von den Japanern gefangen gehalten worden war. Dyers Eltern waren weit weg. Er versuchte sich in den Schlaf zu weinen, ohne einen Laut von sich zu geben.
Zwei Tage später stand er abends im Bad und putzte sich die Zähne, als ein Junge in einem rot karierten Bademantel hereinkam. Im Spiegel tauchte das sommersprossige, ziemlich blasse Gesicht von Rougetel auf, einem »Frischling« aus dem Schlafsaal einen Stock höher. Er war ein ungewöhnlich begabter Schüler und bereits »eine Legende«, weil er seine Mathehausaufgaben in Minuten erledigte. Im ersten Halbjahr hatte er schrecklich unter Heimweh gelitten – seine Eltern lebten im Ausland –, und Dyer hatte alles getan, um ihn zu trösten, nachdem er eines Tages weggelaufen war. Daraus hatte sich eine Freundschaft entwickelt. Rougetel half Dyer, Slimys schwierigere Bruchrechnungen zu lösen. Wenn Dyers Großmutter ihn zum Mittagessen ins Mitre einlud, nahm er Rougetel mit. Während der letzten Ferien hatten sie sich unabhängig voneinander höfliche Weihnachtskarten geschickt.
Rougetel schluckte und kam zum Waschbecken. Er blickte sich verstohlen um, neigte sich wie Dyers Mutter so weit vor, bis sein Gesicht fast den Spiegel berührte, sodass Dyer das Grübchen in seinem Kinn sehen konnte, als hätte jemand einen Bleistift dagegengedrückt, und flüsterte Dyers Spiegelbild zu: »Schau in der Sprunggrube nach.« Weil er ganz leise sprechen wollte, klang seine Stimme wie ein weit entfernter Propeller.
Dyer sagte zu Marvar: »Ich habe gewartet, bis alle schliefen. Dann bin ich im Schlafanzug rausgeschlichen – die Türen waren nicht verschlossen – und habe ein bisschen gegraben.«
Gespannt fragte Marvar: »Sie meinen hier? In dieser Sandgrube?«
»Irgendwo hier.«
»Und – haben Sie es gefunden?«
Dyer erinnerte sich an die Nacht, sie war vielleicht ein bisschen verblichen wie eine Restaurantrechnung in einem alten Jackett. Die kühle Frische der Luft nach dem muffigen Bad, das nach Desinfektionsmittel gerochen hatte. Die dunkle leere Straße, der niedrige Zaun, die Sprunggrube. Und der Augenblick, als seine Finger auf etwas Hartes stießen, den Sand wegschoben und das geschwungene Ende eines Plastikflügels bloßlegten, der mit dunkelgrünen und erdbraunen Aufklebern versehen war.