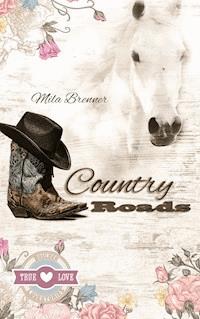4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Feelings
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Die Liebe ist so wechselhaft wie das Wetter. Die 20-jährige Rubye Landon liebt das Leben, ihre Freunde und vor allem die Musik. Nur an die wahre Liebe zwischen zwei Menschen, daran glaubt sie nicht. Ihrer Meinung nach bringt sie nämlich nichts als Ärger. Auch das Glück von Schwester Rina und ihrem Märchenprinzen Blair ändert daran nichts. Und während sich in deren Beziehung die ersten Regenwolken abzeichnen, lernt Rubye den Musiker Darryl Blackhall kennen und plötzlich steht die Welt Kopf. Nicht nur seine Leidenschaft für die Musik, auch sein Verständnis wecken Rubyes Interesse. In seiner Nähe schlägt ihr Herz in einer Melodie, vor der sie bisher immer weggelaufen ist. Doch diesmal ist alles anders. Denn auf einmal schmecken Regentropfen statt nach Abschied nach Sommer, Sonne und Sehnsucht. feelings-Skala (1=wenig, 3=viel): Erotik: 1, Humor: 0 Gefühl: 3 »Herzmelodien« ist ein eBook von feelings*emotional eBooks. Mehr von uns ausgewählte erotische, romantische, prickelnde, herzbeglückende eBooks findest Du auf unserer Facebook-Seite: www.facebook.de/feelings.ebooks. Genieße jede Woche eine neue Geschichte - wir freuen uns auf Dich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 556
Ähnliche
Mila Brenner
Boulder Lovestories: Herzmelodien
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Summer Rain
Das Leben ist wie das Wetter: Unbeständig, unvorhersehbar, und stets haben wir etwas auszusetzen.«
Professor Archer sah mich an. Dabei lag dieser Ausdruck in seinem Gesicht, der ihn bei den Studenten so beliebt machte. Seine blauen Augen funkelten amüsiert, seine schmalen Lippen zeigten ein jungenhaftes Grinsen.
»Ein interessanter Ansatz.« Er lachte, und zwei Reihen vor mir kicherten einige Studentinnen. Während ich sie lachen hörte, dachte ich darüber nach, warum Archer so beliebt war. Vielleicht weil er jung war und gut aussah und es nicht nur um seine lockeren Vorlesungen ging?
Sein Aussehen war mir egal, ich mochte seine aufrichtige Art im Umgang mit uns. Und dass es ihm gelang, alles, was er sagte, positiv wirken zu lassen. Das hatte zwar nichts mit »mögen« zu tun, sondern eher mit Neid, da ich das gerne selbst gekonnt hätte, aber dennoch war Archer für einen Professor echt cool. Ich besuchte seine Vorlesungen und Seminare mit Vergnügen, obwohl ich Philosophie nur gewählt hatte, weil ich Nachdenken einfach fand. In meinem Kopf gab es viel zu viele Gedanken. Ständig. Es tat gut, sie rauszulassen. Zu Papier zu bringen. Und das nicht nur in lyrischer Form, in Songtexten, die ich nur für mich alleine schrieb.
»Möchtest du deine Philosophie über das Leben nicht noch etwas ausführen und mit uns teilen, Rubye?«
Im Gegensatz zu anderen Professoren behandelte Archer uns nicht so distanziert. Es gab kein höfliches Sie in seinen Kursen, und das schaffte eine vertrauensvolle Basis. Die war auch notwendig, da sich sonst keiner öffnen und sich bereit erklären würde, eine Gruppe von mehr oder minder Fremden an seinem Innersten teilhaben zu lassen. Für mich waren diese Seminare beinah eine Therapie. Ich war gezwungen, meine Gedanken so in Worte zu fassen, dass ich sie artikulieren konnte. Am besten noch in einer Form, dass andere begriffen, was ich meinte. Allerdings musste ich zugeben, dass es sich dabei um keine leichte Aufgabe handelte. Manchmal verstand ich mich schließlich selbst nicht.
»Na ja, unberechenbar brauche ich bestimmt nicht zu erläutern. Es gibt Tage, da scheint die Sonne und alles ist einfach nur gut. Dann fängt es aus heiterem Himmel an zu regnen, und keiner kann sagen, woher der Regen kommt. Also, man könnte ihn wissenschaftlich erklären, aber das hilft auch nicht weiter, wenn man völlig durchnässt an einer Haltestelle auf den nächsten Bus wartet oder die geplante Gartenparty ins Wasser fällt. Genauso ist es mit dem Leben. Ab und zu läuft eben alles schief und scheiße. Und obwohl man Gründe dafür finden könnte, ist es schwer, nicht zu vergessen, dass nach jedem Unwetter – egal, wie schlimm es ist – die Sonne wieder hervorkommt. Wie im echten Leben. Egal, wie beschissen es dich behandelt, irgendwann geht es wieder aufwärts. Völlig unberechenbar und unvorhersehbar. Und deswegen ist es auch total verrückt, sich auf das Glück zu verlassen. Das Einfachste ist, jeden Tag zu nehmen, wie er kommt.«
»Sieht das jemand anders?«, fragte Archer in den Raum.
Meine Kommilitonen schwiegen. Das war ich schon gewohnt. Die Hälfte von ihnen war nur hier, weil es leicht war, Punkte zu sammeln. Es reichte aus, anwesend zu sein und gute Aufsätze zu schreiben. Die andere Hälfte teilte sich in diejenigen, die zu schüchtern waren, etwas zu sagen, und in solche, die mich wie erwähnt nicht verstanden. Sie hatten keinen Schimmer, wovon ich sprach. Aber sie hatten vermutlich auch keine Erfahrung mit Unwettern und dem Sonnenschein, der kam, selbst dann, wenn man sich nicht für ihn bereit fühlte.
»Clara, du vielleicht?«
Es überraschte mich nicht, dass Archer ausgerechnet sie aufrief. Clara Hanson war seit diesem Semester neu bei uns. Sie kam von außerhalb, wohnte erst seit Kurzem in Boulder, und ich wusste nichts von ihr, außer dass sie eine Außenseiterin war. Eben das, was man zu Highschool-Zeiten eine Streberin genannt hätte. In der Uni fand ich es lächerlich, jemanden als Streber zu bezeichnen. Immerhin waren wir alle hier daran interessiert, einen möglichst guten Abschluss zu machen, denn der entschied schließlich über unsere Zukunft. In der Highschool war es okay, naiv zu sein. So zu tun, als sei Schule nicht mehr als ein Folterinstrument von Eltern und Lehrern, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, entweder Folterknecht oder rettender Engel zu spielen. Mittlerweile waren wir zu alt dafür.
»Jetzt kommt es wieder. Ich sag es dir, gleich passiert es. Spätestens beim vierten Wort kann ihr keiner mehr folgen, der nicht das ganze verdammte Fachbuch gelesen hat.«
»Das Wetter als Korrelat zu verwenden ist nachvollziehbar.«
Chris, der wie immer rechts von mir saß, pfiff durch die Zähne, und Fozzy lachte.
»Teilst du Claras Meinung nicht?«, klinkte sich Professor Archer ein. Seine Lippen lächelten noch, aber in seinen Augen lag eine Herausforderung.
Chris zuckte mit den Achseln. »Ich fürchte, Clara war noch nicht fertig. Sie läuft sich gerade erst warm.«
Ich brauchte nicht an Chris vorbeizusehen, um Fozzys breites Grinsen zu erahnen. Allerdings musste ich zugeben, dass ich mich geirrt hatte. Wir waren nicht alle zu alt für den Kindergarten oder das Verhalten von pubertierenden Teenagern.
»Das war nur etwas Motivation von mir. So ein bisschen Unterstützung für Clara, weil sie hier ja immer noch fremd ist.«
Chris spielte darauf an, dass Clara zwar extrem hübsch war, aber jeden Versuch, mit ihr ins Gespräch zu kommen, genauso ignorierte wie seine Bemühungen, sie anzuflirten. Und er flirtete beinah alle Mädchen an. Selbst wenn er nicht mit jeder von ihnen etwas anfing, für einen Flirt war er immer zu haben.
Er wurde seinem Image als Mitglied des Footballteams gerecht, und ich hatte Glück, dass ich Chris seit dem Kindergarten kannte, als er noch Windeln getragen hatte. Für mich war er schon immer bloß »Channing« gewesen. So hieß Chris mit Nachnamen. Er war mein bester Freund. Der Junge, der heimlich mit mir Auto fuhr, damit ich weniger Fahrstunden benötigte – falls ich überhaupt das Geld zusammenbekam, um im Sommer den Führerschein zu machen. Der Junge, der darauf aufpasste, dass mir kein anderer zu nahe kam, und der mich selbst dann zum Lachen brachte, wenn es in meinem Kopf mal wieder gewitterte. Er war eben mein bester Freund, weil mein Bruder Rian mich verlassen hatte, als ich ihn gebraucht hätte, und meine Schwester Rina keine Zeit gehabt hatte, für mich da zu sein.
Das Mädchen mit den Geldsorgen und der Sohn des Bürgermeisters. Das war Stoff für ein besonders kitschiges Märchen. Doch sowohl für mich als auch für Chris stand fest, dass wir beide viel zu wenig an diesen Kitsch glaubten, um Gefahr zu laufen, uns in einer dieser rosaroten Disney-Geschichten wiederzufinden. Ich hielt mehr von Freundschaften. Solide, fest und weniger herzbrechend als Beziehungen.
Während Chris sich leise mit Fozzy unterhielt, monologisierte Clara längst weiter. Das Schlimme war ja, dass das, was sie sagte, durchaus interessant war. Bloß drückte sie sich immer in der Fachsprache aus, und der konnte ich nachmittags um fünf nicht mehr folgen. Nicht, nachdem ich heute schon vier Stunden Musiktheorie bei Mrs. Robinson hinter mir hatte. Es war eine Tortur, morgens um acht in ihrer Vorlesung zu sitzen. Sie schaffte es, vier Stunden aus unserem Script vorzulesen, ohne Pause und ohne Interaktion. Zwischendurch lief sie mit ihren Pfennigabsätzen auf und ab, damit niemand von uns einnickte. Dabei liebte ich Musik. Auch die Theorie. Aber Robby gelang es, selbst die coolsten Sachen so langweilig aussehen zu lassen, dass ich mich manchmal fragte, warum ich mir ihre Kurse und dieses Musikstudium eigentlich antat. Robby schaffte es jeden Tag aufs Neue, mich an meiner Entscheidung zweifeln zu lassen. Ohne Archer und seine Therapiesitzungen hätte ich bestimmt schon längst alles hingeworfen. Okay, das war nicht ganz die Wahrheit. Die praxisorientierten Kurse meines Musikstudiums liebte ich heiß und innig. Dieses Jahr belegte ich nicht nur den Gitarrenkurs, sondern auch wieder einen Gesangskurs. Und im Herbst hatte ich mich für einen Songwriter-Kurs eingeschrieben, den sie endlich anboten. Ich konnte gar nicht beschreiben, wie sehr ich mich darauf freute. Jedenfalls setzte ich verdammt viel Hoffnung in diesen Kurs und dass er mir genug bot, um die langweiligen Vorlesungen mit Robby erträglich zu machen.
Ich bekam erst mit, dass Clara von Archer unterbrochen wurde, weil Chris neben mir sein Zeug einpackte. Der Kurs war vorbei, und ich hatte die letzten zwanzig Minuten komplett verträumt.
»Ich hoffe, ihr habt alle ein paar gelungene Ansätze zum Thema Leben gefunden. Nächste Stunde besprechen wir noch den Aufbau und die äußere Form eurer Ausarbeitung.«
»Ausarbeitung? Ich dachte, wir schreiben im Juli unsere Klausur, und das war es dann?«
»Den Abfragetest?«, erkundigte sich Archer bei Fozzy, der sein dunkelbraunes Haar mit einem heftigen Nicken ins Gesicht warf.
»Der wird die Hälfte eurer Scheinnote ausmachen. Die andere Hälfte steuert das Essay bei.«
Hier und da wurde Fozzys Murren aufgegriffen und unterstützt. Es war unser viertes Semester und das erste Mal, dass Archer uns eine solche Arbeit während der Vorlesungszeit schreiben ließ. Ich nahm an, es war eine gute Vorbereitung für die Abschlussarbeit, die wir zu einem ausgesuchten Thema in den Ferien verfassen sollten. Mitte September war Abgabetermin, und Anfang Oktober würden wir noch ein Kolloquium dazu halten und eine Klausur über den gesamten Stoff der ersten zwei Jahre schreiben. Zwischenprüfungen erfreuten sich der gleichen Begeisterung wie damals in der Highschool die Abschlussprüfungen. Hierfür hätte ich nicht die Reaktionen meiner Kommilitonen benötigt. Ich fühlte ja selbst genau wie sie. Ich hasste Kolloquien. Zu reden, wenn mir nicht danach war. Mit fremden Prüfern, die ich kein bisschen kannte und die mich nicht kannten. Vielleicht mochte ich in dem Moment Philosophie doch viel weniger, als ich geglaubt hatte, aber es half nichts. Manchmal regnete es, und man konnte bloß hoffen, dass man einen Regenschirm dabeihatte. Ansonsten wurde man eben nass. Das Leben ging weiter und kümmerte sich kein bisschen darum, ob die Sonne schien oder nicht.
Ich folgte den Jungs hinaus und schulterte gerade meine Tasche, als am Ende des Flurs eine Tür aufging. Mein Blick suchte in der herausströmenden Studentenmasse nach einer zierlichen Gestalt. Mischa war schlank, gerade mal 1,63 Meter groß, und außerdem war sie Koreanerin. Sie sprach ihre Geburtssprache fließend, liebte K-Pop, las Mangas und flog in den Ferien regelmäßig in ihre Heimat, um ihre Tante und ihren Onkel in Seoul zu besuchen. Obwohl sie so klein war, fiel Mischa in einer Gruppe aus mehreren Leuten immer auf. Sie trug diese für Kawaii Fashion typischen knalligen Farben, und bei ihr passte es irgendwie. Vielleicht lag es daran, dass Mischa die Kleider oder Longshirts in Pink, Babyrosa und Babyblau mit schwarzen Leggings kombinierte und auf Ringelsocken und Strumpfhosen verzichtete. Stattdessen steckten ihre Füße heute in neonpinkfarbenen Sandalen, die aus dem Internet stammen mussten, denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass es so was in Boulder zu kaufen gab. Über der schwarzen Leggings trug sie ein graues Shirtkleid mit Mangaaufdruck.
»Mischa!«, rief ich und winkte kurz. Da ich nicht unbedingt klein war, hatte sie kein Problem, mich zu sehen. Sie schlängelte sich durch die Massen zu mir.
»Heute ist es so voll wie sonst nur zu Beginn des Semesters.«
Mischa sprach mir aus der Seele. Gelassen zuckte ich mit den Schultern. Mir machten Menschenansammlungen nichts aus.
»Es geht aufs Ende zu.«
Wie immer kamen jetzt auch die Studenten zu ihren Kursen, die mehr als die Hälfte der Zeit durch Abwesenheit glänzten. Vier Wochen vor den Prüfungen schien die magische Grenze zu sein, die darüber entschied, ob man seinen Schein erhielt oder nicht. Zumindest war das meine Erfahrung nach vier Semestern, in denen ich dieses Spiel beobachtet hatte.
»Du sagst es.« Mischa seufzte.
Sie absolvierte wie alle aus unserer Clique den Bachelor of Education. Sie hatte zwei völlig andere Fächer als ich, nämlich Englisch und Mathe, und ihr Schwerpunkt war ebenfalls ein anderer. Sie hatte sich für das Foundation Phase Teaching entschieden und durfte damit in der Vorschule und in den ersten drei Jahrgängen der Elementary und Primary School unterrichten. Ich dagegen hatte mich, wie auch Chris, Elise, Trev und Fozzy, für den Secondary Teaching Grade entschieden, der mir erlaubte, an der Highschool und Senior Highschool zu lehren. Mischa und ich sahen uns daher nur in einigen der allgemeinen Pädagogik- und Allgemeinbildungskurse, waren aber immer noch eng befreundet. Ich kannte sie seit fünf Jahren. Zu der Zeit war sie mit ihrer Familie nach Boulder gezogen, und wir hatten die meisten Kurse an der Highschool zusammen gehabt.
Mischa und mich verband die große Leidenschaft zur Musik. Sie spielte Klavier, seitdem sie vier war, und nahm in ihrer Freizeit auch noch Tanzunterricht. Sie war richtig gut darin, und meiner Meinung nach hätte sie dabei bleiben sollen. Nicht, dass ich mir sie nicht als Lehrerin für kleine Kinder vorstellen konnte, was zugegeben bei ihrem Look ein wenig schwierig war. Ich wusste eben nur, dass sie verdammtes Talent besaß. Sie liebte den Paartanz und nahm regelmäßig mit ihrer Tanzgruppe an Wettbewerben teil. Allerdings war ihre Familie ziemlich streng und in gewisser Weise konservativ. Sie ertrugen Mischas Vorlieben für extrovertierte Kleidung und Mangas, doch sie hatten von ihr erwartet, dass sie etwas »Vernünftiges« erlernte. Ihre älteren Schwestern – Zwillinge – waren beide an der Universität gewesen. Henna kümmerte sich zwar jetzt nur noch um ihre drei Kinder, aber Hanna arbeitete als Anwältin. Sie hatte Jura studiert, und in meinen Augen war sie alles andere als eine steife Juristin. Sie hatte uns zum Beispiel für Geburtstagspartys Alkohol besorgt, als keiner von uns volljährig gewesen war. Trotzdem war Hanna, was ihre Arbeit betraf, erfolgreich und ehrgeizig. Der Druck, der auf Mischa lastete, war enorm. Wenn ich es so sah, hatte ich es mit meiner Schwester Rina als der einzig Übriggebliebenen in meiner Familie ganz gut getroffen. Seit Blair in ihrem Leben aufgetaucht war, hatte sie kaum noch Zeit, mich nach der Uni zu fragen, und ich war nicht böse drum. Ich wollte nicht darüber nachdenken, warum ich studierte und ob es wirklich das war, was ich mir vom Leben wünschte. Wünsche waren eine verdammt komplizierte Sache. Die meiste Zeit in meinem Leben wusste ich nicht einmal, was ich mir wünschen sollte.
»Woran denkst du?«
Ich deutete zum Ausgang. »Komm mit, ich muss endlich mal hier raus.«
»Gute Idee.«
Chris, Fozzy und Trev waren scheinbar schon ohne uns vorausgegangen. Ich sah sie jedenfalls erst wieder, als wir nach draußen kamen. Sie standen um Chris’ Auto herum, einen alten, roten Camaro.
Wenn Channing etwas liebte, dann seinen Wagen.
»Also woran hast du nun gedacht?«, lenkte Mischa meine Aufmerksamkeit zurück auf sich und unser angefangenes Gespräch.
»Es ist zu laut in meinem Kopf. Zeit für einen Song.« Ich zuckte mit den Achseln. »Vielleicht kommt etwas Brauchbares dabei raus.«
Mischa lachte. »Bei dir kommt immer was Brauchbares raus. Vor allem, wenn es zu laut in deinem Kopf ist.«
Nur dann. Doch das sagte ich nicht. Mischa zu widersprechen war sinnlos – nicht, weil sie nicht nachgab. Das tat sie. Viel zu oft sogar. Aber ich war mir sicher, dass sie innen drin nicht von ihren eigenen Überzeugungen abrückte, sondern nur nach außen hin so tat. Sie hasste es zu streiten, und ich konnte mich nicht daran erinnern, dass wir das je getan hätten.
Vielleicht war sie deswegen meine Freundin, ohne meine allerbeste Freundin zu sein. Weil ich es brauchte, mich streiten zu können und wütend sein zu dürfen. Ab und an benötigte ich wohl jemanden, der mir den Kopf wusch. Elise konnte so was. Elise war meine beste Freundin und das weibliche Gegenstück zu Chris. Nicht charakterlich, aber sie war der Teil, mit dem ich all die Dinge teilte, die nur ein Mädchen verstand. Dabei gelang es uns zu reden, ohne viele Worte zu benutzen. Ich kannte sie genauso lang wie Chris. Seit dem Windelalter waren wir drei und Trev die engsten Freunde. Wir passten aufeinander auf, und wenn jemand von uns in Schwierigkeiten steckte, war mindestens einer sofort zur Stelle, um zu helfen. Wir waren für Trev da gewesen, als seine Mutter, die bei der Feuerwehr arbeitete, bei einem Einsatz verletzt worden war und mit einer schweren Rauchvergiftung im Krankenhaus gelegen hatte. Ich hatte Chris jeden Tag zu Hause besucht und für sechs Wochen seine pedantische Mutter ertragen, als er sich beim Footballtraining irgendeine Fußverletzung zugezogen hatte. Sie waren für mich da gewesen, als mein Vater gestorben und meine Mutter ins Heim gekommen war.
Und jetzt würden wir für Elise da sein. Ihre Eltern hatten ihr am Wochenende eröffnet, das sie sich scheiden ließen. Ihr Vater hatte eine Neue und wollte nach der Trennung nach Denver ziehen. Er hatte ihr angeboten, bei ihm zu leben. Elise dachte darüber nach. Doch ich war mir sicher, dass sie nicht wegziehen würde. Elise bei ihrem Dad in der Großstadt und mit seiner neuen Flamme, die gerade mal Ende zwanzig war? Nein, das war einfach absurd. Ich wusste es, und sie wusste es auch, aber es fiel ihr schwer, loszulassen. Sie war ihrem Vater so ähnlich. Er teilte ihre Vorliebe fürs Theater, für alte Schinken von großen Literaten, überhaupt für Bücher und natürlich Kunst. Ihre Mutter hatte für Kunst in jeder Form wenig übrig. Für Abygail Morgan war Kunst nur etwas Schönes zur Unterhaltung, aber nichts, was sie verstand oder verstehen wollte. Dummerweise trieb das Elise an den Rand des Wahnsinns, denn sie studierte Kunst und liebte sie so sehr wie ich die Musik.
»Landon!«
Ich schreckte aus meinen tiefen Gedanken hoch und wandte den Blick zu Chris.
»Was?«, rief ich zurück.
»Brauchst du heute ’ne Extraeinladung?« Er klopfte auf die Motorhaube. »Ich will nach Hause.«
Was so viel bedeutete wie: Komm jetzt!
Trev grinste, hob die Hand und winkte mir zu, bevor er sich umdrehte und mit Fozzy abbog. Die beiden joggten nach Hause. Ja, kein Kommentar.
Es dauerte ungefähr eine Dreiviertelstunde vom Campus bis in die 13th Street, und trotzdem nahmen sie weder den Bus noch ein Fahrrad. Aber gut, wahrscheinlich mussten Footballer ein gewisses Maß an fanatischer Sportbegeisterung besitzen. Es sei denn, man hieß Channing und spielte Football nur, weil es cool war.
Mit seinem Camaro zur Uni zu fahren war in seinen Augen noch cooler. Also waren übertriebene Sportbegeisterung und gar nach Hause zu joggen für ihn keine Option.
Ich wandte mich an Mischa. »Ich muss los.«
»Rufst du mich an?«
»Sicher.«
»Rubye?«
Fragend sah ich zu ihr. »Was?«
»Du hast es doch nicht vergessen, oder?«
»Vergessen?« Ich hatte keine Ahnung, wovon Mischa sprach.
»Du wolltest vorbeikommen. Zum Aufnehmen?« Sie schüttelte das schwarze Haar und lachte ihr sanftes Glockenlachen, um das ich sie so sehr beneidete wie Archer um seine positiven Rhetorikfähigkeiten.
»Du hast es also doch vergessen!«
»Nein, nicht wirklich.« Ich war mir nur nicht sicher. »Vielleicht verschieben wir es noch mal um ein Wochenende? Morgen möchte ich lieber bei Elise vorbeischauen.« Sie war die ganze Woche nicht in der Uni gewesen und hatte auf keinen meiner Anrufe reagiert. Es war an der Zeit, sie aus ihrer Starre herauszureißen. Elise neigte dazu, sich in Melancholie zu verlieren. Auch in ihrem Kopf wurde es manchmal zu laut, aber sie schaffte es nicht so gut, ihren Gedanken Luft zu machen. Sie vergrub ihre Gefühle nur noch tiefer in ihrem Inneren. Wenn sie sich eine Woche lang nicht bei mir meldete und sich nicht mal mir öffnete, war es an der Zeit, sich Sorgen zu machen. Und das tat ich.
Mischa nickte. »Okay, das verstehe ich. Soll ich mitkommen?«
»Nein, lass mal. Das muss ich allein machen.«
»Na gut. Rufst du mich trotzdem an? Vielleicht treffen wir uns am Samstagabend alle im Slyr?«
»Ja klar. Ich sag dir Bescheid, ob ich Elise mitbringe.«
»Täte ihr bestimmt gut.«
Ich nickte. Das sah ich ganz genauso.
»Landon! Ernsthaft jetzt. Schwing deinen scharfen Hintern hier rüber und lass uns abhauen. Es ist Freitag, Baby.«
Mischa kicherte. »Baby.«
Anstatt das zu kommentieren, rollte ich bloß mit den Augen, umarmte sie kurz und ging endlich zu Chris, bevor ihm noch mehr Peinlichkeiten über die Lippen kamen.
»Idiot!«, begrüßte ich ihn, öffnete die Beifahrertür und stieg ein.
Mit einem breiten Grinsen schnallte sich Channing an. Während ich das Radio voll aufdrehte, fuhr er gemächlich mit runtergelassenen Scheiben los. Wir unterhielten nicht nur den ganzen Campus, sondern die gesamte Sprucestreet, als er mich vor Rinas und meiner Wohnung aussteigen ließ. Kein Wunder, dass unsere Nachbarin Mrs. Miller immer annahm, ich verkehrte in gefährlichen Kreisen. Channing wirkte nicht wie ein Dealer, aber seine Karre und sein Gehabe konnten eine alte Frau wie sie durchaus auf falsche Gedanken bringen.
»Ciao Süße, und wehe, du lässt uns morgen hängen!«
»Haha, als wenn ich euch je hängen lasse.«
»Es ist Open-Mic-Abend.«
Ich zögerte sekundenlang. Es reichte, damit es ihm auffiel. Natürlich. Er kannte mich einfach zu gut.
»Jetzt komm schon. Du hast es versprochen.«
Das hatte ich.
»Mal sehen. Wenn Elise mitkommt, bin ich dabei.«
»Das haben wir nicht vereinbart, Landon. Der Wetteinsatz war ein Auftritt an diesem Samstag.«
»Der Wetteinsatz war für eine Wette mit Elise. Ohne sie gibt es keine Einlösung meinerseits.«
Chris grinste. »Wir werden sehen.«
Ich schüttelte den Kopf, schlug die Tür seines Wagens zu und ging ins Haus. Gar nichts würden wir sehen. Nach all den Jahren sollte Channing eigentlich wissen, dass ich mich von niemandem zu etwas überreden ließ und grundsätzlich nur das tat, was ich wollte. Sich selbst treu zu bleiben und nicht etwas zu tun, nur weil andere es verlangten oder erwarteten, das war etwas, das ich mir für mein Leben vorgenommen hatte. Ich nahm an, es war nicht die schlechteste Lebensphilosophie – und bestimmt hätte mir Professor Archer da zugestimmt.
May It Be
Es war kurz vor sechs, als ich die Wohnung betrat. Von Rina noch keine Spur, aber das wunderte mich nicht. Seitdem Noreen im Laden aushalf, machte Rina zwar eine längere Mittagspause und widmete sich auch einigen Kundenaufträgen außerhalb des Fiori Flowers, doch vor acht war sie trotzdem selten zu Hause.
Ich versuchte, mich zu erinnern, ob sie heute mit Blair verabredet war. Bestimmt. Die Frage war vielmehr, ob sie ausgingen, sich hier trafen oder bei ihm. Obwohl ich mich für meine Schwester freute, traute ich dem Frieden noch nicht. Dafür waren die letzten Wochen zu turbulent gewesen. Ein Auf und Ab der Gefühle und alles andere als ein perfektes Märchen. In meinen Augen gab es die zwar nicht, aber Rina war überzeugt davon.
Ich glaubte, man sollte einfach jeden Menschen sein Leben so leben lassen, wie er es möchte. Das galt natürlich auch für Rina. Ich wollte nur nicht, dass sie enttäuscht wurde. Wenn es nämlich jemand verdient hatte, glücklich zu werden, dann meine Schwester.
Also spielte ich brav mit und gab mein Bestes, sobald Rina und Blair den nächsten Versuch unternahmen, unsere Familien zusammenzuführen. Bisher hatten sie sich nur ein paar Mal getraut. Der letzte Ausflug war ganz okay gewesen, bis auf die Tatsache, dass jeder gemacht hatte, was er wollte. Blairs Kinder hatten sich nach zehn Minuten im Park abgeseilt, und wir trafen sie erst auf dem Parkplatz wieder. Mich hatte das Lichtspiel in den Baumkronen so sehr inspiriert, dass ich mich irgendwann auf eine der Parkbänke setzte und anfing, meine Gedanken niederzuschreiben. Das bedeutete, dass die beiden Turteltäubchen schließlich allein wanderten. Am Ende war es ihnen nicht unrecht. Sie hatten jedenfalls verdammt glücklich ausgesehen, als sie mich von meiner einsamen Parkbank abholten und mit mir zum Auto zurückliefen.
Ich glaubte Rina, wenn sie mir erzählte, dass Blairs Kinder langsam anfingen, sie zu akzeptieren. Obwohl es für mich so aussah, als fügten sie sich in ein Schicksal, das selbst sie als unabwendbar erkannt hatten. Aber nur weil sie meine Schwester als die neue Frau an der Seite ihres Dads akzeptierten, hieß das nicht, dass wir alle plötzlich eine große glückliche Familie sein wollten. Doch die beiden schienen nicht zu begreifen, dass wir vier dafür zu alt waren. Bei Blair verstand ich das noch. Es ging um seine Kinder. Für manche Eltern stellte es tatsächlich ein Problem haben, ihre Kinder nicht loslassen zu können. Aber bei Rina? Ich war ihre Schwester und nicht ihre Tochter. Manchmal vergaß sie das, und so, wie unsere Vergangenheit aussah, konnte ich es ihr nicht mal zum Vorwurf machen.
Also zeigte ich meine Unterstützung, indem ich bei den geplanten Familienzusammenkünften mitmachte. Dazu ermutigen wollte ich die beiden jedoch nicht. Meine Schwesternliebe hatte schließlich Grenzen. Außerdem war es mir lieber, Rina konzentrierte sich auf sich selbst und ihre Beziehung zu Blair. Die beiden sollten ihre eigene Zukunft planen. Ein gemeinsames Kind, das würde meiner Schwester stehen. Sie wäre eine großartige Mutter. Ich wusste das, und mir würde es gefallen, wenn sie das endlich auch erkannte. Aber bitte bei einer Tochter, die ihre eigene war, und nicht bei mir oder Stiefkindern, bei denen der Zug bereits abgefahren war.
Zwanzig vor sieben, und ich stand immer noch im Flur der Wohnung und dachte über meine Schwester und ihr Liebesleben nach. Es machte Spaß, darüber zu sinnieren, weil es mich an diese verqueren Romantikkomödien erinnerte, aber im Gegensatz zu Filmen ging es hier um die Wirklichkeit. Rina musste ihren eigenen Weg finden. So wie ich auch.
Ich betrat mein Zimmer, warf meine Tasche aufs Bett und ließ mich kurz danach stöhnend daneben fallen. Für ein paar Sekunden schloss ich die Augen und sammelte meine Gedanken, um sie auf wichtige Dinge zu lenken. Was wollte ich mit dem Wochenende anfangen, das vor der Tür stand?
Song schreiben, um meinen Kopf freizubekommen.
Das würde ich noch heute Abend machen. Gleich nachdem ich was gegessen hatte, denn mir knurrte seit heute Mittag der Magen. Gut, kochen, essen und dann erst schreiben.
Das klang nach einem hervorragenden Plan. Morgen früh würde ich erst einmal ausschlafen, danach lange duschen, ausreichend frühstücken und mich anschließend um die Wäsche kümmern. Seit Rina an den Wochenenden kochte, übernahm ich den Wäschedienst. Irgendwann, hoffte ich, waren ihre Kochkünste so gut, dass ich aufhörte, mich zu fragen, weshalb ich mich auf diesen Tausch eingelassen hatte.
Danach würde ich zu Elise fahren. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie dieses Treffen ablief. Elise in einer ihrer verzweifelten, melancholischen Phasen war unberechenbar. Es war möglich, dass sie in ihrem Zimmer saß und einfach vor sich hin starrte. Sie konnte aber auch draußen unterwegs sein, sodass ich sie in der ganzen Stadt suchen musste. Oder – was am wahrscheinlichsten schien – sie hatte sich in ihre Garage eingeschlossen. Dort malte sie. Eigentlich immer, wenn sie nicht gerade lernte oder ich sie dazu zwang, mit mir und der Clique wegzugehen. Manchmal machte ich mir wirklich Sorgen um Elise. Ohne mich, so sah es wenigstens aus, kam sie nie unter Leute und raus aus ihrer eigenen Welt. Nicht, dass ich sie nicht verstand. Ich war selbst der größte Fan meiner eigenen Gedankenwelt und teilte sie lieber nicht mit anderen, aber ich brauchte meine Freunde. Wir hatten immer eine verdammt gute Zeit, und wenn es Elise so schlecht ging, wie ich annahm, war es genau das, was sie brauchte.
Okay, freundschaftliche Therapiesitzung bei Elise.
Das war nicht unbedingt das, was ich mir für diesen Samstag vorgestellt hatte. Es wartete noch jede Menge Lernstoff auf mich, den ich somit am Sonntag abarbeiten musste. Andererseits gab es mir die Möglichkeit, eine Ausrede parat zu haben, sollte Rina mich erneut fragen, ob ich mit ihr nach Longmont fuhr. In letzter Zeit fragte sie häufiger. Dabei hatte ich gehofft, sie hätte endlich verstanden, dass ich nicht mitfahren wollte. Ich konnte nicht. Rina hatte ich gesagt, dass ich meine Gründe hätte – und die hatte ich. Aber darüber wollte ich jetzt ganz bestimmt nicht nachdenken. Songs über Mütter waren nicht, was ich vorhatte zu schreiben. Also schob ich sämtliche Gedanken daran in die hinterste Ecke meines überfüllten Kopfs.
Als ich aufstand und mein Zimmer verließ, ging ich nicht direkt in die Küche. Zuerst suchte ich im Bad die Toilette auf. Nachdem ich mir aus der Hausapotheke zwei Aspirin genommen und mit einem Zahnputzbecher voll Leitungswasser hintergespült hatte, ging ich schließlich in die Küche.
Der Inhalt unseres halb leeren Kühlschranks war nicht gerade vielversprechend, und ich hoffte, Rina wollte morgen einkaufen gehen. Nach meiner Tagesplanung hatte ich keine Zeit, das zu erledigen. Außerdem hasste ich es, vollbepackt mit Einkäufen in einem überfüllten Bus zu stehen. Grauenhaft! Das brachte mich zurück zu meiner Absicht, einen anständigen Ferienjob zu finden und genug Geld zu verdienen, um endlich meinen Führerschein zu machen. Danach besaß ich zwar immer noch kein Auto, klar, aber es war zumindest der erste Schritt auf dem Weg zur Unabhängigkeit. Denn Rinas Fahrrad zählte da einfach nicht, egal, wie oft sie mich überzeugen wollte, dass so ein Zweirad praktisch war.
Nur weil mein Vater einen tödlichen Verkehrsunfall gehabt hatte, würde mich das nicht davon abhalten, selbst Auto zu fahren. Ich hatte keine Angst vor Autos und auch nicht vor Unfällen. Wenn einem im Leben etwas Schlimmes passieren sollte, konnte das überall geschehen. Ich glaubte an Fügung. An irgendwas musste ich schließlich glauben, und Gott – so hatte es sich herausgestellt – war mir einfach zu schweigsam.
Doch weder Fügung noch Gott würde mir bei der Frage helfen, was ich nun kochen sollte. Das überließen sie meinem allzu vollen Kopf, der wenigstens nicht mehr wehtat. Das Aspirin half.
Schließlich beschloss ich, das Abendessen simpel zu halten und Reste zu verwerten. Ich fand eine halbe Packung Nudeln im Schrank, Tomaten, die für keinen Salat mehr getaugt hätten, und konnte sogar noch Zucchini und ein bisschen Paprika retten. Dazu schnitt ich Salami in kleine Würfel und rührte aus einem Ei, etwas Milch und ein paar Kräutern eine Sauce an. Das Ganze überlagerte ich mit einer unheiligen Menge Reibekäse und schob es einfach in den Backofen. Mittlerweile hatte ich so viel Hunger, dass es mir egal war, wie genießbar das Ergebnis ausfallen würde.
Die Dreiviertelstunde Wartezeit verbrachte ich damit, die Spülmaschine auszuräumen und den Tisch zu decken. Da ich am Ende noch genug Zeit übrig hatte, suchte ich in der Dreckwäsche helle Kleider zusammen, um wenigstens schon mal eine Maschine anzustellen.
Gerade als ich den abgekühlten Auflauf auf den Tisch gestellt hatte und meinen Teller füllte, kam Rina in die Küche. Sie begrüßte mich mit einem Lächeln, das ihre Müdigkeit nicht verbergen konnte. Nicht vor mir jedenfalls.
»Anstrengender Tag?«, fragte ich.
»Ging schon. Es ist Freitag. Das Wochenende steht vor der Tür, und ich habe gute Laune. Das lässt alles andere nur noch halb so schlimm erscheinen.«
Sie setzte sich, und als ich sie mit einem Blick fragte, ob sie auch was wollte, nickte sie.
»Was ist das?«
Ich zuckte mit den Achseln. »Keine Ahnung. Resteverwertung. Wird schon schmecken.«
»Schlimmer als meine Quiche von letzter Woche kann es kaum sein.«
»Oh ja, die war wirklich furchtbar.«
Rina verzog das Gesicht, und ich lächelte.
»Ich spreche bloß aus, was wir beide wissen. Die Quiche war ein gut gemeinter Versuch. Aber auch nicht mehr als das.«
»Das Rezept taugte nichts.«
»Bestimmt.«
Während des Essens schwiegen wir. Es lag sicher daran, dass wir beide ziemlich großen Hunger hatten, um viel zu reden. Außerdem war Rina nie sehr gesprächig, wenn sie müde war; und mein Kopf war immer noch zu voll, um meine Gedanken zu ordnen und mit jemandem teilen zu können. Da meine Schwester mir anders nicht folgen konnte, ließ ich es gleich bleiben.
Regen. Sonne. Wetter. Leben.
Das waren die vier Schlagwörter, die mir nicht aus dem Kopf gingen und von denen ich wusste, dass ich sie irgendwie vernünftig in einen Song einarbeiten musste, um sie loszuwerden. Vielleicht half mir das auch dabei, endlich mit meinem Essay zu beginnen. Archer erklärte zwar erst am Montag die Form, und dann blieben mir etwa drei Wochen bis zur Abgabe, aber ohne ein Thema zu haben machte Recherche keinen Sinn. Daher hatte ich auch noch nicht angefangen. Drei Wochen waren demnach nicht wirklich viel Zeit.
Rina schob seufzend ihren Teller von sich. »Im Gegensatz zu meiner Quiche war deine Resteverwertung sehr lecker. Danke, Rubye.«
»Kein Ding. Sag mal, fährst du morgen einkaufen?«
Fragend sah Rina mich an.
»Der Kühlschrank ist leer. Was glaubst du, weswegen ich dieses ausgefallene Gericht hier zusammengewürfelt habe.«
»Oh.« Sie fuhr sich durch ihr blondes Haar. Das war seit den letzten Wochen länger geworden und reichte ihr jetzt bis zu den Schulterblättern. Es stand ihr. Ebenso wie ihr Lächeln, wann immer Blair aufkreuzte. Er tat ihr gut, das war nicht zu übersehen.
»Ich kann morgen unmöglich einkaufen.«
»Okay. Wieso nicht?« Mir gelang es nicht, meinen Ärger aus der Stimme zu bannen. Ich hatte es ja geahnt.
»Es gibt so viel zu tun.«
»Ich denke, Noreen hilft dir?«
»Sie hat frei. Sie fährt nach Denver, um ein paar Freundinnen zu besuchen.«
Ich verzog genervt das Gesicht.
»Kannst du das machen?« Sie sah mich flehend an. »Bitte, Rubye.«
Machtlos seufzte ich. »Bleibt mir eine andere Wahl? Allerdings brauchen wir dringend Getränke, und ich schleppe bestimmt nicht wieder Sixpacks durch den ganzen Supermarkt bis zur Haltestelle und hierher. Außerdem müsste ich dann zweimal fahren, und ob du es glaubst oder nicht, auch ich habe morgen viel zu tun.«
»Warum fragen wir nicht Blair?«
»Wonach? Ob er für uns einkaufen geht?« Ich zog eine Augenbraue hoch. »Eher nicht.«
»Nein, so nicht. Aber vielleicht kann ja Keith oder Deena dich rumfahren.«
Ich vergaß immer, dass die beiden im Gegensatz zu mir einen Führerschein besaßen.
»Das wäre doch super.«
Ja, vor allem, weil wir uns dann besser kennenlernen konnten. Rina sagte es nicht, aber sie dachte es. Ich sah es ihr ganz genau an.
»Warum rufst du nicht gleich mal an?«
»Bitte?« Fassungslos sah ich sie an. »Ist das dein Ernst?«
Bevor sie etwas sagen konnte, hob ich abwehrend meine Hand. »Okay, okay. Vergiss, dass ich gefragt habe. Natürlich ist es dein Ernst.«
Ich muss wahnsinnig sein.
»Na schön. Hast du die Nummer von einem der beiden?«
»Warte kurz.« Rina verließ die Küche. Vermutlich suchte sie ihr Handy. Ich stand derweil auf und räumte den Tisch ab. Irgendwas musste ich tun, um ja nicht darüber nachzudenken, wie verrückt Rinas Vorschlag war – und wie viel verrückter, dabei auch noch mitzumachen.
»Da, ich habe sie.« Rina kam zurück in die Küche und hielt mir triumphierend ihr Handy entgegen.
Ich nahm es ihr ab, überflog den SMS-Verlauf und sah sie entgeistert an. »Du hast gerade wirklich Blair gefragt, ob er mir die Nummer seines Sohns geben kann? Wie sieht denn das bitte aus. Der soll sich ja keine Hoffnungen machen, dass ich was anderes von ihm will als seinen Chauffeurdienst.«
»Rubye! Keith ist wirklich ein netter Junge.«
»Oh Gott, bitte. Nicht wieder diese Leier. Abgesehen davon, dass er viel zu jung für mich ist, ist er absolut nicht mein Typ.«
Ich wusste nicht, was mein Typ war. Aber ich wusste mit Sicherheit, dass ich nicht auf Keith stand. So gar nicht.
»Er wird neunzehn«, warf Rina ein.
»Und ich werde einundzwanzig!«
»Weißt du, Altersunterschiede spielen bei der Liebe …«
»Woha!« Ich hob die Hände, und Rina trat einen Schritt zur Seite. Nicht deswegen, sondern weil ich zudem meine Stimme erhoben hatte.
»Mach mal halblang, Rina, und dann fährst du bitte mindestens zehn Gänge zurück. Das Wort Liebe in einem Satz mit dem Sohn deines Lovers ist ein Tabu.«
»Blair ist nicht mein …«
»Lover. Ich weiß. Entschuldigung. Aber dein Gefasel von Liebe macht mich nervös. Seitdem du auf Wolke sieben schwebst, kriege ich fast Angst vor dir.«
»Warum das?«
»Du scheinst dem irrsinnigen Glauben verfallen, ich müsste mich ebenfalls unsterblich verlieben, nur um glücklich zu sein. Aber du vergisst, dass ich auch ohne Beziehung ganz zufrieden bin. Es gibt andere Dinge im Leben, die einen ebenso glücklich machen können. Das weißt du doch.«
»Natürlich.« Sie lächelte mich an, und ich konnte meinen bösen Ausdruck nicht länger beibehalten.
»Die Liebe ist nicht alles. Das weiß ich ja. Und ich habe ehrlich nicht vor, dich mit Keith oder irgendwem anders zu verkuppeln. Es ging mir bloß darum, dir klarzumachen, dass er sehr nett ist. Und hilfsbereit. Bestimmt fährt er dich gerne. Das wollte ich damit sagen.«
Ja, sicher. Ich war nicht blöd genug, um das zu glauben, aber ich wollte das Thema nicht vertiefen.
»Na schön. Ich schreibe ihm.«
Rina lächelte wieder. »Danke dir. Fürs Einkaufen, meine ich.«
»Passt schon«, winkte ich ab. »Triffst du dich nachher noch mit Blair?«
»Nein, heute nicht mehr. Aber morgen Abend. Wir gehen zusammen tanzen.«
»So langsam macht es ihm richtig Spaß, was?«
Zumindest waren sie in letzter Zeit oft im Tanzcafé gewesen.
»Ich glaube zwar, das hat eher was mit den tollen Cocktails zu tun, die es im 1001 Nights gibt«, Rina lachte. »Aber er wird auf jeden Fall besser.«
»Besser als deine Quiche?«
»Hör auf, immer auf meiner Quiche herumzuhacken. Das war ein missglückter Versuch. Morgen gelingt sie mir sicher.«
Ich schüttelte den Kopf. »Warum muss es unbedingt eine Quiche sein? Ich begreife das nicht.«
»Weil Deena behauptet hat, so etwas gelänge mir nicht.«
»Oh Gott.«
Während Rina lachte, sah ich sie bloß fassungslos an. »Du lässt dich von ihr provozieren? Wegen einer dämlichen Quiche?«
»Es ist nur Spaß, Rubye. Ehrlich. Außerdem sollen die wirklich super schmecken.«
»Klar, wenn man sie richtig macht, bestimmt.«
Rina verzog schmollend ihr Gesicht. »Ich gehe jetzt baden und gönne mir anschließend einen gemütlichen Abend auf dem Sofa.«
»Mach das. Vielleicht suchst du im Internet noch nach Rezepten. Für die nächste Quiche.«
Lachend ließ ich Rina in der Küche stehen. Manchmal konnte ich es mir nicht verkneifen, sie ein bisschen zu ärgern. Herumalbern war unsere neu gefundene Art der Kommunikation, und es funktionierte wunderbar. Wir waren uns jetzt näher als früher. Und wenn das bedeutete, dass ich Rina dafür ab und an auf den Arm nehmen musste, war ich gerne bereit dazu. Manchmal tat es ohnehin gut, einfach ein bisschen kindisch zu sein und den Ernst des Lebens abzuschütteln. Nur für ein paar Minuten.
In meinem Zimmer fühlte ich mich unbeaufsichtigt genug, um das Handy aus meiner Unitasche zu holen. Ich setzte mich aufs Bett und speicherte Keith’ Nummer unter Kontakten, bevor ich die vielen Zahlen, die Rina mir eben unter die Nase gehalten hatte, wieder vergaß.
Für Sekunden starrte ich auf mein Display und überlegte, was ich ihm schreiben sollte. Dabei drifteten meine Gedanken zu der Frage, wer er eigentlich war. Nicht als Mensch, sondern an sich. Er war nicht mein Stiefbruder, denn ich war nicht Rinas Kind. Ich war ihre Schwester. Keith war also … was? Gab es so etwas wie Stiefneffen?
Das Wort allein brachte mich so sehr zum Lachen, dass ich mich rücklings auf mein Bett fallen ließ und wartete, bis ich mich wieder unter Kontrolle hatte. Danach setzte ich mich auf und schrieb, was mir durch den Kopf schoss, ohne ein zweites Mal darüber nachzudenken.
»Hi Keith. Lust für deine Stieftante morgen den Chauffeur zu spielen? Ich muss einkaufen und hab ’ne Allergie gegen den Bus.«
Grinsend schaltete ich mein Handy aus und legte es beiseite. Es gab nichts Schlimmeres, als beim Schreiben unterbrochen zu werden. Ich warf meine Schreibkladde, Bleistift und Radiergummi aufs Bett. Alles, was ich jetzt noch brauchte, war meine Gitarre. Sie hatte bereits einige Jahre auf dem Buckel, aber da sie aus Massivholz gearbeitet war, sah man ihr die Zeit kein bisschen an. Sie hatte sechs Saiten und war modal gestimmt, wie es in der irischen Musik oft verwendet wird. Das entsprach meiner momentanen Art und Weise, Songs zu Papier zu bringen.
Während ich begann, langsam und sicher eine Melodie zu zupfen, schloss ich meine Augen. Dieses Lied konnte ich blind spielen. »May It Be« war eines meiner absoluten Lieblingsstücke. Ich nutzte es gern, um mich zu erden und freizumachen, bevor ich anfing, meine Worte niederzuschreiben. Erst wenn ich damit fertig war, transferierte ich sie in Noten und schrieb an der Tabulatur für den Song.
Ob das klug war, ob man es so oder anders machte, wusste ich nicht. Deswegen war ich ja auch gespannt auf den Songwriter-Kurs im Herbst, aber für mich funktionierte diese Variante bisher gut genug. Es war ja nicht so, als wollte ich die Lieder anderen vorspielen. Manchmal fragte ich mich, ob ich das je können würde. Alle meine Texte handelten von mir. Von meinen Gefühlen und meinen Gedanken. Sie waren zu persönlich, um sie mit der Öffentlichkeit zu teilen. Es hätte mich viel zu verletzlich gemacht.
Verletzlich …
Ich griff nach meinem Stift und fing an zu schreiben.
Blind
Ich tanze im Regen.
Allein. Glücklich. Verwegen.
Niemand da, der mich sieht.
Niemand, der mich liebt.
Aber ich.
Still. Still stehe ich im Sonnenlicht.
In der Menge, so allein. Das Leben, es bricht.
Immer jemand da, der mich hält.
Wenn der Regen in die Sonne fällt.
Ohne mich.
Regen und Sonne kommen und gehen, sind eins.
Kannst du es sehen?
Im Regen die absolute Stille, in der Sonne die Dunkelheit.
Es ist nicht der Regen, nicht die Sonne, die mich befreit.
Kannst du es sehen?
Ich tanze. Tanze im Regen.
Allein. Glücklich. Verwegen.
Stehe still im Sonnenlicht.
In der Menge, allein. Das Leben, es bricht.
Regen und Sonne kommen und gehen, sind eins.
Kannst du es sehen?
Kannst du mich verstehen?
Downtown
Um zehn klingelte mein Handywecker. Normalerweise stellte ich mir an Wochenenden keinen Wecker. Ich schlief gerne aus, und das bedeutete, vor elf kam ich nicht in die Gänge. Da ich heute jedoch viel erledigen wollte, hatte ich mir gestern ausnahmsweise doch den Wecker gestellt.
Der Holzboden unter meinen Füßen fühlte sich kalt an, und die Versuchung, zurück ins warme Bett zu klettern, war groß. Es war spät geworden. Bis weit nach Mitternacht hatte ich an meinem Lied gefeilt, dann erst war ich mit den Noten und der daraus entstandenen Melodie zufrieden. Jetzt war ich also um ein ungehörtes Lied reicher und um einige Stunden Schlaf ärmer. Trotzdem waren meine Gedanken nicht mehr so laut und mein Kopf nicht mehr so voll. Das fühlte sich gut an. Ich verließ mein Zimmer, um ins Bad zu gehen.
Da Rina bereits im Laden war, benutzte ich ihr Bad. In der Badewanne ließ es sich besser duschen als in der schmalen Kabine im Gästebad. Die hatte die Bezeichnung Dusche gar nicht verdient.
Nachdem ich im Bad fertig war, band ich mir das lange Haar zusammen und lief wieder hinunter in mein Zimmer. Dort griff ich erst mal nach meinem Handy, um zu sehen, ob Keith geantwortet hatte. Daran hatte ich gestern gar nicht mehr gedacht, und es war mir eben in der Dusche erst wieder eingefallen, dass ich ihn gefragt hatte, ob er mich fahren könnte.
»Komme dich um elf abholen.«
Ich warf das Handy zurück aufs Bett und sah auf die Uhr. Das war in einer halben Stunde. Mir blieb also nicht mal mehr Zeit, um zu frühstücken.
Ich schlüpfte in eine meiner vielen Treggings, die ich hatte. Sie war aus einem dunkelblauen Jeansstoff und ging mir bis über die Knie. Es sollten heute 25 Grad werden, deshalb entschied ich mich für ein T-Shirt mit halbem Arm. Es war blau und trug einen für mich typischen Aufdruck: Hard Rock Café. Ich liebte solche Oberteile, von denen ich eine ganze Menge besaß.
Nachdem ich angezogen war, ging ich noch mal in mein Bad, cremte mir das Gesicht ein und legte ein wenig Make-up auf. Ich benutzte weder Rouge oder Puder. Im Alltag hielt ich mein Make-up lieber klassisch dezent, aber ohne verließ ich nicht das Haus.
Ich kämmte mein Haar und steckte den Föhn in die Steckdose. Meine Haare waren länger als die von Rina. Während sie in fast jeder Hinsicht nach unserem Vater kam und aussah wie die typische hübsche Amerikanerin, war ich irgendwas dazwischen.
Ich war 1,76 Meter groß und hatte dieses dunkelblonde Haar, das man überall sah. Meine Augen waren der Form nach die Augen meiner Mom. Asiatisch schmal. Allerdings waren sie nicht so verheißungsvoll braunschwarz. Noch nicht mal katzenhaft grün. Sie waren irgendwas dazwischen. Eine total seltsame Mischung. Wie alles an mir. Rina glaubte, es machte mich besonders. Doch in Wahrheit machte es mich nur anders – und das war ganz und gar nicht das Gleiche. Anders zu sein war viel zu oft verdammt schwierig.
Es schellte, als ich mir gerade meine Chucks anzog. Solange es nicht 30 Grad warm war, verzichtete ich selten auf meine Lieblingsschuhe. Ich hatte verschiedene Modelle, aber Chucks konnte man meiner Meinung nach nie genug haben.
Ich drückte den Türöffner und wartete, bis Keith auf dem Treppenabsatz erschien.
»Hi«, grüßte er mich.
Mein Blick glitt nur flüchtig über ihn. Er trug eine lange hellblaue Jeans, darüber ein weißes T-Shirt mit hellblau abgesetztem Rand, weiße Turnschuhe und eine Sonnenbrille von Ray-Ban. Typisch für jemanden, der gern auf sportlich coole Klamotten zurückgriff.
»Hi. Wollen wir gleich los?«, fragte ich ihn direkt.
»Klar. Wenn du willst.«
»Ja, will ich.«
Ich zog die Tür hinter mir zu, schloss ab und steckte den Schlüssel in meine Tasche. Dann ging ich an Keith vorbei und durchs Treppenhaus nach unten. Auf der Straße suchte ich bereits nach Blairs Auto. Das kannte ich mittlerweile gut genug, um es auch schnell zu finden.
Als ich mich angeschnallt hatte, fragte Keith mich, wohin ich denn wollte.
»Macht es dir was aus, wenn wir zwei Märkte anfahren? Im Farm Market haben sie ein paar Sachen im Angebot, doch ich bekomme da nicht alles, was wir brauchen.«
Ich hatte keine Lust, ihm auf die Nase zu binden, dass Rina und ich beim Einkaufen genauso aufs Geld achten mussten wie bei allem anderen auch. Es ging ihn nichts an.
»Okay, wieso nicht? Solange es da irgendwo einen Kaffee gibt.« Er lächelte mich an. Ich sah es an seinem Mund, denn durch die Sonnenbrille konnte ich seine Augen nicht erkennen. Allerdings hatte er wie Blair Grübchen, die verrieten, wenn er lächelte.
»Lang geschlafen, ergo keine Zeit für Frühstück. Aber ohne Kaffee komme ich nicht so richtig auf Tour«, erklärte er.
»Ich habe auch noch nicht gefrühstückt.«
»Warum fahren wir dann nicht erst was essen und später einkaufen?«
»Hast du denn so viel Zeit?«
Keith zuckte mit den Achseln. »Ich habe heute nichts vor.«
Einen Moment musterte ich ihn, um zu erkennen, wie ernst er seine Worte meinte; schließlich nickte ich.
»Na gut. Dann lass uns erst frühstücken gehen. Ich könnte nämlich auch einen Cappuccino gebrauchen.«
»Cappuccino?«
»Ja, ich trinke keinen Kaffee. Zumindest nicht, wenn ich es mir aussuchen kann.«
»Cool.«
»Was findest du daran cool?«
Keith zuckte wieder mit den Achseln. Ich erkannte, dass es sich um eine für ihn typische Geste handelte. Indifferent. Das passte zu ihm. Er schien immer etwas zu verbergen. Ganz anders als ich.
»Ist nicht die Norm. Entweder mag man Kaffee oder eben nicht. Wer bitte mag Kaffee und trinkt trotzdem lieber Cappuccino?«
»Frauen«, erwiderte ich prompt.
»Mädchen«, konterte er, und ich lächelte.
»Vielleicht. Auf jeden Fall ist es keine Seltenheit.«
»Mag sein. Ist dennoch cool. Ich hätte dich für eine Teetrinkerin gehalten.«
»Echt? Sehe ich etwa aus wie eine Ökotante?«
Keith lachte tonlos. »Nein. Aber deine Schwester hat einen unverkennbaren Teetick. Dachte, der liegt in der Familie.«
Das entlockte mir ein Lächeln. »Rina und ich sind ziemlich verschieden. Vertrau mir; bloß weil sie für Tee schwärmt, heißt das nicht, dass es mir auch so geht.«
Keith nickte uneinschätzbar. Danach schwiegen wir beide. Es störte mich, dass er kein Radio anhatte. Ich war es gewohnt, beim Autofahren Musik zu hören. Nach Jahren harter Überzeugungsarbeit ließ Channing mich sogar den Sender bestimmen. Er hatte eingesehen, dass ich mehr Ahnung von Musik hatte als er. Warum hatte ich eigentlich nicht ihn gebeten, mich zu begleiten?
Ich verzog das Gesicht. Dass ich nicht schon gestern Abend darauf gekommen war! Rina hatte sich wieder den besten Moment ausgesucht, mich zu dieser Schnapsidee hier zu überreden.
»Wo fahren wir eigentlich hin?«
Überrascht wandte ich den Blick vom Fenster zu Keith.
»Ist das dein Ernst?«
Erneutes Schulterzucken. »Ich kenn mich nicht gut genug aus, um zu wissen, wo man hinfährt, wenn man hier frühstücken will.«
»Unfassbar.«
»Also?«, überging er meine Feststellung, als hätte ich nichts gesagt.
»Fahr da links ab, die zweite rechts und danach immer geradeaus. So kommst du ins Stadtzentrum. Du kannst auf dem freien Parkplatz gleich am Anfang parken, und wir laufen von dort.«
»Okay.«
In fünf Minuten erreichten wir den Parkplatz, von dem ich gesprochen hatte. Er war zwar gut besucht, aber Keith fand mit etwas Glück eine freie Lücke.
»Weißt du, Boulder ist nicht so groß.«
»Das habe ich auch schon festgestellt.«
Ich zog meine linke Augenbraue hoch. »Ach wirklich?« Meine Stimme unterstrich die Ironie der Frage perfekt. Meine bevorzugte Art von Humor – Sarkasmus. »Wieso kennst du dich dann immer noch nicht hier aus?«
»Ich komme nicht viel raus. Arbeit und na ja.«
Und na ja? Das sagte alles. Er hatte keine Lust, sich hier auszukennen. Ich rollte mit den Augen und ging voraus.
Nach zehn Minuten erreichten wir das Stadtzentrum. Die Pearl Street. Und obwohl Boulder nicht groß war, lief bereits eine Menge Leute durch die Innenstadt. Vor dem Buchladen standen sie Schlange, weil es heute eine Signierstunde gab. Elise hatte mir davon erzählt. Ursprünglich hatte sie auch dahin gewollt. Jetzt suchte ich gar nicht erst nach ihr. Sie war bestimmt nicht dort.
Aber auch vor dem Starbucks war wieder die Hölle los. Selbst im Burger King saßen bereits Leute.
»Unfassbar«, murmelte ich. Für Fastfood am frühen Morgen hatte ich wirklich kein Verständnis. Wer tat seinem Körper bitte so was an?
»Was?«, fragte Keith und sah zu mir. Er zündete sich im Gehen eine Zigarette an.
»Vergiss es, war nicht so wichtig.« Stattdessen zeigte ich auf das Boulder Café. »Da gehst du hin, wenn du ein richtig gutes Frühstück willst.«
»Ich dachte, hier gibt es nur Kuchen und Teilchen. So was eben.«
Lächelnd schüttelte ich den Kopf. »Nein, du bekommst im Boulder Café einfach alles, was lecker ist.«
»Na schön. Ich werde mich davon überzeugen.«
»Mach das.«
Wir suchten uns einen Platz, und allein die Tatsache, dass wir uns zu einem Pärchen an den Tisch setzen mussten, bestätigte mich. Vielsagend blickte ich Keith an, der mir mit seinem gewohnten Achselzucken antwortete.
Stur. Er war Schotte.
Zwar kannte ich mich mit denen nicht aus, aber Rina las viele Romane, und da Autoren scheinbar eine Vorliebe für Schottland besaßen, kamen die in Büchern sehr häufig vor. Schon vor Wochen hatte sie mir erzählt, dass Schotten gar nicht so stur seien, wie sie in Büchern meist dargestellt wurden. Mir war natürlich klar, dass da nur ihre rosarote Brille sprach. Der Beweis saß hier vor mir. Wenn ich etwas über Keith Somerled wusste, dann dass er ganz sicher stur war.
Keith trank einen Kaffee und aß ein britisches Frühstück, dabei tippte er laufend auf seinem iPhone herum, anstatt mit mir zu reden. Ich selbst nippte an meinem Vanille-Cappuccino, dazu hatte ich einen Truthahn-Bagel genommen; das war eine absolute Sünde und schmeckte super. Als ich aufgegessen hatte, war ich pappsatt.
»Fertig?«, fragte ich Keith, der von seinem Handy aufsah und nickte.
»Dann lass uns gehen. Wenn du willst, können wir von hier aus zum Farm Market laufen. Es ist nicht weit, und ich brauch nur ein bisschen Obst und Gemüse.«
»Okay, klar.«
Keith stand auf, und wir verließen gemeinsam das Café. Draußen folgte er mir und schwieg dabei immer noch. Allerdings hatte er sein Handy weggesteckt. Wenigstens etwas. Dass er nicht darauf aus war, sich mit mir zu unterhalten, störte mich nicht wirklich. Mir war es lieber als erzwungener Smalltalk. Nicht gerade eine meiner Stärken.
Im Farm Market trennten wir uns. Keith wartete draußen, während ich in Ruhe meinen Einkauf erledigte. Da ich hier nur Obst, Gemüse, Rinas und mein Lieblingsmüsli sowie Milch, Käse, Wurst und verschiedene Joghurts kaufte, konnte ich die beiden Taschen auch gut allein tragen. Trotzdem nahm Keith mir eine davon ab, als ich nach draußen kam. Diesmal brauchten wir länger bis zum Parkplatz als auf dem Hinweg. Keiner von uns verspürte große Lust, zu reden, denn mit der Zeit wurden die Beutel schwer, und jedes Wort wäre zu viel gewesen.
Schließlich lud Keith die Taschen in den Kofferraum, und wir fuhren weiter zum Boulder Market. Den Weg kannte er, da auch seine Familie dort einkaufte. Ich wusste, dass ich hier etwas mehr Zeit brauchen würde, also verabredeten wir uns für zwei Uhr am Ausgang. Da direkt neben dem Markt die Pearl Street Mall lag, würde Keith keine Schwierigkeiten haben, sich für die Stunde zu beschäftigen. Mir war es recht so. Schließlich konnte ich mir Besseres vorstellen, als Tampons, Duschbad, Shampoo und Rasierschaum zu kaufen, während mir ein fremder Typ dabei über die Schultern schaute, der noch dazu der Sohn des Freundes meiner Schwester war.
Ein paar Minuten nach zwei kam ich beladen wie ein Packesel zum Ausgang. Keith pfiff durch die Zähne.
»Jetzt verstehe ich, wieso du einen Fahrdienst brauchst.«
»Ja, Rina hat mir einen Zettel mitgegeben mit Dingen, die sie unbedingt noch benötigt. Es war mehr, als ich gedacht habe.«
Allein die Getränke nahmen schon den halben Wagen ein.
»Warte, ich mach das.«
Keith nahm mir den Wagen ab und fuhr ihn nach draußen zum Parkplatz. Da ich bereits alles in Tüten verstaut hatte, ging es schnell, und zehn Minuten später verließen wir das Stadtzentrum in Richtung Sprucestreet.
»Und was machst du nachher?«, fragte Keith und überraschte mich damit völlig. Nachdem er die ganze Zeit nicht besonders gesprächig war, hatte ich überhaupt nicht mehr damit gerechnet.
»Ich packe jetzt erst einmal die Einkäufe aus. Danach besuche ich meine Freundin. Und heute Abend gehe ich mit Freunden weg. Das, was man eben samstagabends so macht.«
»Ja.«
Er starrte auf die Straße, sodass ich nicht in seinem Gesicht lesen konnte, aber seine Stimme verriet mir genug.
»Willst du mitkommen?«
Keine Ahnung, wie das über meine Lippen gekommen war. Mir war nicht mal klar gewesen, dass ich vorhatte, ihn das zu fragen. Es war spontan, und vielleicht hatte ich ihn deswegen so überrumpelt. Keith sah jedenfalls von der Straße zu mir und sagte kein Wort.
»Sorry, wenn das unpassend war. Ich dachte nur …«
Ja, was?
»Keine Ahnung, was ich gedacht habe. Wahrscheinlich nichts. Passiert mir manchmal, dass ich Dinge sage, ohne nachzudenken.«
»Schon okay. Das kenne ich. Ich habe zwei Schwestern.«
Daraufhin verzog ich das Gesicht. Natürlich. Für ihn war das eine Mädchensache. So wie die Cappuccino-Kaffee-Geschichte. Warum wunderte mich das nicht?
»Du würdest dich prächtig mit Channing verstehen, meinem besten Freund.«
»Ach ja? Wieso das?«
»Vertrau mir einfach. Wenn du ihn kennenlernst, wirst du wissen, was ich meine.«
»Noch habe ich nicht zugesagt.«
»Sag bloß, du hast was Besseres vor?« Herausfordernd sah ich ihn an und wartete darauf, dass er mir widersprach.
»Wann geht es los, und wo macht ihr hin?«
»Weiß ich noch nicht. Ich melde mich bei dir.«
»Cool.« Keith hielt den Wagen und hatte Glück, dass er direkt vor der Tür einen Parkplatz fand. Nachdem er mir geholfen hatte, alle Tüten und Getränke in die Wohnung zu tragen, wobei er den fehlenden Aufzug genauso beklagte wie ich sonst, verabschiedete er sich und fuhr nach Hause, oder wo immer es ihn hinzog, um seinen Nachmittag totzuschlagen. Vielleicht suchte er ja auch seinen Dad auf der Baustelle auf. Keine Ahnung, wie das bei ihm lief. Ich wusste nicht, ob Keith feste Arbeitszeiten hatte, für seine Arbeit bezahlt wurde oder einfach nur hier und da aushalf.
Eine Dreiviertelstunde später hatte ich ausgepackt, Wäsche aufgehängt und mich frisch gemacht. Ich steckte mir die Stöpsel meines iPods in die Ohren und verließ die Wohnung, um meiner besten Freundin einen Besuch abzustatten.
You’ve Got A Friend
Von mir zu Elise war es nicht allzu weit. Sie wohnte in der Mahaoe Street, im Boheme-Viertel Boulders. So genannt, weil die Häuser alle sehr individuell gestaltet waren. Sowohl außen als auch innen. Meistens lebten dort gut verdienende Künstler, Architekten, Anwälte, Ärzte und unser Bürgermeister. Da ich mit Elise und Chris schon so viele Jahre befreundet war, kannte ich mich in dem Viertel aus, als hätte ich selbst dort gewohnt. Ich wusste über alle Schlupfwege und Abkürzungen Bescheid. So brauchte ich nicht mehr als eine halbe Stunde, bis ich bei Morgans an der Haustür klingelte und darauf wartete, dass mir jemand aufmachte.
Es dauerte einen Moment, doch dann erschien Abygail. Sie lächelte, als sie mich sah, und ich erkannte sofort die Erleichterung in ihrem Blick. Sie verriet mir, dass meine Sorge um Elise berechtigt gewesen war.
»Wo ist sie?«, kam ich gleich zur Sache.
»Hallo Rubye.« Abygail überging meine Frage und bat mich herein.
»Ist sie nicht zu Hause?«
»Doch, sie ist da. Ich dachte mir, du kannst vielleicht was zu trinken und zu essen mitnehmen, wenn du zu ihr gehst.«
»Alles klar. Sie hat sich in der Garage eingeschlossen, oder?«
Ich wusste die Antwort, dennoch nickte Elise’ Mutter und seufzte.
»Schon die ganze Woche. Sie kommt nur raus, um mal auf die Toilette zu gehen oder sich ein Wasser und ein paar Kekse zu nehmen. Ich bin immer sehr tolerant gewesen, wenn Elise diese Aussetzer hatte. Aber irgendwann ist Schluss. Das geht so nicht weiter.«
Abygail war Ärztin. Sie hatte Elise’ melancholische Tendenzen früh erkannt und herausgefunden, dass es ihr half, sich mit Malen abzulenken. Normalerweise kam sie von selbst aus diesen Phasen heraus, aber über eine Woche hatten sie noch nie angedauert.
»Es ist zu lang«, sinnierte sie laut, und ich stimmte ihr mit einem Nicken zu.
»Ja, sie hat sich die ganze Woche nicht gemeldet. Kein Wort von ihr.«
»Es wird nicht leicht sein, zu ihr durchzudringen.«
Ich sah Abygail fragend an.
»Du wirst verstehen, was ich meine, wenn du sie siehst. Aber du hast bestimmt mehr Glück als ich. Mich will sie im Augenblick nicht sehen, und das kann ich ihr nicht verübeln.«
»Na gut.«
Ich griff nach dem Wasser und dem Teller, auf dem zwei Stücke Kuchen und zwei Gabeln lagen.
Den Weg zur Garage kannte ich. Nach Abygails Vorwarnung wunderte es mich nicht, dass die Tür zur Garage verschlossen war.
»Elise? Ich bin’s, mach auf.«
Nichts passierte. Ich hörte nicht mal Musik. Kein gutes Zeichen.
»Elise! Mach schon auf. Mir fällt der Arm ab, und ich hab keinen Bock, die halbe Stunde umsonst hergelaufen zu sein.«
Als Elise die Tür öffnete, trat ich ein, bevor sie es sich anders überlegen konnte. Zum Vertrauensbeweis schloss ich gleich wieder hinter mir ab. Dann drehte ich mich zu ihr um und holte erschrocken Luft.
»Du siehst total durchgeknallt aus.«
Elise gegenüber war ich immer ehrlich. Schonungslos. Wir beide kannten keine andere Art, miteinander umzugehen.
»Ich weiß.« Sie zuckte mit den Achseln.
Mein Blick glitt von ihrem blassen Gesicht zu den tiefen Furchen unter ihren Augen. Sie sah aus, als hätte sie sich entweder was Schweres reingezogen oder die ganze Woche nicht geschlafen.
»Kaffee«, beantwortete Elise meine unausgesprochene Frage. »Zu viel Kaffee.«