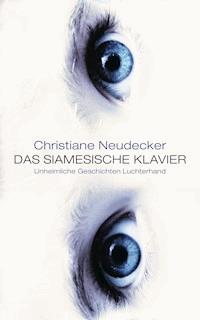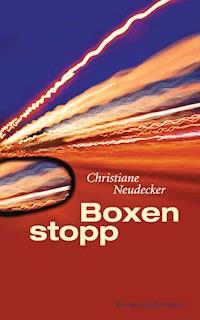
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die malerische Kulisse Portugals. Das Dröhnen der Boliden auf der Rennstrecke von Estoril. Und eine Frau, die mit einer männerdominierten Wirtschaftswelt kollidiert.
Als erfolgreiche Fernsehmoderatorin wird sie häufig für Marketing-Events gebucht. Diesmal soll sie gleich einen ganzen Monat für die Präsentation eines luxuriösen Sportwagens zur Verfügung stehen. Autos haben sie nie interessiert, doch die Aussicht ist verlockend: Das neue Modell wird auf der ehemaligen Formel 1-Rennstrecke im portugiesischen Estoril den Vertragshändlern aus der ganzen Welt vorgeführt. Sie akzeptiert. Und damit beginnt ein Sturz in die Katakomben des Big Business – dorthin, wo sich die Grenzen von Geld, Gier, echten Gefühlen und glitzernden Oberflächen verwischen. Denn im Zentrum wirtschaftlicher Macht gelten eigene Gesetze.
Christiane Neudecker, für ihre klare, atmosphärische Prosa vielfach ausgezeichnet, gelingt mit "Boxenstopp" ein literarischer Trip in die Abgründe der Wirtschaftswelt, ins marode Innere unserer Gesellschaft: poetisch, zornig, hochaktuell.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Handlung und alle handelnden Personen dieses Romans sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig.
Die Arbeit der Autorin am vorliegenden Buch wurde durch den Deutschen Literaturfonds e. V. gefördert.
© 2013 Luchterhand Literaturverlag, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Gesetzt aus der Trump Mediäval
Satz: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-10884-7V002
www.penguin.de
»Driften ist die Kunst, einen instabilenZustand stabil zu halten.«
Walter Röhrl
Er muss stürzen. Seit heute Morgen habe ich nichts anderes im Kopf, nein, nicht erst seitdem: der Gedanke hat mir schon die Nacht zerrissen, er hat sich in meinen Schlaf geschraubt, mich hin und her geworfen und vom Kopfende zum Fußende verdreht mit diesen drei Worten, er muss stürzen. Es geht nicht anders, es darf gar nicht anders sein. Wenn es noch Gerechtigkeit in diesem Staat gibt, der sich Rechtsstaat nennt, dann beschwöre ich Euch: lasst ihn stürzen, stürzen, stürzen.
Der Prozess wird in einer Woche beginnen, endlich ist es soweit. Gestern haben sie es endgültig in den Medien bestätigt, und plötzlich ist alles wieder da, ist bei mir, so nah, als wäre es heute erst gewesen und nicht vor fast einem dreiviertel Jahr. Sieben lange Tage noch sind es, bis die Berufsrichter und die Schöffen ihn vor sich stellen und ihn schwören lassen werden, die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit, aber ich kann schon jetzt nicht mehr still stehen, ich laufe vor und zurück, ich höre ein Keuchen, das außerhalb ist, fern von mir. Denn glaubt mir, ich selbst bin das nicht, ich, dafür hat er ja gesorgt, atme längst schon nicht mehr.
»Du Schlampe«, flüsterte er mir in mein Ohr, »du miese kleine Schlampe.« Seine Lippen berührten mein Haar, seine Stimme klang so freundlich, er lächelte den anderen zu, die an uns vorüberwirbelten, er wirkte so gelöst, so frei, nur seine Hand hätte ihn – hätte jemand uns genau beobachtet – verraten, seine Fingerkuppen mit den manikürten Nägeln, die sich in meine Hüfte gruben, sich einbohrten, so tief, dass ich am nächsten Morgen fünf sichelförmige Blutergüsse auf meiner Haut finden würde. Wir kreisten und kreisten, die Bassschläge der Musik zuckten durch unsere Körper und ich öffnete den Mund, wollte ihm widersprechen, ihm sagen, dass ich gerade das doch eben nicht war: eine seiner Schlampen, dass er doch einsehen müsse, dass er mich nicht kaufen könne, mich nicht, aber noch während ich Luft holte, gab es an der Seitenfront des Raumes ein Krachen und er ließ mich los und ich schlitterte im Nachdrall der Drehung über den Tanzboden und sah im Vorüberwischen den Agenturchef, der auf dem Boden lag, die Hand in seinen Brustkorb verkrallt, auf sich die Überreste des Buffets, das er umgerissen hatte, die Salatblätter, die herabtriefende Mayonnaise in seinem angegrauten Bart, die fettigen Shrimps auf seinen blutunterlaufenen Augen, jemand lachte schrill, jemand rief nach einem Arzt, ein Glas zersprang, und ich wandte mich ab und streifte dabei seinen Blick, diesen hasserfüllten Blick, mit dem er mich ab jetzt ansah. Aber das war später.
Niemand will mehr mit mir darüber reden. Sie haben es alle schon zu oft gehört, sie wenden sich weg, wenn ich wieder davon anfange, ich sehe ihren Widerwillen, lese ihn ab von der sich verschränkenden Haltung ihrer Gliedmaßen, von ihren sich schließenden Mündern, den sich senkenden Köpfen. Sie werden so still, sie wollen und werden sich nicht mehr wiederholen, sie haben, ich müsste es einsehen, doch alles schon mehrfach gesagt. Und sie haben ja recht: es hätte mich nicht so aus dem Gleichgewicht bringen dürfen, es gibt andere Karrieren, andere Möglichkeiten, man hat nie nur einen einzigen Weg in seinem Leben.
»Du wirst es bereuen«, sagte er. Kurz vor einem meiner letzten Auftritte stand er plötzlich neben mir auf der Hinterbühne und ich sah zu ihm hoch, »du wirst es bereuen«, sagte er noch einmal, und er wirkte ganz höflich dabei, ganz fröhlich, als würde er mir ein Angebot machen, würde mich einladen an etwas teilzunehmen, das ohnehin stattfinden würde – im Zweifelsfall ohne mich. Und ich zuckte mit den Schultern und zupfte einen Flusen von meinem Kostüm, ich lächelte und dachte noch, dass er mir doch nichts anhaben könnte, dass ich abreisen würde, bald, und er doch jenseits dieses Orts keinen Einfluss mehr haben würde auf mich, und dann öffneten sich vor uns die Flügeltüren in der Bühnenrückwand und jemand griff von hinten nach mir und riss mich zurück, während er an mir vorbei auf die Rampe hinaus stürmte, hinein in das Scheinwerferlicht, in den sektgeschwängerten Atem der wartenden Masse, die zu jubeln anfing, sobald sie ihn sah.
Eine forensische Arbeit sei das, schrieben sie, als vor Monaten die ersten Artikel erschienen und klar wurde, dass der Konzern diese Anzeige erstatten würde, eine Ausgrabung in den Tiefenschichten der Wirtschaftsindustrie. Schon an der Struktur scheiterten die meisten der Journalisten, sie brachten Eigner und Aktionäre durcheinander, sie verwechselten Betriebs- und Aufsichtsrat und betitelten ihn als Aufsichtsratsvorsitzenden, der er doch gar nicht ist. Dabei kam sein Name erst sehr spät ins Gespräch, er selbst ist ja gar nicht angeklagt, immer noch nicht, er opfert den Bauern: den Abteilungsleiter für Marketing. Und seine eigene Mitwisserschaft, seine Befehlsgabe (die Anstiftung zu Untreue, Beihilfe zum Betrug, zu Verdunklung, zum Verstoß gegen das Verfassungsgesetz, all diese mir fremden Worte) müssen sie ihm, dem geladenen Zeugen, erst einmal nachweisen.
Ich möchte glauben, dass alles inszeniert ist. Dass jemand, der über ihm steht, Interesse hat an seinem Fall. Viele bleiben da nicht, er ist zu mächtig geworden, er ist höher als oben, die Luft um ihn herum ist so dünn. Aber es muss einen Grund geben, warum die Dinge jetzt ans Licht kommen, warum die Staatsanwaltschaft und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft begonnen haben zu graben, hervor zu zerren, zu sezieren: auch dieser Fisch stinkt vom Kopf. Jemand hat diesen Prozess ins Rollen gebracht, jemand hat den Giftschrank geöffnet und eine Bombe gebaut und auch wenn ich mir wünschte, es wäre anders: ich war es nicht. Der Prozess hat mit mir nichts zu tun. Und auch er, er selbst, betrifft mich doch gar nicht, zumindest nicht mehr. Das weiß ich und weiß ja auch, dass ich selbst es bin, die ihm diese Macht über mich gegeben hat, nur ich ganz allein.
Ich sollte aufhören damit. Ich sollte mich abwenden, mich ablenken, endlich wieder vorwärts denken. Stattdessen laufe ich hier in meiner Wohnung herum, ich pendle hin und her, durchmesse meinen Flur mit viel zu schnellen Schritten. Im Vorübergehen streife ich mit den Fingern über die beiden verschlossenen Zimmertüren, die nach links abgehen. Ich habe sie seit November nicht mehr geöffnet. Seit P. ausgezogen ist, wohne ich in meinem kleinen Arbeitszimmer und erzähle niemandem davon, es klänge verrückter als es ist.
Dass ich hinfahren könnte, denke ich, als ich gerade wieder die aufgeschlagene Zeitung auf der Küchenanrichte passiere: ich könnte beiwohnen. Der Prozess findet in München statt, ich könnte das Landgericht anrufen und mich erkundigen, nach Uhrzeiten, Saalnummer, Platzkarten. Die Verhandlung muss frei zugänglich sein, so leicht kann niemand die Öffentlichkeit ausschließen lassen, nicht einmal er.
Aber dann stelle ich mir vor, wie das wäre. Die wartenden Ü-Wagen auf dem Vorhof des Gerichtsgebäudes, die Kameras, die drängelnden Kollegen am Aufgang zum Saal, die Beamten, die Sicherheitsleute in der Kontrollschleuse, denen ich mit meinen Wertsachen ja auch meinen Pass reichen müsste – sie alle würden mich erkennen. Sie würden ihre Folgerungen ziehen, den letzten, noch fehlenden Rückschluss. Das kann ich nicht wollen.
Und außerdem: Ich möchte ihm ja gar nicht begegnen, nie wieder.
Schneyder Motors – drive your dream.
Was für ein Kerl, habe ich gedacht, als ich ihn zum ersten Mal sah, was für ein Kerl von einem Mann, und: kein Wunder, dass jemand von seiner Statur so viel Macht besitzt. Ich stand unten auf der Rennstrecke, über mir der Brückenbau, den sie eigens für die Veranstaltung über die Zielgerade gezogen hatten: ein geschlossener Glasraum auf Stahlstreben, der, so schätze ich, mindestens zweihundert Leute fassen konnte. Ich hielt mich im Dunkeln, knapp außerhalb des Lichtquadrats, das der erleuchtete Glasbau von oben auf den Asphalt zeichnete, ich stand da und sah hoch zu ihm. Die Generalprobe muss das gewesen sein, die Generalprobe für die Enthüllung, den Reveal, und ich weiß noch, dass ich verwundert war, dass ich mich fragte, ob jemand wie er überhaupt einer Probe bedurfte. Er war das Zentrum dieses Luftaquariums, er lehnte am Rednerpult vor der noch leeren Zuschauertribüne, stand mit dem Rücken zur hinterleuchteten Glasfront und ich konnte von draußen nur seinen breitschultrigen Umriss erkennen, seine lichtumrandete Silhouette. Um mich herum kroch der Spätsommernebel in die Baumwipfel hinein, die Dunkelheit wurde dickflüssig, ich sah keine Flugzeuge im nächtlichen Sinkflug auf Lissabon mehr, nur noch den gedämpften Lichtreif des blinkenden Spielcasinos von Estoril, keinen einzigen Stern. Es roch nach Motoröl und Meer, ich wartete und betrachtete ihn, während sie oben die Farbfilter wechselten, das Licht auf ihn fokussierten, ihr Firmenlogo in den ganzen Raum hinein projizierten, ein rotierendes, zerfallendes Kaleidoskop, das sich um ihn herum drehte. Zwischen meinen Fingern flatterten die Karten mit den Stichworten im Wind, hinter mir öffnete sich quietschend eines der Rolltore an den Werkstatt-Boxen und gebückte Gestalten schoben sich darunter hindurch. Über ihre Glitzerkostüme hatten sie weiße Frotteebademäntel geworfen, ihre Gesichter waren blass gepudert, mit dicken Rouge-Balken und blutrot nachgezogenen Mündern und schwarz umrandeten Augen, die offenstehenden Gürtel ihrer Mäntel schlängelten hinter ihnen über den Asphalt. Sie kicherten und brachten einen eigenartigen Geruch mit sich, nach Schweiß und Staub und Aceton, sie schwankten auf viel zu hohen Pfennigabsätzen durch die Dunkelheit, an mir vorüber und auf ihn zu. Das war der Moment, in dem ich begriff, dass wir diesen Ort entfremdeten, dass wir etwas hierherbrachten, das hier nichts zu suchen hatte, dass wir, so dachte ich, diese Rennstrecke entweihten: das Autódromo Fernanda Pires da Silva, den Circuito Estoril.
Immer wieder träume ich von dem Streckenverlauf des Autodroms. Er hat sich mir eingegraben, ist ein Stachel, den ich mir nicht ziehen kann. Im Traum sehe ich die Rennstrecke von oben, immer von oben. Eine Luftaufnahme ist das, die Linienführung verschlingt sich von dort zu einem Drachen, der sich mit rückwärts gerecktem Haupt in den eigenen Schwanz beißen will.
Dass der Ort nichts dafür kann, ist mir klar. Das Autódromo nicht, Estoril nicht, Sintra nicht. Nicht das Cabo da Roca, die steilen Schieferklippen der Westküste, der Atlantik. Und Lissabon nicht, natürlich nicht, meine geliebte, treppendurchmaserte Stadt.
Erinnerungen an L.: das Licht und seine Brechungen über dem unfassbar ruhig dahin fließenden Tejo. Der gleißend strahlende Innenhof des Hieronymus-Klosters. Mein Lachen, als der kleine gelbe Straßenbahnwaggon mit der Nummer 28 bei der steilen Auffahrt zum Castelo plötzlich angeschrägt stehen bleibt und die dicht gedrängten Fahrgäste unaufhaltsam abwärts rutschen. Der Burgberg. Das versteckte Restaurant mit dem endlosen Ausblick, das ich doch P. zeigen wollte. Wozu es nie kam.
Ich könnte zurück. Ich könnte, statt zum Landgericht zu fahren, nach Lissabon fliegen. Der Gedanke kommt mir plötzlich, gerade wollte ich wieder wenden, aus dem Arbeitszimmer herauslaufen, zurück in den Flur, aber jetzt halte ich inne. Einen Moment lang lausche ich. Der Heizkörper pocht, draußen schliert das Schmelzwasser der abtauenden Eiszapfen über das Fensterglas. Ich wende mich meinem Schreibtisch zu und setze mich langsam hin, zum ersten Mal an diesem Tag.
Das Autódromo, dieser Ort.
Ich könnte wirklich zurück. Ich könnte die Zeit bis zum Prozess dort verbringen, die sieben langen Tage, zumindest würde ich mir dann endlich wieder eine Richtung geben. Der Gedanke gefällt mir, er hat eine nicht zu erklärende Folgerichtigkeit (ich wieder dort, er vor Gericht), wer sollte mich hindern, es gibt niemanden mehr. Und Zeit, nun, Zeit, dafür hat er ja gesorgt, habe ich mehr als genug.
Testweise gebe ich meine Anfrage in die Suchmaschinen ein, erst zögernd, dann immer zielstrebiger. Abflug Berlin, oder Abflug Frankfurt, München, mit oder ohne Zwischenstopp, heute, morgen, mir egal.
Morgen. Es existiert ein Flug für morgen Nachmittag über Paris, aber auf einmal ist mir das zu spät, erneut gebe ich meine Schlagworte ein, ich insistiere: lissabon + berlin + flug. Und da finde ich eine Billigfluglinie, die vorher nicht registriert gewesen war, und ich atme ein und wieder aus, denn, ja, zweimal wöchentlich fliegen sie. Und sie fliegen direkt, immer donnerstags, immer montags, also heute. Berlin Schönefeld nach Lissabon, oder besser: SXF nach LIS.
Ich klicke den Flug an, markiere: nur Hinflug. Ein kleines, rot umrandetes Fenster ploppt auf. Sie haben als Abflugdatum heute gewählt, steht da, die heutigen Flüge werden, sofern sie stattfinden, mindestens zwei Stunden lang angezeigt, SIE SELBST SIND FÜR IHRE RECHTZEITIGE ANKUNFT AM FLUGHAFEN ZUM EINCHECKEN VERANTWORTLICH – MINDESTENS 40 MIN VOR ABFLUG.
Ich sehe auf die Uhr. Dann klicke ich: buchen.
Der Taxifahrer erkennt mich. Ich kann es in seinen Augen sehen, als er sich umdreht. Jedesmal fährt ihnen ein Zucken durch die Pupillen, eine Veränderung innerhalb von Millisekunden. Ich habe einen Blick dafür, kann es auch bei denjenigen diagnostizieren, die sich im Griff haben, denen nicht die Gesichtszüge entgleisen. Viele sprechen mich dann an, sie trauen sich das jetzt, sie haben, finden sie, ein Recht dazu. Früher war das anders. Davor.
»Schönefeld«, sage ich, »Flughafen.« Er öffnet den Mund und schließt ihn wieder. Einen Moment lang scheint er zu überlegen. Seine Hände fingern an dem Drehknopf des Radios herum, er stellt einen Klassiksender ein. Dann nickt er stumm und fährt los.
Mir ist kalt. Ich habe meinen Wintermantel nicht dabei. Er wird, hoffe ich, in Portugal nicht nötig sein, es ist schon fast Ende März. Ich kann diesen schwarzen Daunenmantel nicht mehr sehen. Seit es im November den ersten Schnee gegeben hat, habe ich das Haus nicht mehr ohne ihn verlassen. Man kann seine Kapuze tief in die Stirn ziehen, man kann sich verhüllen, und das war nötig geworden, so nötig.
Am Alexanderplatz nimmt der Fahrer eine Linksbiegung zu knapp, unter den Winterreifen knirscht die kristallisierte Schneeverwehung am Kurvenrand. Noch immer ist die Stadt von einer schmutzigen Eiskruste überzogen, es wird und wird einfach nicht Frühling. Eine Müdigkeit hat sich in die Augen der Berliner gelegt, kaum jemand hebt noch den Blick. Mit gesenkten Köpfen schlurfen sie über den Platz, sie bewegen sich langsam, auch die Straßenbahnen kriechen nur zögerlich vorwärts, eine ganze Stadt unter Zeitlupe, oben am Funkturm steht das Drehrestaurant still. Im Dezember wurde ich auf dem Platz von Blitzeis überrascht. Ich befand mich mitten auf der plötzlich spiegelglatten Fläche und konnte mich nicht mehr bewegen. Um mich herum bildeten sich purzelnde Menschenketten, alle lachten und kreischten, das Gelächter schlug als gedoppeltes Echo aus den U-Bahnschächten zurück. Eine Frau im knallroten Anorak griff nach meiner Hand, gemeinsam rutschten wir in Richtung der Weltzeituhr, wir klammerten uns aneinander, wir kicherten, und als wir es fast schon geschafft hatten, verlor ich den Halt, ich stolperte, meine Füße glitten weg. Im Sturz flog mir die Kapuze in den Nacken, mein Schal rutschte mir aus dem Gesicht, ich konnte mich nicht schnell genug wieder abwenden, ich starrte zu der Frau hoch und wartete auf ihr Begreifen. Aber ihr Blick blieb klar, sie lachte mir zu, hielt mir ihre Hand hin und zog mich nach oben. Sie kannte mich nicht.
Am Flughafen komme ich nicht so leicht davon. Das Wispern setzt hinter mir ein, es pflanzt sich fort. Irgendjemand in der Schlange muss mich erkannt haben, es ist die Struktur dieser Aufreihung: in jeder Biegung der endlosen Warteschlange sieht jemand mein Profil. Ich spüre das Klicken der Kameras und der schnell hochgerissenen Handys in meinem Nacken, höre die abgebrochenen, hin und her huschenden Sätze. Und auch die Blondine am Abflugschalter erkennt mich sofort, sie reißt die hellen Augenbrauen in die Höhe und es hilft ja nichts, ich muss ihr ihren Verdacht bestätigen und ihr meinen Personalausweis zuschieben, mit meinem Namen, meinem zerstörten, gefledderten Namen.
An eine Umbenennung habe ich oft gedacht, und natürlich: an eine Veränderung meines Äußeren. Eine Perücke, ein Haarschnitt, Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme, irgendetwas. Aber ich kann das nicht, ich will das nicht. Denn dann hätte er mich endgültig vernichtet und ich bin doch alles, was mir noch bleibt.
Was willst du haben, sagte er. Ich sah ihn an und lachte. Dann schüttelte ich den Kopf. Nichts, sagte ich. Gar nichts will ich. Das stimmt nicht, sagte er, das kann gar nicht sein. Man kann alles kaufen, ich weiß das und: ich bin soweit, du hast es geschafft. Sag mir deinen Preis.
Die Autos im Duty-free sehe ich spät. Sie sind aus Schokolade und in kleinen durchsichtigen Schächtelchen auf einem Sondertisch aufgebahrt und mit bunten Seidenschleifen verziert. Schneyder Motors, der neue P7 in Zartbitter und Vollmilch, steht auf einem kleinen Schild, und: Limited Edition. Ich hätte es auch so erkannt. Natürlich hätte ich es erkannt: Wie Sie an den ausgestellten Fahrzeugen zu meiner Linken und Rechten sehen können, zeigt sich der P7 mit einem komplett neuen Exterieur-Design, das von straffen Flächen und präzise ausmodellierten Muskeln dominiert wird. Ursache hierfür sind im Wesentlichen eine um 47mm breitere Karosserie, ausgelagerte Bugleuchten vorne, sowie die an den Schneyder P5 Classic angelehnte Doppelarm-Außenspiegeloptik und die Räder mit deutlich vergrößertem Abrollumfang. Ich kann meinen Text. Noch immer kann ich meinen verdammten Text und ich kann nicht fassen, dass diese Autos hier herumstehen und mich anstarren, aus Schokolade noch dazu, mit Scheinwerfern aus weißer Kuvertüre, es ist der pure Hohn.
In das Flugzeug steige ich als Letzte ein, ein Mann in grellgelber Schutzkleidung riegelt die Plattform hinter mir ab. Ungeduldig wartet er auf meinen Schritt ins Flugzeuginnere. Ich habe allen den Vortritt gelassen und mich an der hinteren Treppe angestellt, vielleicht kann ich vermeiden, dass jeder mich sieht. Und tatsächlich: gleich in der letzten Reihe ist neben einem rundlichen Portugiesen ein Gangplatz frei. Schimpfend versucht seine Frau, die Lehne an seinem dicken Bauch vorbei abwärts zu drücken, sie zieht und zerrt an dem viel zu kurzen Gurt herum, sie schimpft und schimpft, während er die Luft anhält und mir verlegen zulächelt.
Drei Stunden und zwanzig Minuten, sagt der Pilot. Drei Stunden und zwanzig, das Wetter in Lissabon ist mild, höre ich, es hat dort ganze achtzehn Grad, freuen Sie sich darauf und bis dahin: genießen Sie Ihren Flug.
Ich weiß nicht, was ich hier tue. Aussteigen sollte ich, zurück nach Hause fahren, das alles hier ist doch Unfug, was will ich denn dort. Aber sie sind fertig mit der Enteisung, sie werfen schon die Motoren an, wir rollen los. Zwei Plätze vor mir entfaltet eine Frau ihre Zeitung in den Gang hinein. Sie blättert den Wirtschaftsteil auf und da ist er, natürlich ist er da: Dr. Kilian Kaysert. Er sieht imposant aus auf diesem Bild. Er steht leicht angeschrägt zum Betrachter. Seine Brille hat er abgenommen, die grauen Locken fallen ihm in die Stirn. Unter den buschigen Augenbrauen hat er den Blick in die Ferne gerichtet. Ein Musiker könnte er auf diesem Foto sein, ein eigenwilliger Meisterpianist oder ein hoch konzentrierter Dirigent, der sein Orchester zwischen den Sätzen eines schwierigen Konzerts in atemlosem Bann behält. In Wirklichkeit sieht er so nie aus – die PR-Stelle von Schneyder Motors hat ganze Arbeit geleistet. Hinter ihm prangt das grüne Schneyder-Motors-Wappen auf weißem Grund. Die-Schneyder-Motors-Affäre – ein Sonnenkönig vor Gericht steht unter dem Foto. Und als Untertitel: Bald nimmt die Justiz den Herrscher von Schneyder Motors in die Mangel. Es gilt seine Rolle im Korruptionsskandal zu klären: wie viel wusste er wirklich? Kaysert könnte leicht vom Zeugen zum Beklagten werden. Ich schließe meine Augen.
Er wird weich fallen, wenn er stürzt. Er hat, das glaube ich, sieben Leben. Und das ist der Unterschied zwischen ihm und mir.
Der Anruf kam Anfang Juni. Jemand sei ausgefallen, sagte mir meine Agentin, Differenzen habe es da mit der Moderation gegeben und ob ich einspringen wolle: beim größten Auto-Event des Jahres, der Internationalen Händlerpräsentation des neuen P7. Die Rennstrecke von Estoril habe Schneyder Motors für das Spektakel gemietet: das komplette Autódromo Fernanda Pires da Silva. Drei Wochen lang hätte ich nichts weiter zu tun, als die Enthüllung des neuen Sportwagen-Modells zu kommentieren, ein paar Workshops mit Fachleuten zu moderieren, ein paar Künstler anzukündigen. Mit Schneyder Motors in Portugal, rief sie, denk doch mal! Und das Beste: du hast jeden dritten Tag frei.
Ich zögerte. Ich weiß noch, dass ich zögerte, wegen P. und mir. Gerade hatten wir beschlossen, zusammenzuziehen und ich konnte das alles nicht fassen. Ich funktioniere so nicht, hatte ich P. mehrfach erklärt (wenn ich ihn wieder so ungläubig betrachtete, wie er da lag, neben mir), mir geschehen solche Dinge nicht, ich verliebe mich nur so selten und dann geht es schief, immer geht es schief, und ich muss mich dann schmerzhaft wieder zusammensetzen, monatelang, jahrelang. Und jetzt du, sagte ich, das kann gar nicht sein, wo kommst du nur her.
Ich habe abgelehnt. Später hat meine Agentin das bestritten. Aber ich weiß das, ich weiß es noch genau. Nein, sagte ich zunächst, fast ein ganzer Monat, das geht gerade nicht, das musst du verstehen – und außerdem: ich glaube nicht, dass der Sender mich freigibt. Aber plötzlich saß ich vor dem Programmleiter – wenn er zusagt, dann machst dus, sagte die Agentin; sie hatte mich irgendwie dahinein gehandelt – und er hörte mich an und sein Gesicht leuchtete auf und er rief: Schneyder Motors, der neue P7, aber sicher, aber selbstverständlich! Und bitte, wenn es sich machen lässt: besorgen Sie mir ein Kaysertsches Autogramm.
Ich wollte nicht. Ich wollte wirklich nicht dahin, aber das Angebot war so gut und es stieg sogar noch und P. lachte und sagte, dass er sein Leben mit mir verbringen werde und was seien da schon ein paar Wochen.
Und dann war es Spätsommer, P. hatte mich noch zum Flughafen gebracht, und wenige Stunden später stand ich im Windschatten der Pitstop-Boxen des Autódromo, den Rücken flach gegen eines der ratternden Garagentore gedrückt, die Hände um die ausgefahrenen Griffe meiner beiden roten Koffer gekrallt, Striemen meiner hoch peitschenden Haarsträhnen auf der Stirn, den Wangen, am Hals. Sobald ich mich vorbeugte, packte mich der Wind, rüttelte an meinen Koffern, an meiner Kleidung, meinen Gliedern. Mit einem Donnern brach der Sturm über den Asphalt, er fegte über die Rennstrecke, wurde beschleunigt von der glatten, widerstandslosen Fläche aus gegossenem Pech, schien fast der Linienführung zu folgen, schoss die Biegungen entlang, mähte in der Haarnadelkurve seitwärts über das aufspritzende, wegknickende Gras, raste auf die Zielgerade zu und prallte dort mit ganzer Wucht an ein endlich gefundenes Hindernis. Vor mir sprangen die Männer von den beiden Gerüsten, die an den Außenseiten der Rennbahn in die Höhe ragten: zwei abknickende, aufeinander zustrebende Winkelbauten aus Stahl. Sofort zerrte der Wind an den frei gegebenen Konstruktionen, er fuhr zwischen die Tentakel der verdrillten Rohre und Platten, schlug von innen heraus gegen die Seitenverstrebungen, riss und rüttelte an den Stützbalken und versetzte die beiden Bauträger in ein gegenläufiges Schwanken und Taumeln. Ich sah die Männer hin und herrennen, sie stolperten über den Asphalt, wichen seitwärts, rückwärts den halbfertigen Brückenteilen aus. Die Männer fluchten und rannten und kreiselten unter den hin und her schleudernden, torkelnden Stahlskulpturen, sie wussten nicht wohin. Dann plötzlich ein Moment aus Ruhe. Beinahe würdevoll hob sich das linke Gerüst aus der eigenen Achse und ich keuchte auf. Mit einer seitlichen Drehung glitt der Stahlträger aus seiner Verankerung heraus, er schien nach oben zu kippen, ein aufwärts gerichteter Fall, in den Wolken verballten Himmel hinein, bevor er stürzte und stürzte und stürzte. Der Aufprall erschütterte den Boden. Stahlrohre schürften über Stein, ein Splittern, ein Bersten, jemand schrie. Die Arbeiter, die zur Seite gesprungen waren, warfen sich noch im Nachbeben in die Windrichtung, sie ließen sich anschieben, den zerschmetterten Überresten des Gerüsts hinterher, die davon zu treiben begannen und als schrille Windfracht über die Rennbahn schrammten. Einer der Männer blieb mit verdrehtem Bein am Fahrbahnrand liegen, das Gesicht zur Schmerzgrimasse verzerrt. Ich ließ meine Koffer los, wollte zu ihm rennen, aber der Wind warf mich zurück, er presste mich an das Garagentor, fuhr mir gegen den Brustkorb, stieß mir die Koffer gegen die Knie. Papierfetzen, Plastikplanen und eingerissene Stoffbahnen flogen an mir vorüber, umgefallene Stative und Alurohre tänzelten über das Gras, eine Kabeltrommel kollerte einen Abhang hinunter, den sich bauschenden, biegenden Dornsträuchern entgegen. Einer der Baustrahler war im Sturz beschädigt worden und hatte sich eingeschaltet. Mit eingedelltem Schutzgehäuse rollte er auf dem Asphalt herum, sein unkontrolliert aufschießender Lichtstrahl als zielloses Flackern in der unwetterdunklen Luft, ein nicht zu dechiffrierender Code. Ein Mann löste sich aus dem sich langsam entfernenden Wirbel aus Stahl, Sturm und Geschrei. Mit seinem ganzen Gewicht presste er sich gegen den Wind, er brüllte in sein Telefon, das Gesicht gerötet, seine Stimme aus der Ferne nicht zu verstehen. Nur kurz hielt er bei dem sich auf dem Boden windenden, aufheulenden Arbeiter an, dann stemmte er sich weiter vorwärts, stieß mit dem Kopf voran durch die ihm entgegenschlagenden Böen, er legte den Oberkörper gegen den Wind, während er schwerfällig einen Fuß vor den anderen schob, ein schiefer, bleierner Gang. Im Nähern sah ich die tiefen Furchen zwischen seinen Augenbrauen, die Erschöpfung in seinem Blick. Keuchend ließ er sich neben mir an das Garagentor fallen, sein Gesicht nass von Schweiß, er beachtete mich nicht. Dass er sowas auch noch nie erlebt habe, brüllte er in den Hörer, einen so plötzlich aufkommenden Sturm, nicht abzusehen sei das gewesen, und, nein, nein, nochmals nein, er habe keinen Windmesser dabei gehabt, werde sich einen besorgen, aber wer habe sich das eigentlich ausgedacht, diesen Glasraum über der Rennstrecke, er habe davor gewarnt, von Anfang an, und was sei nun mit dem Krankenwagen, verdammt noch mal. Er wartete, nickte, legte dann auf, stopfte das Handy in seine Hosentasche, fuhr sich mit beiden Händen über das Gesicht und schloss die Augen. Als er sie wieder öffnete, hatte er mich im Blick. Er musterte mich, die zitternden, windzerschlagenen Koffer zu meinen Füßen, schnaubte: »Was wollen denn Sie hier!« Und ich wusste, was ich jetzt antworten müsste: dass mich vom Flughafen niemand abgeholt hatte, dass die Assistenz der Projektleitung nicht wie verabredet frühmorgens in der Ankunftshalle gewesen war, stattdessen eine zerknisterte Nachricht auf meiner Mobilbox, nicht zu verstehen, ins Hotel sollte ich wohl fahren, einfach ein Taxi nehmen, von Lissabon nach Estoril, aber der Name des Hotels war nicht zu erraten und meine Agentin nicht zu erreichen gewesen, also war ich hierher gekommen, zum Autódromo mit dem einzigen Namen, den ich mir hatte merken können: Fernanda Pires da Silva. Das hätte ich antworten müssen auf diese Frage: was wollen denn Sie hier. Stattdessen wandte ich mich ab, ich sah auf die Rennstrecke, auf den verbliebenen, noch immer schwankenden, rechten Gerüstturm, auf die Stahltrümmer im Gras und auf dem Asphalt, sah hin zu den Blinklichtern des von der nördlichen Auffahrt stumm heran rollenden Krankenwagens, blickte auf dessen Aufschrift: ambulância, und dann sagte ich: »Wenn ich das wüsste.«
So fing es an.
Mit einem Zischen entriegeln sie die Flugzeugtür und ich trete hinaus in den Gang. Durch die Glasscheibe fällt das Sonnenlicht, ich sehe Fragmente des Flughafengebäudes, ein Stück Himmel, hoch aufragende, weiße Buchstaben auf dem Dach: LISBOA. Ich laufe zügig und biege bei der ersten Gelegenheit vom vorgezeichneten Weg ab. Nach links müsste ich, zum baggage claim, den Schildern folgend, aber ich halte mich rechts, bringe mich aus dem Sichtfeld, will nicht mit den vielen Deutschen am Förderband warten müssen.
Nur wenige Meter weiter entdecke ich in einer fensterlosen Ecke ein kleines Café. Fettglänzende Kuchenteile schwitzen in der Auslage und ich bestelle einen galão, sinke auf einen der grauen Plastikstühle und drehe meinen Rücken gegen die Richtung, aus der ich kam. Ich weiß nicht weiter. Hinter mir höre ich das Getrappel von Füßen, das Quietschen der hektisch gezogenen Handkoffer sich entfernender Passagiere. Sie alle haben es eilig, sie haben Ziele. Nur ich weiß gar nicht, wohin ich soll.
Werte Fluggäste, sagt eine blechern klingende Frauenstimme auf Deutsch, Flug 8342 nach Berlin ist zum Einstieg bereit. Dann wiederholt sie die Ansage auf Englisch, auf Portugiesisch. Meine Maschine muss das sein. Sie fliegen direkt zurück, halten die Aufenthaltszeit hier so kurz wie möglich.
Ich könnte mitfliegen. Wenn ich jetzt sofort aufstehen würde, könnte das klappen. Ich könnte ein Ticket kaufen, ihnen erklären, dass meine Tasche gar nicht ausgeladen werden muss. Bis Mitternacht wäre ich wieder zu Hause in Berlin. Aber was dann.
Ich denke an die Matratze, die ich mir nach P.s Auszug unter den Schreibtisch geschoben habe. Das Geräusch der abbrechenden, aufschlagenden Eiszapfen im Hof. Die kaputte Glühbirne im Flur, die ich seit Wochen auswechseln will. Ich rühre mich nicht.
Als es hinter mir still wird, suche ich mein Handy aus meiner Umhängetasche heraus, schalte es ein. Die Nummer der kleinen Pension in der Rua das Portas de Santo Antão habe ich nicht gelöscht. P. hatte sie mir geschickt, als wir noch beide dachten, er würde kommen und mich besuchen.
Ein Mann hebt ab, boa tarde, sagt er. Und nachdem ich mein Anliegen erklärt habe: I will see what I can do. Seine Stimme ist ruhig, warm, sein Englisch hat einen britischen Akzent, und, ja, er hat ein Einzelzimmer frei für diese Nacht. Wieder kommt aus den Lautsprechern die Durchsage, dringlicher diesmal, lauter, sie hallt durch die Steingänge des Gebäudes: this is the last call for flight 8342. Und ich zucke zusammen, vielleicht sollte ich doch – aber der Mann lacht, oh, Sie sind gerade angekommen, wie schön, nehmen Sie den Bus 91, fahren Sie bis zum Restauradores, sagt er. Falls Sie uns nicht finden, rufen Sie mich wieder an.
Die Gepäckausgabe ist leer. Niemand ist mehr da, vielleicht habe ich zu lange gewartet. Die Monitore, die die Bandnummer ausweisen, zeigen meinen Flug schon nicht mehr an. Mein Blick fliegt über die Förderschleifen, über den spiegelnden Boden. Ganz hinten im Raum steht eine Putzfrau. An ihren Händen trägt sie blaue Gummihandschuhe, sie stützt sich auf den Stiel ihres Wischmobs. Ratlos betrachtet sie meine Tasche auf dem stillstehenden Förderband.
Die Stadt ist in schwefelgelbes Licht getaucht. Wir rollen einen Hügel herunter, auf das Zentrum zu. Der Bus ist nicht voll, es ist zu früh im Jahr, keine Hauptreisezeit. Über dem Busfahrer flirrt ein defekter Monitor, grüne Störstreifen flackern über die aufblendenden Fotos der bekanntesten Sehenswürdigkeiten: dem Castelo de São Jorge, dem Torre de Belém, dem Praça do Comércio. Ich presse meine Schläfe gegen das Fensterglas, versuche zu verstehen, dass ich wirklich wieder hier bin. Draußen zieht die Vorstadt vorbei. In den Schaufenstern haben sie schon die Abendbeleuchtung eingeschaltet, die angestrahlten Gliederpuppen tragen orange, gelbe, pinkstichige Kleider, Sommerfarben. Aber es ist noch nicht Sommer, nicht einmal Frühling scheint es zu sein. Viele der Bäume sind noch kahl, die Palmenwedel wirken angegraut und an den Häuserfassaden der Plattenbauten sind die Fenster verschlossen und dreckverschmiert. Das ist gut, denke ich, es ist Zeit vergangen seither, sichtbar. Ich muss das lernen: Dinge verwittern, sie gehen vorbei.
Wir fahren in einen Kreisverkehr, plötzlich stauen sich die Autos. Bunte sightseeing-Busse versperren sich gegenseitig den Weg, sie hupen, der Busfahrer flucht. Ich hebe mein Handgelenk, stelle meine Uhr eine Stunde zurück.
Sieben Wellen. Sieben Wellen in drei Wochen sind das, sagte die Projektleiterin. Sie stand vor mir, sie war kleiner als ich und reckte mir von unten den Ablaufplan entgegen. Ihre Jacke hatte sie sich um die schmalen Hüften gebunden, ich konnte an den Ärmeln den Agenturaufdruck erkennen: straub&friends Live Marketing GmbH. Den Plan hatte sie mir mehrfach ausgedruckt, sie traute mir nicht. Meine Finger fuhren über die eingezeichneten Spalten, über Zeit, Ort, Aktion, ich suchte meine Einsätze. Ich konnte meinen Namen nicht finden, aber bei den Produktworkshops, der Gala-Inszenierung und dem Reveal fand ich den Vermerk: Mod1. Wellen, murmelte ich, Wellen. Ja, fuhr sie fort, man habe die Händler nach Nationalitäten unterteilt, in die deutsche, die europäische, die nordamerikanische, südamerikanische, russische, arabisch/afrikanische, die asiatische Welle. Für alle gelte der gleiche Ablauf. Erster Tag: Ankunft, offizielle Begrüßung durch KK und den Vorstand, Enthüllung des P7 auf der Rennstrecke. Zweiter Tag: Produkt- und Marketingworkshops in den Pitstopboxen, abends: Galadinner auf der Zielgeraden, mit Showblöcken zwischen den einzelnen Gängen. Dritter Tag: Überlandfahrten im P7 nach Sintra und zum Cabo da Roca, sowie Testfahrten auf der Rennstrecke, abends: Dinner und Party im Sala Árabe des Klosterhotels. Am vierten Tag, sagte die Projektleiterin, geht es von vorne los, der letzte Tag ist der erste Tag, jede auslaufende Welle bricht sich in der nächsten.
Ein Techniker ging rückwärts an uns vorbei, er verlegte ein Starkstromkabel, hielt sich mit beiden Händen daran fest, wie ein Hundehalter an der Leine seines herum zerrenden Welpen. Keine Wellen seien das, rief er mir zu, sondern gottverdammte Tsunamis. Wenn ich du wäre, rief er, würde ich mich in Sicherheit bringen, ganz schnell. Sonst ersäufst du mir noch hier.
Ich meine mich zu erinnern, dass ich lachte.
Dr. Kilian Kaysert: geboren 1958 in Stuttgart? Ja. Promovierter Maschinenbauer, später Studium der Metallkunde und Metallphysik. Ja. Einstieg bei Schneyder Motors als Fertigungsplaner und späterer Produktionschef Mitte der Achtzigerjahre.Ja. Berufung in den Vorstand: 1997, Vorstandssprecher: 1999, Vorsitzender des Vorstands der Schneyder Motors AG: seit 2001, Vorsitzender der Schneyder Motors Holding: seit 2004? Ja. Verheiratet mit Eva Kaysert, geborene Mohr. Ein Sohn und zwei Töchter. Sammler von Metallskulpturen und seltenen Natursteinen (poliert, geschliffen, am liebsten geflammt und/oder sandgestrahlt), Hobbyschütze, Raucher … Ja. Schwören Sie die Wahrheit zu sagen, nichts als die –
Jaja.
Mein Zimmer liegt unter dem Dach. Ich kann von hier oben in die Rua das Portas de Santo Antão hinunter sehen wie in eine erleuchtete Schlucht. Fußgänger schieben sich gleichmäßig über das zerklüftete Kopfsteinpflaster, ANTIGUIDA-DES COMPRA VENDE steht unten auf einer blau-weißen Fliesentafel an einer der Hausmauern, auf dem Dachfirst mir gegenüber tippelt eine Ringeltaube durch die Abenddämmerung. Es ist schon fast dunkel. Vorne, in der hell ausgekleideten Fußgängerzone, versuchen Kellner mit wedelnden Speisekarten, die vorüberschlendernden Passanten in ihre Restaurants hinein zu fächern. Ich höre Gläser klirren, irgendwo zischt Fleisch auf einem Grill, mein Magen knurrt. Ich habe nichts zu essen dabei, aber das ist vielleicht ganz gut. Ich muss mich also überwinden, ich muss noch einmal hinaus.
Marinierte Garnelen, zartrosa Thunfischcreme, bluttriefende Steaks. Dicke Maissuppe und gewürzter Brotbrei, gebackener Fisch mit Knoblauchsoße, frische Meeresfrüchte, gegrillt. Arroz doce mit Zimt und geraspelten Zitronenschalenflocken, pastéis de nata mit noch warmer Vanillepuddingfüllung, bernsteinfarbener pudim flan. Jeden Mittag und jeden Abend quoll das verdammte Crewbuffet über, Schneyder Motors after all, und die Tänzerinnen und ich, wir bissen uns in die Handrücken, wir rissen uns gegenseitig weg von den dampfenden Töpfen und funkelnden Platten, wir schubsten uns hin zu den Schüsseln mit dem grünen Salat und dem trockenen Beilagenreis und jagten uns danach im Sprint über die Rennstrecke und trotzdem nahmen wir alle zu, alle, auch die Ton-, Licht- und Videotechniker, die Fahrer und Mechaniker, die Schneyder-Motors- und straub&friends-Mitarbeiter, die Sänger, Artisten, Assistentinnen. Nur die Projektleiterin wurde täglich dürrer, sie stand mit immer tiefer einfallenden Wangen und leerem Teller im Cateringzelt herum und drohte den Darstellern mit Vertragsauflösung, und das Gelächter hörte erst auf, als sie eine der Tänzerinnen nach Hause schickte und auf der Bühne durch die schlankere Choreographin ersetzen ließ, ein unumgänglicher Schritt, wie sie sagte.
Es ist jetzt egal, wie viel ich wiege. Ich könnte kiloweise zunehmen, ich könnte mich mästen mit Fett und Zucker und Weißmehl, aber seit Wochen fehlt mir der Appetit. Oft vergesse ich das Essen ganz, ich wiege weniger als je zuvor. Ich bohre neue Löcher in meine eng und enger geschnallten Ledergürtel, stecke meine Hosen und Röcke, damit sie mir nicht von der Hüfte rutschen, mit Sicherheitsnadeln am Bund in Falten.
Auch meine Muskeln sind geschrumpft. Denn natürlich habe ich mit dem Training aufgehört. Ich wollte meinen Kampfsportlehrer nicht verwickelt sehen, wollte ihm und seiner Schule in Weissensee nicht schaden, seinem Ruf. Also erwähnte ich ihn nicht. Es hätte, wäre es zu einer Anzeige gegen mich gekommen, nur Schwierigkeiten gegeben. Sie ist trainiert, hätte es geheißen. Diese mixed-martial-arts-Kurse, wir wussten es doch, die fördern nur die Aggression.
Aber tatsächlich: niemand kam darauf, mich mit einem Kampfsport in Verbindung zu bringen. Alle hielten mich für zart. Sie dachten, dass ich nicht wusste, was ich tat. Und völlig falsch liegen sie damit ja nicht.
Zwei Köpfe schleudern aufeinander zu. Die Wucht, mit der die Schädelknochen aneinanderkrachen: Krümmungskreis kreuzt Winkelgeschwindigkeit, alles gerät ins Schleudern. Eine einzige Bewegung und meine Karriere zerschellt, sie verglüht im Ellipsenbrennpunkt. Ich hätte, das ist wohl so, zu so einer Gewalt heute gar nicht mehr die Kraft.
Der Mann an der Rezeption lächelt mich an. Vorhin, beim Ankommen, war ich einen Augenblick lang enttäuscht, dass er so jung ist. Ob er mir den Weg hinauf zum Castelo beschreiben könne, frage ich ihn. Er rückt seine Brille zurecht, begleitet mich zur Tür, hält sie mir auf. Alles an ihm ist höflich, achtsam: seine britische Aussprache, seine geordnet fallenden Haarsträhnen, seine Kleidung – die Kragenspitzen seines Hemdes sind exakt symmetrisch ausgerichtet. Die vielen Straßennamen, die er mir nennt, kann ich mir nicht merken, ich brauche nur eine grobe Richtung, ich muss mich verorten. Dass ich einfach hinter dem Mc Donald’s einbiegen solle, sagt er schließlich, als er meine Ratlosigkeit bemerkt. Und dann aufwärts gehen, immer irgendwie aufwärts – das sei jetzt wieder möglich, aber noch im letzten Monat habe es schwarzes Eis gegeben und viele Stürze auf den verzwirbelten, steilen Gässchen.
Black ice. Ich denke darüber nach, während ich mit gesenktem Kopf an den weit aufgerissenen Restauranteingängen vorübereile (deutsche Touristen überall), Glatteis muss das wohl heißen. Ich kenne den Begriff nicht, aber er gefällt mir – eine Stadt, von schwarzem Eis überzogen. Und es ist noch spürbar: eine Gedämpftheit liegt über den Straßen. Die Leute um mich herum scheinen zu flüstern und zu schleichen, die Rufe der noch wenigen Straßenverkäufer sind leise, die Passanten am Ausschank der kleinen Ginjinha-Bar nippen still an den Plastikbechern mit dem Kirschlikör und selbst die Skateboardfahrer am Praça da Figueira gleiten fast lautlos über den Platz. Auch die Farben sind anders, ich habe Lissabon bunter in Erinnerung, greller, stattdessen wirken die Hausmauern, die Menschen, die Werbetafeln, die Kirchenplätze und Brunnenskulpturen im fahlen Schein der Laternen immer verwaschener und ausgeblichener, je höher ich steige. Der Winter sitzt, hätte P. gesagt, auch dieser Stadt noch in den morschen, klappernden Knochen.
Das Chapitô ist geöffnet. Ich atme auf, als ich die Mauertür aufdrücke und die Treppe zu der kleinen Hofterrasse betrete. Ich bin früh genug hier, die Bänke vor dem Grill sind unbesetzt, die Wärmestrahler heizen sich gerade erst auf und unter den ausgelegten Bestecken flattern die zurecht gefalteten Servietten noch unbenutzt im Wind. Auch das Restô über der Bar im Hinterhaus ist noch fast leer, die Anweiserin am Abhang winkt mich direkt hinauf. Ich steige über die Wendeltreppe nach oben, lasse mich an einem der Fenster platzieren, mit dem Rücken zum Raum. Ohne in die Karte hineinzusehen, die sie vor mir aufschlagen, ohne die Tagesgerichte zu prüfen, die sie in schwungvoller Kreideschrift an der Wandtafel vermerkt haben, bestelle ich einen Martini bianco (on ice, with a twist) und das Spinatrisotto mit der Tomatencreme.
Ich bin also wieder hier. Aus den Lautsprechern kommt leise Musik und vor mir liegt der Blick, dieser Blick. Straßen und Plätze schimmern bis herauf zu mir und vom Altstadtviertel in der Oberstadt, dem Chiado, morst ein riesiger, hochaufragender Baukran fieberhafte Blinkzeichen über alle sieben Hügel der Stadt.
Eine Gruppe von Frauen mit bodenlangen Kleidern nimmt am Tisch neben mir Platz, sie schütteln ihre Armreifen, während sie aufeinander einreden. Ich trinke und lasse die Eiswürfel gegen die Innenwand meines Martiniglases klirren, meine Wangen fangen an zu glühen. Immer öfter klingelt die Glocke am Essens-Aufzug, das Lachen und Rufen im Raum wird lauter, auf dem Fenstersims flackert eine Kerze, ich ziehe meine Jacke aus, die noch immer nach Flugzeug riecht, und schiebe den aufdampfenden Reis in meinen Mund, schmecke Salbeiblätter auf meiner Zunge. Hinter mir erzählt eine Männerstimme von einem Seminar über Abwasserverwertung (es scheint einen Unterschied zu geben zwischen waste water und grey water), ich bestelle eine kleine Karaffe mit rotem Hauswein, das Mondlicht funkelt auf den verschachtelten Spitzdächern, eine einzige Fähre pflügt sich vom Cais do Sodré ans andere Ufer nach Almada, auf die riesige Christusfigur zu, die dort mit weitausgebreiteten Armen auf ihrem Monolithen ruht und mich anzusehen scheint, von ganz weit weg.
Wo bist du, sagte der Regisseur, der mich auf dem Produktionshandy anrief, und ich stand auf und trat an das Fenster, an genau dieses Fenster, das weit geöffnet war. Ich sah den Tejo durch sein breites Flussbett strömen, ich atmete die Sommernachtluft ein und die Abgase, die von der Stadt heraufstiegen, und drehte mich um und zwinkerte den Tänzerinnen und den Technikern zu, die gerade dabei waren, die vielen kleinen Tische aneinanderzuschieben. Ich sagte: Lissabon, ein Bergfest auf einem Berg, was könnte passender sein, und konnte nicht verstehen, warum der Regisseur so erleichtert klang und warum er sagte, dass das gut sei, sehr gut, und dass ich besser dieses Handy ausschalten sollte in den nächsten Stunden und direkt auf mein Zimmer gehen, wenn wir später ins Crewhotel zurückkämen. Ich legte auf, ich zuckte mit den Schultern und schaltete ab, ich sprang auf einen der Holzstühle, reckte eine Faust in die Luft, der holzverkleideten Decke entgegen, und rief: mir wurde gesagt, es ist gut, dass ich hier bin,