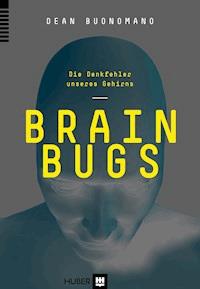
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Mit seinen Billionen von neuronalen Verknüpfungen ist das menschliche Gehirn das komplexeste und faszinierendste Organ in unserem Körper. Und obwohl wir noch weit davon entfernt sind, die Schaltpläne dieses Supercomputers in unserem Kopf komplett zu verstehen, lassen gerade seine Schwächen, die Bugs, interessante Einblicke in die Funktionsweise unseres Gehirns zu. Warum trügt uns unser Gedächtnis oft? Warum haben wir Schwierigkeiten, große Beträge im Kopf zu addieren? Warum misstrauen wir Menschen, die uns nicht gleichen? Und warum treffen wir so oft Entscheidungen, die eigentlich komplett irrational sind? Der Neurowissenschaftler Dean Buonomano zeigt anhand von eindrücklichen Experimenten und neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung, woher diese Bugs kommen und wie sie unser Leben immer wieder durcheinanderbringen können – vor allem in unserer modernen, informationsgesättigten Welt. Gleichzeitig macht Buonomano aber auch klar, wie erstaunlich stark unser Gehirn bei allen Schwächen trotzdem ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buonomano
Brain Bugs
Verlag Hans Huber
Sachbuch Psychologie
Wissenschaftlicher Beirat:
Prof. Dr. Guy Bodenmann, Zürich Prof. Dr. Dieter Frey, München Prof. Dr. Lutz Jäncke, Zürich Prof. Dr. Franz Petermann, Bremen
Dean Buonomano
Brain Bugs
Die Denkfehler unseres Gehirns
Aus dem amerikanischen Englisch von Sebastian Vogel
Für meine Eltern, Lisa und Ana
Programmleitung: Tino Heeg
Herstellung: Jörg Kleine Büning
Umschlaggestaltung: Anzinger | Wüschner | Rasp, München
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen oder Warenbezeichnungen in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen-Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Verlag Hans Huber
Lektorat Psychologie
Länggass-Strasse 76
CH-3000 Bern 9
Tel: 0041 (0)31 300 4500
Fax: 0041 (0)31 300 4593
www.verlag-hanshuber.com
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel «Brain Bugs. How the Brain’s Flaws Shape Our Life» bei W. W. Norton & Company.
© 2011 by Dean Buonomano
1. Auflage 2012
© 2012 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-456-95151-5)
(E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-456-75151-1)
ISBN 978-3-456-85151-8
eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheimwww.brocom.de
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Das Gedächtnis-Netzwerk
2. Gedächtnis-Upgrade erforderlich
3. Wenn das Gehirn abstürzt
4. Zeitliche Verzerrungen
5. Der Angstfaktor
6. Unvernünftige Vernunft
7. Der Werbe-Bug
8. Die Übernatürlichkeitsmacke
9. Fehlerbeseitigung
Danksagungen
Anmerkungen
Literatur
Einleitung
So war es eigentlich bei allen meinen Erfindungen. Am Anfang steht eine Intuition – die kommt ganz plötzlich, und dann ergeben sich Schwierigkeiten. Erst klappt dieses nicht, dann jenes – «Bugs», wie man solche kleinen Fehler und Schwierigkeiten nennt.
Thomas Edison
Das Gehirn des Menschen ist das komplexeste Gebilde im bekannten Universum, aber vollkommen ist es nicht. Was wir als Individuen und Gesellschaft sind, definiert sich nicht nur durch die erstaunlichen Fähigkeiten des Gehirns, sondern auch durch seine Schwächen und Beschränkungen. Denken wir nur daran, wie unzuverlässig und einseitig unser Erinnerungsvermögen sein kann: Im besten Fall vergessen wir Namen und Zahlen, im schlimmsten wandern Unschuldige aufgrund falscher Zeugenaussagen ein Leben lang ins Gefängnis. Oder denken wir an unsere Anfälligkeit für Werbung und an die Tatsache, dass eine der erfolgreichsten Werbekampagnen der Geschichte im 20. Jahrhundert zu schätzungsweise 100 Millionen Todesopfern führte: Der tragische Erfolg der Zigarettenwerbung zeigt, in welchem Umfang unsere Wünsche und Gewohnheiten durch Werbung geprägt werden können.1 Unser Handeln und unsere Entscheidungen werden durch eine Fülle willkürlicher, unwichtiger Faktoren beeinflusst, die Wortwahl in einer Frage kann zu einseitigen Antworten führen, und die Lage eines Wahllokals kann sich auf das Wahlergebnis auswirken.2 Oft erliegen wir der Verlockung einer schnellen Belohnung, die auf Kosten unseres langfristigen Wohlergehens geht, und unsere unwiderstehliche Neigung, an Übernatürliches zu glauben, führt uns oftmals in die Irre. Selbst unsere Ängste stehen nur in einer losen Verbindung zu den Dingen, vor denen wir uns fürchten.
Dies alles hat zur Folge, dass unsere vermeintlich rationalen Entscheidungen in Wirklichkeit alles andere als rational sind. Einfach gesagt, ist unser Gehirn für manche Aufgaben gut geeignet, für andere aber viel weniger. Leider betrifft eine solche Schwäche des Gehirns auch die Entscheidung, welche Aufgaben in welche der beiden Kategorien gehören; deshalb befinden wir uns meist in einem Zustand des seligen Unwissens darüber, in welchem Ausmaß die Bugs des Gehirns über unser Leben bestimmen.
Das Gehirn ist ein ungeheuer komplexer biologischer Computer und verantwortlich für jede unserer Handlungen, Entscheidungen, Gedanken und Gefühle. Diese Vorstellung erscheint den meisten Menschen wahrscheinlich nicht besonders tröstlich. Nicht einmal die Tatsache, dass der Geist aus dem Gehirn erwächst, ist in allen Gehirnen anerkannt. Aber unsere Vorbehalte gegenüber dem Gedanken, dass unser Menschsein ausschließlich dem physischen Gehirn entstammt, sollten uns nicht überraschen. Das Gehirn wurde ebenso wenig dazu konstruiert, sich selbst zu verstehen, wie ein Taschenrechner dazu konstruiert wurde, im Internet zu surfen.
Das Gehirn wurde aber dazu konstruiert, über die Sinnesorgane Daten aus der Außenwelt zu sammeln, diese Informationen zu analysieren, zu speichern und weiterzuverarbeiten und einen Output – Handlungen und Verhaltensweisen – zu erzeugen, der unsere Überlebens- und Fortpflanzungschancen optimiert. Aber wie jede andere Rechenmaschine, so hat auch das Gehirn seine Fehler und Grenzen.
Weniger aus Gründen der wissenschaftlichen Strenge als vielmehr wegen der Bequemlichkeit verwende ich den Begriff «Bugs» – die Macken der Computersprache – für das ganze Spektrum der Beschränkungen, Fehler, Schwächen und Voreingenommenheiten des menschlichen Gehirns.3 Bei Computerbugs reichen die Folgen von lästigen Defekten der Bildschirmanzeige bis zum Absturz des Computers oder dem gefürchteten «Bluescreen». Hin und wieder können Computerfehler sogar tödliche Folgen haben, beispielsweise wenn schlecht programmierte Software dafür sorgt, dass den Patienten bei der Krebstherapie zu hohe Strahlendosen verabreicht werden. Ebenso breit gefächerte Folgen können auch die Macken unseres Gehirns haben: von einfachen Täuschungen über peinliche Gedächtnisaussetzer bis hin zu irrationalen Entscheidungen, die manchmal harmlose, manchmal aber auch tödliche Folgen haben.
Wenn unser Lieblingscomputerprogramm einen Bug hat oder wenn eine wichtige Funktionalität fehlt, besteht immer die Hoffnung, dass die Schwäche in der nächsten Version behoben wird. Bei Menschen und Tieren gibt es diesen Luxus nicht: Für das Gehirn existieren keine Programmpatches, Updates oder Upgrades. Angenommen, es gäbe sie: Welche Verbesserung des Gehirns würde auf der Liste an erster Stelle stehen? Stellt man diese Frage einem Hörsaal voller Erstsemester, erhält man immer die gleiche Antwort: ein besseres Gedächtnis für die Namen, Zahlen und Fakten, mit denen sie bombardiert werden (ein beträchtlicher Anteil der Studierenden ist allerdings auch fantasievoll und entscheidet sich für das Gedankenlesen). Jeder von uns hatte irgendwann schon einmal Mühe, sich an den Namen eines Bekannten zu erinnern, und der Satz «Du weißt schon … wie heißt er doch gleich» dürfte in allen Sprachen zu den am häufigsten benutzten gehören. Aber darüber zu klagen, dass wir ein schlechtes Namen- und Zahlengedächtnis haben, ist ein wenig so, als würden wir uns beschweren, dass unser Smartphone unter Wasser nicht richtig funktioniert. In Wirklichkeit ist unser Gehirn einfach nicht dazu konstruiert, unzusammenhängende Informationsbruchstücke wie Zahlen oder Namen von einer Liste zu speichern.
Denken wir einmal an jemanden, den wir nur einmal gesehen haben – beispielsweise den Sitznachbarn auf einem Flug. Angenommen, diese Person hat uns ihren Namen und ihren Beruf mitgeteilt – werden wir uns dann an beide Informationen gleich gut erinnern oder an die eine besser als an die andere? Mit anderen Worten: Lassen wir beim Vergessen Gleichberechtigung walten, oder vergessen wir Namen aus irgendeinem Grund leichter als Berufe? Diese Frage hat man mit einer Reihe von Studien beantwortet. Dazu mussten Freiwillige sich die Bilder von Personen ansehen, und gleichzeitig erfuhren sie Namen und Berufe der Abgebildeten. Sahen sie dann die Fotos im Laufe des Experiments ein zweites Mal, erinnerten sie sich an die Berufe häufiger als an die Namen. Nun könnte man annehmen, es sei einfacher, sich Berufe zu merken – vielleicht weil es sich dabei um häufig gebrauchte Wörter handelt, ein Faktor, der das Erinnern bekanntermaßen erleichtert. Die Versuchsleiter hatten aber eine kluge Kontrolle eingebaut: Manche Wörter waren sowohl Namen als auch Berufsbezeichnungen wie Bäcker/Becker oder Bauer/Bauer. Dennoch erinnerten sich die Versuchspersonen leichter an einen Bauern als an einen Herrn Bauer.4
Oder nehmen wir ein anderes Beispiel für die Macken unseres Gedächtnisses. Lesen Sie einmal die folgende Wortliste:
Bonbon, Zahn, sauer, Zucker, gut, Geschmack, schön, Mineralwasser, Schokolade, Herz, Kuchen, Honig, essen
Jetzt lesen Sie sie noch einmal und halten Sie kurz inne, um sie sich einzuprägen. Welche der folgenden Wörter standen auf der Liste?
Tofu, süß, Sirup, Pterodactylus
Selbst wenn Sie so schlau waren und gemerkt haben, dass keines dieser vier Wörter auf der Liste vorkam, mussten Sie zweifellos bei süß und Sirup länger nachdenken als bei Tofu oder Pterodactylus.5 Der Grund liegt auf der Hand: süß und Sirup stehen mit den meisten Wörtern auf der Liste im Zusammenhang. Unsere Neigung, eng zusammenhängende Begriffe zu verwechseln, beschränkt sich nicht auf Süßigkeiten, sondern sie gilt auch für Namen. Menschen reden sich ständig irrtümlich mit falschen Namen an. Aber die Fehler sind nicht zufällig verteilt; man weiß, dass Menschen ihren derzeitigen Freund oder ihre Freundin mit dem Namen des oder der Ex ansprechen, und ich nehme an, meine Mutter war unter vielen gestressten Eltern nicht die einzige, die ein Kind mit dem Namen des anderen belegte (und ich habe nur eine Schwester). Auch ähnlich klingende Namen verwechseln wir: Während des US-Präsidentschaftswahlkampfes 2008 bezeichnete mehr als eine Person und auch ein Präsidentschaftskandidat Osama bin Laden fälschlich als Barack Obama.6 Warum fällt es uns schwerer, uns daran zu erinnern, dass der Sitznachbar im Flugzeug Bauer hieß, als dass er Bauer war? Warum verwechseln wir eng zusammenhängende Wörter und Namen? Wie wir erfahren werden, ergibt sich die Antwort auf solche Fragen unmittelbar aus der Verknüpfungsstruktur des menschlichen Gehirns.
Bugs und Methode
Eine Sonnenuhr und eine Armbanduhr haben nichts gemeinsam außer ihrem Daseinszweck. Ganz ähnlich verhält es sich auch mit Digitalcomputer und Gehirn: Sie haben kaum Gemeinsamkeiten mit Ausnahme der Tatsache, dass es sich bei beiden um Vorrichtungen zur Informationsverarbeitung handelt. Selbst wenn Digitalcomputer und biologischer Computer sich mit dem gleichen Problem befassen, beispielsweise weil beide (in der Regel zur Verblüffung des zweiten) gegeneinander Schach spielen, ähneln sich die dabei ablaufenden Berechnungen kaum. Der eine analysiert mit der Brechstangenmethode Millionen Zugmöglichkeiten, der andere lässt sich von seiner Fähigkeit zur Mustererkennung leiten und analysiert gezielt nur ein paar Dutzend Züge.
Digitalcomputer und Gehirn eignen sich für ganz unterschiedlich geartete Berechnungen. Die größte Stärke des Gehirns – und eine berüchtigte Schwäche der heutigen Computertechnik – ist die Fähigkeit zur Mustererkennung. Wie überlegen wir in dieser Hinsicht sind, zeigt sich sehr deutlich an unserem Umgang mit Computern. Wer in den letzten zehn Jahren online war, wurde wahrscheinlich vom Computer schon einmal gebeten, einige verzerrte Buchstaben oder Wörter abzuschreiben, die in einem Kasten auf dem Bildschirm erschienen. Diese Übung hat einen in vielfacher Hinsicht tief greifenden Sinn: Sie soll sicherstellen, dass ein Mensch vor dem Computer sitzt. Genauer gesagt, stellt sie fest, dass kein automatisierter «Web Robot» am Werk ist, ein Computerprogramm, das von Menschen mit dem heimtückischen Ziel eingesetzt wird, Spam zu verschicken, persönliche Konten zu knacken, Konzertkarten zu horten oder eine Vielzahl anderer hinterhältiger Handlungen zu begehen. Diese einfache Prüfung heißt auch «Vollautomatischer öffentlicher Turing-Test zur Unterscheidung von Computern und Menschen» oder CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart).7 Als Turing-Test bezeichnet man ein Spiel, das von Alan Turing, dem Ausnahmekryptografen und Vater der modernen Informatik, entwickelt wurde. In den 1940er-Jahren, als ein Digitalcomputer ein ganzes Zimmer füllte und weniger Rechenkapazität hatte als eine heutige Cappuccinomaschine, grübelte Turing nicht nur darüber nach, ob Computer eines Tages zum Denken in der Lage sein werden, sondern er fragte sich auch, wie wir das wissen können. Dazu schlug er einen Test vor, ein einfaches Spiel, in dem ein Mensch ein Gespräch mit einem verborgenen Partner führt, der entweder ein zweiter Mensch oder aber ein Computer ist. Turings Argument: Wenn eine Maschine sich erfolgreich als Mensch ausgeben kann, hat sie die Fähigkeit zum Denken erlangt.
Bis heute können Computer weder denken, noch reichen sie auch nur entfernt an unsere Fähigkeit zur Mustererkennung heran – deshalb sind CAPTCHAs ein wirksames Mittel, um Webroboter fernzuhalten. Ob wir die Stimme unserer Großmutter am Telefon oder das Gesicht eines Vetters, den wir seit zehn Jahren nicht gesehen haben, wiedererkennen oder ob wir einfach ein paar verzerrte Buchstaben vom Bildschirm abschreiben: Unser Gehirn repräsentiert die am höchsten entwickelte Mustererkennungstechnologie der Welt. Allerdings gewinnen Computer schnell an Boden, sodass wir unseren Vorsprung vielleicht nicht mehr lange behalten werden. Die CAPTCHAs der nächsten Generation werden wahrscheinlich andere Aspekte unserer Mustererkennungsfähigkeit ansprechen und beispielsweise verlangen, dass wir Inhalte und dreidimensionale Perspektiven aus Fotos ableiten.8
Unser Gehirn verfügt über eine beeindruckende Fähigkeit, in dem «blühenden, summenden Durcheinander» der Informationen, die auf unsere Sinnesorgane einströmen, einen Sinn zu finden. Schon ein dreijähriges Kind versteht, dass das Wort Nase, von einer beliebigen Stimme gesprochen, jenes Ding im Gesicht der Menschen bezeichnet, das Erwachsene manchmal angeblich stehlen wollen. Die Fähigkeit eines Kindes, Sprache zu verstehen, geht über die der heutigen Spracherkennungssoftware hinaus. Solche Programme werden zwar für automatische Telefondienste eingesetzt, sie haben aber Schwierigkeiten mit dem unbegrenzten Wortschatz unterschiedlicher Sprecher. In der Regel versagen sie, wenn man ihnen ähnlich klingende Sätze präsentiert, beispielsweise «Ich stehe dicht am Meer» und «Ich stehle nicht mal mehr». Wenn dagegen unsere eigene Mustererkennungsfähigkeit eine Schwäche hat, dann höchstens die, dass wir übers Ziel hinausschießen; mit ein wenig Motivation sehen wir Muster, wo keine vorhanden sind: Wir erkennen die rätselhafte Erscheinung der Jungfrau Maria auf einer wasserfleckigen Kirchenmauer oder sind bereit, den Farbklecksen im Rorschach-Test eine Bedeutung beizulegen.
Stellen wir uns einmal vor, wir sollten einen Test entwickeln, der den entgegengesetzten Zweck zum CAPTCHA hat: einen Test, in dem ein Mensch versagt, während ein Web-Bot, ein Android, ein Replikator oder eine beliebige andere, nicht auf Kohlenstoff basierende Rechenmaschine ihn besteht. Einen solchen Test zu entwickeln, ist natürlich bedrückend einfach. Er könnte darin bestehen, dass nach dem natürlichen Logarithmus des Produkts zweier Zufallszahlen gefragt wird, und wenn die Antwort nicht innerhalb weniger Millisekunden kommt, ist der Mensch entlarvt. Man könnte eine Fülle einfacher Tests entwerfen, mit denen sich die Menschen aussortieren lassen. Solche Tests könnten im Großen und Ganzen auf eine einfache Beobachtung zurückgreifen: In der Mustererkennung erbringt das menschliche Gehirn hervorragende Leistungen, in Mathematik aber nicht. Das war Alan Turing schon in den 1940er-Jahren klar. Als er darüber nachdachte, ob Computer denken können, vergeudete er nicht viel Zeit auf die umgekehrte Frage: Werden Menschen jemals in der Lage sein, Zahlen so zu handhaben wie ein Digitalcomputer? Er wusste, dass hier von Natur aus eine Asymmetrie besteht; Computer werden vielleicht eines Tages an die Fähigkeiten des Gehirns beim Denken und Fühlen heranreichen, aber das Gehirn wird nie die Rechenfähigkeit eines Computers erreichen: «Wollte der Mensch so tun, als wäre er eine Maschine, er würde eindeutig eine sehr schlechte Figur machen. Er würde sich durch seine langsamen und gleichzeitig ungenauen Berechnungen verraten.»9
Rechnen wir einmal ein wenig im Kopf:
Wie viel ist tausend plus vierzig?
Nun addieren wir nochmals tausend hinzu
Und noch einmal dreißig
Plus tausend
Plus zwanzig
Plus tausend
Und schließlich noch einmal zehn.
Die meisten Menschen gelangen zu dem Ergebnis 5000 statt der richtigen 4100. Wir können im Geist nicht besonders gut Dezimalstellen nachverfolgen, und gerade diese Aufgabe verleitet die meisten Menschen dazu, eine 1 an die falsche Dezimalstelle zu übertragen.
Die meisten von uns finden ein Gesicht in einer Menschenmenge schneller, als dass sie das Ergebnis für 8 × 7 nennen können. In Wirklichkeit sind wir, um es unverblümt zu sagen, im Rechnen saumäßig schlecht. Es ist schon paradox: Praktisch jeder Mensch auf der Erde beherrscht mindestens eine Sprache, hat aber Mühe, 57 × 73 im Kopf zu berechnen. Dabei ist die zweite Aufgabe nach praktisch allen objektiven Maßstäben ungeheuer viel einfacher. Natürlich können wir unsere Fähigkeiten im Kopfrechnen durch Übung verbessern, aber auch mit noch so viel Übung wird auch der begabteste Mensch natürliche Logarithmen nicht so einfach und schnell berechnen können, wie jeder Jugendliche die verzerrten Buchstaben in einem CAPTCHA erkennt.
Wir sind auf Näherungslösungen spezialisiert, und numerische Berechnungen sind von ihrem Wesen her digital: Jede ganze Zahl, ob 1 oder 1729, entspricht einer abgegrenzten Größe. Die stufenweise Abfolge der ganzen Zahlen steht im Gegensatz beispielsweise zu dem unbestimmten Übergang zwischen Orange und Rot. Der französische Neurowissenschaftler Stanislas Dehaene weist in seinem Buch Der Zahlensinn oder Warum wir rechnen können darauf hin, dass Menschen und Tiere zwar von Natur aus ein Gefühl für Mengen haben (manche Tiere kann man sogar darauf trainieren, die Zahl der Gegenstände in einem Umfeld festzustellen), dieses Gefühl ist aber eindeutig nicht digital.10 Wir können die Zahlen 42 und 43 mit Symbolen wiedergeben, aber eigentlich haben wir kein Gefühl für «Zweiundvierzigsein» im Gegensatz zu «Dreiundvierzigsein», wie wir es für «Katzesein» und «Hundsein» haben.11 Möglicherweise besitzen wir ein inneres Gespür für Mengen von eins bis drei, aber jenseits davon wird die Sache unklar – wir erkennen vielleicht auf einen Blick, ob eine Haarsträhne oder drei auf Homer Simpsons Kopf stehen, aber wahrscheinlich müssen wir zählen, ob er vier oder fünf Finger hat.12 Angesichts der großen Bedeutung von Zahlen in der modernen Welt – von Altersangaben über Geld bis zur Baseballstatistik – erscheint es uns vielleicht verwunderlich, dass es in den Sprachen mancher Jäger und Sammler keine Wörter für größere Zahlen als 2 gibt. In diesen «Eins-zwei-viele»-Sprachen gehören alle Mengen, die größer sind als 2, einfach in die Kategorie «viele». In der Evolution war die Notwendigkeit, Muster zu erkennen, sicher größer als die, Zahlen nachzuverfolgen und zu handhaben. Auf einen Blick zu erkennen, dass mehrere Schlangen über den Boden kriechen, ist wichtiger, als genau festzustellen, wie viele es sind – hier funktioniert das «Eins-zwei-viele»-System natürlich gut, denn schon eine einzige Giftschlange ist eine zu viel.
Dass unser Gehirn sich schlecht für die Verarbeitung von Zahlen eignet, wissen wir alle. Aber warum hat ein Apparat, der Gesichter sofort erkennt und die notwendigen Berechnungen anstellen kann, um einen Ball im Laufen zu fangen, solche Schwierigkeiten mit einer langen Division? Wie die Einzelteile einer Armbanduhr, die viel über die Genauigkeit ihrer Zeitmessung aussagen, so liefern auch die Bausteine jeder Rechenmaschine viele Aufschlüsse darüber, was für Berechnungen sie gut durchführen kann. Unser Gehirn ist ein Netzwerk aus ungefähr 90 Milliarden Neuronen, die durch 100 Billionen Synapsen verknüpft sind; was die Zahl der Elemente und Verknüpfungen angeht, übertrifft es damit das World Wide Web mit seinen rund 20 Milliarden Webseiten, die durch eine Billion Links verbunden sind.13 Wie es sich für Elemente der Informationsverarbeitung gehört, sind Neuronen extrovertiert: Sie sind darauf aus, Verknüpfungen herzustellen und mit Tausenden anderer Neuronen gleichzeitig zu kommunizieren. Damit eignen sie sich hervorragend für Aufgaben wie die Mustererkennung, die voraussetzen, dass man aus den Beziehungen einzelner Teile Erkenntnisse über das Ganze gewinnt. Wie wir noch genauer erfahren werden, ist es kein Zufall, dass das Gehirn seine Rechenkapazität zu einem großen Teil seiner Fähigkeit verdankt, die innere Abbildung verschiedener Informationsbruchstücke zu verknüpfen, die auch in der Außenwelt in irgendeiner Beziehung zueinander stehen. Berechnungen mit Zahlen werden dagegen am besten durch die praktisch fehlerlosen, wie Schalter mit abgegrenzten Stellungen arbeitenden Millionen Transistoren auf einem Computerchip vollzogen. Neuronen sind fehleranfällige Elemente und miserable Schalter; wer eine Maschine für arithmetische Berechnungen konstruieren wollte, würde sie niemals aus Neuronen-ähnlichen Einzelteilen aufbauen, wer dagegen ein System zur Gesichtserkennung plant, könnte das durchaus tun.
Die natürliche, nicht aufzuhaltende Fähigkeit des Gehirns, Verknüpfungen aufzubauen und Assoziationen herzustellen, zeigt sich sehr deutlich in einer meiner Lieblingsillusionen, dem McGurk-Effekt (nachzuvollziehen auf meiner Homepage brainbugs.org/demos.html).14 In einer typischen Vorführung sieht man dabei einen Videoclip, in dem eine Frau etwas sagt. Wenn man ihr ins Gesicht sieht, erkennt man, wie ihre Lippen sich bewegen (sich aber nicht berühren), und man hört immer wieder, wie sie «dada dada» sagt. Schließt man dagegen die Augen, verwandelt sich das Geräusch in «baba baba». Was man hört, hängt also erstaunlicherweise davon ab, ob die Augen offen oder geschlossen sind. Die Illusion entsteht dadurch, dass man eine Tonspur, in der die Sprecherin «baba» sagt, über eine Videospur legt, in der sie «gaga» sagt. Warum hören wir dann mit geöffneten Augen «dada»? Das liegt einerseits daran, dass unser Gehirn unglaublich gut Verbindungen oder Assoziationen zwischen verschiedenen Vorgängen herstellen kann. Wenn wir nicht gerade eine ungewöhnlich große Zahl schlecht synchronisierter Kung-Fu-Filme gesehen haben, dann haben wir in 99 Prozent aller Fälle, in denen jemand die Silbe «ba» ausgesprochen hat, auch die Berührung und anschließende Trennung der Lippen gesehen. Das Gehirn hat diese Information gespeichert und entscheidet mit ihrer Hilfe, was wir hören. Der McGurk-Effekt entsteht durch widersprüchliche akustische und visuelle Informationen. Unser Gehör nimmt «ba» wahr, das Sehsystem sieht aber keine Berührung der Lippen, und deshalb weigert sich das Gehirn zu glauben, dass jemand «ba» gesagt hat. Es entscheidet sich für ein Mittelding zwischen «ba» und «ga», und das ist oftmals «da». (Wenn wir «da» sagen, nimmt unser Mund eine Zwischenposition zwischen den geschlossenen Lippen des «ba» und dem weit offenen «ga» ein.) Ob wir es wissen oder nicht: Wir alle lesen von den Lippen. Das ist nützlich, wenn wir andere in einem Zimmer, in dem es laut ist, verstehen wollen, aber es kann zum Problem werden, wenn wir synchronisierte Filme sehen.
Man kann es gar nicht nachdrücklich genug betonen: Viele unserer geistigen Begabungen erwachsen aus der Fähigkeit unserer Neuronen, Informationen mit benachbarten und weiter entfernten Partnern auszutauschen und Verknüpfungen zwischen Geräuschen, Bildern, Begriffen und Gefühlen herzustellen. Dazu ist das Gehirn programmiert. Durch akustische und visuelle Assoziationen lernen Kinder, dass das gesprochene Wort Bauchnabel zu diesem faszinierenden Gebilde mitten auf ihrem Bauch gehört. Dass sie die Striche erlernen, die einen Buchstaben bilden, die Buchstaben, die ein Wort bilden, und den Gegenstand, den das Wort bezeichnet, liegt an der Fähigkeit ihrer Neuronen und Synapsen, Assoziationen festzuhalten und neu zu erschaffen.15 Die assoziative Architektur des Gehirns trägt aber auch dazu bei, dass wir ähnliche Begriffe verwechseln und dass wir uns den Namen Bauer weniger gut merken können als den Beruf Bauer.
Erinnerungslücken sind bei Weitem nicht die einzige Schwäche unseres Gehirns, die mit seiner Art der Informationsspeicherung zu tun hat. Wie wir noch genauer erfahren werden, unterliegen auch unsere Meinungen und Entscheidungen willkürlichen, launischen Einflüssen. Unser Urteil über den Geschmack eines Weins wird beispielsweise unverhältnismäßig stark durch den angeblichen Preis der Flasche beeinflusst.16 Die assoziative Architektur unseres Gehirns steht auch in enger Verbindung zu unserer Anfälligkeit für Werbung, denn diese wirkt zu einem großen Teil deshalb, weil sie in unserem Gehirn Assoziationen zwischen bestimmten Produkten und wünschenswerten Qualitäten wie Komfort, Schönheit oder Erfolg schafft.
Die Evolution ist ein Pfuscher
Neuronen und Synapsen sind eindrucksvolle Produkte der evolutionären Konstruktion. Aber obwohl das Nervensystem so komplex und hoch entwickelt ist und obwohl die Vielfalt und Schönheit der Lebensformen auf unserem Planeten uns staunen lassen, ist der Evolutionsprozess als «Designer» oftmals schrecklich unelegant. Im Laufe der Jahrmilliarden wurde das Leben mühsam durch Ausprobieren gestaltet, und jeder Erfolg ging auf Kosten einer ungeheuer viel größeren Zahl tödlicher Sackgassen. Und selbst die Erfolge sind von Unvollkommenheiten durchsetzt: Meeressäuger, die unter Wasser nicht atmen können, Menschenbabys, deren Kopf zu groß ist und kaum durch den Geburtskanal passt, ein blinder Fleck auf unserer Netzhaut. Der Evolutionsprozess findet keine optimalen Lösungen; er richtet sich mit Lösungen ein, die einem Individuum gegenüber anderen einen geringfügigen Fortpflanzungsvorteil verschaffen.
Fragen wir uns beispielsweise einmal, woher eine frisch aus dem Ei geschlüpfte Gans genau weiß, wer ihre Mutter ist – das ist eine wichtige Information, denn das Küken sollte nahe bei der Gans bleiben, die ihm im Laufe der nächsten Wochen etwas zu fressen, Wärme und Flugstunden gibt. Für dieses Problem hat die Natur eine Lösung entwickelt: Frisch geschlüpfte Gänse werden auf eines der ersten beweglichen Objekte geprägt, das sie in den ersten Stunden nach dem Schlüpfen sehen. Aber die Prägung kann auch zum Nachteil werden. Unter Umständen laufen junge Gänse am Ende einem Hund, einer Spielzeuggans oder dem Verhaltensforscher Konrad Lorenz nach, wenn eines davon das Erste ist, was sie sehen. Eine raffiniertere Lösung würde darin bestehen, dass junge Gänse von Geburt an eine genauere Vorstellung davon haben, wie eine Gänsemutter aussieht. Die Prägung ist evolutionärer Pfusch – eine Lösung, die ihren Zweck erfüllt und relativ einfach umzusetzen ist, die aber auch in der Gesamtkonstruktion zur Schwachstelle werden kann. So ist es häufig: Die Evolution entwickelt eine Lösung, zu der ein intelligenter Konstrukteur sich nicht herablassen würde.
Ein Luftfahrtingenieur, der sich an die Entwicklung eines neuen Flugzeugs macht, wird zunächst einmal theoretische Analysen im Zusammenhang mit Schub, Auftrieb und Luftwiderstand durchführen. Als Nächstes baut er Modelle und macht Experimente. Und was am wichtigsten ist: Wenn das Flugzeug schließlich gebaut wird, werden seine Einzelteile zusammengebaut, eingestellt und getestet, während die Maschine noch sicher am Boden steht. Die Evolution kann sich solchen Luxus nicht leisten. Die Entwicklung einer Spezies muss immer «bei laufendem Betrieb» ablaufen. Jede neue Abwandlung muss vollständig funktions- und wettbewerbsfähig sein. Der Neurowissenschaftler David Linden hat das menschliche Gehirn einmal als fortschreitende Anhäufung evolutionärer Tricks und schneller Pfuschlösungen bezeichnet.17 Während der Evolution des Gehirns wurden neue Strukturen auf ältere, funktionsfähige Gehirnteile aufgepfropft, was zu Redundanzen, Ressourcenverschwendung, unnötiger Komplexität und manchmal sogar zu konkurrierenden Lösungen für das gleiche Problem führte. Außerdem mussten neu entstandene Berechnungsanforderungen mit der vorhandenen Hardware umgesetzt werden. Es gibt unterwegs keinen Wechsel vom Analogen zum Digitalen.
Menschen sind natürlich nicht die einzigen Tiere, deren Gehirn aufgrund der chaotischen Konstruktionsprozesse der Evolution am Ende Schwächen aufweist. Manch einer hat vielleicht schon beobachtet, wie eine Motte ihren Abschiedsflug in eine Lampe oder Kerzenflamme unternimmt. Motten orientieren sich am Licht des unerreichbaren Mondes, und dabei kann das erreichbare Licht einer Lampe ihr inneres Navigationssystem durcheinanderbringen – mit tödlichen Folgen.18 Stinktiere, die sich einem schnell näher kommenden Auto gegenübersehen, bleiben bekanntermaßen stehen, drehen sich um 180 Grad, heben den Schwanz und bespritzen das näher kommende Fahrzeug. Solche Fehler kommen wie viele Schwächen des menschlichen Gehirns dadurch zustande, dass manche Tiere heute in einer Welt leben, auf die sie von der Evolution nicht vorbereitet wurden.
Andere Macken des Gehirns aus dem Tierreich sind rätselhafter. Manch einer hat vielleicht schon einmal beobachtet, wie eine Maus hektisch im Laufrad rennt. Wer eine Maus als Haustier hat, der weiß auch, dass sie manchmal stundenlang auf der Stelle läuft, und dann fragt man sich vielleicht, warum sie so viel Zeit und Energie auf das Laufen im Laufrad verwendet. Eine ein wenig anthropozentrische Antwort würde lauten: «Nun ja, der arme Kerl hat Langeweile, was soll er denn sonst machen?» Aber die Bewegungen einer Maus im Laufrad lassen weniger an ein Ventil für Langeweile als vielmehr an eine Versessenheit denken. Ein wichtiger Nachweis wurde schon vor Jahrzehnten an Ratten geführt: Verschafft man ihnen eine Stunde am Tag Zugang zu Futter, wobei sie während dieser Zeit so viel fressen können, wie sie wollen, führen sie ein relativ gesundes Laborrattenleben. Bringt man dagegen in ihrer Behausung ein Laufrad an, sterben sie häufig innerhalb weniger Tage. Sie laufen von Tag zu Tag immer mehr, und wenig später werden sie zum Opfer von Unterkühlung und Hunger. Wenn Ratten ein Laufrad im Käfig haben, sind sie zwar aktiver, sie nehmen aber während der einstündigen Fütterungsphase weniger Nahrung zu sich als Ratten ohne Laufrad.19 In dem Laufen spiegelt sich also ganz offensichtlich kein gesundes Interesse an aerober körperlicher Aktivität wider. Ratten und Mäuse sind sehr erfolgreiche biologische Arten. Abgesehen von Menschen und Küchenschaben gelingt es nur wenigen Tieren, in so vielen ganz unterschiedlichen Winkeln der Erde zu überleben und zu gedeihen. Sie sind äußerst anpassungsfähige, zähe Tiere; wie können sie so töricht sein, sich von einem Laufrad in den Tod locken zu lassen? Ganz offensichtlich spricht das Gerät bestimmte Nervenschaltkreise an, die nie richtig auf ihre Eignung geprüft wurden, weil es für sie in der Entwicklungsgeschichte der Nagetiere kein entsprechendes Umfeld gab.
Die Bugs im Gehirn von Motten und Stinktieren werden eines Tages vielleicht ausgebessert, denn es liegt auf der Hand, dass Motten, die in Kerzenflammen fliegen, und Stinktiere, die überfahren werden, sich seltener fortpflanzen als andere. Als Konstrukteur wird die Evolution aber ständig durch ihre berüchtigte Langsamkeit behindert. Um Lebewesen zu schaffen, die beispielsweise eine giftige gelbe Meeresschneckenart nicht mehr verspeisen, bediente die Evolution sich ursprünglich der Strategie, alle krank werden oder sterben zu lassen, die es tun, sodass diese Individuen weniger Nachkommen haben. Die Umsetzung eines solchen Prozesses kann Zehntausende von Generationen in Anspruch nehmen, und wenn die Meeresschnecken in dieser Zeit ihre Farbe ändern, muss der Prozess wieder von vorn beginnen. Die kluge Lösung für das Problem der Langsamkeit fand die Evolution mit dem Lernen. Viele Tiere lernen, giftige Beute zu vermeiden, nachdem sie zum ersten Mal davon probiert haben, oder – noch besser – sie lernen durch Beobachtung der Mutter, welches Futter ungefährlich ist. Durch das Lernen können sich die Tiere während der Lebensdauer eines Individuums an ihre Umwelt anpassen, allerdings nur bis zu einem gewissen Grade. Wie die Motten, die weiterhin in Kerzenflammen fliegen, und wie die Stinktiere, die immer noch näher kommende Autos anspritzen, so haben auch viele andere Tiere relativ starre Verhaltensweisen, die in den Schaltkreisen des Gehirns fest verdrahtet sind. Wie wir beispielsweise noch genauer erfahren werden, neigen Menschen von Geburt an zu Angst vor Dingen, die früher eine beträchtliche Bedrohung für unser Leben und Wohlbefinden darstellten: Raubtiere, Schlangen, enge Räume und Fremde – das heißt vor Gefahren, die uns in unserer modernen Welt mit Autounfällen und Herzinfarkten am allerwenigsten beunruhigen sollten. Wegen des langsamen Tempos der Evolution funktionieren viele Tiere einschließlich des Menschen heute auf einer Grundlage, die man sich als unglaublich altertümliches Nerven-Betriebssystem vorstellen kann.
Wenn man verstehen will, was ich mit einem Nerven-Betriebssystem meine, ist die Analogie zu Computern wiederum nützlich – sie kann aber auch in die Irre führen. Welche Aufgaben ein Computer ausführt, hängt von seiner Hardware und Software ab; als Hardware bezeichnet man die physischen Bausteine wie Chips und Festplattenlaufwerke, bei der Software handelt es sich um die Programme oder Anweisungen, die in der Hardware gespeichert sind. Das Betriebssystem eines Computers kann man sich als seine wichtigste Software vorstellen: Es ist das Oberprogramm, das eine Mindestausstattung an Computerfunktionen zur Verfügung stellt und die Möglichkeit schafft, auf dem Rechner eine praktisch unendliche Zahl zusätzlicher Programme laufen zu lassen. Wenn es um das Nervensystem geht, ist die Abgrenzung zwischen Hardware und Software im besten Fall verschwommen. Man ist leicht versucht, sich Neuronen und Synapsen als Hardware vorzustellen, weil sie die greifbaren Bausteine des Gehirns sind. Aber jedes Neuron und jede Synapse hat auch eine individuelle Persönlichkeit, die nicht nur von den Genen, sondern auch von der Umwelt geprägt wird. Neuronen und Synapsen verändern sich, wenn wir lernen, und ihre Eigenschaften bestimmen ihrerseits darüber, wer wir sind und wie wir uns verhalten – welche Programme also im Gehirn ablaufen. Demnach stellen die Neuronen und Synapsen auch die Software des Gehirns dar.
Nützlicher ist die Analogie zwischen Computer und Gehirn vielleicht, wenn man die Hardware und das Betriebssystem des Computers mit dem genetisch codierten Programm vergleicht, das die Anweisungen für den Aufbau eines Gehirns enthält. Hardware und Betriebssystem sind im Computer eigentlich immer vorhanden und wurden nicht dazu konstruiert, dass man sie regelmäßig oder leicht verändern kann. Ganz ähnlich verhält es sich mit der genetischen Blaupause, die über Entwicklung und Funktion des Nervensystems bestimmt: Auch sie ist mehr oder weniger in Stein gemeißelt. Das Nerven-Betriebssystem bestimmt über alles, von der ungefähren Größe der frontalen Hirnrinde bis zu den Regeln dafür, wie Erfahrung den Charakter der Milliarden Neuronen und Billionen Synapsen prägt. Die in unserer DNA codierten genetischen Anweisungen sind auch für die viel weniger handfesten Aspekte im Gehirn des Menschen verantwortlich, so dafür, dass Sex uns Spaß macht, während wir es nicht mögen, wenn wir mit den Fingernägeln über eine Schultafel kratzen. Unser Nerven-Betriebssystem sorgt dafür, dass wir alle die gleiche Grundausstattung mit Trieben und Gefühlen besitzen. Die Evolution musste ein kognitives Rezept schaffen, das für die Feinabstimmung dieser Triebe und Gefühle sorgt: Es musste Angst und Neugier ins Gleichgewicht bringen, einen Ausgleich zwischen rationalen und irrationalen Entscheidungen schaffen, Habgier und Altruismus gegeneinander abwägen und eine schwer fassbare, launische Heuristik in Gang setzen, die Liebe, Eifersucht, Freundschaft und Vertrauen miteinander verschmilzt. Wo liegt die optimale Balance zwischen Angst und Neugier? Während der gesamten Evolution war Neugier die Triebkraft für den Wunsch, Neues zu erfahren, und für die Fähigkeit, sich auf neue Horizonte einzustellen; Angst dagegen schützt ein Tier vor seiner unwirtlichen Umwelt, in der man viele Dinge am besten unerforscht lässt. Die Evolution stand vor der schwierigen Aufgabe, gegensätzliche Triebe und Verhaltensweisen ins Gleichgewicht zu bringen, damit wir in einer unberechenbareren, sich ständig wandelnden Welt mit unzähligen Zukunftsszenarien zurechtkommen. Das Ergebnis war kein festes Gleichgewicht, sondern ein System von Regeln, die zulassen, dass Erfahrungen unser Wesen abwandeln. Da wir als Homo sapiens – anders als unsere ausgestorbenen Vettern, die Neandertaler – derzeit über den Planeten herrschen, sieht es ganz danach aus, als habe die Evolution uns mit einem Betriebssystem ausgestattet, das sich für das Überleben und den Fortpflanzungserfolg gut eignet.
Andererseits leben wir heute in einer Welt, die der erste Homo sapiens nicht mehr wiedererkennen würde. Als Spezies haben wir den historischen Weg von einer Zeit ohne Namen und Zahlen in eine Welt zurückgelegt, die im Wesentlichen auf Namen und Zahlen basiert; aus einer Zeit, in der die Nahrungsbeschaffung das wichtigste Problem darstellte, in eine Welt, in der die Überversorgung mit Nahrung eine verbreitete Ursache potenziell tödlicher Gesundheitsstörungen darstellt; aus einer Zeit, in der der Glaube an Übernatürliches der einzige Weg war, um das Unbekannte zu «erklären», in eine Welt, die im Großen und Ganzen mit der Naturwissenschaft zu erklären ist. Und doch funktionieren wir immer noch im Wesentlichen mit dem gleichen alten Nerven-Betriebssystem. Obwohl wir jetzt in einer Zeit und an einem Ort wohnen, für die wir nicht programmiert wurden, sind die in unserer DNA niedergeschriebenen Anweisungen zum Aufbau eines Gehirns noch die gleichen wie vor 100 000 Jahren. Damit stellt sich eine wichtige Frage: Inwieweit eignet sich das von der Evolution bereitgestellte Nerven-Betriebssystem noch für eine digitale Welt ohne natürliche Feinde, wie wir sie für uns selbst aufgebaut haben – mit zu viel Zucker, mit vielen Spezialeffekten, mit einer Überfülle an Antibiotika, einer Übersättigung mit Medien und einer dichten Bevölkerung?
Wie wir in den nächsten Kapiteln genauer erfahren werden, reicht das Spektrum der Bugs unseres Gehirns von harmlosen bis zu Fehlern, die weitreichende Auswirkungen auf unser Leben haben. Die assoziative Architektur des Gehirns trägt zu falschen Erinnerungen bei und sorgt dafür, dass Politiker und Unternehmen unser Verhalten und unsere Überzeugungen nur allzu leicht beeinflussen können. Unsere schlechte Fähigkeit zum Umgang mit Zahlen und unser verzerrtes Zeitgefühl tragen dazu bei, dass wir zu schlecht überlegten persönlichen finanziellen Entscheidungen neigen und schlecht mit Gesundheit und Umwelt umgehen. Unsere angeborene Neigung, uns vor Fremdem zu fürchten, vernebelt unser Urteilsvermögen und beeinflusst nicht nur unsere Wahlentscheidungen, sondern auch die Entscheidung, ob wir in den Krieg ziehen. Unsere anscheinend tief verwurzelte Neigung, an Übernatürliches zu glauben, gewinnt oftmals die Oberhand über die stärker rational ausgerichteten Teile unseres Gehirns, was manchmal tragische Folgen nach sich zieht.
In einigen Fällen sind diese Macken sofort zu erkennen; meist jedoch hängt das Gehirn seine Schwächen nicht an die große Glocke. Wie Eltern, die sorgfältig auswählen, welche Informationen sie ihrem Kind zugänglich machen, so überprüft und zensiert auch das Gehirn große Teile der der Informationen, mit denen es den bewussten Geist füttert. Ihr Gehirn hat wahrscheinlich das überzählige «der» im vorherigen Satz getilgt, und auf ganz ähnliche Weise bleibt unser Bewusstsein auch gnädig verschont vor den vielen willkürlichen, irrationalen Faktoren, die über unsere Entscheidungen und Verhaltensweisen bestimmen.
Wenn wir aber die Schwächen des Gehirns offenlegen, können wir unsere natürlichen Stärken besser nutzen und unser Versagen erkennen, und das wiederum führt dazu, dass wir uns besser auf die Linderung der Schwachpunkte konzentrieren können. Unsere kognitiven Grenzen und geistigen blinden Flecke zu erkunden, ist also einfach ein Teil unserer Suche nach Selbsterkenntnis. Oder, wie der große spanische Neurowissenschaftler Santiago Ramon y Cajal es formulierte: «Solange das Gehirn ein Rätsel ist, wird auch das Universum – das Spiegelbild der Struktur des Gehirns – ein Rätsel bleiben.»
1. Das Gedächtnis-Netzwerk
Als ich eines Abends in Kanada vor Miles Davis aufgetreten bin … wollte sagen … vor Kilometer Davis.
Diesen Witz habe ich von dem Comedian Zach Galifianakis übernommen. Verständlich wird er, wenn man zwei Verbindungen herstellt: Kilometer/Meilen (miles) und Kanada/Kilometer. Dazu muss man sich bewusst oder unbewusst daran erinnern, dass in Kanada im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten das metrische System verwendet wird – daher der Austausch von «Kilometer» für «Miles». Zu den vielen schwer fassbaren Zutaten des Humors gehören Übergänge und Assoziationen, die sinnvoll sind, aber unerwartet kommen.1
Eine andere Faustregel aus der Welt der Comedy besagt: Kehre zu einem bereits erwähnten Thema zurück. Fernsehkomiker und Stand-up-Comedians machen häufig einen Witz über eine Person und kommen ein paar Minuten später in einem ganz anderen, unerwarteten Zusammenhang auf das gleiche Thema oder dieselbe Peron zurück, woraus sich ein humoristischer Effekt ergibt. Die gleiche Anspielung wäre aber überhaupt nicht lustig, wenn das Thema zuvor nicht bereits erwähnt worden wäre.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























