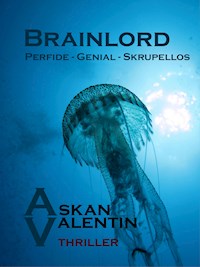
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Weltweit häufen sich bizarre und grausame Vorfälle. Zunächst augenscheinliche Suizide. Dann subtilere Handlungen, vom Einzelmord bis zum Massensterben. Erst als in den Köpfen einiger Täter und Opfer eine seltsame Masse entdeckt wird, können die Behörden einen Zusammenhang erkennen. Doch wie kommt dieses Gebilde in den menschlichen Körper? Warum bringen sich die Menschen um oder töten andere? Und warum werden die Aktionen immer gezielter und raffinierter? Eine spektakuläre Welterpressung, bei der der Ermittler Stefan Koch selbst ins Fadenkreuz der skrupellosen Täter gerät.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Brainlord
Ein Thriller von
Askan Valentin
in partnerschaftlicher Entwicklung mit
Lektorat: Monika Esterer (www.wortklauberei.de)
~ 340 Normseiten
Text Copyright © BPM Kai Wollschläger
www.4-wollschlaeger.de
Alle Rechte vorbehalten
Endbahnhof
Südafrika, Pretoria, ein Monat früher
Die grünen Zahlen des Radioweckers flackerten in den Augen von Husani Cwele, als er mitten in der Nacht aufwachte. Die Ziffern zeigten kurz vor drei Uhr morgens und ein pulsierender Kopfschmerz ließ Husani instinktiv seine Schläfen massieren. Neben ihm schlief seine Frau Azana. Sie schnarchte leise. Seit der Geburt ihres dritten Sohnes hatte sie öfter Probleme mit der Lunge. Husani setzte sich auf und massierte weiter seine Schläfen. Doch der Schmerz wurde unbeeindruckt intensiver. Angesichts der Tatsache, dass Husani Lokführer war und dadurch selten zu Hause, hatte Azana ihre drei Söhne zum großen Teil allein zu versorgen. Dementsprechend leicht war ihr Schlaf und sie bemerkte ihren Mann auf der Bettkante sitzen. Sie war fast schon wieder weggenickt, als Husani aufstand und in den Flur ging. Azana dachte an einen nächtlichen Besuch auf der Toilette, doch ihr Mann blieb im Flur stehen. Sie konnte es zwar nicht sehen, doch sie hörte keine Schritte mehr. Dann meinte sie, das Freizeichen des Telefons zu hören, und tatsächlich wählte ihr Mann eine Nummer. Vorsichtig richtete Azana sich auf und lauschte mit kraus gezogener Stirn. Meldete sich ihr Mann etwa krank? Oder wen rief er um diese Uhrzeit an?
»Husani Cwele 55468732642125489501. Bestätigung. Blue Train von Pretoria nach Kapstadt. Abfahrt heute um 8:00 Uhr. Geplante Ankunft am 8. April um 12:00 Uhr. Gleis zwei.« Er legte den Hörer in die Gabel und seufzte. Nach einigen Sekunden begab er sich auf die Toilette.
Innerlich kopfschüttelnd konnte sich Azana keinen Reim darauf machen. Seit wann musste er seine Routen bestätigen? Und dann noch mitten in der Nacht? Noch bevor sie sich weitere Gedanken machen konnte, tauchte ihr Mann wieder aus dem dunklen Flur auf und legte sich ins Bett.
»Mit wem hast du telefoniert?«, flüsterte Azana. Sie erhielt keine Antwort. Husani war bereits wieder eingeschlafen. Sie schüttelte noch einmal den Kopf und legte sich ebenfalls wieder auf ihr Kopfkissen.
Um 5:30 Uhr dröhnte Husanis Radiowecker mit seinem durchdringenden Quäken durch das kaum möblierte Schlafzimmer. Als Lokführer war er es gewohnt, zu unterschiedlichen Zeiten aufzustehen, und benötigte nicht lange, um sich aus seinem Bett zu schälen. Sofort schwang er sich unter die erfrischende Dusche. Bereits beim Abtrocknen nahm seine Nase den wohligen Duft von frischem Kaffee wahr. Azana ließ es sich nicht nehmen, mit ihrem Mann aufzustehen und zu frühstücken. Fünf Minuten später saßen sie am kleinen Tisch in der Küche. Husani gab seiner Frau einen Kuss auf die Stirn und ließ sich dampfenden Kaffee in seinen Becher gießen.
»Mit wem hast du heute Nacht eigentlich telefoniert?«, versuchte Azana erneut, ihre Neugier zu befriedigen.
»Telefoniert?«, echote ihr Mann und verengte die Augen. »Wann?«
»Sagte ich doch. Heute Nacht. Um kurz vor drei. Du hast deinen Namen gesagt. Und eine Nummer. Ist das deine Personalnummer? Und du hast von deiner heutigen Tour gesprochen. Abfahrt, Ankunft und das Gleis, glaube ich. Seit wann musst du das machen? Und warum mitten in der Nacht? Hatte dein Wecker geklingelt?«
Mit einem sanften Lächeln legte Husani seiner Frau seinen rechten Zeigefinger auf die Lippen. »Stopp. Hol erst mal Luft. Hast du geträumt oder was?«
Kopfschüttelnd antwortete Azana mit einem beleidigten Gesichtsausdruck: »Nein, habe ich nicht. Du bist aufgestanden und dann eine Weile im Flur gestanden. Dann hast du eine Nummer gewählt. Und dann hast du ...«
»Nein, Azana. Ich habe nicht telefoniert. Und ich muss das auch nicht machen. Du wirst geträumt haben.«
»Ich weiß doch, wann ich geträumt habe, Husani. Ich bin davon aufgewacht. Willst du mir wirklich weismachen, dass du nicht telefoniert hast?«
»Ich wüsste niemanden, der es besser wissen müsste«, antwortete er mit einem schelmischen Grinsen. »Hör zu«, er schaute auf die einfache Küchenuhr, die über dem Tisch hing, »es ist schon spät. Ich muss los. Ich melde mich, wenn ich in Kapstadt bin. Wie immer.«
Azana wurde trotz der ablehnenden Haltung ihres Mannes nicht müde, weiter zu protestieren. Zum Abschied gab Husani seiner Frau einen Kuss und flüsterte in ihr rechtes Ohr. »Ich liebe dich. Gib den Kindern einen Kuss.«
»Ich liebe dich auch. Aber wenn du mich anflunkerst und dir neben mir eine Freundin hältst, schneide ich dir was ab. Hörst du?«
Im Umdrehen rief Husani: »Aber ich liebe doch nur dich.«
»Das hoffe ich für dich.« Sie lächelte zögerlich und winkte ihm zum Abschied.
Um 7.30 Uhr schritt Husani auf seine 34-404 Diesellokomotive zu. Aufgrund umfangreicher Reparaturarbeiten an den Streckenabschnitten mit Oberleitung würde er diese Tour vollständig mit der Diesellok fahren. Die Bahnangestellten waren gerade dabei, die schweren Koffer der 74 internationalen Gäste an Board des über 300 Meter langen Luxuszuges zu hieven. Wie immer war der Zug vollständig ausgebucht. Und wie immer ließen sich die sehr betuchten Gäste viel Zeit bei der Anreise und beim Einstieg, sodass sie erst mit gut 30 Minuten Verspätung starten konnten. Aber dabei ging es bei dieser Reise nicht. Niemand hatte einen Anschlusszug zu bekommen oder einen geschäftlichen Termin am Zielort. Der Weg war das Ziel.
Knapp 28 Stunden und einige Pausen zum Augen schließen später fuhr der Blue Train auf sein Ziel zu, den Kopfbahnhof von Kapstadt. Zehn Kilometer vor dem Bahnhofsgelände wurde Husanis Blick trübe. Zwei Minuten und vier Kilometer später ignorierte Husani eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 Stundenkilometer und setzte seine Fahrt unbeirrt mit etwas über 100 Stundenkilometer fort. Immer wenn der sogenannte Totmannschalter summte, sauste seine Hand wie in Trance auf den riesigen Taster herab und ließ das Gerät verstummen. Noch fünf Kilometer.
Ein Mitarbeiter des Zuges schaute aus dem Küchenwagen heraus, als er ein ungewöhnliches Klappern des Geschirrs feststellte. Er erkannte die Häuser von Maitland und konnte sich nicht daran erinnern, dass der Zug schon einmal mit so einer hohen Geschwindigkeit durch das Wohngebiet gefahren war. Eine darauf hingewiesene Kollegin zuckte nur mit den Schultern und räumte das letzte Porzellan in die Schränke.
Im Führerstand der Lokomotive ignorierte Husani das Zugtelefon und das Funkgerät. Die männliche Stimme, die durch das Funkgerät schallte, wurde von Sekunde zu Sekunde nervöser und lauter. Husanis rechte Hand drückte automatisch auf den Totmannschalter und stierte unbeirrt geradeaus. Noch etwas über drei Kilometer. Direkt nach der Durchfahrt der Unterführung des Black-River-Parkway begann der gesamte Zug durch diverse Weichen ruckartig zu rumpeln. Einige Frauen kreischten in den Waggons auf und viele der reisenden Touristen starrten ungläubig auf die vorbeirasende Stadtkulisse. Das Rumpeln und Holpern des Zuges nahm stetig zu. Jetzt wurde es auch dem letzten Angestellten und den meisten Passagieren klar, dass es ein ernsthaftes Problem gab. Der verantwortliche Reiseleiter kämpfte sich durch den schwankenden und lärmenden Zug zum Boardtelefon. Er wählte die Nummer des Lokomotivführers. Es klingelte. Aber niemand ging ran. In der nächsten Sekunde wurde er durch eine harte Rechtskurve und weitere Weichen an die linke Außenwand geworfen und verlor kurzfristig den Halt. Erschrocken angelte er sich wieder den Hörer und schrie hinein: »Stopp!« Aber sofort bemerkte er, trotz der Rumpel- und Quietschgeräusche, dass das Telefon immer noch läutete. Starke Stöße und ein komplett wankender Waggon holten ihn erneut von den Füßen und zum Getöse des ächzenden Zuges gesellten sich die Schreie der Passagiere und Angestellten. In letzter Konsequenz hechtete er auf den Hebel für die Notbremse zu. Doch ein weiterer Schlag des Zuges ließ ihn taumeln und gegen die Ausgangstür knallen. Benebelt sah er, wie Blut aus seiner Nase auf den Boden tropfte.
Husani sah weiter geradeaus. Endlich. Das Ziel war vor seinen Augen. Gleich wäre er erlöst. Die letzte Kurve vor dem Bahnhof hatte den Zug fast aus den Schienen gerissen. Aber wie durch ein Wunder blieben der Triebwagen und alle Waggons in der Spur. Die Dunkelheit des Kopfbahnhofs kam rasend schnell näher und nur wenige Augenblicke später tauchte Husani mit seinem Zug in den Bahnhof ein. Auf dem Bahnsteig des Gleises standen außergewöhnlich viele Menschen. Bahnangestellte versuchten, einige von ihnen hektisch vom Bahnsteig zu entfernen. Doch sie schienen sich zu wehren. Wie auf Kommando begannen plötzlich viele der Wartenden, die kein erschrockenes Gesicht hatten, auf die Lokomotive zuzulaufen. Kurz bevor die Lok an ihnen vorbeirauschen konnte, sprangen sie auf Husani zu. Wie bei einem wilden Trommelwirbel klatschten dutzende Körper gegen die Front der Lok und flogen spritzend auseinander. Husani starrte weiter geradeaus. Seine rechte Hand berührte ein letztes Mal den Totmannschalter. Im gleichen Augenblick erstarb das Getrommel der menschlichen Leiber und die Puffer der Lokomotive bohrten sich in den Prellbock des Gleises. Dieser hatte der enormen Wucht des Zuges nichts entgegenzusetzen. Er wurde zusammen mit der dahinterliegenden Wand aus dem Bahnhofsgebäude geschoben. Nun kam der gesamte Zugkörper aus der Spur. Der Triebwagen und die Waggons begannen sich während ihrer verheerenden letzten Reise querzustellen. Dabei zerstörten sie Mauer- und Stahlpfeiler. Teile der Decke des Bahnhofsgebäudes stürzten polternd herab. Die Menschen, die auf dem Dach des Gebäudes einen Markt besucht hatten oder einen Stand darauf betrieben, hatten keine Chance und verschwanden in den staubenden Löchern, die sich unter ihnen auftaten. Vier Sekunden später kam das letzte Zugabteil, der leere Konferenzwagen, fast unversehrt zum Stehen. Die anderen Waggons waren nicht mehr als Ganzes zu erkennen.
Husani war erlöst.
Am Abend erfuhr Azana zusammen mit ihren drei Kindern vor dem Fernseher von dem Unglück. Die Nachrichtensprecherin war sichtlich schockiert und las von einem knittrigen Zettel die bisherigen Erkenntnisse vor: »Mehrere Überwachungskameras vor und in dem Bahnhof haben das Unglück aufgezeichnet. Der Zug scheint mit voller Geschwindigkeit und ohne Bremsversuch gegen den Prellbock des Gleises geprallt zu sein. Aber noch bevor der Zug durch die Bahnhofsmauer brechen konnte, zeichneten die Kameras auf, dass insgesamt 27 Menschen, die am Bahnsteig warteten, auf den Zug zu rannten und«, sie schluckte mehrfach kräftig, »scheinbar Selbstmord begingen. Bisher hat noch niemand eine Erklärung für das Verhalten. Bei dem Unfall sind im Zug 55 meist ausländische Touristen ums Leben gekommen. 15 wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert und einige werden noch vermisst. Neben dem Zugführer gab es weitere 19 Tote bei den Zugbegleitern. Einige schweben noch in Lebensgefahr. Durch den teilweisen Einsturz des Daches sind weitere zwölf Menschen getötet worden und über hundert verletzt. Die Stadt hat den Notstand ausgerufen und geht nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen von einem terroristischen Anschlag aus.«
Kapitel 1 - Jenny
Deutschland, Raum Hannover
Es war noch dunkel. Alles außerhalb der Bettdecke war dunkel, weit weg und sie fröstelte bei dem Gedanken, auch nur ein Bein herauszustrecken. Wie aus einer entfernten Dimension hörte Jenny die Stimme ihrer Mutter.
»Ich rufe dich jetzt zum letzten Mal«, hörte sie sie wiederholt kreischen. Sie rief das normalerweise mindestens drei Mal, bevor sie die Treppe hochkam und ein Donnerwetter losging. Auf der Treppe rumpelten Schritte. Aber nicht die ihrer Mutter. Es waren die Schritte ihrer trampeligen Schwester. Fast zehn Jahre jünger, aber hundertmal lauter. Alles, was sie tat, war laut. Ihre Stimme, ihre Art zu gehen, und wenn sie ihr Zimmer aufräumte, klang es fast so, als würde sie ausziehen. Inklusive Möbel. Als sie zur Welt kam, war Jenny schon zehn Jahre alt. Das zweite Wunschkind ihrer Eltern entpuppte sich allerdings nicht als Jennys erträumte Schwester. Sie war permanent laut, aggressiv, im Mittelpunkt stehend und sowieso alles besser machend als ihre große Schwester. Es gab keinen Tag, keine Stunde ohne Streit ...
»Jenny«, schallte es die Treppe herauf. »Jetzt platzt mir gleich der Kragen!«
»Ich komme ja«, antwortete Jenny und hielt vorsichtig ein Bein aus dem Bett. Es war tatsächlich kalt außerhalb der kuscheligen Decke.
»Wenn du nicht in einer Minute am Frühstückstisch sitzt, kannst du deinen Ausflug in die Stadt heute vergessen.«
Jenny schlug ihre Augen auf und war mit einem Mal hellwach. Das hatte sie ja völlig vergessen. Sie musste heute früher aufstehen. Sie musste sich chic machen und schminken. Direkt nach der Schule wollte sie mit zwei ihrer Freundinnen und drei Typen aus der zehnten Klasse in die Stadt fahren. In die richtige Stadt. 30 Kilometer mit der Bahn. Mit hunderten Klamottenläden. Riesig und schön. Richtig was los ...
»Hast du mich verstanden?«
»Ja, Mama.« Sie schoss hoch. Die Kälte war vergessen. Die Müdigkeit auch. Gestern hatte sie sich in Gedanken noch zurechtgelegt, was sie anziehen wollte. Heute war sie sich nicht mehr sicher. Was Kurzes musste es sein. Sexy. Simon erschien vor ihrem inneren Auge. Einer der Jungs aus der Zehnten. Sie bekam Herzklopfen, wenn sie an ihn dachte. Und sie musste im Grunde immerzu an ihn denken. Er war anders als die anderen. Cool und hübsch. Wenn er mit seinem Skateboard über den Schulhof glitt, drehten sich nahezu alle weiblichen Köpfe nach ihm um. Klar, bei seiner Erscheinung. Groß, blond und ein Gesicht wie ein Popstar. Und er war nicht so albern ...
»Mama hat gesagt, wenn du nicht ...«, hörte sie ihre Schwester plappern, die plötzlich mit ihrem unter die Achselhöhle geklemmten Kuscheltier vor ihr stand.
»Raus aus meinem Zimmer!«, blökte sie ihre kleine Schwester an und donnerte die Tür zu, dass es im Flur knallte. Sie zog ihren Morgenmantel aus einem am Boden liegenden Kleiderhaufen und betrachtete sich kurz im Spiegelbild einer CD. »Du siehst zum Heulen aus«, sagte sie zu sich selbst, drehte sich um und lief die Treppe hinab zur Toilette. Zwei Minuten später saß sie neben ihrer ununterbrochen meckernden Mutter am Frühstückstisch in der Küche und spürte die Füße ihrer Schwester gegen ihre Knie prallen.
»Hör auf, du blöde Kuh«, schrie sie genervt und rückte etwas von ihr ab.
»Hast du mich verstanden?«, fragte ihre Mutter mit einem ebenfalls genervten Gesichtsausdruck nach.
Jenny dachte kurz nach. Was hatte ihre Mutter gesagt? Sie hatte ihr nicht zugehört. Sie meckerte ununterbrochen. Wie sollte man da die ganze Zeit zuhören? »Was?«
»Wie - was?« Verdutzt taxierte ihre Mutter Jennys Gesicht.
»Was du gesagt hast?«
»Mama hat gesagt ...«
»Ich habe dich nicht gefragt«, schnauzte Jenny ihre kleine Schwester an.
»Ich habe dich gefragt«, versuchte sich ihre Mutter in einem betont ruhigen Ton, »was du anziehen willst.«
»Die kurze weiße Jeans.«
»Die du gestern anhattest?«
Jenny nickte, während sie lustlos von ihrem Toastbrot abbiss.
»Ist in der Wäsche.«
»Was?«, rief Jenny und spuckte dabei ein paar Krümel auf den Tisch. »Die wollte ich heute aber anziehen!«
»Dann hättest du keinen Kirschjoghurt draufkleckern sollen.«
»Scheiße«, rief Jenny aus und schmiss das Toastbrot auf den Teller.
»Scheiße sagt man nicht«, kam es von ihrer Schwester.
Jenny bestrafte ihre Schwester mit einem tödlichen Blick, der von einer mit Nougatcreme beschmierten Zunge beantwortet wurde. Sie stand auf und lief mit wässrigen Augen zum Hauswirtschaftsraum. Im Hintergrund hörte sie ihre Mutter meckern. Sie begann, die beiden Wäschetonnen zu durchwühlen, konnte aber auf Anhieb nichts finden.
»Flecken mit Kirschjoghurt wasche ich sofort und lasse es nicht erst eintrocknen«, hörte sie ihre Mutter sagen, die plötzlich in der Tür stand. »Kannst du nicht die blaue Jeans anziehen?«
»Nein«, antwortete Jenny erbost. »Immer musst du das waschen, was ich anziehen will.«
Ihre Mutter zeigte mit ihrem rechten Zeigefinger drohend in Jennys Gesicht. »Du hast doch selbst die Shorts vor die Tür geworfen. Wenn nicht, wäre sie in deinem - Haufen - verschwunden oder auf dem Toilettenboden gelandet. Also erzähl mir nicht, ich ...«
»Du kapierst es einfach nicht«, antwortete Jenny schnippisch und kurz davor loszuheulen.
»Was kapiere ich nicht?«
»Nichts.«
»Was?«
Die Katzenklappe schepperte und ihr ewig hungriger Kater stand maunzend zwischen ihnen.
»Mach, was du willst. Es ist mir langsam egal. Meinetwegen kannst du die feuchte Hose anziehen, wenn du dich blamieren willst.«
»Du kapierst echt nichts!«, schrie Jenny, warf ein paar Stücke der Schmutzwäsche auf den Boden und stampfte heulend die Treppe hinauf, um kurz danach erneut lautstark die Tür ihres Zimmers ins Schloss fallen zu lassen.
Eine halbe Stunde später verließ Jenny das Haus und schwang sich samt Helm auf ihr Fahrrad. Sie trug blaue Jeans mit einem weißen Top. Darüber eine offene Jacke. Das war jetzt geradetrendy. Zumachen ging nicht - auch wenn es arschkalt war. Dazu hatte sie sich dezent geschminkt und leicht parfümiert, denn sie wollten zusammen direkt nach der letzten Stunde los.
»Wenn irgendetwas ist«, rief ihre Mutter hinterher, »rufst du mich an. Und spätestens um acht bist du zu Hause. Verstanden?«
»Ja, Mama.«
»Und mach die Jacke zu.«
»Ja.« Sie verdrehte die Augen und bog in eine kleine Allee ein. Außer Sichtweite öffnete sie wieder die Jacke und stopfte ihren Helm und den Schal in ihren Rucksack.
Deutschland, Hamburg
In einer Ecke eines Privatlabors eines Professors saß ein Mann und tippte Befehle in einen Computer, die er umständlich über mehrere Zettel kombinieren musste.
»Was machst du da?«, unterbrach ihn der Professor und ließ den Mann zusammenzucken.
»Das geht dich nichts an.«
»Wie bitte?«, kam es empört vom Professor.
»Sorry - ich probiere was aus.«
»Entschuldige, aber ich habe so langsam das Gefühl, dass wir nicht am gleichen Strang ziehen - irgendwie unterschiedliche Interessen verfolgen.«
»Nee - alles gut. Ich kümmere mich nur ums Marketing.«
»Das ist Marketing?«, fragte der Professor und deutete auf den Bildschirm mit seiner Befehlsmatrix.
»Das ist ...«, der Mann stockte und seufzte schwer, »nur etwas zum Ausprobieren. Nichts Schlimmes. Versprochen.«
»Ist was nicht in Ordnung?«, unterbrach ein anderer Mann das Zwiegespräch.
»Nee, alles roger«, kam es vom Mann vor dem Computer. »Der Professor wollte nur wissen, was ich mache.«
»Mach auf jeden Fall keinen Unsinn«, forderte der Professor auf und lies die beiden Männer stehen.
Grinsend fragte der stehende Mann: »Und? Was machst du?«
»Ich probiere aus, was für Möglichkeiten wir haben. Vielleicht steht es morgen in der Zeitung.«
Hannoverscher Anzeiger vom 15. März.
Tödlicher Unfall am Kreisel
Isernhagen. Die Kriminaldienststelle Isernhagen sucht dringend Zeugen, die den Vorfall am gestrigen Abend in der Fußgängerzone beobachtet haben, als eine circa 40-jährige Frau aus irrationalen Gründen in Panik geriet. Im bekannten Café Schöne Aussicht begann die Odyssee, als die Frau zu einer Bedienung sagte, in ihrem Kaffee schwämme ein Tier und sie sei Vegetarierin. Bei der Überprüfung der Kaffeetasse verschüttete die Bedienung ein paar Tropfen auf den Tisch. Scheinbar fasste die noch unbekannte Frau die Kaffeeflecken als Ungeziefer auf, denn sie soll lauthals geschrien haben, jemand solle die Spinnen wegmachen. Augenzeugen berichteten, dass die Bedienung und Gäste des Cafés versucht haben, die Frau zu beruhigen. Ihr Gefühlsausbruch verwandelte sich aber trotz aller Bemühungen in eine ausgedehnte Panikattacke. In jeder Ecke sah sie Ungeziefer, schüttelte vermeintliches Geschmeiß an ihrer Kleidung ab und begann, mit ihrer Handtasche um sich zu schlagen. Ein zufällig anwesender Psychologe versuchte, die Frau aus ihrer Panikattacke zu befreien, aber auch mit einem herbeigerufenen Polizisten konnte nicht verhindert werden, dass sie offenbar vollkommen orientierungslos auf die Hauptstraße direkt am Kreisel lief. Der Führer eines LKWs konnte trotz Notbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und überrollte die Frau. Sie starb noch am Unfallort. Zeugen, die den Unfallort überhastet verlassen haben, werden gebeten, ihre Aussagen zu Protokoll zu geben.
Nach der letzten Stunde versuchte Jenny, mit ihren Freundinnen den Schulhof zu überblicken, konnten aber weder Simon noch einen seiner Freunde entdecken. Erst nachdem sich der Hof einigermaßen gelichtet hatte, sahen sie die drei auf ihren Skateboards mit ihren Rucksäcken über den Schultern in Richtung Eingang gleiten.
»Die waren in der Turnhalle«, meinte eine von Jennys Freundinnen. »Los, hinterher!«
»Hallo?«, erwiderte Jenny empört. »Ich laufe denen doch nicht hinterher ...«
»Aber sie haben uns nicht gesehen.«
»Ja und? Sollen sie sich doch nach uns umgucken. Wir bleiben hier stehen«, bestimmte Jenny streng. Ihre Freundinnen fügten sich und versuchten wieder möglichst lässig zusammenzustehen.
»Und wenn sie jetzt abhauen?«, kam es nun von Jennys zweiter Freundin, die ihre Klamotten zwei Nummern zu klein gewählt hatte.
»Dann tun wir so, als wenn wir es vergessen hätten, und verabreden uns neu.«
»Wenn sie das dann noch wollen.« Ihre Freundin strafte sie mit einem strengen Blick. »Jenny - die sind zwei Klassen über uns. Ich weiß sowieso nicht, warum die sich mit uns treffen wollen.«
»Weil wir nicht wie aus der Achten aussehen.«
»Passt auf, sie kommen«, zischelte Jennys Freundin hinter vorgehaltener Hand.
»Hey Mädels«, kam es von einem der Jungs. »Seid ihr startklar?«
Die Mädchen nickten unsicher und kurze Zeit später setzte sich die Gruppe in Richtung Bahnhof in Bewegung.
Die S-Bahn in die Stadt war leider so überfüllt, dass sie keine Sitzgruppe für sich finden konnten, und so saßen oder standen sie wild durcheinander.
Jenny beobachtete Simon verstohlen zwischen ein paar Fahrgästen hindurch. Innerlich seufzte sie. Im Profil sah er mindestens genauso gut aus wie von allen anderen Seiten auch. Am liebsten hatte sie seinen traurigen Blick, wenn er Musik hörte oder träumte. Das Date hatte ihre Freundin Sissi hinbekommen. Jenny hätte sich nie getraut, die Jungs anzusprechen. Obwohl Sissi nicht dem Schönheitsideal entsprach, war sie enorm selbstbewusst. Sie hatte die Jungs einfach angesprochen, ob sie die Jungengruppe als Begleitschutz in die Stadt anheuern könnte, und wollte sich mit einem Eis bedanken. Die Jungs schauten erst skeptisch, sagten aber zu, als sie sich überzeugt hatten, wer noch mitkommen würde. Simon hatte Sissi dann gefragt, wie die Brünette hieß. Er deutete dabei auf Jenny. Und Sissi hat ihr das natürlich gleich erzählt, woraufhin Jenny prompt rot wurde und den Tag des Ausflugs in die Stadt nicht mehr erwarten konnte.
In der Stadt angekommen, begannen sie ihren Einkaufsbummel, wobei sich die drei Jungs als charmante Begleiter entpuppten. Sie schauten zwar hier und da auch nach Jungsklamotten oder neuen Schuhen, waren aber genauso gern Berater der Mädchen. Leider wich Marc, einer der Freunde von Simon, nicht mehr von Jennys Seite. Er nutzte jede Gelegenheit, Simons eventuelle Blicke vor ihr abzuschirmen. Oder schaute er gar nicht?
Am frühen Abend suchten sie sich dann ein kuscheliges Eiscafé, wo die Jungs den Mädchen gegenübersaßen. Jenny bestellte sich einen Schokobecher und hoffte, unter einem Vorwand bei Simon naschen zu können, aber der bestellte sich ausgerechnet einen Nussbecher. Jenny war gegen Nüsse allergisch.
Während des Eisessens lernten sie sich ein wenig näher kennen und tauschten die Kontaktinformationen ihrer sozialen Netzwerke aus. Und wieder war es Sissi, die in die Offensive ging, Eis von den Jungs naschte und zum Schluss schon fast auf dem Schoß von Simons bestem Freund saß. Aber auch Jenny meinte, ein paar vielversprechende Blicke von Simon erhascht zu haben. Zum Ende hin zwinkerte er ihr zu und meinte, dass man gern öfter was zusammen machen könnte.
Hannoverscher Anzeiger vom 16. März.
Löste Kaffee die Panikattacke aus?
Isernhagen. Die vorgestern am Kreisel in Isernhagen tödlich verunglückte Frau stellt die Kriminalpolizei und einen Psychologen, der zufällig Zeuge des Vorfalls geworden war, vor ein Rätsel. Die mittlerweile identifizierte Frau (40 Jahre, verheiratet und Mutter von vier Kindern) soll laut Aussagen des Ehemannes und ihres Hausarztes in der Vergangenheit niemals Panikattacken erlitten haben. Auch habe sie nie eine Phobie gegen Insekten und Spinnen entwickelt. Weiter sagte der unter Schock stehende Ehemann aus, dass seine Ehefrau niemals Kaffee getrunken haben, den sie aber laut Aussage der Bedienung konsumiert hatte. Die Kriminalpolizei Hannover hat Ermittlungen aufgenommen und eine Probe des Kaffees zur Untersuchung in ein Labor geschickt. Der Psychologe meinte dazu, dass eine Panikattacke nicht unbedingt einen direkten Beweggrund brauche, sondern jeder Zeit und ohne ersichtlichen Grund ausgelöst werden könne. Er bezweifelt, dass der Kaffee zu der Attacke geführt hat, und vermutet eine symptomatische psychische Störung.
Kapitel 2 - Nur ein Job
Deutschland, Hamburg. Zwei Monate zuvor.
Mit einem Ohrwurm im Kopf tanzte Karl Riewesell pfeifend durch seine kleine Wohnung und packte seinen Reisekoffer. Mittlerweile hatte er sich an diese Tätigkeit so gewöhnt, dass er sie schon fast als liebgewonnenes Ritual durchführte. Kurz nachdem seine Frau sich von ihm hatte scheiden lassen, hatte er sich vollständig auf seine Karriere konzentriert und firmenintern einen neuen Job angeboten bekommen. Zuerst lehnte er dankend ab, überlegte es sich dann aber anders. Grundsätzlich hasste er das Kofferleben, aus dem der neue Job zum Hauptteil bestand. Doch dann dachte er, dass es genau das Richtige wäre. Weg von zu Hause. Weg von der Möglichkeit, seiner Frau, oder schlimmer noch, auch ihrem neuen Freund zu begegnen. Und so wurde er International Manager in einem riesigen Rüstungsunternehmen. Seine Aufgaben umfassten die Akquise und Betreuung von Kundenaufträgen sowie die Vertragsgestaltung bei Großprojekten. Dazu war er in allen möglichen Ländern unterwegs. Nur der ostasiatische Raum war nicht sein Revier. Dorthin schickte man immer seinen Kollegen, der zwei Köpfe größer war als er. Die Asiaten liebten große Europäer, denen sie nur aufgrund ihrer Körpergröße mehr Anerkennung zollten.
Sein nächstes Ziel bedeutete 22 Flugstunden und vier Umsteigeflughäfen, was ihn noch vor einem Jahr schier zur Verzweiflung gebracht hätte. Heute vertrieb er sich die Zeit an der Bar der First Class und flirtete bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Leider ausschließlich ohne Erfolg. Die meisten Frauen konnten mit seinen 1,70 Metern und seinem Haarkranz offensichtlich nicht sympathisieren.
Sein Handy gab einen Ton von sich, den er schon lange nicht mehr gehört hatte. Eine SMS. Er fragte sich, ob das nur eine Werbung war, denn er wüsste nicht, wer auf diese Art mit ihm kommunizierte. Er schaute auf das Display und sah eine ihm unbekannte Nummer. Sollte er sie löschen? Er war sich unsicher und öffnete die SMS.
Hallo Karl. Hab die Nummer von deiner Ex bekommen. Du sollst ja viel unterwegs sein. Wann kann ich dich erreichen? Gruß Ronny
Ronny. Karls Kopf durchzuckte die Schulzeit. Die Zeit in der neunten oder zehnten Klasse. Ronny, mit vollem Namen Ronny Klein. Karl kratzte sich nachdenklich zwischen seinen letzten Haaren am Kopf. War der nicht nur mit Hauptschulabschluss oder sogar ohne in der Neunten abgegangen? Er wusste es nicht mehr genau. War zu lange her. Hatte der nicht ab und zu Dreck am Stecken gehabt? Beim Klassentreffen vor einem halben Jahr hatte er ihn nicht gesehen. Und daran, dass jemand nach ihm gefragt hatte, konnte er sich auch nicht erinnern. Er hatte ihn allerdings auch nicht vermisst. Sollte er ihn anrufen? Oder per SMS antworten? Wenn er erst in den USA war, würde das Gespräch viel teurer. Auf vermeidbare Kosten mit dem Diensttelefon wurde in seinem Unternehmen ein besonderes Augenmerk gelegt. Grundsätzlich verdiente man mit Rüstungsgütern und Kriegswaffen eine Menge Geld, allerdings verschlangen die Geschenke an das Auswärtige Amt, das Wirtschaftsministerium beziehungsweise das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und zu guter Letzt die Bundesregierung einen großen Teil des Gewinns. Innerlich wiegte er ab und antwortete per SMS: Jetzt.
Eine Minute später klingelte sein Handy und sein alter Schulkamerad Ronny begrüßte ihn, als ob sie die dicksten Freunde gewesen wären. Er brauchte nicht lange, um auf den Punkt zu kommen, und bot ihm einen Job an. Einen Nebenjob. Karl sei genau der Richtige, da er überall rumkäme.
»Also«, antwortete Karl ihm nach einem fünfminütigen Monolog auf Seiten Ronnys. »Habe ich das richtig verstanden? Ich soll weltweit - wo ich halt rumkomme, Wasserproben nehmen? Die dann beschriften und an ein Labor schicken?«
»Ganz genau so«, antwortete die Stimme am Telefon.
»Und dafür bekomme ich 3.000 Euro monatlich?«
»Auch richtig.«
»Als Nebengewerbe - oder wie soll das abgerechnet werden?«
»Nee, das bekommst du so.«
»Wie bitte?«
Kurze Pause am Telefon. »Weißt du, das ist ein privates Unterfangen. Von einem Millionär. Der will damit was beweisen und so. Das wäre viel zu umständlich - mit Rechnung und so.«
»Bei ständigen Überweisungen von monatlich 3.000 Euro könnte aber die Bank und somit auch das Finanzamt misstrauisch werden.«
»Ach was, Karl. Das bekommst du als Barkassenfahrt.«
»Barkassenfahrt?«
»Bar - kassen - fahrt.«
»Hä?«
»Bar, Scheine - in einem Umschlag.«
Fast hätte Karl über den Witz gelacht. Aber die Realität holte ihn wieder ein. »Das klingt irgendwie illegal.«
»Was könnte denn an Wasserproben sammeln illegal sein?«
Achselzuckend antwortete er: »Keine Ahnung.«
»Ich auch nicht. Hör mal, Karl. Es geht nur darum, einen Umweltskandal aufzudecken, in den wahrscheinlich die Bundesregierung höchstpersönlich verstrickt ist. Da geht nichts offiziell. Verstehst du?«
»Oh«, antwortete Karl mit hochgezogenen Brauen. »Wenn das so ist ...«
»Heißt das ja?«
»Ja. Okay. Aber ich möchte bei den Recherchen involviert sein und mein Name darf nirgendwo auftauchen.«
Wiederholte Pause in der Leitung. »Okay.«
USA, Arizona, Phoenix
Mit seinen gerade 15 Lebensjahren konnte Jeff bereits auf die weniger gewordenen Haare seines Vaters schauen und ging locker als 17 bis 18 durch. An einem Sonntagmorgen, als seine Familie noch schlummerte, stand er unter Kopfschmerzen auf und hatte plötzlich ein Ziel vor Augen, dem er nicht widerstehen konnte. Er schlich vorsichtig ins Wohnzimmer, schnappte sich den Autoschlüssel seines Vaters und schlüpfte durch eine Nebentür in die angeschlossene Garage. Zwei Minuten später fuhr er mit dem fast neuen Buick Lacrosse in Richtung Phoenix-City. Seine Fahrt endete an der Washington Street Ecke 1st Street, an der er den Wagen im Halteverbot stehen ließ. Er ließ den Motor laufen und schloss nicht mal die Fahrertür, sondern lief zum Nebeneingang des Bürogebäudes, in dem sein Vater in der Regel seiner Arbeit nachging. Zielstrebig suchte er nach dem richtigen Schlüssel am Bund und öffnete die Tür. Mit einem Legic entsicherte er die Alarmanlage. An einem Sonntag hatte er nicht unbedingt mit Anwesenden zu rechnen, aber er dachte darüber nicht einmal nach. Er hatte einen Plan - ein Ziel. Und dieses Ziel galt es zu erreichen. Egal was kam. Die Kopfschmerzen wurden stärker. Aber er wusste, dass die Kopfschmerzen verschwunden sein würden, wenn er sein Ziel erreicht hatte. Auf dem Weg zu den Fahrstühlen sah er einen Wachmann mit einer Zeitung vor dem Gesicht im Foyer sitzen. Ohne anzuhalten, bestieg er den ersten Aufzug und drückte auf die oberste Taste. »Hallo?«, hörte er den Wachmann gerade noch rufen, als sich die Tür schloss und die Fahrt begann. Auf halber Höhe bemerkte Jeffs Unterbewusstsein, dass der Aufzug im Schacht neben ihm ebenfalls nach oben fuhr. Er selbst reagierte nicht darauf. Er kannte nur noch sein Ziel. Mit einem Gongton und der Ansage des obersten Stockwerks öffnete sich die Tür. Jeff hielt direkt auf das Treppenhaus zu, welches in die aufzuglosen Service-Stockwerke führte. Vor einem Jahr hatte Jeff in der Firma seines Vaters ein Schülerpraktikum absolviert. In der Abteilung Facility Management hatte er jede Ecke und jede Tür des Komplexes kennengelernt. Im obersten Stockwerk, welches über die Treppen zu erreichen war, hielt er auf eine kahle Betontreppe zu, die auf das Dach des Gebäudes führte. Oben angekommen öffnete er die Stahltür über die Notentriegelung. Sofort brach die Hölle in Form einer Sirene los. Jeff nahm das ohrenbetäubende Schrillen nicht wahr. Er hielt auf den Rand des Gebäudes zu. Er stellte sich an die Dacheinfassung und breitete die Arme aus. Der Kopfschmerz nahm zu. Aber das Ziel lag vor ihm.
»Hey - was machst du da?«, erklang die unsichere Stimme des Wachmanns, der ihm gefolgt war. »Komm da weg ...«
Jeff hörte ihn nicht. Und sprang.
Phoenix Police Department
»Auch das noch«, seufzte der Leiter der Mordkommission von Phoenix und füllte seine erste Tasse mit heißem Kaffee, während er weiter seinem Gesprächspartner am Telefon zuhörte. Ohne eine Verabschiedung legte er irgendwann auf und schüttelte den Kopf.
»Ein neuer Fall?«, fragte sein Kollege mit vollem Mund und biss kurz danach von seinem zweiten Donut ab.
»Mh«, antwortete sein Chef und nickte. »Allerdings, so wie es aussieht, Selbstmord. Ein Jugendlicher ist von einem Bürohaus an der Washington Street gesprungen. Angeblich mit ausgebreiteten Armen. Ein Wachmann hat noch versucht, ihn aufzuhalten.«
»Alkoholisiert oder Drogen«, prognostizierte sein Gegenüber.
»Wahrscheinlich durchzechte Nacht. Das war nämlich heute Morgen um kurz vor 6:00 Uhr«, bestätigte er die Vermutungen seines Kollegen und erhob sich schwerfällig von seinem Schreibtisch. »Ich fahr hin. Inzwischen sollte die Spurensicherung da sein. Es gehört nicht zu meinen Lieblingsdisziplinen, diesen Matsch zu sehen ...«
20 Minuten später war er am noch weiträumig abgesperrten Tatort. Am Sonntag gab es aber in diesem Teil der Stadt kaum Verkehr. Die Leiche hatte man mit einem Tuch abgedeckt und direkt daneben lag bereits der obligatorische Zinksarg. Er suchte sich aus der Schar an Polizisten und anderen Beamten seinen Ansprechpartner heraus und versuchte, die blutige Hand des Opfers zu ignorieren, die unter dem Leichentuch herausragte.
»Und? Was haben Sie bis jetzt herausgefunden?«, fragte er mit dem Rücken zur Leiche.
»Tja«, antwortete ihm der örtliche Policeofficer. »Scheinbar ist der junge Mann mit dem Buick da drüben gekommen«, er deutete auf die Straßenecke vor dem Haupteingang des Gebäudes, »und hat sich dann mit einem Schlüssel Zugang zum Gebäude verschafft.« Er winkte einen jungen Mann mit mexikanisch aussehenden Gesichtszügen zu sich heran. »Das hier ist der Wachmann, der versucht hat, den Jungen aufzuhalten.«
»Guten Morgen«, begrüßte er den Wachmann und bot ihm eine Zigarette an.
Der Wachmann lehnte das Angebot mit einem Kopfschütteln ab und schilderte ihm kurz und knapp die tragische Geschichte. »Was mich wundert«, sagte er zum Schluss. »Dass der Junge überhaupt nicht auf mich reagiert hat. Er hat sich nicht mal umgedreht. Er ist einfach gesprungen. Mit ausgebreiteten Armen.«
»Drogen«, war die knappe Antwort des Mordkommissars. »Die merken dann ...«
»Keine Drogen«, widersprach der Leiter der Spurensicherung, der sich zu ihnen gesellt hatte. »Wir haben einen Schnelltest durchgeführt.« Er grinste leicht schelmisch. »Solange das Blut noch warm und flüssig ist, geht das.«
»Und was ist das Ergebnis?«, versuchte der Kommissar abzukürzen.
»Kein Alkohol. Keine bekannten bewusstseinsverändernden Substanzen.«
»Mh«, war die knappe Antwort. »Hatte er einen Ausweis dabei?«
»Nein. Aber den Halter des Fahrzeugs haben wir ermittelt.«
»Dann fange ich da am besten an«, antwortete der Kommissar und wollte sich gerade umdrehen, als der Leiter der Spurensicherung ihn aufhielt.
»Wollen Sie sich die Leiche nicht ansehen?«
Mit innerlich verdrehten Augen antwortete der Kommissar: »Gibt´s da was Besonderes zu sehen?«
»Nein.«
»Dann wüsste ich keinen Grund.« Und er dachte den Satz weiter: »... mir den Tag zu versauen.«
Kurze Zeit später hatte sich herausgestellt, dass der Halter des Fahrzeugs seinen Sohn und sein Auto vermisste. Nachdem die Eltern ihren Sohn identifiziert hatten und die Mutter mit einem Nervenzusammenbruch in eine Klinik eingeliefert worden war, saß der Kommissar neben dem Vater auf der Veranda des Elternhauses. Der Vater hatte sich zwischenzeitlich zwei Sixpacks Bier verinnerlicht und stierte mit verheulten, glasigen Augen ins Leere. Ab und zu schüttelte er kaum merklich seinen Kopf.
»Hatte Ihr Sohn vielleicht Ärger in der Schule oder mit denfalschen Leuten?«, probierte der Kommissar einen nächsten Versuch, einen Grund für das offenbar freiwillige Ableben des Jungen zu finden.
Der Vater schüttelte erneut den Kopf. »Er war immer beliebt und hatte viele Freunde.«
»Eine Freundin?«
»Nein.«
»Und die Schulnoten?«
»Bestens.«
Nun schüttelte der Kommissar seinen Kopf. »Das ist alles sehr ungewöhnlich. Keine Depressionen. Kein Abschiedsbrief. Keine Hinweise. Es muss irgendetwas ganz Schreckliches passiert sein. Aber was? Was hat so eine Kurzschlussreaktion ausgelöst? Und warum sucht er sich das Hochhaus aus?«
»Es ist das Höchste in Phoenix.«
»Ja«, bestätigte der Kommissar. »Aber bei Kurzschlussreaktionen begehen die Opfer keinen geplanten Selbstmord. Und so leid es mir tut, aber ihr Sohn wusste ganz genau, wie er in das Gebäude gelangen konnte. Er hatte scheinbar einen konkreten Plan. Irgendetwas muss vorgefallen sein.«
»Um Himmels willen, nein! Ich - ich kann mir das nicht vorstellen - dass ...«, stotterte der Vater mit neuen Tränen in den Augen.
»Was?«
»Wir hatten ihm diesen Wahnsinn verboten.« Er stockte und schluckte einen scheinbar unüberwindbaren Kloß herunter. »Er war mal mit einem Freund Fallschirmspringen. Er war ganz begeistert davon und wir finanzierten ihm diesen Sport. Allerdings wollte er irgendwann mehr. Er wollte dieses - Basejumping, wissen Sie?«
»Wo die Leute von Hochhäusern und Steilhängen herunterspringen?«
»Genau, ja.« Er wischte sich ein paar Tränen von den Wangen.
»Und das haben Sie ihm verboten?«
»Ja. Ich hatte meine Gründe. Da passiert auch genug. Aber ...«, er schniefte ausgiebig. »Das kann doch nicht der Grund sein, oder?«
»Nein«, antwortete der Kommissar. »Das glaube ich auch nicht.«
Das Klingeln des Smartphones des Kommissars unterbrach die Stille.
»Harry. Hast du etwas herausgefunden?« Er lauschte. »Oh. Wäre das eine Erklärung?« Pause. »Ja. Seltsam. Okay. Erst einmal vielen Dank.« Er legte auf und schaute in das verkrampfte Gesicht des Vaters. »Bei der Obduktion Ihres Sohnes wurde etwas gefunden.«
Der Vater schaute auf und versuchte, durch seinen vernebelten Blick die Augen des Kommissars zu fixieren. »Was?«
»Die Kollegen haben entdeckt, dass Ihr Sohn scheinbar einen Tumor hatte. Einen Gehirntumor.«
»Was? Das kann doch nicht ...«, er stockte. »Er war nie beim Arzt. Das kann er uns doch nicht verheimlicht haben, oder? Ich meine, er hat nie etwas gesagt oder über etwas geklagt.«
»Vielleicht wusste nur Ihre Frau etwas davon?«
»Glaube ich nicht«, antwortete der Vater weinend und öffnete sich eine nächste Bierdose.
»Dann kontaktieren Sie doch bitte mal Ihren Hausarzt. Vielleicht ist das eine Erklärung.«
Kapitel 3 - Brutstätte
Deutschland, Kiel, drei Jahre zuvor
Es regnete Bindfäden. Bereits seit dem frühen Morgen. Ronny schaute auf den nassen, grauen Hof der JVA Kiel. Fünf Monate saß er schon in seiner Zelle. Neun Monate hatte er wegen Kreditkarten- und Steuerbetrugs bekommen. Es ärgerte ihn bis heute maßlos, dass sie ihn erwischt hatten. Sein Plan war eigentlich todsicher gewesen. Nur leider hatte er ein Detail übersehen, weil er keine Ahnung von der Komplexität hatte. So einen Fehler würde er in Zukunft nicht mehr machen. Die Zukunft musste nun aber noch warten. Allerdings rechnete er damit, innerhalb der nächsten Wochen, wegen guter Führung, rauszukommen. Neben ihm schnarchte Steve, auch Keule genannt. Er hatte zwei schlagende Argumente, war aber im Grunde eine gute Seele. Wenn er seine Emotionen im Griff gehabt hätte, wäre der Sozialarbeiter, mit dem er sich angelegt hatte, ohne lebensgefährliche Verletzungen davongekommen. Er hatte ebenfalls neun Monate bekommen. Plus Besuch einer Gewaltpräventionsgruppe. »Psychoquatsch« sagte Steve dazu, ließ sich aber an den Terminen nichts anmerken. Denn auch er hatte begriffen: Gute Führung bedeutete frühes Gehen.
Es war Sonntag. Einer dieser elend langen grauen Sonntage. Normalerweise waren Sonntage die Hauptbesuchstage. Aber Ronny bekam keinen Besuch. Die wenigen Kumpels, die er hatte, saßen entweder selbst ein oder fristeten ihr arbeitsloses Dasein irgendwo in der Welt. Steve hatte dagegen vor einigen Monaten einmal Besuch gehabt. Von seiner Frau in Begleitung ihres Anwalts. Sie hatte die Scheidung eingereicht. Steve hatte sie regelmäßig weichgekloppt. Das war wohl auch ein Grund.
Es klackte. Die Türen wurden geöffnet. Zeit für das Frühstück. Ronny stupste Steve an, der luftschnappend zu sich kam.
»Frühstück, du Penner.«
Schweigend trotteten sie nebeneinander die Stahltreppe hinab. Kaum hatten sie sich mit ihrem Frühstück einen freien Platz am regennassen Fenster gesichert, setzte sich der stellvertretende Direktor der JVA neben sie.
»Guten Morgen, die Herren.«
Ronny und Steve schauten kurz auf, antworteten aber nicht.
»Ich hoffe, ich störe nicht allzu sehr«, unternahm der Stellvertreter einen zweiten Versuch.
Steve brachte kauend ein kaum hörbares »Doch.« über die Lippen.
»Ich kann natürlich warten, bis die Herren mit der Nahrungsaufnahme fertig sind.«
Ronny stieß mit seinem Fuß gegen Steves Schienbein. »Nichts für ungut, Herr Direktor. Steve hat schlecht geschlafen. Was gibt´s denn?«
»Es geht um einen Insassen aus dem Block B. Ein Professor. Es sitzt wegen unerlaubter Tierversuche.«
»Dafür kommt man in den Knast?«
»Wenn ihr wüsstet, was der Kerl mit den Viechern angestellt hat, dann würdet ihr das Strafmaß verstehen.«
»Und was ist mit dem?«
»Er ist erst seit Kurzem hier. Hat auch nur zwei Monate zum Absitzen. Das Problem ist, dass er mit seinen Mitbewohnern nicht zurechtkommt.«
»Aha«, antwortete Ronny und legte sein Besteck auf den Teller.
»Wie ihr sicherlich wisst, benötigt man eine gewisse Körperpräsenz oder die Mitgliedschaft in einer geeigneten Schutzorganisation, um die Tage und Nächte in dieser Anstalt unbeschadet zu überstehen.«
»Höre ich zum ersten Mal«, antwortete Steve kichernd, der ebenfalls mit seinem Frühstück fertig war.
»Natürlich«, erwiderte der stellvertretende Direktor. »Wie dem auch sei. Ich beabsichtige, den Herrn Professor in eure freie Koje zu verlegen. Ich denke, es ist für euch beide ein guter Test, ob ihr es verdient, frühzeitig entlassen zu werden, oder?«
Ronny und Steve nickten zustimmend.
»Gut.« Er schaute auf die leergegessenen Teller. »Offensichtlich sind die Herren fertig. Dann möchte ich euch den Herrn Professor gerne vorstellen. Wenn die Herren mir folgen möchten.«
Nach einer fünfminütigen Unterredung und gegenseitigen Vorstellung fanden sich Ronny und Steve, gefolgt vom Professor, in ihrer Zelle ein. Das Gesicht des Professors zierte ein Veilchen unter dem linken Auge, eine lädierte Lippe und eine verbundene Platzwunde am rechten Ohr. Professor Pichler war Genetiker und forschte aus einem privaten Budget, welches er geerbt hatte. Er hatte das sechszigste Lebensjahr direkt vor sich, war kaum größer als ein zehnjähriger Junge, ebenso schmächtig und vollständig ohne Kopfbehaarung. Von einer dominanten Körperpräsenz war wahrlich nicht zu sprechen.
»So, Professor Pichler«, kam es von Ronny bestimmend. »Wir sprechen uns normalerweise hier mit Vornamen an. Wie sieht es aus? Haben Sie einen abbekommen?«
Der Professor schaute verdutzt und unterdrückte bewusst ein Lächeln, welches seine geschwollene Lippe erneut aufreißen könnte. »Natürlich habe ich einen Vornamen. Kopernikus-Julius.«
»Kop ..., wie?«, nuschelte Steve.
»Was für’n Scheißname«, antwortete Ronny. »Dann sagen wir besser Pichler.«
»Meinetwegen«, entgegnete der Professor. »Ich bestehe nicht auf meinem Titel, er wird mir eh aberkannt werden.«
»Was hast du denn gemacht? Wir haben da etwas von Tierversuchen gehört?«
»Unter anderem. Ja. Ich habe mich in das Gehirn der Tiere geklinkt. Über einen Boten. Den ich in die Tiere gepflanzt habe. Über diesen Boten kann ich Befehle geben, die das Gehirn unter normalen Umständen nicht ausführen würde.«
»Ich verstehe kein Wort ...«, flüsterte Steve.
»Aha«, antwortete Ronny. »Und was für ein Zweck hatte die Aktion?«
»Ganz einfach. Ich habe schweres Rheuma und damit verbunden sehr starke Schmerzschübe. Die bekannten pharmazeutischen Mittel helfen mir nicht, lähmen mein Gehirn oder ich habe allergische Reaktionen darauf, die schlimmer sind als die Schmerzen. Mit dem Boten habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, die Rheumaschübe, beziehungsweise die Schmerzen, zu unterbinden.«
»Mh«, brummte Ronny. »Und dafür muss man in den Knast?«
»Ich wurde mehrfach verwarnt. Und ich bin Privatmann. Außerdem standen die linken Chaoten permanent vor meiner Tür und demonstrierten. Das waren wohl genügend Argumente.«
»Und warum haben dich die Kollegen aus Block B so malträtiert?«, er deutete auf das lädierte Gesicht des Professors.
»Ich habe den Jungs dort die gleiche Geschichte erzählt und dass ich bei einer Weiterentwicklung des Boten ihre Krankheiten ausmerzen könnte.«
»Krankheiten?«
»Kleptomanie, emotionale Gewaltausbrüche und so weiter.«
»Du meinst Klauen und Hauen sind Krankheiten, oder was?«, Ronny erzürnte sich.
»Ja. Das sehe ich so.«
Ronny lächelte schief. »Hätte ich mich nicht im Griff, würde ich dir wahrscheinlich jetzt auch ein paar aufs Maul hauen.«
Kapitel 4 - Zarte Blüten
Deutschland, Hannover, 17. März
Seufzend stand Jenny in der letzten Pause auf dem Schulhof und hielt mit ihren Freundinnen Ausschau nach den Jungs. Keiner von ihnen hatte sich blicken lassen. Den ganzen Tag schon nicht.
»Wo sind die bloß?«, fragte sich Jenny, während sie sich mit den Fingern durch ihre langen Haare fuhr.
»Vielleicht schwänzen sie«, antwortete eine ihrer Freundinnen.
»Oder verstecken sich vor uns, weil wir so hässlich sind«, kam es von Sissi.
Alle Mutmaßungen nutzten nichts, die Pausenglocke klingelte zur letzten Stunde. Nach dem todlangweiligen Deutschunterricht trennten sich die drei Mädchen und fuhren oder gingen nach Hause. Jenny benutzte seit Kurzem kein Fahrrad mehr, nachdem irgend so ein Witzbold es demoliert und mit einem fremden Schloss an ein anderes Fahrrad gekettet hatte. Und da ihr Vater seit einem Jahr einen Kunden in der Schweiz betreute, hatte er während der wenigen Zeit am Wochenende keine Lust, sich um solche Themen zu kümmern. Jenny hatte ihren Vater in den Zeiten seiner häufigen Abwesenheit als schlechtesten Vater der Welt beschimpft. Der konterte nur mit: »Früher haben wir bereits mit zehn Jahren unsere Fahrräder ...«, weiter hatte sie ihm nie zugehört und die Tür zu ihrem Zimmer zugeknallt.
Jenny öffnete die Wohnungstür. Ein gelber Zettel an der Türzarge fiel ihr ins Auge. »Ich habe noch einen Kundenauftrag. Deine Schwester ist bei Oma. Ich schätze, ich bin gegen 18:00 Uhr zu Hause.«
Stöhnend schaute Jenny in den Kühlschrank, um ihr Essen herauszuholen. Es gab mal wieder etwas Nichtessbares. Sie schüttete das Essen eins zu eins in den Mülleimer und drapierte anderen Abfall darüber. Im Anschluss plünderte sie den Schrank mit den Süßigkeiten und verzog sich in ihr Zimmer.
Während sie eine angebrochene Tüte Chips und eine ganze Tafel Schokolade verspeiste, checkte sie ihre Social-Media-Apps auf neue Nachrichten. Das Blut schoss ihr in den Kopf und zugleich begann ihr Herz, wie wild zu klopfen. Simon hatte ihr eine Anfrage geschickt. Heute Vormittag bereits. Sofort klickte sie auf Annehmen. Sie spürte Schweiß in ihren Handflächen, während sie auf seine Profilseite navigierte und die eingestellten Bilder begutachtete.
»Gott, siehst du süß aus«, flüsterte sie und browste sich durch den gesamten Inhalt, bis sie plötzlich eine neue Nachricht von ihm erhielt.
»Hey, was machst du gerade?«, stand da in einer mit Smileys geschmückten Zeile.
Jenny zuckte zusammen. Was sollte sie antworten? Dass sie gerade seine Bilder anschmachtete? Mit zittrigen Fingern tippte sie unsicher eine Antwort.
»Hey Simon. Ich langweile mich. Wir haben euch heute nicht auf dem Schulhof gesehen. Habt ihr eine Projektwoche?«
Nur wenige Sekunden später kam bereits die Antwort. »Nee, wir hatten nur keine Lust. Habt ihr uns auf dem Schulhof vermisst?«
Jenny vergrub ihr Gesicht hinter ihren Händen. Das wurde ja immer heikler. Was sollte sie bloß schreiben?
»Irgendwie schon. Wir haben uns sehr wohl an euerer Seite gefühlt«, tippte Jenny nach ein paar Bedenksekunden und sendete die Antwort. Erwartungsvoll starrte Jenny auf den Bildschirm. Was würde er jetzt wohl fragen? Ob sie ihn persönlich auch vermisst hätte? Was würde sie dann antworten? Einfach ein Ja? Und wenn er dann antwortete: >Ich dich aber nicht<, könnte sie nie mehr in diese Schule gehen. Sie müsste in eine andere Stadt ziehen und eine neue Schule besuchen.
Das Telefon klingelte. Es klingelte sieben Mal. Dann ging der Anrufbeantworter dran. Es war ihre Freundin Sissi. Sie quatschte irgendetwas von einem dringenden Rückruf. Jenny verstand fast nichts und riss sich von ihrem Laptop los. Sie rannte die Treppe hinunter und griff nach dem Telefon.
»Hey Sissi, ich habe keine Zeit. Ich schreibe gerade mit ...«, sie stockte. Sollte sie ihr das erzählen? Oder war Sissi dann vielleicht eifersüchtig ...?
»Mit wem?«, fragte Sissi ungeduldig.
»Du erzählst es aber nicht weiter, versprochen?«
»Ehrenwort.«
»Mit Simon.«
»Echt?«, kam es mit enttäuschtem Unterton aus der Hörmuschel. »Hat er dir eine Anfrage geschickt?«
»Ja, stell dir vor. Und jetzt schreiben wir gerade. Deshalb hab ich keine Zeit. Ich ruf dich heute Abend an. Okay?«
Ohne zu antworten, legte ihre Freundin auf. Ups, dachte sich Jenny und lief zurück in ihr Zimmer. Fassungslos starrte sie auf den Bildschirm. Immer noch keine Antwort von Simon. Hatte sie irgendetwas Dummes geschrieben? Sie schaute noch mal über die alten Fragen und Antworten. Unsicherheit kroch in ihr hoch und sie spürte, wie ihr Hals immer trockener wurde. »Durst«, sagte sie zu sich selbst, schaute noch einmal auf den Bildschirm und lief dann in die Küche, um sich aus Orangensaftkonzentrat, Leitungswasser und Eiswürfeln einen Drink zu mixen. Mit dem Glas in der Hand flog sie förmlich die Treppe zu ihrem Zimmer hinauf. Sie setzte sich vor ihren Laptop und nippte an ihrem Orangensaft. Erneut zuckte sie zusammen, als eine Antwort von Simon auftauchte, und verschüttete dabei Orangensaft auf ihrer Tastatur. »Scheiße, Scheiße, Scheiße«, rief sie aus und versuchte krampfhaft, mit einem gebrauchten Taschentuch das Unglück zu beseitigen. Völlig unerwartet kam bereits wieder eine Antwort von Simon.
»Geht es dir gut?«
Jenny stutzte. Wie kam er denn jetzt auf die Frage? Sie erschrak, als sie ihre letzte Antwort las: »ihoiföjfjöadskvkdlvls«. Schnell tippte sie eine neue Antwort.
»Ich habe Saft auf meine Tastatur geschüttet. Beim Wegmachen habe ich wohl den Quatsch eingegeben.«
Keine zehn Sekunden später kam bereits die Antwort von Simon: »Wollen wir besser telefonieren?«
Das Blut schoss erneut in Jennys Kopf. »Nun wird es ernst«, sagte sie zu sich selbst und tippte zitternd eine bejahende Antwort ein.
England, Birmingham, 19. März
Immer wieder wechselte das Licht zwischen klarem Sonnenschein und kühlem Schatten. Vom kräftigen Westwind wurden die Wolkenfragmente eiligst über das Land geschoben. Im ältesten Stadtteil von Birmingham beobachtete auf seinem Balkon ein 96-jähriger Rentner die Szenerie des Licht- und Schattenspiels. Seine Pupillen zuckten zwischen den wolkenlosen Räumen hin und her und schienen etwas zu suchen. Seine Unterlippe begann zu zittern und seine zusammengekniffenen Augen verzerrten sein faltiges Gesicht. »Wo seid ihr?«, flüsterte er. »Wir schaffen das nicht alleine.« Sein Blick wechselte vom Himmel zum Boden. Sechs Stockwerke unter ihm vernahm er geschäftiges Treiben. Ausländische Ladenbesitzer priesen ihre Waren an. Lieferwagen entluden ihre Güter. Schulkinder liefen über den Bürgersteig. Der alte Mann bekam einen glasigen Blick und umklammerte einen seiner vielen Blumentöpfe, um dessen Inhalt er sich schon länger nicht mehr gekümmert hatte. Er hörte Motorenlärm. Flugzeugmotoren von Propellermaschinen. Und er hörte dumpfe Explosionen. Auf der Straße reagierte niemand auf den Lärm und die Explosionen. Die Leute gingen einfach ihres Weges. Der Alte verkrampfte sein Gesicht zu einer Fratze. Der Lärm erzeugte Kopfschmerzen. Höllische Kopfschmerzen. »Warum machen wir das?«, fragte er kaum vernehmlich. »Warum schmeißen wir Bomben auf Frauen und Kinder?« Er hob den Blumentopf an, und während er ihn gezielt auf eine Gruppe Kinder warf, schrie er: »Weil Churchill es befohlen hat - und weil es nicht um die Nazis geht, sondern um die Vernichtung der deutschen Wirtschaft!«
Der Blumentopf landete krachend nur Zentimeter neben den Kindern und verteilte hunderte Tonsplitter und trockene Erde mit Pflanzenresten auf dem Bürgersteig und der Straße. Die Mädchen und Jungs schrien auf und die Gruppe stob hastig auseinander. Die Kinder und die Erwachsenen vor den Läden schauten zu dem Alten nach oben auf den Balkon. Der hatte bereits einen anderen Blumentopf in den knochigen Händen. Er schrie vom Balkon herab: »Und weil man einen Befehl nicht hinterfragt!« Der zweite Blumentopf wurde von einer Ladenmarkise abgefedert und landete auf der Ladefläche eines kleinen Pritschenlasters. Der Besitzer und die anderen Leute begannen zu schimpfen und auf den Rentner zu zeigen.
»Ihr müsst vernichtet werden, koste es, was es wolle«, rief der alte Mann und schleuderte seinen größten Blumentopf auf die Menschen, die sich mittlerweile weiter zurückgezogen hatten oder in den Gebäuden Unterschlupf suchten. Auch dieser Topf landete auf der Ladenmarkise, durchschlug sie aber und traf eine Kundin an der Schulter. Sie brach schreiend zusammen. Ein weiterer Topf und ein weiterer Wortschwall folgten. Sirenengeheul eines Streifenwagens näherte sich schnell und kam vor dem Gebäude zum Stehen.
»Brennen sollt ihr!«, tönte es vom Balkon und zwei leere Weinflaschen landeten zersplitternd auf der Straße.
»Sofort aufhören!«, rief einer der Polizisten und verschwand im Hausflur.
Dem Rentner waren die Blumentöpfe und Flaschen ausgegangen. »Keine Munition mehr«, flüsterte er nun wieder. »Wir fliegen nach Hause.« Er hörte donnernde Schritte die alte Holztreppe hinaufkommen. Langsam schlurfte er durch das Wohnzimmer in seine Küche. Er angelte nach einer Karaffe, die er früher nie benutzt hatte, und füllte sie mit Leitungswasser. Draußen vor seiner Haustür forderten die Polizisten energisch den Zugang zur Wohnung. Die Karaffe war fast voll. Die Tür flog mit zersplittertem Schlossfang auf und stieß krachend an die Garderobe des Greises. Die Polizisten stürmten herein, sahen den alten Mann in der Küche stehen und beobachteten erstaunt, wie er sich mit einer Karaffe ein Wasserglas füllte.
»Sind Sie verrückt geworden?«, blaffte einer der Polizisten ihn an. »Jetzt ist aber gut mit dem Unsinn. Stellen Sie die Karaffe hin. Das Bombardement ist beendet.«
Der Alte schaute verwirrt von den Polizisten zu seiner Karaffe und zurück. »Beendet«, sagte er emotionslos und stellt die Karaffe auf die Arbeitsplatte der Küche.
»Wieso schmeißen Sie die ganzen Sachen auf die Straße? Was soll das?«, brüllte der Polizist in der Annahme, alle alten Menschen wären schwerhörig.
»Sachen?«
»Blumentöpfe und Flaschen«, konkretisierte der Schutzmann genervt.
»Was?«, fragte der Alte und nahm ein Schluck aus dem Wasserglas.
»Was - was? Sie haben Blumentöpfe und Flaschen auf die Straße geschmissen. Warum?«
»Ich trinke eigentlich kein Wasser«, antwortete der alte Mann. »Aber ich hatte letztens nichts mehr zu trinken und es war Sonntag, da habe ich ...«
»Haben Sie mich nicht verstanden oder wollen Sie mich nicht verstehen?«, schrie der Polizist dem alten Mann in sein Ohr.
»Jetzt mag ich Wasser.«
»Der ist verrückt«, sagte der Kollege des Polizisten. »Ich werde mal einen Arzt rufen.«
Zehn Minuten später war der Arzt, der auch die leicht verletzte Frau im Gemüseladen versorgt hatte, bei dem alten Mann und untersuchte ihn oberflächlich.
»Wissen Sie noch, was Sie vor einer Viertelstunde auf Ihrem Balkon gemacht haben?«, fragte der Arzt in einem betont ruhigen Ton.
»Ich hatte Kopfschmerzen«, sagte der alte Mann unsicher.
»Aha. Und dann?«
»Ich weiß es nicht mehr.«
»Aha. Sind Sie von Ihrem Hausarzt schon mal auf Alzheimer untersucht worden?«
»Weiß ich nicht. Ich glaube nicht.«
Der Arzt drehte sich zu den wartenden Polizisten und sagte halblaut: »Ich werde ihn einweisen und untersuchen lassen müssen. Hierbleiben kann er nicht.«
Am nächsten Tag und nach einer umfassenden Untersuchung werteten die Ärzte eines nahe gelegenen Krankenhauses die Bilddaten der Kernspintomografie aus.
»Tja, nicht eindeutig«, sagte einer der Ärzte und deutete auf einen Fleck zwischen Hirnhaut und Hirnmasse, in der Mitte zwischen beiden Gehirnhälften. »Könnte eine Blutung sein oder ein Tumor.«
»Wir haben keine Tumormarker im Blut festgestellt, aber auch keine Werte, die auf einen Hirnschlag hinweisen«, antwortete ein anderer Arzt.
»Könnte die Blutung nicht älter sein?«
»Schon möglich, ja. Aber sie scheint ja relativ groß zu sein. Er müsste richtige Aussetzer haben.«
»Er soll irgendwas von >vernichten< und >Churchill< geschrien haben, als er die Gegenstände vom Balkon warf. Fehlfunktionen aufgrund einer Hirnblutung konnten wir nicht feststellen.«
»Ich habe mir seine Vita angesehen«, kam es von einem leitenden Manager. »Er war von 1943 bis 1945 bei einer Bomberstaffel der Royal Air Force eingesetzt und ist diverse Einsätze über Deutschland geflogen. Vielleicht hat die Verletzung Bombardementsphantasien ausgelöst. Wer weiß?«
»Wir müssten die Schädeldecke öffnen und nachschauen.«
»Der Mann geht auf die Hundert zu.«
»Dann bleibt wohl nur die Betreuung.«
Der Manager drehte sich nickend zum Gehen. »Ich kümmere mich darum.«
Kapitel 5 - Der Plan
Deutschland, Kiel, 3 Jahre zuvor
Fast zwei Monate verbrachte Professor Pichler nun schon in der Zelle mit Ronny und Steve. Sie hatten sich, so gut es ging, arrangiert, obwohl ihre Ansichten unterschiedlicher nicht sein konnten. Professor Pichler redete gern über sein Projekt und stellte das eigentliche Ziel des gezielten Abschaltens von Schmerz über ethische Bedenken. Ronny und Steve suchten dagegen nach Möglichkeiten des Geldverdienens, wenn sie denn wieder in Freiheit wären. Geld hatte dieser verrückte Professor nach eigenen Aussagen genug und Ronny überlegte angestrengt, wie er an das Geld herankommen könnte.
Gleich am nächsten Morgen kam Ronny eine Idee, wie man eventuell mit dem verrückten Professor ein gemeinsames Geschäft aufbauen konnte. Nach dem Frühstück zog er Pichler zur Seite, während Steve ein Comic las.
»Sag mal, Professor. Wenn du dein neues Medikament fertig entwickelt hast, wie bekommst du diesen komischen Boten denn ins Gehirn?«
»Durch eine Spritze in den Kopf.«
»Eine Spritze?«, echote Ronny. »In den Kopf?«
Nickend bejahte Professor Pichler. »Richtig. Es gibt eine Stelle an der Fontanelle, dort kann man ohne ein Loch in die Schädeldecke zu bohren eine Kanüle einführen. Alternativ ginge es natürlich auch durch das Ohr oder das Auge. Die Nase wäre auch noch eine Möglichkeit.«
»Aua. Keine andere Möglichkeit?«
»Warum?«, fragte der Professor verwirrt. »Wenn jemand wegen starker Schmerzen in Behandlung geht, wird das das kleinste Problem sein ...«
Durch das Klackern des Zellenschlosses unterbrochen, schauten die drei auf. Die Tür öffnete sich und zwei Wärter erschienen.
»Guten Morgen«, sagte einer der beiden. »Draußen scheint die Sonne. Wenn auch von ein paar Wolken unterbrochen.« Er begann zu grinsen. »Der Direktor hat eure vorzeitige Entlassung für heute vorgesehen.«
Ronny schaute ungläubig. »Wir alle drei?«
»Korrekt. Die Verwaltung sammelt immer ein bisschen. So sparen sie sich ein wenig Papierkram. Wenn ihr es wünscht, würde einer der Kollegen euch übrigens zum Amt fahren. Für die Arbeitssuche und so.«
»Ich nicht«, antwortete der Professor. »Ich bestelle mir ein Taxi.«
»War nur ein Vorschlag«, erwiderte der Vollzugsbeamte.
»Ja, danke. Aber ich will gleich nach Hause.«
Kaum waren die Wärter verschwunden, begannen die drei ihre Siebensachen einzupacken oder sich von unnötigem Kram zu trennen.
Ronny lehnte sich zum Professor. »Kann ich mir das mal angucken?«
»Was?«
»Das mit den Versuchen. Interessiert mich.«
»Natürlich«, kam es knapp vom Professor. »Warum nicht? Ich freue mich, wenn es jemanden interessiert. Normalerweise treffe ich nur Gegner und Bedenkenträger.«
Kapitel 6 - Jungs
Deutschland, Raum Hannover, 20. März
Seitdem Jenny ihre Handynummer Simon gegeben hatte, war komplette Funkstille eingetreten. Keine Aktionen in den diversen sozialen Netzwerken, keine Messenger-Nachrichten - einfach nichts. Und angerufen hatte er auch nicht. Sie selbst hatte ein paarmal überlegt, ob sie die Initiative ergreifen sollte, konnte sich aber bisher nicht dafür erwärmen. Heute hatte sie außerdem Kopfschmerzen. Eigentlich hatte sie die nur, wenn sie ihre Tage bekam. Aber die hatte sie erst vor einer Woche. Das konnte es also nicht sein.
»Jenny«, rief ihre Mutter von unten. »Komm bitte zum Essen und bring deine Schwester mit. Jetzt und sofort. Und ohne dass ich zehnmal rufen muss.«
Jenny verdrehte die Augen und klappte ihren Laptop zu. Widerwillig erhob sie sich, stockte und bekam glasige Augen. Ohne hinzuschauen, ergriff sie ihr Smartphone und wählte eine Nummer. Am anderen Ende die Stimme eines Anrufbeantworters. Nach dem Piep sprach Jenny in einem mechanischen Ton: »Code 52643856947816774438, Jenny Böge, weiblich, 160 cm, 15 Jahre, Deutschland, Hannover, Schülerin, meine Hobbys sind Shoppen und Musik hören. Ich kenne mich gut mit den aktuellen Kinofilmen und den Musikcharts aus.« Während sie auflegte, kehrte ihr klarer Blick unvermittelt zurück. Sie ging nach unten in die Küche, setzte sich auf ihren Platz und wartete.
»Toll, wie du mich begrüßt«, hörte sie die Stimme ihres Vaters. Sie schaute auf, sah ihrem Vater kurz in die Augen und blickte im Anschluss zu Boden, während sie ihren Mund verzog.
»Da ist dein Vater schon mal so früh zu Hause und du kannst noch nicht mal richtig hallo sagen«, kam es von ihrer Mutter, die irgendetwas in die Teller füllte.
»Hallo«, entgegnete Jenny, ohne aufzuschauen.
»Wie herzlich«, antwortete ihr Vater. »Ich hab dich auch lieb.«
»Wo bleibt deine Schwester? Hast du ihr nicht Bescheid gesagt?«
Jenny zuckte mit den Schultern.
»Ich mach das schon«, flüsterte ihr Vater. »Bemüh dich nicht.«
»Was gibt es denn?«, fragte Jenny und deutete auf eine Auflaufform.
»Gemüseauflauf. Der mit Brokkoli, Blumenkohl, Putenbrust und ...«
»Ich mag keinen Brokkoli. Und auch keinen Blumenkohl.«
»Seit wann das denn nicht?«, antwortete ihre Mutter empört.
»Mochte ich noch nie.«
»So ein Quatsch«, entgegnete ihre Mutter und stellte ihr einen Teller vor die Nase. »Hast du bis jetzt immer gegessen.«
»Hab ich nicht!«
Ihre Mutter drehte sich zu ihr und stützte sich auf dem Küchentisch ab. »Jenny. Was ist los? So geht das nicht weiter. Wenn du nur noch Süßigkeiten isst, wirst du dick.«
»Na und? Ist doch egal. Bin eh hässlich.«
»Geht das schon wieder los. Du weißt ganz genau, dass du ein sehr hübsches Mädchen bist.«
»Und ich?«, kam die lautstarke Frage von Jennys Schwester, die gerade auf den Schultern ihres Vaters in die Küche kam. »Ich bin schöner als Jenny. Oder Mama?«
»Ihr seid beide gleich schön.« Sie stellte den letzten Teller auf den Küchentisch und setzte sich. »Und jetzt möchte ich in Ruhe und ohne Streit essen. Guten Appetit.«
»Guten Appetit«, antworteten Jennys Schwester und ihr Vater im Chor.





























